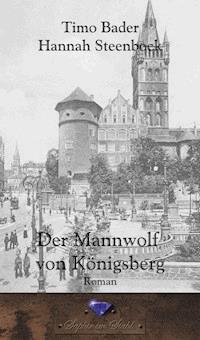
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saphir im Stahl
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Königsberg 1822 Der spannende Beginn eines neuen historischen Krimis mit Schauplatz Königsberg in Ostpreussen. Unversehens findet sich der findige Ermittler in einer gefährlichen Situation wieder. Luuk de Winter bleiben nur wenige Tage, um das Geheimnis zu lüften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luuk de Winter
Band 2Timo Bader und Hannah Steenbock -Der Mannwolf von Königsberg
Bereits erschienen:Band 1Jörg Olbrich – Das Geheimnis der Ronneburg
In Vorbereitung:Band 3Michael Buttler – Die Bestie von Weimar
Timo BaderHannah Steenbock
Luuk de Winter2
Der Mannwolfvon Königsberg
Roman
ebook 010 Luuk de Winter 2erste Auflage 01.06.2013
© Saphir im StahlVerlag Erik SchreiberAn der Laut 1464404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: R. W. K. , Archiv Andromeda
Lektorat: Christine Rix
Vertrieb: bookwire
ISBN: 978-3-943948-07-3
Timo BaderHannah Steenbock
Luuk de Winter2
Der Mannwolfvon Königsberg
Roman
1. CAROLINE
16. August 1822, Königsberg
Caroline huschte durch die Dunkelheit, ganz darauf bedacht, nicht gesehen zu werden. Sie musste ihr Geheimnis schützen. Ihre schnellen Schritte waren selbst auf dem gepflasterten Boden kaum zu vernehmen. Nur die Sterne spendeten ein wenig Licht. Zu dieser späten Stunde waren zum Glück wenige Menschen unterwegs.
Doch was war das?
Unter einem Baum rührte sich ein Schatten.
Stand dort jemand?
Sie hielt inne. Der Vater hatte ihr verboten, nachts nach draußen zu gehen, und doch war ihr diese Aufgabe wichtiger als seine Anordnungen. Angst griff nach ihrem Herzen. Niemand durfte wissen, was sie hier tat, auch nicht Wilhelm, ihr lieber Bruder.
Der Schemen bewegte sich erneut.
Sie zog sich in den Schatten eines Hauses zurück und fand Schutz in einem dunklen Mauerwinkel.
Lange stand sie dort, während die Müdigkeit in ihre Knochen kroch und sie zu überwältigen drohte. Immer wieder fielen ihr die Augen zu, sackte der Kopf weg.
Nein, sie durfte nicht schlafen, sie musste doch aufpassen! Musste rechtzeitig zu Hause sein, bevor ihr Bruder aufstand, bevor er sie in ihrer Kammer suchte …
Der gute Wilhelm, er kümmerte sich so liebevoll um sie, obwohl sie ihm eine solche Last war. Die Umgebung verschwamm vor ihren müden Augen.
„Hah, hab ich dich, mein Täubchen!“
Sie schrak hoch. Schwere Hände packten ihre Schultern. Blankes Entsetzen durchflutete Caroline. Hände zerrten an den Schnüren ihrer Jacke, der Gestank von Bier stach ihr in die Nase. Rote Augen, sabbernder Mund, gierige Zunge. Alles in ihr ekelte sich. Sie konnte sich nicht rühren, ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr.
Aus. Vorbei.
2. WILHELM
16. August 1822, im Wald nahe Königsberg
Wilhelm öffnete ein Auge. Nur das linke und nur einen kleinen Spalt. Der Anblick des Messers, das auf dem Nachttisch lag, beruhigte ihn. Langsam streckte er die Hand aus, streichelte den Griff aus Gebein, in das der Vater eine Schlange geschnitzt hatte. Genauso rasch und unerwartet wie ihr Giftbiss sollte die Waffe töten. Die Berührung gab ihm ein Gefühl von Sicherheit.
Ein Schrei ließ ihn zusammenfahren – ein Schrei, den er nicht nur in den Ohren hörte, sondern der auch in seinem Herz ertönte und es zu zerbrechen drohte. Mit einem Ruck fuhr er hoch, die Augen weit aufgerissen, in die Dunkelheit starrend, das Haar zerzaust. Seine Hand krampfte sich um das Messer. Caroline – er musste sie beschützen!
Von Nacht umgeben saß Wilhelm auf der Liege, mit nacktem, bebendem Oberkörper und lauschte seinem Herzschlag. Im Ofen brannte kein Feuer mehr, selbst die Glut war erloschen. Er war alleine in der Hütte, es gab nur ihn und sonst nichts.
Abermals schrie jemand - seine Schwester! -, und diesmal vernahm Wilhelm deutlich die Angst in ihrer Stimme.
Caroline schwebte in Gefahr!
Er warf die Decke von sich und sprang auf die Beine. Für gewöhnlich schlief Wilhelm auf der Liege, während sich seine Schwester des Nachts in ihre Kammer zurückzog. Auf dem Weg dorthin stolperte er über einen Schemel, beinahe wäre Wilhelm gestürzt. Gequält verzog er das Gesicht. Etwas Bedrohliches lag in der Luft, und der Schmerz steigerte seine Besorgnis ins Unermessliche.
Er überlegte, den Schnepper mitzunehmen, doch er hätte kostbare Zeit opfern müssen, um die Armbrust zu laden. Zeit, die ihm nicht blieb. Zeit, in der Caroline vielleicht mit dem Tod rang. Das konnte Wilhelm nicht zulassen!
Entschlossen packte er den Griff des Messers fester, ignorierte das unangenehme Pochen in seinem Bein und stieß die Tür zu Carolines Kammer auf. Kalte Luft wehte ihm ins Gesicht, die nach frischem Harz roch. Der Wind schlug das Fenster am anderen Ende des Raumes dumpf gegen die Wand.
Von Caroline fehlte jede Spur.
Wie oft musste er diese Qualen noch ertragen?
Am Fenster angekommen, schaute Wilhelm nach draußen. Hinter der Hütte erstreckte sich ein Gemisch aus Wald und tiefster Nacht. Auf den ersten Blick machte er nichts Verdächtiges aus, keine wilden Tiere, nichts. Das Fenster zeigte keine Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen hindeuteten.
Es war niemand von draußen hereingekommen – wie er bereits vermutet hatte –, vielmehr schien es so, als wäre Caroline selbst geflohen. Schon wieder.
Wilhelm kehrte in die Stube zurück und schlüpfte in die grüne Uniform. Durch die Tür zu Carolines Kammer fiel Licht aus einer Blendlaterne, das ihm dabei half, seine Ausrüstung einzusammeln. Auf dem Tisch lagen, sauber aufgereiht, der Beutel mit den Tonkugeln, der Schnepper, das Bild des toten Vaters, Feuersteine und etwas Zunder. Nur das Gesangbuch und die Bibel ließ er zurück.
Hastig schulterte er die Armbrust.
Wilhelm war bereit für die Jagd. Menschenjagd.
So schnell er konnte, verließ er die Hütte. Im Schein der Blendlaterne bereitete es ihm keine große Mühe, Carolines Spur zu folgen. Hinter dem Haus nahm sie ihren Anfang, vor dem offenen Fenster. Fußabdrücke in der nassen Erde. Es gab keine weiteren Spuren, niemand hatte die junge Frau verschleppt. Ein kleiner Trost wenigstens.
Je weiter er ging, desto mehr verdichtete sich das Unterholz, und der Boden wurde trockener. Nur noch hier und da entdeckte Wilhelm einen halben Fußabdruck. Vereinzelt hingen Fäden an den Ästen, wie Spinnweben. Wolle. Caroline musste die Bäume mit ihrem Jäckchen gestreift haben.
Wilhelm folgte dem Gespinst und einer Spur abgeknickter Zweige. Hin und wieder sah er niedergetrampeltes Gras. Wenigstens war Caroline quer durch den Wald gelaufen, statt einem der befestigten Pfade zu folgen. Das erleichterte die Verfolgung, wenn auch nur geringfügig.
Schließlich verlor Wilhelm die Fährte. Noch ein Stück ging er weiter in dieselbe Richtung, ohne einen Abdruck oder einen anderen Hinweis zu finden. Sie konnte unmöglich gelernt haben, ihre Spuren zu verwischen. Dennoch war sie ihm entkommen, verdammt, er hatte versagt! Sein Atem raste. Bisher hatte Wilhelm kaum einen Laut von sich gegeben, nun fluchte er, erst leise, dann immer lauter.
Es gelang ihm nur mühsam, sich zur Ruhe zu zwingen. Wilhelm kehrte um, musste den halben Weg zurücklaufen und verschenkte Zeit. Zeit, die über Leben und Tod entscheiden konnte. Endlich stieß er wieder auf die Fährte seiner Schwester, jedoch an einer anderen Stelle. Die Spuren führten in die andere Richtung, zurück zur Hütte. War Caroline etwa im Kreis gelaufen? Aber warum?
Diese Fährte hier war frischer, Wilhelm lief schneller.
Vor ihm tauchte etwas Weißes auf … Caroline!
Im Schneidersitz kauerte sie mitten auf einer Lichtung, den Blick zum Himmel gerichtet. Reglos. Als er näher kam, hob seine Schwester die Hände vor sich. Schützend? Abwehrend? Wilhelm war sich nicht sicher. Sie hatte das Jäckchen verloren, trug nur dünne Kleidung, zitterte.
Allmählich entspannte sich Wilhelm, doch das Messer behielt er in der Hand. Er trat auf die Lichtung hinaus, sein Blick suchte die Umgebung ab. Ruhig ging er auf Caroline zu.
Ihr Körper bebte kaum sichtbar, von Unruhe erfüllt.
„Was ist geschehen?“, fragte Wilhelm.
Nun steckte er das Messer weg und setzte sich neben seine Schwester auf die Erde. Sofort kroch Caroline auf allen vieren zu ihm und warf sich an seine Brust. Ihr langes Haar kitzelte seine Wange, doch Wilhelm drehte den Kopf nicht weg. Er hielt Caroline, so fest er konnte.
„Sch …“, beruhigte er sie. Mit einer Hand streichelte er ihr Gesicht. „Dir passiert nichts, alles wird gut.“
„Der Nachtmahr …“, flüsterte sie.
Seit Monaten plagten schlimme Albträume seine Schwester und brachten sie um den Schlaf. Manchmal vergingen Tage, ohne dass der Nachtmahr sie quälte, und manchmal kam er häufiger. Stets nahm er eine andere Albgestalt an, um Caroline zu erschrecken, und immer öfter wachte die Arme im Wald auf, völlig verstört, und ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen war. Meist war sie zu Tode geängstigt. Auch jetzt hatte sie die Augen weit aufgerissen, und ihr Herz schlug so stark, dass Wilhelm glaubte, es durch die Kleidung zu spüren.
„Schlangen …“, keuchte sie. „Schlangen hielten mich, krochen über meine Brust und … würgten … mich.“ Mit einer Hand tastete sie ihren Hals ab, als könnte sie die geschuppten Biester noch spüren, die ihr die Luft abgeschnürt hatten.
„Es war nur ein Traum“, sagte Wilhelm. Behutsam legte er seine Jacke über ihre Schultern und half ihr auf.
Caroline krallte sich fest. „Lass mich nicht allein.“
Er lächelte. „Sei unbesorgt, ich werde dich beschützen“, versprach Wilhelm. „Schlangen fürchten sich vor Förstern. Solange ich in deiner Nähe bin, halten sie sich fern.“
Er nahm sie bei der Hand und führte Caroline zur Hütte zurück. Dort half er ihr, sich auf die Liege zu setzen. Wilhelm schloss das Fenster in ihrer Kammer, machte ein Feuer im Ofen und wärmte etwas Milch auf. Er achtete darauf, sie nicht zu heiß zu machen, damit seine Schwester sich nicht verbrannte.
Vorsichtig nahm Caroline den Becher entgegen und trank einen Schluck. Sie wirkte schon viel gefasster. Wie jedes Mal, wenn Wilhelm seine Schwester betrachtete, fiel ihm auch jetzt auf, wie zerbrechlich und hübsch sie aussah. Obwohl sie bereits siebzehn Jahre alt war – nur etwas jünger als er –, erschien sie ihm so hilflos.
„Glaubst du, der Nachtmahr kehrt zurück?“, fragte Caroline, und der Becher in ihrer Hand schwappte fast über.
„Nein, fürchte dich nicht, ich habe ihn verjagt.“
Vielleicht hatte ihre überbordende Fantasie ihr im Traum einen Streich gespielt. Als Kind hatte Caroline oft behauptet, sie könne mit den Blumen sprechen, in den Wolken Symbole erkennen oder habe die wundervollsten Fische in den Bächen der Umgebung entdeckt. Nur widerwillig räumte Wilhelm sich gegenüber ein, dass ein Mädchen – eine junge Frau – wie Caroline nicht nur im Wald aufwachsen sollte. Die Abgeschiedenheit belastete ihr Gemüt.
„Morgen bringe ich dich in die Stadt“, verkündete er.
„Ja. Kaufst du mir dann Schokolade?“, fragte Caroline in schläfrigem Tonfall. Sie streckte sich auf der Liege aus, ihre Augen wurden schmaler, und sie gähnte.
„Natürlich“, sagte Wilhelm, obwohl sie nicht über viel Geld verfügten und das wenige besser für Salz oder Einmachgläser ausgeben sollten. Aber er konnte seiner Schwester keinen Wunsch abschlagen, erst recht nicht in dieser Nacht.
Neben Caroline machte er es sich auf der Liege gemütlich, sodass sie mit dem Gesicht zueinander lagen und sich bei der Hand hielten, wie sie schon als Kinder geschlafen hatten.
„Ich kaufe dir Schokolade, und wir schauen uns die schönen Kleider an, die dir so gefallen, und du darfst die Luft vor dem Pfeifengeschäft schnuppern.“ Während Wilhelm redete, überkam ihn selbst die Müdigkeit, und als er zu Ende gesprochen hatte, war Caroline bereits eingeschlafen.
Nur allzu gerne hätte auch er die Augen geschlossen, doch Wilhelm genoss es zu sehen, wie friedlich Caroline schlief, und weil er versprochen hatte, sie vor dem Nachtmahr zu beschützen, blieb er wach, mit dem Messer in der Hand.
Die ganze Nacht.
3. WILHELM
17. August 1822, nahe Königsberg
Je näher sie der Stadt kamen, desto ausgelassener verhielt sich seine Schwester. Mit jedem Schritt fielen die ihr eigene Zurückhaltung und Stille mehr und mehr von ihr ab, wie alte Kleider, die sie nur im Wald zu tragen brauchte. Jetzt plapperte Caroline ununterbrochen: über das heitere Spiel der Straßenmusikanten, die riesigen Gebäude, die Brücken und Flüsse, und die Worte sprudelten nur so aus ihrem Mund. Nach einer Weile stimmte sie ein fröhliches Lied an und statt zu gehen, tanzte sie in Richtung Stadt, hüpfend und sich drehend.
Auf Wilhelm übte Königsberg genau die gegensätzliche Wirkung aus: Immer weniger Worte stahlen sich über seine Lippen, bis er schließlich gar nichts mehr sagte, sondern still über finsteren Gedanken brütete. Den Schnepper hatte er in der Hütte zurückgelassen, nur das Messer und seinen Stock trug er bei sich. Dermaßen schutzlos fühlte Wilhelm sich unwohl. Königsberg steckte voller Gefahren, denen er nur ungern ohne angemessene Vorbereitungen begegnen wollte.
Von einer Anhöhe blickten Caroline und Wilhelm auf die Stadt hinab, die - eingerahmt von einem Flickenteppich aus Wäldern und Feldern - unter ihnen lag. Umschlungen von den Strömen des Alten und Neuen Pregels, streckten ihnen die höchsten Häuser der Dominsel ihre Dächer entgegen.
Es war noch früh am Morgen. Aus zwei Gründen hatte Wilhelm zu baldigem Aufbruch gedrängt. Erstens lagen die meisten Städter um diese Zeit noch in ihren Betten, sodass seine Schwester und er nur wenige treffen würden; zweitens fühlte Wilhelm sich im morgendlichen Halbdunkel weniger beobachtet, solange er die Fenster noch geschlossen vorfand. Menschen bedeuteten Ärger, Probleme, die er lieber meiden wollte.
Als sie das weiche Moospolster verließen und auf einen harten Feldweg traten, nur um kurze Zeit später auf die noch festere Straße zu wechseln, fühlte Wilhelm sich darin bestätigt, dass das Leben in Königsberg für ein so zartes Wesen wie Caroline auf Dauer nicht auszuhalten wäre. Der Lärm, den die Fuhrwerke auf den Straßen machten, die neugierigen Blicke und Fragen der Städter, nicht zu vergessen die Versuchungen, die ein solcher Ort barg. Er konnte sich nicht vorstellen, in einem Moloch wie Königsberg zu hausen, geschweige denn, seine Schwester den verlockenden Gefahren auszusetzen. Da zog er die Einsamkeit des Waldes dem dunklen Labyrinth der Gassen gerne vor.
Sie durchquerten die Vorstadt, südlich des Pregels gelegen, in der häufig Brände wüteten. Diese Tatsache wunderte Wilhelm nicht im Geringsten, standen die Häuser doch fast so dicht wie die Bäume im Wald. Ein einzelner Funke, getragen vom Wind, konnte mühelos von einem Dach aufs nächste springen, und Stroh, Schilf oder Holz entzünden.
„Sieh nur, wie zauberhaft!“, rief Caroline.
Voller Begeisterung rannte sie auf die Grüne Brücke und stellte sich ans Geländer, um den Pregel auf und ab zu schauen. Dabei lehnte sie sich nach vorne, und ihr Blick folgte dem Verlauf des Flusses. Neugierig stieg sie mit einem Fuß aufs Geländer und beugte sich noch mehr über die Brücke hinaus. Ein Stück zu weit, denn sie verlor das Gleichgewicht. Obgleich sie sich am Geländer festklammerte, rutschte ihr Fuß ab, und sie kippte vornüber.
Im letzten Augenblick griff Wilhelm zu und riss seine Schwester zurück. Caroline stolperte nach hinten, hielt sich jedoch, dank seiner stützenden Hand, auf den Beinen.
„Gib Acht!“, warnte er sie.
„Du immer mit deiner ewigen Besorgnis“, neckte ihn seine Schwester. „Ich wäre schon nicht gestürzt.“
Sie täuschte sich, doch weil er Caroline nie lange böse sein konnte, beließ Wilhelm es bei einem ernsten Blick.
Auf der anderen Seite der Brücke wartete Georg, ungeduldig von einem Fuß auf den anderen tretend. Als er Wilhelm sah, riss er seinen Prügel hoch. Dieser trat auf ihn zu und wehrte den Schlag mühelos mit dem eigenen Stab ab. Kurz standen sich die beiden gegenüber, grimmigen Gesichts, die Stöcke gekreuzt, dann brachen sie in lautes Gelächter aus.
Georg umarmte Caroline überschwänglich. Wilhelm wollte ihm die Hand reichen, doch sein Gegenüber, der taub war, zog ihn zu sich und schlang ihm die Arme um den Oberkörper.
„Wir Förster müssen zusammenhalten“, sagte Georg laut, wobei der Mund und seine Zunge die Silben umständlich formten, sodass sie überbetont und unnatürlich lang gezogen klangen.
„Ohne uns sind die Städter hilflos“, antwortete Wilhelm. Die Wörter sprach er leise, aber deutlich aus, damit der Taube sie von seinen Lippen ablesen konnte; zugleich zeigte er mit dem Finger auf Georg und sich, dann führte er die flache Hand von links nach rechts und tippte sich an den Kopf.
Von Georg, der als Kind seinen Gehörsinn verloren hatte, hatte Wilhelm die Zeichen gelernt, mit denen Taube sich verständigten. Jede Bewegung entsprach einem Wort: Der Fingerzeig hieß wir, das Winken mit der flachen Hand bedeutete alle, und die letzte Geste hätte sogar jeder nicht Eingeweihte als „verrückt“ verstanden. So hoffte Wilhelm, dass er Georg den Sinn der gesprochenen Worte verständlich übermitteln konnte.
Der Taube klatschte und nickte ihm stolz zu. Wie Wilhelm war auch Georg ganz in Grün gekleidet, allerdings trug er keine Uniform, sondern einen Mantel, den er aus verschiedenen grünen Fetzen zusammengenäht hatte. Vom Taschentuch über alte Lappen und ein Stück Decke war fast alles dabei. Georg hielt sich für einen Förster, und die Grüne Brücke hatte er zu seinem Revier erkoren. Hier wachte er tagsüber, und des Nachts schlief er unter ihrem Schutz. Die Vögel betrachtete er als das Wild, das er gegen die Angriffe der frechen Burschen verteidigen musste, die mit Steinschleudern auf sie schossen. Die Städter empfanden keine Sympathie für Georg. Die nettesten von ihnen ignorierten den Tauben einfach, doch die meisten benahmen sich weniger höflich: Sie zeigten mit dem Finger auf ihn oder spotteten, ahmten die Art nach, wie er sprach, um ihn dann auszulachen. Manche bespuckten ihn, andere beschimpften oder verprügelten ihn sogar. Besonders die Bewohner der umliegenden Häuser und die Ladenbesitzer jagten ihn oft von der Brücke. Aber stets kehrte Georg in sein Revier zurück. Er lebte wie ein Ausgestoßener. Die Städter behaupteten, er sei ein Idiot, folge tierischen Trieben und bedrohe die Unschuld ihrer Töchter.
„Brauchst du etwas?“, fragte Georg. Nebenbei handelte der Taube mit Waren, die er aus verschiedenen Geschäften stahl. Weil ihn niemand beachtete, fiel es Georg leicht, sich heimlich in die Läden zu schleichen und dort alles unter seinen Mantel zu schieben, was er benötigte. Üblicherweise wich ihm die restliche Kundschaft aus oder blickte bewusst in die andere Richtung, was sein Unterfangen erleichterte.
„Konntest du die Kugeln besorgen?“, fragte Wilhelm.
Nachdem er einen verschwörerischen Blick in die Runde geworfen hatte, führte Georg sie zum anderen Ende der Grünen Brücke. Dort lag sein Bündel, in dem er eine Weile kramte, bis er die verlangte Ware endlich hervorzog. Sie waren aus Eisen gegossen und größer als die Tonkugeln, die Wilhelm sonst mit der Armbrust verschoss.
„Willst du den Wolf erschießen?“, fragte Georg.
„Wovon redest du?“, wunderte sich Wilhelm.
„Darum erschlägt sie ein Löwe aus dem Walde“, deklamierte der Taube mit fester Stimme, „ein Wolf der Steppe vertilgt sie, ein Pardel belauert ihre Städte: Jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen; denn ihrer Übertretungen sind viele, zahlreich ihre Abtrünnigkeiten.“
„Was bedeutet das?“ Zum ersten Mal, seit er Georg kannte, seit Wilhelm ihn damals, vor vielen Jahren, auf der Grünen Brücke stehen und die Vögel mit Brotkrumen füttern gesehen hatte, zweifelte er an dessen Geisteszustand.
„Er hat zugeschlagen … Zerfetzt.“
„Georg, bist du von Sinnen?“
„Ich zeige es euch.“ In aller Eile warf Georg das Bündel auf seinen Rücken und winkte sie hinter sich her. „Kommt mit, kommt!“ Ungeduldig rannte er voraus.
Caroline folgte ihm, und nach kurzem Zögern schloss auch Wilhelm sich an. Sie bogen ab in die Brodbänkenstraße, passierten das Rathaus und steuerten auf die Kirche zu.
An der linken Seite der aus Backsteinen gemauerten Westfront erhob sich ein spitzer Turm mit einem zwölfeckigen Dach. Den rechten Turm hatte ein Brand zerstört, und die verkohlten Reste bedeckte ein einfaches Giebeldach.
Auf dem Domplatz hatte sich eine Traube von Menschen gebildet. Unter ihnen machte Wilhelm die üblichen Kirchgänger aus, die auf dem Weg zur Morgenmesse gewesen sein mussten. Doch auch ein paar Jäger lungerten herum, die sich offenbar nur wichtigmachen wollten.
„Seht nur, wer da kommt“, lästerte einer von ihnen, als er Wilhelm und seine Begleiter ausmachte. „Der Wilde kehrt in den Schoß der Zivilisation zurück.“
„Und er hat den Idioten mitgebracht“, kicherte ein anderer. „Sag die Wahrheit: Hast du dort draußen in der Wildnis noch mehr Bastarde mit deiner Schwester gezeugt?“
„Das stimmt nicht“, erwiderte Caroline.
Wilhelm legte ihr die Hand auf die Schulter. „Ignorier sie einfach. Diese Torfköpfe sind es nicht wert.“
„Für so ein Weib würde ich auch zum Wilden werden.“ Ein dritter Kerl, mit schmierigen Haaren, zeichnete die Umrisse einer Frau in die Luft. Sein Gesicht glühte vor Begierde.
„Zügle deine Zunge!“ Wilhelm stampfte in die Richtung der Jäger, und eine Hand wanderte unter seine Kleidung, wo das Messer steckte. „Oder ich schneide sie dir …“
„Immer mit der Ruhe.“ Plötzlich packte ihn Georg am Arm. „Wir wollen keinen Ärger machen, bitte entschuldigt.“
„Was tust du?“, fauchte Wilhelm.
„Dich davor bewahren, eine große Dummheit zu begehen“, flüsterte der Taube. „Sie warten nur darauf, dass du einen Fehler machst, auf eine Gelegenheit, dich zu töten.“
Erst jetzt bemerkte Wilhelm die Radschlosswaffen, mit denen die Jäger auf ihn zielten, und hatte nur ein mitleidiges Lächeln für die Büchsen übrig, die – wie der Vater ihm erklärt hatte – ein Werk des Teufels waren. Allen lebenden Kreaturen zu merklichem Untergang hatte der Pferdefuß das schädliche Schießpulver erdacht. Arme Narren.
„Warum klemmt ihr nicht eure Waffen zwischen die Beine und verschwindet?“, knurrte Wilhelm. „Nur passt dabei gut auf, dass ihr euch nicht in euer drittes Bein schießt, denn mit einer Meute keifender Weiber will ich keinen Streit.“
„Na warte, du Halunke!“ Einer der Jäger, Ignaz, ein hagerer Kerl mit grauem Schnauzbart, trat vor.
Wie eine Lanze stach der Lauf der Radschlosswaffe gegen Wilhelms Brust. Ein Schmerz durchzuckte die getroffene Stelle, doch Wilhelm hielt dagegen, sodass Ignaz einen Schritt zurückweichen musste. Der Finger des Jägers wanderte zum Abzug der Waffe. Was dachte Wilhelm sich nur dabei? Wer würde auf Caroline aufpassen, sollte er verwundet werden oder gar sterben? Er verfluchte sich für seinen Stolz und erkannte, dass er unüberlegt gehandelt hatte.
„Genug!“, unterbrach ein harscher Ruf das Duell ihrer Blicke. „Reicht ein Toter für heute nicht aus?“
Mit plumpen Schritten stampfte Paulmann zu ihnen. Selten eignen sich Redensarten, um einen Menschen treffend zu beschreiben, doch im Falle des Polizisten hätten einfache Worte nicht ausgereicht. Paulmann war ein Berg von einem Mann, so breit wie hoch, dabei überragte er Wilhelm um mindestens eine Haupteslänge. Die Uniform spannte an mehreren Stellen, besonders an den muskulösen Oberarmen, das Gesicht des Polizisten war rund. Zu den Lippen hätte ein breites Grinsen vortrefflich gepasst, stattdessen hingen die Mundwinkel traurig nach unten.
„Eine solche Provokation muss ich mir nicht gefallen lassen“, schnaubte Ignaz und zog seinen Handschuh.
„Das lasse ich nicht zu!“, rief Paulmann. „Nachdem die werten Herrschaften mir bedauerlicherweise nicht helfen konnten, ersuche ich das Urteil des Försters. Und dazu benötige ich ihn zwingenderweise lebend.“
„Nun denn“, maulte Ignaz. „In diesem Fall kommst du noch mal mit dem Leben davon, Bürschchen. Aber bei unserem nächsten Treffen wird es nicht so glimpflich für dich ausgehen.“
Mit diesen Worten verabschiedete er sich und stolzierte mit seinen Begleitern davon.
Wilhelm atmete erleichtert auf. Nur knapp war er einem Kampf auf Leben und Tod entronnen.
„Bis zum heutigen Tag hielt ich Sie für einen vernünftigen Mann, Förster“, sagte Paulmann. „Wenn nun auch noch die zur Vernunft Begabten der Unvernunft verfallen, wie soll ich in solchen Zeiten für Recht und Ordnung sorgen?“
„Es tut mir leid“, erwiderte er.
„Sie können mir Ihre Dankbarkeit demonstrieren, indem Sie sich etwas ansehen.“ Paulmann bedeutete, ihm zu folgen.
An der Mauer des Doms lehnte eine zusammengesunkene Gestalt. Sie schien zu schlafen oder bewusstlos zu sein. Als Wilhelm die Blutlache auffiel, die den Körper umgab, wusste er sofort, dass keine seiner Vermutungen zutraf.
Der Unbekannte war tot.
„Sein Name ist Hubert, ein stadtbekannter Unruhestifter. Keine Prügelei fand ohne ihn statt. Ein bedauerliches Beispiel für das Scheitern einer menschlichen Existenz.“ Mit hängenden Schultern betrachtete Paulmann die Leiche.
Wilhelm hörte nicht auf die Worte; er vergaß Paulmann und wusste nicht, ob Georg oder Caroline ihm gefolgt waren. Neben Hubert ging er auf die Knie und studierte den Toten mit einer Mischung aus Faszination und Ekel. Drei tiefe Wunden klafften in der Bauchdecke, aus denen die Innereien herausquollen. Hin- und hergerissen zwischen Neugier und aufsteigender Übelkeit fuhr Wilhelm den Verlauf der Verletzungen mit einem Zeigefinger nach. Sie waren von oben nach unten gezogen worden, zweifellos.
„Es wäre möglich, dass ein wildes Tier hinter der Tat steckt“, mutmaßte Paulmann. „Gerüchten zufolge treibt ein Wolf in den Wäldern sein Unwesen. Bei Spaziergängen haben schon mehrere Bewohner zerfetzte Kleintiere gefunden, und einige Haustiere werden vermisst. Was halten Sie davon?“
„Könnte in der Tat ein wildes Tier gewesen sein“, meinte Wilhelm, „muss es aber nicht. Sehen Sie, die Risse verlaufen exakt im gleichen Abstand zueinander, was äußerst ungewöhnlich ist. Zudem sind die Wundränder viel zu glatt. Krallen hätten die Haut stärker zerfetzt, während diese Wunden sauber sind. Fast wie Schnitte.“
„Schnitte?“ Paulmanns Gesicht färbte sich weiß.
Natürlich blieb Wilhelm die Reaktion nicht verborgen. Was mochte der Polizist denken? Hatte er einen Verdacht?
„Was wissen Sie?“, fragte er in unnachgiebigem Tonfall.
Paulmann nahm Wilhelm am Arm und führte ihn von dem Toten weg. „Es gibt … andere Gerüchte“, flüsterte er.
„Was für Gerüchte?“
„Schlimme Gerüchte.“
„Nun reden Sie schon!“
„Es heißt, dass Anhänger von Johann Georg Hamann in geheimen Tunneln unter den sieben Hügeln leben. Es sollen dort Menschen getötet worden sein – als Opfer für dämonische Mächte.“
„Hamann?“, fragte Wilhelm.
„Der Sohn eines Königsberger Baders. Er studierte Theologie und dann Rechtswissenschaft, wenn ich mich recht entsinne. Ohne Abschluss verließ er die Universität. Später erstellte er einige Schriften, die sich durch eine starke Zuneigung zum Irrationalen auszeichneten. Hamann hielt sich für einen Mystiker, einen Propheten, was ihm den Beinamen Magus des Nordens einbrachte. Schon zu Lebzeiten hatte er viele geheime Anhänger, doch nach seinem Tod entstand ein wahrer Kult um ihn und sein Erbe. Man erzählt sich, dass vieles verzerrt und unrichtig dargestellt wird, sodass die angeblichen Lehren des Magus des Nordens, an die jene Verwirrten glauben, weit entfernt sind von den wahren Ansichten Hamanns.“
„Der Magus des Nordens …“, wiederholte Wilhelm.
„Es scheint, als hätten sich die Mächte des Bösen entschlossen, mir das Leben zur Hölle zu machen“, seufzte Paulmann. „Wie soll ein einfacher Mensch wie ich, wenngleich ein gläubiger Mensch, daran sollte es keinen Zweifel geben, gegen eine derartige Bedrohung bestehen?“
„Die Mächte des Bösen stehen in keinem Zusammenhang zu diesem Mord“, widersprach Wilhelm. „Wenn es kein wildes Tier war, wie ich vermute, nein, weiß, dann ist ein ganz gewöhnlicher Mensch für diese Tat verantwortlich.“
„Es war kein Tier“, stimmte ihm eine unbekannte Stimme zu, „und auch kein Mensch.“ Geschmeidig wie ein zum Leben erwachter Schatten glitt die große, schmale Gestalt zu ihnen.
Als Erstes fiel Wilhelm das Gewehr auf, das der Neuankömmling auf dem Rücken trug. Er musste ein Jäger sein, aber kein Königsberger, denn diese bildeten sich viel auf ihr tadelloses Äußeres ein. Der Mantel des Neuankömmlings hingegen war voller Risse und starr vor Schmutz, als hätte er eine weite Reise hinter sich.
„Wer sind Sie?“, verlangte Paulmann zu wissen. „Und wer ist Ihrer Meinung nach für den Mord verantwortlich?“
„Nicht wer“, verbesserte der Unbekannte den Polizisten, „sondern was“. Dann fügte er hinzu: „Ein Ungetüm.“
Wilhelm nahm an, dass dies die Antwort auf die zweite Frage war, und der Neuankömmling die erste Frage einfach ignoriert hatte. Ganz sicher war er sich allerdings nicht.
Von den Worten des Jägers angelockt, drängten sich einige Schaulustige näher an ihn heran.
„Ich bitte Euch, sprecht leiser“, zischte Paulmann.
Gelassen kniete sich der vermeintliche Jäger neben Wilhelm und untersuchte die Verletzungen mit kundigem Blick. Die Leiche schien ihn weder abzuschrecken, noch zu interessieren.
„Godverdomme“, flüsterte der Neuankömmling.
„Nicht wahr? Die Wunden sind wie mit einer Feder gezogen, geschickt, präzise, mit großer Fertigkeit“, stellte Wilhelm begeistert fest. „Das ist nicht nur ein Mord, um Leben auszulöschen, sondern eine Art … Kunstwerk. Die Wildheit der Verletzungen, vereint mit der gewandten Ausführung. Erlesen.“
„Erschreckend, würde ich es nennen“, verbesserte ihn der Jäger. Er betrachtete Wilhelm von der Seite, die Augen zu engen Schlitzen zusammengezogen.
„Selbstverständlich“, stimmte dieser eilig zu.
„Auf ein ähnlich zugerichtetes Opfer bin ich flussabwärts gestoßen. Beinahe hätte der Pregel den Körper ins Frische Haff gespült. Nicht die Schnitte, sondern die Verletzung am Hinterkopf führte zum Tod des Mannes.“ Der Jäger zeigte ihnen die Wunde, dann stand sie auf und klopfte sich mit den Händen die Knie ab. „Das Ungetüm war entgegen dem Flusslauf unterwegs und ist so nach Königsberg gelangt.“
Mit einem Fingerzeig deutete Paulmann an, dass ihn eine Frage quälte: „Verzeiht meine Unwissenheit. Wenn Sie von einem Ungetüm sprechen, was genau meinen Sie damit?“
„So etwas wie ein Wolf im Schafspelz, eine Bestie in Menschengestalt. Ein Mannwolf, halb Mann, halb Wolf, mit einem von bösen Geistern beseelten Verstand, der nur den Hunger kennt, den unstillbaren Hunger, und niemals satt wird, egal wie häufig er tötet.“
„Sie … Sie meinen, Jesus Christus, Sie denken, der … Mörder wird wieder töten?“, flüsterte Paulmann und wischte sich mit einem bestickten Taschentuch über die Stirn.
„Ich vermute es nicht, ich weiß es.“ Der lebende Schatten nickte. „Es sei denn, ich kann ihn rechtzeitig aufhalten.“
4. CAROLINE
17. August 1822, Königsberg
„Komm weg hier“, nuschelte Georg in Carolines Ohr und zupfte an ihrem Ärmel. Caroline schüttelte ihn ab. Sie wollte bei Wilhelm bleiben. Auch wenn sie das Treiben der Stadt liebte, die johlende Gruppe Jäger hatte ihr Furcht eingejagt. Sie war dankbar, dass Wilhelm vom Gendarmen gerettet worden war. Noch immer schlug ihr Herz vor Angst schneller.
Staunend starrte sie auf den hochgewachsenen Fremden, der nun neben Wilhelm stand. Beide blickten auf einen weiteren Mann hinunter, der am Dom zusammengesunken saß. Wilhelm wechselte einige Worte mit der schmalen Gestalt und dem Gendarmen, die Caroline nicht verstand.
„Komm!“, sagte Georg wieder.
Der sitzende Mann rührte sich nicht, und nun entdeckte Caroline die dunkle Lache, die sich zwischen den Beinen des Mannes ausgebreitet hatte. Blut. Schaudernd gab Caroline dem Drängen des Tauben nach. Allerdings warf sie noch einen langen Blick auf die schmale Gestalt neben Wilhelm. Auch er trug ein Gewehr, wie die Männer, die Wilhelm bedroht hatten, und dazu einen langen, steifen Mantel. Wieder erfüllte eine bange Ahnung Carolines Herz. Wer war dieser Mann?
Georg zog sie mit sich fort. „Komm, das ist nichts für ein Mädchen“, murmelte er auf seine langsame, unbeholfene Art. Caroline folgte ihm ohne Widerstand, ein weiterer Blick auf den Toten ließ ihre Knie weich werden und trieb sie von diesem Ort fort.
Georg brachte sie nicht weit weg, nur bis zum Haupteingang des Doms. Dort lehnte sich Caroline an den harten Stein und nahm einige tiefe Atemzüge. Langsam kehrte ihre Kraft zurück.
Georg zog schon wieder an ihrem Ärmel. „Komm!“, sagte er erneut und zeigte auf die Läden gegenüber dem Dom. Caroline zwang sich zu einem Lächeln. Wie lieb Georg sich um sie kümmerte, und wie einfach sein Gemüt doch war, zu glauben, dass sie sich von billigem Tand ablenken ließ. Noch immer sah sie die Blutlache vor ihrem inneren Auge.
Georg zuliebe warf sie einen Blick auf die bunte Seide. Er zerrte an ihrem Arm, zog sie weiter fort, sodass sie Wilhelm nicht länger sehen konnte. Sie wehrte sich gegen den Tauben, versuchte, ihren Bruder im Blick zu behalten.
Um sich selbst von dem Anblick des Toten und der Angst abzulenken, die dieser in ihr ausgelöst hatte, warf sie nun doch einen zweiten Blick auf die Seide. Ein Kleid daraus zu schneidern, das wäre wunderbar. Sie müsste sich endlich nicht mehr schämen bei Tageslicht in die Stadt zu gehen. Bunte Bänder flatterten neben der Tür des Stoffladens. Caroline stellte sich vor, wie sie diese Bänder in ihr Haar flechten würde, aber ohne Wilhelm wollte sie den Laden nicht betreten. Schon kehrten ihre Gedanken wieder zu dem schauerlichen Toten zurück. Sie lugte hinüber zum Dom, in der Hoffnung, Wilhelm zu erblicken.
„Ach, dieser Ritter von der armen Gestalt!“, kicherte eine ältere Dame neben Caroline. Sie fuhr herum und fragte sich, ob die Frau mit ihr redete. Doch diese sah aufmerksam zum Dom herüber und schüttelte immer wieder den Kopf. Die eingedrehten Locken der Dame zitterten bei jeder Bewegung ihres Kopfes, die Puffärmel ihres seidenen Kleides waren nach der neuesten Mode geformt.
Nein, sie hatte wohl einfach nur mit sich selbst geredet. Caroline sah sich um. Der Mann, der mit Wilhelm gesprochen hatte, lief mit langen Schritten über den Domplatz. Caroline fasste all ihren Mut zusammen und sprach die Dame an, obwohl sie sicherlich die Ehefrau eines Kaufmanns und damit weit über ihrem eigenen Stand war.
„Madame, wissen Sie, wer dieser Mann ist?“ Sie deutete auf den hochgewachsenen Fremden.
„Der da?“ Die Frau warf ihr einen prüfenden Blick zu. Caroline beobachtete, wie sich die Mundwinkel der Fremden verhärteten, und war sich sicher, dass sie die Flecken am Rocksaum entdeckt hatte. Schon bereute sie es, die Dame überhaupt angesprochen zu haben.
„Nun, noch längst nicht jeder hat von dem großen Jäger gehört“, sagte die Frau herablassend und neigte den Kopf mit der blumenbedeckten Haube. Caroline nickte zum Zeichen, dass sie die Worte vernommen hatte. Sie wagte, noch eine Frage zu stellen.
„Was jagt er denn?“
„Herr Luuk de Winter hat großes Geschick in der Jagd auf Ungetüme, heißt es“, fuhr die Dame fort.
„Gibt es denn Ungetüme in Königsberg?“ Carolines Stimme war nur noch ein Flüstern.
„Nun ja, irgendetwas hat den armen Hubert auf dem Gewissen“, brummte die Frau und sah verächtlich auf Caroline hinunter. „Ich glaube nicht, dass ein Mensch zu so etwas fähig ist.“
„Komm!“, zischte Georg neben ihr. „Komm weg.“
Mit einem Schnauben strich die Frau ihren weiten, bunten Rock glatt und zog sich einen Schritt zurück. „Der Idiot hat ausnahmsweise recht.“ Die Dame warf Caroline einen langen Blick zu und nickte dann entschlossen. „Ein Mädchen wie du sollte im Haus arbeiten und sich nicht um derlei Grausamkeiten kümmern. Und gib dich nicht länger mit diesem Dummkopf ab.“
Damit rauschte sie davon. Caroline war erleichtert, Wilhelm auf sich zukommen zu sehen. Dennoch richtete sie ihren Blick entschlossen auf die bunte Seide. Vielleicht konnte der Stoff trotz allem dabei helfen, die Gedanken an Blut und Tod, an Dämonen und Ungetüme zu vertreiben.
5. WILHELM
17. August 1822, Königsberg
Während der Unbekannte Paulmann versprach, all seine Kraft und Weisheit einzusetzen, um das Ungetüm zu töten, schlich sich Wilhelm unauffällig von der Stelle weg, an der die Leiche lag. Er suchte Caroline und Georg in der Menge, konnte sie jedoch nicht finden. Nervös umrundete er den Dom.
Am Vordereingang machte er ein vertrautes Gesicht aus. Dort stand Clara, eine gute Bekannte, und Wilhelm wollte schon zu ihr eilen, als er bemerkte, dass sie nicht allein war. Ein junger, gut gekleideter Mann kam zu ihr und begrüßte sie hocherfreut. Die beiden steckten vertraut die Köpfe zusammen und unterhielten sich lebhaft miteinander. Es handelte sich um niemand geringeren als Theodor von Hippel, den Sohn von Theodor Gottlieb von Hippel, dem der Vater einst das Leben gerettet hatte. Theodor kümmerte sich um Clara, das wusste Wilhelm; so bezahlte der junge Hippel ihr Zimmer in der Wohnung der Witwe Wagner, bei der die Waise lebte.
Auf ihrer Schulter lag ein einzelnes, goldenes Haar, das Theodor wegzupfte. Was bildete sich dieser Schuft ein? Wilhelm biss die Zähne zusammen. Theodor sagte etwas, und Clara legte den Kopf zurück, lachte, hell und klar.
„Psst“, zischte eine junge Frau hinter ihm. „Ich bin Maria.“ Sie warf einen wachsamen Blick in die Runde. „Durch Zufall habe ich bemerkt, wie du mit dem Jäger gesprochen hast.“
„Mit Ignaz?“, wunderte sich Wilhelm.
„Nein, ich meine den anderen“, sagte Maria. Sie reichte ihm nur bis zur Schulter, war klein und dünn. Ihre Arme sahen so mager aus, als bestünden sie nur aus Haut und Knochen.
Wilhelm dachte an den Jäger. „Kennst du ihn etwa?“ Vielleicht konnte die Frau ihm verraten, wer der Fremde war.
„Nicht persönlich“, antwortete Maria ausweichend.
„Woher weißt du dann, dass er ein Jäger ist?“
„Weil ihn alle so nennen“, meinte sie und fügte eine Spur leiser hinzu: „Den Jäger. Oder den Belgier.“
„Belgier, soso“, schnaubte Wilhelm.
Maria nickte. „Einmal bin ich ihm bereits begegnet. Das ist eine ganze Weile her, aber die Visage werde ich nie mehr vergessen, die dunklen Augen, der blasse Teint. Zu dieser Zeit lebte ich auf der Ronneburg. Schon damals war er ein Jäger. Nannte sich Luuk de Winter.“
Wilhelm fröstelte. „Was jagt er denn?“
„Ungetüme, behauptet er jedenfalls. Ich glaube, das ist nur eine Ausrede. In Wirklichkeit ist er selbst ein Ungetüm und hat kaum etwas Menschliches an sich, findest du nicht?“
„Ich verstehe nicht ganz …“, murmelte Wilhelm.
„Damals“, Maria machte eine betonte Pause, „auf der Ronneburg, da suchte de Winter ebenfalls nach einem Ungetüm. Er unternahm alles, um ihm auf die Schliche zu kommen.“
„Wenn du sagst, er tat alles - was meinst du damit?“
Maria stellte sich auf die Zehenspitzen, sodass ihre Lippen sein linkes Ohr berührten. „Ich meine … alles. Er hat einen Mann getötet“, zischte sie.
Dann fuhr sie herum und floh.
„Warte!“, rief Wilhelm ihr nach.
Aber die junge Frau war schon um den Dom gebogen und aus seiner Sichtweite verschwunden. Kopfschüttelnd blickte Wilhelm ihr nach. Luuk de Winter. Der Jäger. Ob der Belgier tatsächlich einen Menschen getötet hatte?
Nicht weit entfernt hakte sich Clara bei Theodor ein, und die beiden betraten den Dom. Wahrscheinlich besuchten sie zusammen die Morgenmesse. Sicher würde der Geistliche heute mehr Zuhörer haben als sonst. Obwohl Paulmann sich bemühte, den Fund des Toten geheim zu halten, würde die Nachricht schon bald die Runde machen, und die Angst den Städtern zu neuer Gläubigkeit verhelfen.
Clara mit einem anderen Mann zu sehen, versetzte Wilhelm einen Stich ins Herz. Wie sollte er, ein Förster, es mit einem so gebildeten und wohlhabenden Konkurrenten aufnehmen?
„Wilhelm?“ Georg kam von den Häusern zu ihm.
„Wo ist Caroline?“, fuhr Wilhelm ihn an.
Der Taube blieb stehen, als wäre er geohrfeigt worden.
„Wieso bist du so wütend?“, fragte Georg.
Wilhelm packte ihn an den Schultern, zerrte an seinem Mantel. „Bist du etwa zu dumm, um auf meine Schwester aufzupassen?“
„Sie steht dort drüben.“ Georg deutete nach hinten, wo Caroline vor einem Laden wartete und die Auslage bestaunte. „Ich hielt es für besser, wenn sie den Toten nicht sieht.“
Der Taube befreite sich aus seinem Griff und rückte die Uniform zurecht. In seiner übertriebenen Sorge hatte Wilhelm einen Ärmel abgerissen. Er ärgerte sich, weil er seine Wut an Georg ausgelassen hatte.
„Es ist wohl besser, ich gehe“, sagte Georg.
„Bleib hier!“ Wilhelm wollte den Tauben zurückhalten, doch dieser hatte sich schon abgewandt und lief weg.
Zwar wusste Wilhelm, wohin Georg ging - zurück zu seiner Zuflucht, seinem Revier, der Grünen Brücke -, aber es wäre nicht vernünftig gewesen, ihm gleich nachzueilen und das Missverständnis aufzuklären. Dafür hatte Wilhelm den anderen zu sehr verletzt. Er würde sich entschuldigen, später.
Als er zu Caroline ging, gab Wilhelm sich Mühe, sein schlechtes Gewissen zu ignorieren. Stattdessen dachte er an Luuk de Winter, den Jäger, und an den Toten, Hubert.
Und nicht zuletzt an das Ungetüm.
Den Mannwolf von Königsberg.
6. CAROLINE
17. August 1822, nahe Königsberg
Auf dem Weg nach Hause musste Caroline immer wieder an den Toten denken. Sie erschauerte, als das Bild der Blutlache erneut vor ihrem inneren Auge erschien. Wilhelm, der neben ihr ging, war stumm und schien ebenfalls in Gedanken versunken.
Als sie die Erinnerung an das Blut noch immer nicht verdrängen konnte, entschloss sich Caroline, nicht länger zu schweigen.
„Wilhelm?“, begann sie zögernd, vielleicht dachte ihr Bruder über etwas Wichtiges nach.
„Ja?“ Seine Stimme klang unwirsch.
Caroline biss sich für einen Moment auf die Lippen, dann sprach sie aus, was sie quälte. „Wilhelm, sind wir sicher?“
Er sah sie erstaunt an. „Natürlich. Woher sollte uns Gefahr drohen?“
„Vom Ungetüm!“, brach es aus ihr heraus. „Von dem Monster, das den Mann am Dom getötet hat!“
Nun lächelte ihr Bruder sanft. „Mach dir darüber keine Sorgen. Dieses Ungetüm treibt in Königsberg sein Unwesen. Warum sollte es zu uns in den Wald kommen, wenn es in der Stadt so viele Opfer finden kann, wie es will? Und außerdem bin ich ja da.“
Caroline atmete tief durch. Es stimmte, das Monster hatte in Königsberg getötet. „Du meinst, im Wald sind wir sicher?“
„Auf jeden Fall“, gab Wilhelm zurück.
Caroline schritt leichter aus. Ja, im Wald, da war sie sicher.
7. CAROLINE
18. August 1822, im Wald nahe Königsberg
Caroline wachte davon auf, dass ihr die Sonne ins Gesicht schien. Die Wärme streichelte ihre Wangen, und sie streckte sich wohlig unter ihrer leichten Decke. Wilhelm hatte ihr versichert, dass im Wald keine Gefahr von dem Monster drohte, und so atmete sie tief durch und genoss das Gefühl, beschützt zu sein.
Eine leise Stimme in ihr erinnerte sie an ihre bösen Träume, den Nachtmahr und die Angst, die mit ihm kam. Carolines fröhliche Stimmung verflog.
Es war Zeit für ihren allmorgendlichen Tee.
Caroline schlüpfte unter ihrer Decke hervor und rannte auf bloßen Füßen in die Stube. Ein Blick auf die Liege verriet ihr, dass Wilhelm noch fest schlief.
Sie schürte leise das Feuer und setzte einen Topf mit Wasser auf den Ofen. Rasch maß sie einige Prisen verschiedener Kräuter ab und warf sie in einen großen Becher aus grobem Ton. Die Muhme Blanewitz, der Kräuterkunde mächtig und ihre einzige Freundin, hatte ihr versprochen, dass dieser Tee gegen die Geister helfen würde, die sie quälten. Caroline wagte es nicht, auf den morgendlichen Trank zu verzichten, obwohl der Nachtmahr sie erst vorgestern wieder heimgesucht hatte.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














