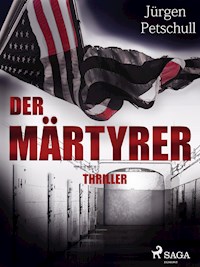
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Gefangene mit der Nummer "FLA DOC 086590" im Staatsgefängnis von Florida ist ein junger Araber und zugleich "der gefährlichste Terrorist, der je hinter amerikanischen Gittern gesessen hat". Als Chef eines Selbstmordkommandos hat er ein US-Verkehrsflugzeug nach Beirut entführt und die Regierungen der USA und Israels erpresst. Nun wartet auf ihn der elektrische Stuhl. Oder etwa doch nicht ...? Petschulls Debüt als Thrillerautor zeigt ihn noch heute als Meister des anspruchsvollen Spannungsromans, der den Vergleich mit den ganz Großen des Genres nicht zu scheuen braucht. Sein zuerst 1986 erschienener, akribisch recherchierter und überaus spannend erzählter Tatsachenroman über den internationalen und islamistischen Terrorismus ist gerade heute wieder auf beklemmende Weise aktuell geworden ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Märtyrer
Jürgen Petschull
Thriller
Saga
Für Evazum 2. Geburtstag
Für Toufiks Tochter in Beirutund für die Kinder vonAaron in Tel Aviv
Dieser Roman entspricht der Realität. Wesentliche Teile der Handlung haben sich in jüngster Zeit zugetragen. Einige Beteiligte leben noch, andere nicht mehr, einige sind untergetaucht. Aus naheliegenden Gründen habe ich Namen geändert und Schauplätze verlegt. Manche Passagen und Personen sind erfunden – der Wirklichkeit nachempfunden. Da sich weder im Nahen Osten noch im Westen in absehbarer Zeit die politischen Verhältnisse und die Mentalität der Machthaber ändern werden, fürchte ich, daß das Thema aktuell bleiben wird.
J. P.
Kapitel 1
Florida, 21. März 1986
Das Lachen des Apfelbaumes weckte ihn auf.
Oder war es die Stimme seiner Frau?
Victor Meller hatte wirr geträumt, und es dauerte eine Weile, bis er unterscheiden konnte, wo der Traum geendet hatte und wo die Wirklichkeit begann. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn, obwohl es, wie meist im März, drückend warm war in Florida.
Er lag auf dem alten Sofa im Gartenhaus. Draußen war es dunkel geworden. Durch die Sprossenfenster an der schmalen Seite des rechteckigen Raumes sah er lange Lichtreflexe, die sich vom anderen Ufer zitternd über das Wasser des Indian Creek zogen. Kleine Wellen schwappten gegen die Bohlen des nahen Bootsanlegers. Oben am Bay Drive, am anderen Ende des zum Wasser abfallenden Grundstücks, hielt ein Auto. Die Eingangstür des großen Wohnhauses wurde geöffnet. Er hörte, wie seine Frau mit jemandem sprach. Dann war es wieder still.
Victor Meller richtete sich im Halbdunkel auf. Er versuchte den Traum zu vergessen, aber es gelang ihm nicht:
Er war in einer Hinrichtungszelle, allein mit einem Todeskandidaten. Der Mann hatte ihn angestarrt und gesagt:
»Du bist mein Diener! Durch dich werde ich ins Paradies kommen!« – Wütend hatte er die tödlichen Stromstöße ausgelöst. Eine Stichflamme schoß aus dem elektrischen Stuhl und brannte ein großes Loch in die Betondecke. Als die Flamme in sich zusammensank, war von dem Mann nichts mehr übrig geblieben ... Dann regnete es, und aus den verkohlten Resten des Hinrichtungsstuhls wuchs in Sekundenschnelle ein Apfelbaum. Der Apfelbaum lachte. Der Apfelbaum lachte so sehr, daß seine frischen Blütenblätter zitterten ...
Noch unsicher vom Liegen stand Victor Meller auf und ging vorsichtig in den Raum, der jetzt vom bläulichen Widerschein des beleuchteten Swimmingpools erhellt wurde. Die Zeiger seiner Armbanduhr standen auf halb acht. Er hatte länger als eine Stunde geschlafen, obwohl er nur kurz ausruhen wollte. Er tastete nach dem Schalter der Stehlampe und knipste das Licht an. Das Gartenhaus, in dem es außer dem Wohnraum nur noch eine kleine Küche und ein Duschbad gab, war altmodisch möbliert: ein schwerer Eichentisch, das Sofa, ein Ohrensessel, an der Wand Bücherborde, Ölporträts seines Großvaters und seines Vaters und ein holzgerahmter alter Spiegel.
Das Gesicht im Spiegel war das Gesicht eines Mannes, den man auf Mitte Sechzig schätzen würde, aber Victor Meller war gerade erst 53 Jahre alt geworden. Graue Haarsträhnen fielen in seine breite Stirn, die durch eine steile Falte in zwei Hälften geteilt wurde. Buschige Brauen überschatteten die Augen. Von der Nasenwurzel aus gruben sich Falten über die Wangen bis zu den Mundwinkeln.
Er hatte schon immer älter ausgesehen, als er war, aber seit einer Magenoperation vor einem Jahr fühlte er sich auch alt. Ja, ihm war schon der seltsam anmutende Gedanke gekommen, daß er seinem alten Gartenhaus immer ähnlicher wurde – so wie manche Menschen mit zunehmendem Alter ihren Hunden gleichen. Es erinnerte ihn mit dem windschiefen Schornstein, dem Schindeldach und der verwitterten Bretterverkleidung an das Haus seiner Kindheit in seinem Heimatort in New Hampshire. Victor Meller hatte Zimmermann gelernt wie sein Vater und sein Großvater auch. Er brachte es zum Bauingenieur und zum Mitinhaber einer gutgehenden Fertighaus-Firma in Miami. Die weiße Villa am Bay Drive, mit Säuleneingang, umlaufender Veranda, mit Wohnhalle und sieben Zimmern, war ein Produkt seines Unternehmens, das Spitzenmodell der Baureihe Tropical Residence.
Der Mann im Gartenhaus war ein wohlhabender Bürger, ein guter Amerikaner, ein Mann im sogenannten besten Alter. Die feinen Leute im Wohnviertel Surfside am nördlichen Rand von Miami Beach schätzten ihn als gleichgesinnten, konservativen Republikaner. Er zahlte seine Steuern pünktlich. Er achtete die Vorschriften, sogar die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Highways. Er fürchtete den wachsenden Einfluß des Kommunismus in der Welt und die zunehmende Kriminalität vor seiner Haustür, denn hinter den weißen Fassaden von Surfside wohnten nicht nur Wohlstand und Ordnungssinn, sondern auch Angst. Seit sich Einbrüche und Überfälle häuften – kaum eine halbe Meile entfernt war kürzlich ein älteres Ehepaar ermordet worden –, hatten die Einwohner eine bewaffnete Bürgerwehr gebildet, um sich und ihren Besitz gegen Schwarze und Puerto-Ricaner zu verteidigen, die immer mehr in ihr Wohngebiet drängten.
Die Kämpfer gegen die Kriminalität nannten sich Night Watchers. Sie gingen nachts zu zweit und zu dritt bewaffnet Patrouille. Sie hatten auch Victor Meller aufgefordert, bei ihnen mitzumachen, und sie erinnerten ihn daran, daß sein Sohn aus erster Ehe bei einem Raubüberfall ums Leben gekommen war. Der 17jährige war zufällig im Schalterraum einer Bank gewesen, als drei maskierte Männer hereinstürmten und um sich schossen. Die Täter entkamen unerkannt mit ein paar tausend Dollar Beute. Dieses Ereignis hatte Victor Mellers Leben verändert. Seither zog er sich zurück, ging regelmäßig zum Gottesdienst der »Southern Baptist Church« und schloß sich schließlich der Bürgerwehr an. Mit großzügigen Spenden unterstützte er auch einen Verein, der sich um die Opfer von Gewaltverbrechen kümmerte.
Er hörte das klackende Geräusch von hochhackigen Schuhen auf den Steinplatten des Gehweges zwischen Wohnhaus und Gartenhaus.
»Vic ...!«
»Victor ...?«
Er trat aus der Tür.
»Da bist du ja endlich«, sagte Helena Meller. »Am Telefon ist wieder diese Frau. Sie sagt, es sei dringend – aber sie will mir nicht sagen, um was es geht.«
Victor Meller registrierte den argwöhnischen Unterton. Obwohl es schon lange keine Eifersucht mehr zwischen ihnen gab, war ihre Neugier geweckt.
»Gut, ich komme sofort.«
Er folgte ihr wortlos auf dem schmalen Weg, der halb um den Swimmingpool herumführte. Sie hatte noch immer eine gute Figur, schulterlange, graublonde Haare, einen schmalen Oberkörper, schlanke Beine und etwas überproportionierte, wohlgeformte Hüften, deren Kurven sie durch hautenge Röcke betonte.
Helena Meller war schlecht gelaunt. Er merkte das ihrem nachlässigen Gang an. Wenn sie guter Stimmung war, konnte sie noch immer durch herausfordernd-gelangweilte Hüftschwünge einen Sexappeal signalisieren, der ihn früher angelockt hatte – wie viele Männer vor und nach ihm auch.
Sie war eine reife Frau von 38 Jahren, eine ehrgeizige Innenarchitektin mit eigenem Büro in der Nähe des Omni International Centre in der City von Miami. Ihren kleinen, aber exklusiven Kundenstamm – so tuschelten die ehrenwerten Ehefrauen aus der Nachbarschaft – erweitere sie hin und wieder durch sehr intime Kontakte zu angesehenen Männern der Geschäftswelt. Victor Meller kannte dieses Gerede. Es störte ihn nicht mehr.
Sie gingen hintereinander durch die Terrassentür in die Wohnhalle des Haupthauses. Helles Licht fiel aus mehreren Kristallleuchtern auf den Marmorboden, wurde von weißlackierten Wänden und von Facettenspiegeln zurückgeworfen. Der hohe, klimatisierte Raum, so empfand es Victor Meller immer wieder, strahlte die Behaglichkeit einer Kühltruhe aus. Die Innenarchitektin Helena Meller dagegen rühmte Design und Funktionalität des Hauses ihren Kunden gegenüber als aktuellen, internationalen Stil.
Das Telefon stand auf einem der Glas- und Chromtischchen. Victor Meller setzte sich auf eine weiße Ledercouch, nahm den Hörer und meldete sich.
»Hallo, hier ist Margie Dyke.«
Er erkannte die Stimme sofort.
»Ich bin froh, daß ich Sie endlich erreiche, Mr. Meller. Superintendent Trugger muß Sie dringend sprechen. Ich verbinde.«
Victor Meller blickte zu seiner Frau hinüber, die sich demonstrativ in Hörweite gesetzt hatte und den Rauch ihrer Zigarette ausatmete. Er drehte das Telefon so, daß seine Frau nicht mithören konnte, als jetzt eine Männerstimme ertönte.
»Hier Superintendent Trugger. Mr. Meller, ich weiß, daß das wahrscheinlich sehr plötzlich für Sie kommt – aber wir haben einen dringenden Fall für Sie!«
»Wann?«
»Morgen mittag!«
Victor Meller versuchte einen Einwand. »Wieso schon morgen? Sie sagen doch sonst immer ein paar Tage vorher Bescheid.«
»Ja, morgen schon. Ich weiß, es ist diesmal sehr kurzfristig, aber dies ist auch ein besonderer Fall. Es soll morgen 12 Uhr mittags sein.«
Victor Meller spürte, wie seine Hände feucht wurden. Er preßte den Hörer fester ans Ohr.
»Mister Meller, ich erkläre Ihnen morgen früh die Einzelheiten. Wir haben einen Platz in der Frühmaschine für Sie gebucht. Das Ticket liegt am Flughafen bereit. Wie immer. Sie werden später mit dem üblichen Wagen abgeholt.«
»Ich komme«, sagte Victor Meller schließlich und fügte eine Phrase hinzu, die ihm sofort selber pathetisch vorkam, »... wenn die Pflicht ruft.«
»Sie ruft«, antwortete der Mann am anderen Ende, grüßte kurz und legte auf.
Victor Meller hielt noch den Hörer in der Hand, als seine Frau mit unüberhörbarer Ironie fragte:
»So, die Pflicht? Immer wenn diese Frau sich meldet, ruft die Pflicht ...«
»So ist es«, antwortete Victor Meller.
Er stand auf, sagte noch wenig überzeugend »Ich muß morgen dienstlich nach Jacksonville« und ging schnell durch die Terrassentür zum Wasser hinunter.
Es sah aus, als ob er vor ihr wegliefe – wie ein Ehemann, der bei der Vorbereitung zu einem Ehebruch erwischt wurde, dachte Helena Meller und drückte ihre Zigarette in einem Kristallaschenbecher aus.
Sie hatte vergessen, wann genau es begonnen hatte: unregelmäßig alle paar Wochen – manchmal dauerte es auch wieder Monate – mußte ihr Mann angeblich für seine Firma nach Jacksonville. Jedesmal hatte zuvor diese Frau angerufen. Ob sie jünger war als sie selbst? Oder mehr ein mütterlicher Typ? Sie kannte seinen Geschmack nicht mehr. Jedenfalls hatte sie nach seinen angeblichen Dienstreisen Übernachtungsquittungen aus einem Motel in einem Ort namens Starke entdeckt. Der aber lag rund 60 Meilen westlich von Jacksonville entfernt. Die Belege waren auf den Namen »Hagman« oder so ähnlich ausgestellt – wahrscheinlich der Name dieser Frau. Manchmal hatte ihr Mann unerwartet Blumen oder kleine Geschenke von diesen Reisen mitgebracht. Es schien so, als wollte er sie geradezu auf seine außerehelichen Abenteuer hinweisen. Aber sie vermied es, ihn zu fragen. Sie hatte selber ein schlechtes Gewissen.
Helena Meller blickte ihrem Mann ohne Zorn nach, bis er wieder in seinem Gartenhaus verschwunden war. Dann rief sie ihren derzeitigen Liebhaber an und fragte, ob er Zeit für sie habe.
Auch Victor Meller empfand seinen schnellen Rückzug als Flucht. Er wollte allein sein. Erst im Gartenhaus wurde er ruhiger. Hier fühlte er sich geborgen. Obwohl er Nichtraucher war, zündete er sich eine Zigarette an, wie immer, wenn er unruhig war. Dann setzte er sich an den gedrechselten Schreibtisch, dicht ans Fenster zum Garten, blätterte noch in Bauplänen und Akten und tat so, als arbeitete er.
Er nahm an, daß seine Frau ihn beobachtete.
Gegen Mitternacht, als im Haupthaus das Licht gelöscht worden war, packte er seine kleine Reisetasche. Er mußte früh am Flughafen sein. Dann zog er aus einem der Bücherborde, die mit Werken über Parapsychologie, Traumdeutung und religiöse Themen überfüllt waren, die alte Familienbibel hervor. Er las lange Zeit darin, besonders die Stellen, die schon durch Lesezeichen gekennzeichnet waren. Drittes Buch Mose, Kapitel 24, Vers 16 bis 20: »... wer den Namen des Herrn lästert soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde steinige ihn, sei es ein Fremder oder ein Einheimischer ... Bringt jemand seinem Nächsten eine körperliche Verletzung bei, soll ihm getan werden, wie er getan hat ... Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn ...« Manchmal bewegte er beim Lesen seine Lippen.
In dieser Nacht zum 22. März 1986 schlief Victor Meller wenig. Er warf sich auf der Couch hin und her und versuchte wach zu bleiben. Er fürchtete, der Traum vom Nachmittag würde wiederkommen. Ja, er hatte jetzt sogar Angst, der Traum könne eine Art Vorahnung gewesen sein.
In dieser Nacht fand auch Hussein Ali Bakir keine Ruhe. Er saß auf der Pritsche in der lindgrün gestrichenen Zelle und las – »Von hinten nach vorne«, wie der diensttuende Beamte Dennis Scott später berichtete – in einem billig gebundenen Buch, dessen blauer Umschlag schon abgegriffen war, und sprach einige Texte mit monotoner Stimme halblaut vor sich hin. Sergeant Scott verstand kein Wort. Der junge Mann sprach Arabisch.
Nachdem alles vorüber war, übersetzte ein Dolmetscher die Seiten aus dem Koran, die der Gefangene aufgeschlagen liegengelassen hatte. Es waren die Seiten mit der 25. und 26. Sure. Sie handeln vom Jüngsten Gericht, vom »Tag der Katastrophe«, von dem Tag, an dem das Leben auf der Erde endet und das wahre Leben im Jenseits beginnt, von dem Tag, an dem die wahren Gläubigen, die Kämpfer für Allah, den einzigen und barmherzigen und gnädigen Gott, ihren Lohn erhalten und die Sünder ihre gerechte Strafe. Auf die Märtyrer aber, so heißt es, warte das Paradies: Ein unermeßlich großer grüner Garten, in dem Quellen sprudeln und in dem Milch und Honig fließen; in dem es nach Moschus duftet; in dem großäugige Jungfrauen die Männer empfangen, die ihr irdisches Leben im Kampf für Allah hingegeben haben. Sie warten unter blühenden Apfelbäumen.
Der Mann in der Zelle machte einen ruhigen, manchmal sogar fröhlichen Eindruck. Nach Aussagen von Sergeant Dennis Scott schien es so, als freue sich Hussein Ali Bakir regelrecht auf den kommenden Tag.
Gegen fünf Uhr tauchte die Sonne groß und rot aus dem Atlantik auf und warf erste Lichtstrahlen gegen die Fassaden der Hotels von Miami Beach.
Victor Meller war froh, daß die nahezu schlaflose Nacht vorüber war. Er duschte kalt, schäumte sein Gesicht ein und rasierte sich mit unsicherer Hand, bevor er seinen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte anzog. Er sah aus wie ein Mann, der zu einer Beerdigung muß. Er trank koffeinfreien Kaffee und schluckte zwei Anecin-Tabletten gegen seine anhaltenden Kopfschmerzen. Um sieben schloß er die Tür des Gartenhauses hinter sich ab.
Im Wohnhaus rührte sich noch nichts. Vor dem Schlafzimmerfenster seiner Frau waren die Jalousien heruntergelassen.
Der Bauunternehmer stieg in den alten Buick Riviera, der sich in der Doppelgarage neben dem silbernen Mercedes-Coupé von Helena Meller wie ein Arme-Leute-Fahrzeug ausnahm. Er fuhr den Bay Drive hinunter zum Surfside Boulevard. Kurz vor der Brücke, die links über den Indian Creek zum Golf- und Country-Club führt, sah er den roten Porsche, den der Liebhaber seiner Frau geparkt hatte. Er vermutete, daß der sportliche junge Mann noch bei ihr war.
Victor Meller steuerte seinen Wagen über die breite Collins Avenue, die an der endlosen Reihe von Luxushotels und Apartment-Häusern nach Süden führt. Vor dem »Fountainebleau« wässerten Gartenarbeiter Palmen und Oleanderbüsche. Aus dem Autoradio klang der Schlager »I just call to say I love you ...« Der Discjockey versprach den Frühaufstehern einen schönen Tag: Wolkenloser Himmel, 32 Grad, leichter Westwind vom Atlantik.
Als er über den Julia Tuttle Causeway fuhr, eine auf Stelzen gebaute Brückenstraße, die das vorgelagerte Miami Beach mit Miami verbindet, kreuzten bereits Motorjachten mit schäumenden Bugwellen über das blaue Wasser der Biscayne Bay. Erst auf der Schnellstraße zum International Airport wurde der Verkehr von Auffahrt zu Auffahrt dichter.
Meller erreichte den Flughafen, als der Radiosprecher die Sieben-Uhr-dreißig-Nachrichten verlas.
New York: An den Börsen der Wall Street hat der Dow Jones Index einen neuen Höchststand erreicht.
Beirut: Keine Fortschritte bei den Bemühungen um die Freilassung von sechs amerikanischen Geiseln, die in der libanesischen Hauptstadt von schiitischen Terroristen gekidnappt worden sind.
Washington: Präsident Ronald Reagan fordert die westeuropäischen Verbündeten zu stärkeren Anstrengungen beim Kampf gegen den internationalen Terrorismus auf.
Victor Meller stellte seinen Wagen auf einem der Parkdecks am Flughafengebäude ab und reihte sich in den Strom der Passagiere ein. Am Schalter der »Piedmont Aviation«, einer Fluggesellschaft, die hauptsächlich im Südosten der USA fliegt, händigte ihm die Bodenstewardeß das für ihn bereitliegende Ticket aus: Miami-Gainesville und zurück.
»Die Maschine wird pünktlich sein«, sagte sie.
Die Boeing 737 mit der Flugnummer PI 808 hob um acht Uhr in Miami ab. Die Kabine war nur zur Hälfte besetzt. Müde, mürrische Geschäftsreisende blätterten lustlos in Zeitungen und Akten. Um 8.59 Uhr landeten sie in Gainesville, einer Provinzstadt im Norden Floridas.
Bei der »Avis«-Autovermietung holte Victor Meller die schon bereitliegenden Schlüssel und Wagenpapiere für einen Mietwagen ab. Er steuerte auf den vierspurigen Highway 301, der nach Nordwesten führt. Nach knapp 40 Meilen erreichte er das Ortsschild von Starke.
Victor Meller parkte am alten backsteinroten Gerichtsgebäude, das unter Denkmalschutz stand. Die Luft war dunstig und schwül. Er überquerte die Temple Avenue, an der sich ein halbes Dutzend kleiner Gotteshäuser zwischen Tankstellen und Motels drängte.
In der Walnut Street betrat er das Gebäude der »Community State Bank of Starke«. Zwei Hausfrauen mit Einkaufstüten drehten sich nach ihm um: der Mann mit dem dunklen Anzug sah so aus, als wolle er eine Menge Geld einzahlen oder abheben. Victor Meller meldete sich beim Bank-Manager und verlangte den Inhalt seines Schließfaches. Er zog eine flache, mit einem Zahlenschloß gesicherte Aktenmappe heraus, bedankte sich bei dem Bankangestellten und ging auf die Straße zurück. Der Mann wünschte ihm noch »gute Geschäfte«.
Am alten Gerichtsgebäude wartete jetzt ein schwarzer Kleinbus vom Typ Dodge Van mit dunklen, von außen nicht einsehbaren Scheiben. Der Fahrer öffnete die Tür. Victor Meller stieg ein. Seine Uhr zeigte Viertel nach neun.
Der Wagen fuhr in Richtung Jacksonville, hielt an der zweiten Ampel und bog links in die Raiford Road ab. Saubere kleine Häuschen, wie sie von den meisten der fünftausend Bürger bewohnt wurden, säumten zunächst die Straße, dann folgten Pinienwälder, Erdbeerplantagen, Obstgärten und Viehweiden und schließlich eine sumpfige Wiesenlandschaft, über die noch am späten Morgen warme Nebelschwaden waberten. Der Fahrer mußte die Scheibenwischer und das Licht einschalten. Zehn Meilen hinter Starke passierte das Fahrzeug einen steinernen Bogen, der die öffentliche Straße halbrund überspannte. Darauf stand: »Florida State Prison«.
Auf dem Rücksitz des Kleinbusses öffnete Victor Meller jetzt die Aktenmappe, holte ein sorgfältig zusammengelegtes Bündel Stoff hervor und zog mit einigen linkischen Verrenkungen eine vom Hals bis zu den Füßen reichende schwarze Robe an. Dann stülpte er sich eine oben spitz zulaufende Kapuze über den Kopf, bis nur noch seine Augen und sein Mund zu sehen waren.
Der Fahrer beobachtete ihn dabei im Rückspiegel, drehte sich um und sagte: »Ich soll Sie heute zuerst ins Büro des Chefs bringen, Mister.«
Der Wagen mit dem vermummten Fahrgast fuhr nun am Alligator Creek entlang, einem Bach, in dem hin und wieder noch Reptilien geschossen wurden. Aus dem dünner werdenden Nebel tauchte ein haushoher, stählerner Wasserturm auf und ein Kraftwerk mit Transformatoren und Hochspannungsmasten, dann Wachttürme, aus deren Schießscharten Gewehrläufe ragten, dann sechs hintereinanderliegende, dreistöckige Zellengebäude. Zwischen zwei Sicherheitszäunen glitzerten mannshohe Drahtrollen mit rasierklingenscharfen Zacken im fahlen Morgenlicht. Hinter dem ersten Zaun hechelten Schäferhunde hin und her und bellten wütend den Wagen an, der langsam auf der kleinen Asphaltstraße am äußeren Zaun entlang zum Haupttor rollte. Schließlich stoppte er vor dem Verwaltungsgebäude des Staatsgefängnisses. Der Fahrer schob die Seitentür zurück. Victor Meller, der Henker des US-Bundesstaates Florida, stieg aus.
Als er mit wehender Robe durch die Eingangshalle zum Büro des Gefängnisdirektors eilte, sah er durch die Augenschlitze in seiner Kapuze zwei von Aufsehern bewachte Gefangene in grauer Anstaltskleidung, die den Fußboden bohnerten. Sie blickten ihm mit entsetzten Gesichtern nach, als ginge der Teufel leibhaftig vorbei.
Die Uhr an der Stirnseite des holzgetäfelten Raumes zeigte halb zehn.
Der Mann in der Todeszelle kniete auf einem Handtuch, das er auf den nackten Betonboden gelegt hatte. Hussein Ali Bakir verrichtete sorgfältig das Ritual des moslemischen Gebetes. Er verneigte sich mehrfach nach Osten, in die Richtung, in der jenseits des Atlantiks in 12 000 Meilen Entfernung Mekka liegt.
Er wies das üppige Frühstück zurück, das ihm angeboten wurde. Statt dessen bat er nur um ein großes Glas Milch mit Honig, ein altes Mittel gegen seine leicht entzündeten Stimmbänder, wie er den Aufsehern freundlich erklärte. Man servierte ihm das Getränk aus Sicherheitsgründen in einem Pappbecher.
Gegen halb zehn wurde die Gittertür aufgeschlossen. Vier Männer drängten herein und stürzten sich auf den jungen Moslem. Zwei hielten ihn fest, die anderen zogen ihn aus. Dann drückten sie ihn in einen mitgebrachten Armlehnstuhl und banden seine Hände und seine Fußgelenke daran fest. Hussein Ali Bakir leistete keinen Widerstand. Er sagte etwas auf arabisch. Es klang, als wolle er sich selber beruhigen.
Einer der uniformierten Wärter erklärte ihm in einem Ton, der um Verständnis bat, man müsse ihn nun von Kopf bis Fuß rasieren – eine leider unumgängliche Maßnahme, damit später auf dem elektrischen Stuhl seine Haare nicht verbrannt werden würden. Der Gefängnisfriseur und sein Assistent seiften den Todeskandidaten ein, dann schabten sie mit scharfen Rasiermessern sorgfältig seine Haare ab: auf dem Kopf, an der Brust, unter den Achselhöhlen, am Geschlechtsteil und an den Beinen, zuletzt den Schnauzbart.
Die Prozedur dauerte eine dreiviertel Stunde. Während der ganzen Zeit hielt Hussein Ali Bakir seine Augen geschlossen. Auch als das Messer versehentlich einige Male seine Haut ritzte, kam kein Laut über seine Lippen.
»Zieh das an«, sagte einer der Wärter, nachdem sie den geschorenen Mann losgebunden hatten. Er warf ihm ein paar Kleidungsstücke zu, eine weite schwarze Hose, ein weißes Kittelhemd, ein Paar Sandalen.
»Ich habe gehört, daß du etwas Besonderes sein sollst, aber du mußt trotzdem in den gleichen Klamotten sterben wie alle anderen auch.«
Der Henker betrat das Vorzimmer des Gefängnisdirektors, in dem sich viele Besucher drängten. Victor Meller erkannte durch die Sehschlitze seiner Kapuze den Chef der Sicherheitsabteilung, der in eines der Telefone sprach; der Anstaltsgeistliche unterhielt sich mit dem Sheriff von Bradford County, zu dessen Bezirk das Gefängnis gehört; zwei Herren mit Werkzeugtaschen auf den Knien warteten auf einem Kunstledersofa; mehrere mit schweren Dienst-Colts bewaffnete Beamte gingen heftig gestikulierend auf und ab. Aus den Funkgeräten in ihren Gürteln piepsten, krächzten, blubberten unverständliche Töne. Die Sekretärin rief so laut in die Gegensprechanlage, die sie mit dem Chefzimmer verband, daß es alle hören konnten:
»Superintendent, ich habe jetzt Gouverneur Graham auf Leitung zwei!«
Die Gespräche verstummten, als der Henker eintraf. Alle starrten den vermummten Mann schweigend an. Die quirlige Vorzimmerdame faßte sich als erste.
»Sir«, sagte sie, »der Chef wartet bereits auf Sie.«
Sie öffnete die schallschluckende, gepolsterte Tür. Victor Meller hörte noch, wie Superintendent Trugger das Gespräch mit Robert Graham, dem Gouverneur von Florida, beendete:
»... offen gestanden, Gouverneur, mir ist das ganze Verfahren immer noch schleierhaft, aber wenn Sie und der Präsident persönlich die Verantwortung übernehmen, soll es mir recht sein. Wir tun wie immer unser Bestes, egal wie schwer es uns die Politiker machen ...«
Trugger legte den Hörer auf. Er winkte den Henker heran und drückte eine Taste der Gegensprechanlage.
»Margie, ich will jetzt nicht gestört werden! Nur wenn die Leute aus Washington kommen!«
Der Leiter des Staatsgefängnisses von Florida schob, ohne aufzustehen, seine rechte Hand über den breiten Schreibtisch, an einem großen, gerahmten Farbfoto vorbei, das seine blonde Frau und seine beiden pausbäckigen Söhne zeigte. Trugger sagte: »Sie werden es nicht glauben, Mister Meller, aber nach allem, was in letzter Zeit passiert ist, kommt mir Ihr Anblick wie eine Erlösung vor.«
Victor Meller schüttelte die Hand, die sich ihm entgegenstreckte, und zog umständlich die schwarze Kapuze vom Kopf, bevor er auf dem Besucherstuhl vor dem Schreibtisch Platz nahm. Er war erst zweimal im Büro des Gefängnischefs gewesen. Gewöhnlich wurde er direkt in die Hinrichtungszelle am anderen Ende des Gebäudekomplexes gebracht und nach getaner Arbeit, noch immer mit Kapuze und Robe getarnt, wieder vom Gelände des Staatsgefängnisses geschleust. Niemand sollte wissen, wie er aussah und wer er in Wirklichkeit war. Victor Meller führte seit Jahren schon ein Doppelleben, von dem nicht einmal seine Frau etwas ahnte. Manchmal wunderte er sich noch, wie sehr das Töten für ihn zur Routine geworden war.
»Wenn ich richtig gezählt habe, Mister Meller, dann wird dies unsere siebenundzwanzigste gemeinsame Hinrichtung werden«, begann Superintendent Trugger, »Sie wissen, daß ich Ihre Zuverlässigkeit sehr schätze, aber in diesem Fall wird für Sie, für mich und für alle Beteiligten einiges anders sein als sonst ...«
Charles Trugger zündete sich ein Zigarillo an. Er war ein erstaunlich junger Mann für einen Job wie diesen. Mit 41 Jahren war er der jüngste Gefängnisdirektor von Florida und noch dazu der Leiter des Staatsgefängnisses, in dem die Todesurteile vollstreckt werden. Zuvor hatte er bereits zwanzig Jahre lang im Strafvollzug gearbeitet. Er galt als harter, zuverlässiger Mann, der notfalls mit brutaler Gewalt den Widerstand aufsässiger Gefangener brach; aber auch als effizienter Manager, der die Kosten seines Betriebs unter Kontrolle hielt. 900 Beamte waren ihm unterstellt, und er war verantwortlich für 1300 Gefangene, davon mehr als 500 »Lebenslängliche«. 256 Todeskandidaten, schwarze und weiße Männer, warteten in den Zellen des Todestraktes auf ihre Begegnung mit dem Henker.
»Lassen Sie es mich kurz machen, Mister Meller«, sagte Superintendent Trugger, »denn wir haben nicht viel Zeit. Die Hinrichtung soll, wie ich Ihnen gestern schon sagte, heute um zwölf Uhr mittags sein.«
Trugger blickte auf seine Armbanduhr.
»In zwei Stunden also.«
Um zehn Uhr vormittags klopfte der Gefängnisgeistliche, Reverend Walter P. McCoy mit dem Ehering an seiner linken Hand an das Eisengitter der Tür zur Todeszelle. In den letzten Tagen und Wochen hatte er vergeblich versucht, mit dem jungen Moslem Hussein Ali Bakir ins Gespräch zu kommen.
Reverend McCoy, ein rundlicher, schüchtern wirkender Mann, war noch immer von missionarischem Eifer erfüllt. Er hatte sich um das Amt des Gefängnisseelsorgers beworben, weil er es langweilig fand, jeden Sonntag immer denselben alten Damen immer dieselben salbungsvollen Predigten zu halten. Er war stolz darauf, daß es ihm gelungen war, viele Todeskandidaten noch kurz vor ihrer Hinrichtung bekehrt zu haben.
Der Gefangene hockte mit verschränkten Beinen auf dem Boden. Er blickte auf ein Foto, das in seinem Schoß lag. Aus zwei Metern Entfernung konnte Reverend McCoy eine junge, hübsche Frau erkennen, eine hellhäutige Orientalin offenbar, die ein lachendes kleines Mädchen in die Luft geworfen hatte und es gerade mit ausgestreckten Armen wieder auffangen wollte.
»Sind das Ihre Frau und Ihr Kind?« fragte McCoy.
Der kahlgeschorene Mann, der nun die schwarz-weiße Kleidung der Todeskandidaten trug, antwortete nicht. Doch dann erhob er sich und kam zur Gittertür der Zelle. In gutem Englisch, mit melodisch klingendem arabischen Akzent sagte er überraschend höflich: »Ich hoffe, Sie wollen nicht noch in letzter Minute einen Christen aus mir machen, Reverend?«
Der Seelsorger schwieg, bevor er erwiderte: »Vielleicht bin ich einfach nur ein neugieriger Mensch. Sie sind nämlich der erste Mohammedaner, den ich in dieser Situation erlebe.«
Der Mann hinter den Gittern hielt das Foto hoch und sagte:
»Das waren meine Frau und mein Kind, Reverend – christliche Amerikaner haben die beiden umgebracht ...«
Der Seelsorger erschrak. Er wartete darauf, daß der Gefangene fortfuhr, aber der wechselte abrupt das Thema: »Da Sie schon mal hier sind, Reverend: Was ist Ihre persönliche Meinung – gibt es ein Leben nach dem Tod?«
Reverend McCoy hatte diese Frage schon oft von Männern in der Todeszelle gestellt bekommen, doch er antwortete so langsam, als überlege er noch, als suche er noch nach den richtigen Worten: »Es gibt nach meiner christlichen Überzeugung ein Leben nach dem Tod – vorausgesetzt, man hat in diesem Leben trotz allen persönlichen Leids seinen Frieden mit Gott geschlossen!«
Hussein Ali Bakir lächelte flüchtig.
Bevor er sich abwandte und in die Zelle zurückging, sagte er:
»Ich habe mehr für meinen Gott getan. Ich habe Krieg für ihn geführt ...«
Im Büro des Gefängnisdirektors schlürfte Victor Meller einen dünnen Kaffee, den man ihm aus der Anstaltsküche gebracht hatte. Er hatte seine schwarze Kapuze auf die Schreibtischplatte gelegt.
»Superintendent, warum ist die Exekution diesmal so überstürzt angesetzt worden?«
Trugger antwortete, er habe erst vor wenigen Tagen Anweisung bekommen, die Hinrichtung so schnell wie möglich zu organisieren. Sie sei ursprünglich erst für den nächsten Monat geplant gewesen. »Die Hintergründe werden wir gleich erfahren, Mister Meller. Ich erwarte nämlich hohen Besuch aus Washington.«
»Um was für einen Mann geht es eigentlich«, fragte Victor Meller.
Trugger blätterte in einer bereitliegenden Aktenmappe und reichte ein paar Fotos über den Tisch. Sie blieben unter dem kleinen Sternenbanner liegen, das auf seiner Schreibtischplatte stand. Die üblichen Farbbilder des Erkennungsdienstes zeigten frontal und im Profil einen gutaussehenden jungen Mann mit beinahe langweiligem, ebenmäßigem Gesicht: große Augen, eine gerade Nase, braunes, gewelltes Haar. Alter: etwa Mitte Zwanzig. Eine kleine rote Narbe zwischen den beiden Augenbrauen war das einzige besondere Kennzeichen. Und ein auffallend weicher Mund unter einem gepflegten Schnauzbart. Vor der Brust mußte er auf den Bildern das Schild mit seiner Gefangenen-Nummer halten: FLA DOC A 086590.
Der Henker sagte: »Ein netter junger Mann.«
»Sehr nett«, antwortete Superintendent Trugger, »er heißt Hussein Ali Bakir. Ein Mörder, Flugzeugentführer, Geiselnehmer und Erpresser. Wahrscheinlich der gefährlichste Terrorist, der je hinter amerikanischen Gittern gesessen hat.«
»Ein Araber?«
»Ein Libanese. Ein Schiit, einer von diesen religiösen Fanatikern, die glauben, dieser verrückte Chomeini sei der neue Herrgott auf Erden. Er war der Chef eines Selbstmordkommandos. Er wollte unbedingt für Allah sterben.«
Victor Meller betrachtete die Porträtbilder noch einmal.
»Und nun erfüllen wir ihm also diesen Wunsch?«
»Es sieht so aus ... Wir werden genau das tun, was er sich am sehnlichsten wünscht: Wir werden ihn zum Märtyrer machen!«
»Das ist aber doch absurd!?«
»Nein, das ist das Gesetz. Wir können doch einen zum Tode verurteilten Terroristen nicht nur deswegen begnadigen, weil er unbedingt hingerichtet werden will.«
Die Männer schwiegen.
Dann setzte Superintendent Trugger hinzu: »Bisher hatten alle Ihre Kunden gewöhnlich Angst vor Ihnen, Mister Meller – ich meine natürlich vor Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Henker –, aber dieser hier, der ist geradezu versessen darauf, Sie endlich kennenzulernen! Der hält Sie sozusagen für einen Abgesandten Allahs, für eine Art göttlichen Diener. Er glaubt, daß Sie ihm das Tor zum Paradies öffnen werden.«
Victor Meller spürte einen Druck in der Magengegend, wie immer seit der Operation, wenn ihn etwas aufregte.
War das nicht die gleiche Situation wie in seinem Traum, die der Gefängnisdirektor gerade beschrieben hatte? Hatte der Mann in seinem Traum nicht sogar die gleichen Worte benutzt?
»Du bist mein Diener. Durch dich werde ich ins Paradies kommen!«
Er überlegte, ob er dem Gefängnisdirektor davon erzählen sollte.
Seine Gedanken wurden von einem Geräusch unterbrochen, das schnell lauter wurde. In etwa 200 Metern Entfernung tauchte hinter der Fensterscheibe des Bürozimmers ein Hubschrauber auf und setzte zur Landung an. Er ging auf dem asphaltierten Platz zwischen dem Verwaltungsgebäude und der äußeren Einzäunung des Gefängniskomplexes nieder.
Während das Rotorblatt noch immer Staub aufwirbelte, sprangen zwei Männer von den Rücksitzen der Kanzel. Beide klemmten Aktentaschen unter den Arm und liefen gebückt aus dem Bereich der langsam ausschwingenden Propeller. »Das werden die Leute aus Washington sein«, sagte Trugger. Wenig später meldete die Sekretärin über die Gegensprechanlage: »Ihr Besuch ist da, Mister Trugger.«
Noch schwer atmend traten die beiden Männer ein. Sie grüßten kurz, stellten ihre Taschen auf den Besuchertisch und strichen sich mit beinahe synchronen Bewegungen durch die zerzausten Haare. Die Besucher setzten sich und kramten in ihren Taschen. Erst jetzt wandte sich der größere Blonde an Victor Meller und fragte den Chef des Staatsgefängnisses: »Wer ist dieser Gentleman, Mister Trugger? Muß er dabei sein?«
»Ich glaube schon«, sagte der Gefängnisdirektor und grinste über die verblüfften Gesichter der Neuankömmlinge, als er, ohne Victor Mellers Namen zu nennen, sagte: »Darf ich vorstellen, Gentlemen: der Henker von Florida!«
Der Größere der beiden rückte seine Brille zurecht, faßte sich aber schnell. »Gut, dann muß er wohl hierbleiben. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Superintendent. Sie sollten die Leute holen lassen, die unbedingt informiert werden müssen.«
Trugger drückte die Sprechtaste an seinem Schreibtisch: »Margie, rufen Sie Daniels, Swanson und Colani herein.«
Nacheinander drängten der Leiter der Sicherheitsabteilung, der Leiter der technischen Abteilung und der Oberaufseher des Todestrakts ins Zimmer. Trugger stellte ihnen mit einer Handbewegung die Männer aus dem Hubschrauber vor. »Doktor Stanford vom Stab des Sicherheitsberaters des Präsidenten der Vereinigten Staaten und Mister McGlawson vom FBI in Washington.«
Die Männer nahmen im Halbkreis um den Konferenztisch herum Platz, bevor Doktor Harvey Stanford, ein etwa 40jähriger, der mit seinen überbreiten Schultern und mit der randlosen Brille wie ein intellektueller Schwergewichtsboxer wirkte, mit seinem Bericht begann:
»Meine Herren, ich will mich kurz fassen und Sie über die letzte Entwicklung in Zusammenhang mit der bevorstehenden Exekution des Terroristen Hussein Ali Bakir informieren. Vorab verpflichte ich Sie hiermit alle zu absoluter Geheimhaltung. Sie werden gleich verstehen, warum.«
Er sortierte einige Dokumente, die er seiner Mappe entnommen hatte.
»Vorweg dies: Bei einem Gespräch zwischen dem Gouverneur Robert Graham von Florida und Präsident Ronald Reagan ist beschlossen worden, daß der Präsident selbst sich die letzte Entscheidung in diesem Fall vorbehält ... Das bedeutet auch, Superintendent, daß der Präsident persönlich Ihr Gesprächspartner am Telefon im Hinrichtungsraum sein wird. Soviel ich weiß, müssen Sie die vorgeschriebene Frage stellen, ob es in letzter Minute Gründe für einen Aufschub der Exekution geben wird?«
Superintendent Trugger ließ einen Kugelschreiber auf die polierte Tischplatte fallen.
»Ich verstehe Ihre Überraschung«, fuhr der Mann aus dem Stab des Sicherheitsberaters des Präsidenten fort, »auch meines Wissens hat es einen solchen Fall noch nicht gegeben. Aber der Gouverneur und der Präsident sind sich heute morgen darüber einig geworden, daß in dieser Sache nationale Interessen auf dem Spiel stehen, die über die Kompetenz des Gouverneurs eines Bundesstaates hinausgehen.«
Doktor Stanford machte eine bedeutungsschwere Pause und blickte von einem zum andern, bevor er weitersprach.
»Folgende Entwicklung hat zu dieser Entscheidung geführt: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen haben schiitische Terroristen offenbar erfahren, daß ihr Kampfgenosse, also dieser Hussein Ali Bakir, bereits zum Tode verurteilt worden ist. Glücklicherweise scheinen sie jedoch noch nicht zu wissen, wann und wo die Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings ist vorgestern nacht im Garten vor dem Büro der Presseagentur Associated Press in Beirut ein Briefumschlag deponiert worden. Der Inhalt ist auf dringenden Wunsch des Sicherheitsberaters persönlich nicht veröffentlicht worden. In dem Umschlag befanden sich eindeutige aktuelle Lebensbeweise der sechs amerikanischen Bürger, die zum Teil bereits vor mehr als eineinhalb Jahren von der Terrororganisation Dschihad Islam gekidnappt worden sind. Sie alle kennen die Fälle aus der Presse. In dem Briefumschlag lag außerdem eine nach Feststellungen unserer Dienste zweifellos echte Mitteilung der Organisation Dschihad Islam. Die Terroristen drohen, daß als sofortige Vergeltung für eine eventuelle Exekution dieses Hussein alle sechs amerikanischen Geiseln im Libanon hingerichtet würden. Diese Drohung ist sehr ernst zu nehmen. Ebenso wie die Ankündigung, daß zum erstenmal Selbstmordkommandos auch in den Vereinigten Staaten blutige Rache nehmen würden. Anschläge in Washington und New York sollen angeblich schon vorbereitet sein.«
Gebannt hörten die Männer am Tisch zu. Victor Meller preßte seine Finger zu einer Faust, so daß das Blut unter den Nägeln entwich. Die metallisch kühle Stimme fuhr fort:
»Sie werden nun verstehen, meine Herren, daß Präsident Ronald Reagan die letzte Entscheidung in diesem Fall selbst treffen will, nicht nur, weil die sechs im Libanon gefangenen Amerikaner aus sechs verschiedenen US-Bundesstaaten stammen!«
Doktor Stanford schloß geräuschvoll seine Aktenmappe.
Der dunkelhaarige Edward McGlawson vom FBI ergriff nun in derselben nüchternen Diktion das Wort.
»Das alles bedeutet natürlich, daß wir jetzt schnell und präzise handeln müssen. Es bleibt vorläufig dabei: technisch gesehen läuft alles wie bei einer gewöhnlichen Exekution ab. Bis auf einige Ausnahmen. Dazu gehören: verstärkte, aber verdeckte Sicherheitsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Gefängnisses. Überwachung bestimmter Räumlichkeiten mit Fernsehkameras und Abhöranlagen, besonders der Todeszelle und des Hinrichtungsraums. Schärfste, aber absolut diskrete Observation aller Personen, die Kontakt zu dem Gefangenen haben, und aller, die direkt oder indirekt mit der Organisation und der Ausführung der Hinrichtung zu tun haben. Das gilt auch für die Zeugen der Exekution. Ganz besonders natürlich für die sechs Ehrengäste, die sich dieser seltsame Todeskandidat selbst – wie ich übrigens erst jetzt erfahren habe – zu seiner Hinrichtung eingeladen hat. Leider können wir diesen Teil der Veranstaltung nicht mehr rückgängig machen, ohne großes Aufsehen zu erregen.«
Stanford unterbrach ihn: »Möglicherweise müßten wir diese Leute aus Sicherheitsgründen für einige Zeit von der Außenwelt abschirmen, offziell zu ihrem eigenen Schutz, und um Zeit zu gewinnen.«
»Sind diese Zeugen eigentlich schon hier?« fragte McGlawson.
»Sie können ...« Superintendent Trugger blickte auf seine Armbanduhr, die zwanzig Minuten vor elf zeigte, »... sie können jederzeit eintreffen.«
»Ich nehme an, Gentlemen, daß Sie auch Leibesvisitationen und Röntgen-Kontrollen der Leute und ihres Gepäcks vorgesehen haben! Und noch etwas: Mich beunruhigt besonders, daß sogar ein islamischer Geistlicher herkommen soll?«
»Wir können doch einem Delinquenten nicht seine letzte Bitte um geistlichen Beistand abschlagen!« sagte Superintendent Trugger.
»Nun gut, wenn Sie meinen – jetzt wäre es ja ohnehin zu spät.«
Gegen elf Uhr trafen nacheinander fünf Männer und eine Frau am Haupttor ein. Sie waren von bewaffneten US-Marshalls in Zivil – einer Spezialtruppe der amerikanischen Justiz, die gewöhnlich zum Schutz von gefährdeten Zeugen bei Kriminalfällen eingesetzt wird – auf den Flughäfen von Jacksonville und Gainesville abgeholt und zum Staatsgefängnis gebracht worden. Die Besucher wurden in den schmucklosen Konferenzraum im Erdgeschoß des Verwaltungsgebäudes geführt.
Alle sechs hatten einen Brief der Gefängnisleitung erhalten, in dem sie gebeten wurden, den beigefügten, handschriftlichen letzten Willen des Häftlings Hussein Ali Bakir zu erfüllen.
Der Häftling hatte ihnen in einem etwas gestelzt klingenden Brief gleichlautend unter anderem geschrieben: »... so haben sich durch Allahs Fügungen unsere Lebenswege gekreuzt. Viel Leid und Unheil ist geschehen, aber ich bedaure nichts, denn nicht unser, sondern Allahs Wille ist geschehen und wird immer geschehen ... Doch fühle ich mich Ihnen persönlich zu großer Dankbarkeit verpflichtet, weil Sie eine große Bedeutung für mein irdisches und für mein späteres Leben bekommen haben ...«
Der Brief schloß: »Ich bitte Sie deshalb im Namen Allahs, des Allmächtigen und Barmherzigen, zugegen zu sein bei meinem vorbestimmten Übertritt in eine andere, bessere Welt ...«
Daneben nahm sich der von einem Beamten der Gefängnisverwaltung angeheftete Vermerk ziemlich profan, aber deutlich aus. »In der Angelegenheit Exekution des Hussein Ali Bakir wird um Ihr Erscheinen am Freitag, dem 22. März 1986, um elf Uhr im Florida State Prison, Starke, Bradford County, nachgesucht.«
Die makabere Einladung zur Teilnahme an der Tötung eines Menschen wurde den drei in den Vereinigten Staaten lebenden Adressaten von US-Marshalls ausgehändigt. In Beirut, in Tel Aviv und in Hamburg überbrachten Sicherheitsbeamte der US-Botschaften und des Generalkonsulats je einen der versiegelten Briefumschläge.
Alle sechs Empfänger hatten gezögert. Jeder von ihnen hätte viele Gründe gehabt, die Einladung abzulehnen – doch schließlich nahmen alle an –, unabhängig voneinander, aus sehr ähnlichen Motiven: Neugier und Nervenkitzel, auch Anteilnahme am Schicksal des Absenders. Vor allem aber folgten sie geradezu einem inneren Zwang, auch den letzten Akt eines Dramas miterleben zu wollen, bei dem jeder von ihnen eine besondere Rolle gespielt hatte.
In dem stickig nach Bohnerwachs riechenden Konferenzraum des Florida-Staatsgefängnisses, von dem aus Wachttürme, Drahtzäune und Zellengebäude zu sehen waren, klärte Superintendent Trugger die ungewöhnliche Gästegruppe über das Ritual eines Exekutionsablaufs auf. Er tat das mit der emotionslosen Sachlichkeit eines Technikers, der über einen bewährten Produktionsprozeß berichtet. Keiner der Zuhörer aß von den Sandwiches, die aus der Gefängnisküche gebracht worden waren.
Ein blaßblauer Himmel wölbte sich über der von Bäumen und Sträuchern gerodeten, weiten Moorlandschaft, als die fünf Männer und die Frau dann in einen Gefangenentransportwagen kletterten, der sie zum äußersten Ende des 600 Meter langen Gefängniskomplexes bringen sollte. Während der kurzen Fahrt sahen sie zwischen den Stacheldrahtumzäunungen und den Zellengebäuden zwei Dutzend Männer regungslos in der Mittagssonne sitzen. An ihren orangefarbenen T-Shirts, die sich leuchtend gegen die grauen Mauern abhoben, waren die Männer für die Scharfschützen auf den Wachttürmen weithin als Insassen des P- und des R-Flügels zu erkennen. Todeskandidaten, die Hofgang hatten.
Ein elektrisch betriebenes Gittertor glitt vor dem Gefangenentransporter mit den Zeugen zur Seite. Ein paar Meter dahinter hielt der Wagen über einer Art Autowerkstatt-Rampe. Zwei uniformierte Aufseher untersuchten mit Neonleuchten den Unterboden. Auch der Kofferraum und der Motorraum wurden kontrolliert. Dann erst rollte der Wagen die letzten hundert Meter bis zum Q-Flügel. Er hielt direkt vor einer fensterlosen, drei Stockwerke hohen Fassade, in die im Erdgeschoß nur eine einzige Tür eingelassen war. Davor wartete Sergeant Dennis Scott auf die Gruppe.
Er führte sie durch die Tür über verwinkelte Gänge in einen Kontrollraum. Wie an Flughäfen mußten sie ein Röntgengerät passieren. Anschließend wurde jeder von ihnen abgetastet. Schlüssel, Kugelschreiber, Taschenmesser, Ausweispapiere wurden eingesammelt. Die Besitzer erhielten numerierte Pappkartonkarten. Weiter ging es durch kahle Zellengänge, in denen jeder Schritt nachhallte. Sergeant Scott blieb schließlich vor einer lindgrün gestrichenen Tür stehen: eine unscheinbare, gewöhnliche, dicke Stahlblechtür, wie sie auch zum Schutz gegen Feuer und Einbrecher in Wohnhäusern installiert wird. Auf die Außenseite war mit gelber Farbe die Ziffer 43 gepinselt. Zwei Wachtposten standen davor.
Einer von ihnen öffnete die Tür. Dahinter lag ein etwa zwölf mal sechs Meter großer, rechtwinkliger Raum. Die Wände waren blaßgrün gestrichen, ebenso wie die Rolläden, die vor den beiden einzigen Außenfenstern heruntergelassen waren. Der Raum wurde in der Mitte durch eine Zwischenwand mit großer Panorama-Glasscheibe in zwei etwa gleich große Hälften geteilt.
Im vorderen Teil standen ein Dutzend harter, hölzerner Stühle mit runden Lehnen, in die herzförmige Löcher geschnitten waren, Sitzgelegenheiten, die an Bauernhausküchen erinnerten, dahinter zwei Reihen billiger brauner Kunststoff-Klappstühle.
Der Raum war bereits gefüllt. Zwölf offizielle, von der Justiz eingeladene Zeugen – achtbare Bürger aus Florida, die später das Hinrichtungsprotokoll mit unterzeichnen sollten – und außerdem ein paar beruflich interessierte Zuschauer: Juristen, Kriminalisten, Ärzte und Kirchenvertreter, unter ihnen Befürworter und Gegner der Todesstrafe. Sie waren nach oft jahrelangen Voranmeldungen als Beobachter einer Exekution zugelassen worden. Sie sollten sich einen persönlichen Eindruck über den Vollzug der Todesstrafe machen.
Sergeant Dennis Scott wies den sechs Neuankömmlingen die sechs letzten freien Plätze zu. Sie mußten sich zwischen die besetzten Stuhlreihen drängen und voneinander getrennt sitzen. Offenbar sollten sie keinen Kontakt untereinander haben können.
Vom Zuschauerraum aus richteten sich alle Augen auf die eigentliche Todeskammer hinter der Trennscheibe.
Auf den ersten Blick wirkte der Arbeitsplatz des Henkers wie eine veraltete Zahnarztpraxis. Der Behandlungsstuhl im Zentrum der zweiten Raumhälfte war fest in den Boden montiert; ein klobiger dunkelbrauner Eichenstuhl, hochlehnig mit vier querlaufenden Rippenstreben und mit stabilen Beinen, die auf einer dicken dunkelroten Gummimatte standen. An der Kopfstütze, an den Stuhlbeinen und an den Armlehnen waren breite Lederschlaufen angebracht. Zwei fingerdicke Starkstromkabel endeten am Kopf und am Boden. Sie führten zu einem schrankgroßen Sicherungskasten.
An der Rückwand der Todeskammer waren ein graues und ein rotes Wandtelefon installiert. Unter der Decke hing ein Mikrofon, mit dem Worte und Geräusche zum Lautsprecher im Zuschauerraum übertragen wurden. In einer Nische auf der linken Seite befand sich der eigentliche Arbeitsplatz des Henkers: eine quadratmetergroße Kabine mit halbhoher Brüstung. Unterhalb dieser Brüstung – vom elektrischen Stuhl und vom Zuschauerraum aus nicht zu sehen – waren Elektrokästen mit Volt- und Ampereskalen angebracht und ein armlanger, armdicker roter Hebel. Diesen Hebel muß der Henker innerhalb von zwei Minuten achtmal von links nach rechts bewegen. Achtmal werden jeweils bis zu 2240 Volt starke Stromstöße durch die Kabel in den Körper des Mannes auf dem Eichenstuhl gejagt.
Über dem Arbeitsplatz des Henkers tickte eine für alle sichtbare, tellergroße elektrische Uhr.
Die schwarzen Zeiger standen auf 18 Minuten vor zwölf, als Victor Meller, wieder mit Robe und Kapuze vermummt, die Hinrichtungsstätte betrat. Ihm folgten zwei blau gekleidete Elektriker, die sich am Sicherungskasten postierten, ein Gefängnisarzt im weißen Kittel, der sich breitbeinig mit herabhängenden Händen neben den elektrischen Stuhl stellte, und Superintendent Trugger im Straßenanzug. Er nahm einen Platz zwischen den beiden Wandtelefonen ein. Nach einer Pause öffnete sich die Tür erneut.
Der Todeskandidat wurde hereingeführt. Zwei Gefängniswärter, deren kurzärmelige weiße Uniformhemden von breiten Brustkörben und muskulösen Armen gespannt wurden, gingen voraus. Dann folgte der eher schmächtig wirkende junge Araber in schwarzer Hose, weißem Hemd und Sandalen. Hinter ihm kamen zwei weitere korpulente Wärter. Starke Männer wurden in dieser Situation gebraucht, denn oft mußte der Delinquent hereingezerrt, hereingezogen oder gar hereingetragen werden. Es hatte schon häufig unschöne Szenen vor den Augen entsetzter Zeugen gegeben. Hussein Ali Bakir aber kam auf eigenen Füßen, etwas steifbeinig und aufrecht, an eine Puppe erinnernd. Er preßte dabei die gestreckten Handflächen an seine Oberschenkel wie ein Soldat. Sein Kopf saß steif zwischen den Schulterblättern. Plötzlich blieb er vor dem Henker stehen, dessen Kapuze oberhalb der Brüstung zu sehen war. Der Todeskandidat legte seinen kahlgeschorenen Kopf in den Nacken. Seine Augen waren kaum einen halben Meter von den Sehschlitzen in der Kapuze des Henkers entfernt.
Hussein Ali Bakir blickte starr in Victor Mellers Augen. Dann entspannten sich seine Gesichtszüge, und er lächelte, als habe er einen lange nicht gesehenen Freund wiedererkannt. Leise, aber laut genug für das Mikrofon unter der Decke sagte er: »Ich bin bereit! Tue deine Arbeit!«
Die kräftigen Wärter rissen ihn zurück, packten ihn an den Schultern und schoben ihn zum elektrischen Stuhl. Es war nur vier, fünf Schritte weit. Sie drückten ihn auf die harte Sitzfläche und gegen die Rücklehne, schnallten seine Arme und Beine blitzschnell mit den Lederschlaufen an das Eichenholz. Die Lederhaube mit eingearbeiteten Kupferplatten, an die die Starkstromkabel angeschlossen wurden, lag auf dem Sicherungskasten. Superintendent Trugger wies die vier Männer mit kurzen Handbewegungen zurück. Sie stellten sich nebeneinander an der Wand auf, jederzeit zum Eingreifen bereit.
Die Uhr in der Todeskammer zeigte 15 Minuten vor zwölf.
Das rote Telefon klingelte. Der Lautsprecher verstärkte in den Ohren der Zuschauer das Geräusch zu einem schmerzhaften Laut. Die meisten zuckten zusammen. Auch der Mann auf dem elektrischen Stuhl. Superintendent Trugger nahm hastig den Hörer aus der Gabel. Eine Frau sagte: »Hier ist das Weiße Haus in Washington. Spreche ich mit Superintendent Trugger?«
Trugger meldete sich mit seinem Namen.
»Halten Sie die Leitung offen. Die nächste Person, mit der Sie sprechen werden, wird der Präsident der Vereinigten Staaten sein ...« sagte die Anruferin.
Zwei, drei Minuten vergingen. Endlich knackte es wieder in der Leitung. Dann war das Rascheln von Papier zu hören, und jemand im Hintergrund sagte: »Das Tonband läuft, Mister President.« Eine etwas belegt klingende Stimme kam jetzt aus dem Hörer, deren unterdrückte Nervosität vom Lautsprecher hörbar gemacht wurde.
»Hier ist Ronald Reagan. Ich hoffe, Sie können mich hören, Superintendent ...?«
Trugger antwortete eilfertig: »Mister President, wir sind bereit, das im Namen des amerikanischen Volkes rechtsgültig verhängte Todesurteil gegen den libanesischen Staatsbürger Hussein Ali Bakir zu vollstrecken ...«
Am anderen Ende der Leitung entstand wieder eine Pause. Stimmen flüsterten im Hintergrund. Superintendent Trugger wartete eine Weile unsicher, dann fuhr er fort: »Mister President, ich darf Sie nun, wie es meines Amtes ist, fragen, ob es Gründe gibt, die Sie veranlassen, den Vollzug dieses Urteils noch kurz vor seiner Vollstreckung aufzuschieben oder den Delinquenten zu begnadigen?«
Wieder war deutlich das Knistern von Papier zu hören, bevor der Mann am anderen Ende der Leitung erneut zu sprechen begann. Von Satz zu Satz wurde die gepreßt klingende Stimme deutlicher und härter. Der Präsident begann:
»Superintendent, bevor ich Ihre Frage beantworte, lassen Sie mich allen Menschen, die mir jetzt im Florida State Prison und hier im Oval Office zuhören, auch denen, die vielleicht später die Aufzeichnung meiner Worte zu hören bekommen werden, sagen, daß dies eine der schwersten Entscheidungen meiner Amtszeit ist. Ich bin mir in dieser Minute bewußt, welche Konsequenzen meine Antwort haben kann ... Die Entwicklung der letzten Stunden hat mir deutlich gemacht, daß es nicht mehr nur um das Leben dieses nach unserem Gesetz von Richtern und Geschworenen rechtsgültig zum Tode verurteilten Mörders und Terroristen geht, der jetzt vor Ihnen auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Von der Entscheidung, die mir der Gouverneur, des Bundesstaates Florida übertragen hat, wird möglicherweise auch das Leben amerikanischer Bürger abhängen, die von einer verbrecherischen Terrororganisation als Geiseln im Libanon gefangengehalten werden; und vielleicht auch die Sicherheit von unschuldigen Menschen in den Vereinigten Staaten und in Europa. Deshalb möchte ich meine Antwort ausführlicher, als dies bei diesem Anlaß sonst üblich sein mag, vor Gott und der Geschichte begründen ...«
Es war still geworden, so still, daß während der Atempausen des Präsidenten das Ticken der elektrischen Uhr zu hören war.
Der große Minutenzeiger schob sich ruckweise vor, Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter. Die Gesichter der meisten Zuhörer waren versteinert. Ihre Blicke wanderten zwischen dem altmodischen Kastenlautsprecher und dem Mann auf dem elektrischen Stuhl hin und her.
Hussein Ali Bakir saß scheinbar ganz entspannt da. Seine Augen suchten ruhig und zielbewußt die Reihen der Zuschauer ab, die aus seiner Perspektive hinter der Glasscheibe in dem grüngestrichenen Nebenraum wie Fische in einem beleuchteten Aquarium aussahen. Immer dann, wenn er ein vertrautes Gesicht entdeckte, lächelte er, wie ein Gastgeber, der einen Gast begrüßt.
Hussein Ali Bakir erkannte in der dritten Stuhlreihe die blonde Stewardeß Cornelia Marks, die an Bord des entführten Flugzeugs Zeugin des Mordes geworden war; drei Plätze von ihr entfernt saß der grauhaarige Chefpilot Jonathan Boulder, der Tage und Nächte lang seinen Befehlen hatte gehorchen müssen; in der Reihe davor der kahlköpfige amerikanische Vietnamkämpfer und Söldner Bill Davidson und schräg hinter ihm der jungenhaft wirkende israelische Captain Gideon Jacobs – die beiden Männer, die ihn gejagt und dem Henker ausgeliefert hatten; zwischen ihnen entdeckte er den strohblonden Reporter Jörg Peters aus Hamburg, der die Jäger absichtlich oder unabsichtlich auf seine Spur geführt hatte.
Der Mann auf dem elektrischen Stuhl nickte jedem von ihnen zu.
Zuletzt erst fanden seine Augen jenen Mann, den sie offenbar besonders gesucht hatten. Der Mann saß gleich vorne links hinter der etwas spiegelnden Trennscheibe. Er trug einen weißen Turban. Ein Backenbart ließ sein Gesicht füllig erscheinen, eine dicke Hornbrille vergrößerte seine Augen. Hussein Ali Bakir sah ihn mit einer Mischung aus Verlegenheit und Zuneigung an. Der Mann mit dem Turban lächelte zurück. Ihre Blicke drückten die Verbundenheit von Menschen gleicher Herkunft, gleicher Gesinnung und gleichen Glaubens aus, die sich nach langer Trennung in einer feindlichen Welt wiedertrafen.
Der junge Moslem auf dem elektrischen Stuhl schloß die Augen.
Für die Zeugen im Zuschauerraum schien es, als konzentriere er sich auf die Stimme des amerikanischen Präsidenten, der nunmehr endgültig über sein Schicksal entscheiden würde, doch Hussein Ali Bakir hörte kaum zu.
Er versuchte sich zu erinnern, wann und wo und unter welchen Umständen er den bärtigen Mann mit dem Turban und den blinkenden Brillengläsern zum ersten Mal gesehen hatte. Es kam ihm jetzt vor, als sei das bereits in einem anderen Leben gewesen ...
Kapitel 2
Hamburg, März 1984
Der erste Frühjahrssturm kam unerwartet über Nacht. Satellitenfotos vom Vortag hatten das Orkantief noch über Island gezeigt und die Metereologen prophezeiten, es werde sich über den britischen Inseln austoben, bevor es Norddeutschland und Hamburg erreichte, wo die Menschen nach einem eisigen Winter die ersten warmen Sonnenstrahlen genossen. Doch der Orkan verlor seine Kraft nicht. Er fiel mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern über die schlafende Stadt her. Dächer wurden abgedeckt, Baugerüste umgeworfen; umherwirbelnde Äste und Dachziegel zertrümmerten Fensterscheiben und Autobleche.
An der Straße Schöne Aussicht, einer teuren Wohngegend an der Außenalster, fuhr der Sturm in die Krone einer jahrhundertealten Kastanie. Die Wurzeln wurden aus dem Boden gerissen und der meterdicke Stamm stürzte vor der Einfahrt der prächtigen Moschee der islamischen Gemeinde quer über die Fahrbahn. Am nächsten Vormittag machten sich Arbeiter mit kreischenden Motorsägen über die mächtige Kastanie her, um das Verkehrshindernis zu zerstückeln und beiseite zu räumen.
Ein doppelstöckiger Stadtrundfahrt-Bus mußte an dieser Stelle warten. Die junge Fremdenführerin hatte Zeit, ihren Fahrgästen die Geschichte des Bauwerkes gegenüber dem Clubhaus des »Norddeutschen Rudervereins von 1868« zu erklären, das sich befremdlich zwischen hanseatischen Patrizier-Villen und modernen, marmorverkleideten Appartementhäusern ausnahm: die türkisfarbene, von zwei schlanken Minaretts flankierte, von einer grünen Kupferkuppel überwölbte Moschee, die Ende der fünfziger Jahre mit Spenden des persischen Schahs Reza Pahlewi erbaut worden war.
Die Insassen des Rundfahrtbusses konnten an diesem Freitagnachmittag die Auswirkungen der iranischen Revolution bestaunen: hinter meist europäisch gekleideten Männern eilten Frauen im schwarzen langen Schador mit schwarzen Kopftüchern in das moslemische Gotteshaus, die hier in Hamburg so exotisch wirkten wie eine katholische Fronleichnams-Prozession in einer Wüstenoase.
Im Verkehrsstau vor der gestürzten Kastanie wartete am Steuer eines weißen BMW 320 ein junger, gutaussehender Libanese mit einer kleinen roten Narbe an der Stirn, die von einem Autounfall stammte. Seine Frau saß neben ihm. Hinter ihm auf einem Kindersitz war seine drei Jahre alte Tochter angeschnallt, ein hübsches Kind mit großen dunklen Augen und zwei kleinen, mit weißen Schleifen zusammengebundenen schwarzen Zöpfen.
Hussein Ali Bakir war nervös. Er drückte mehrmals auf die Hupe. Sie würden zu spät zum Freitagsgebet kommen, das um 13.30 Uhr begann. Er scherte schließlich aus der Schlange der wartenden Fahrzeuge aus und parkte seinen Wagen gegenüber vom Café »Hansa-Steg«, einem hinter Büschen am Alsterufer gelegenen gelb geklinkerten Bungalow.
Er nahm seine Tochter auf den Arm. Die letzten zweihundert Meter zur Moschee legte das Ehepaar im Schnellschritt zurück. Sie eilten die lange Einfahrt entlang, die breite Steintreppe hinauf, durch die Eingangshalle und stellten vor dem Gebetsraum ihre Schuhe zu den mehr als zweihundert Paaren, die die vor ihnen angekommenen Gläubigen sorgfältig nebeneinander aufgereiht hatten.
»Es sind heute viel mehr Leute hier als sonst«, flüsterte ein junger Mann mit dem typischen Backenbart der Schiiten, der sich ebenfalls gerade die Schuhe abstreifte. »Sie wollen alle den Imam Ghobal, den neuen Gastprediger, hören.«
»Ein neuer Imam?« Hussein blickte den jungen Mann, den er schon einige Male gesehen hatte, fragend an.
»Er soll ein berühmter Prediger sein. Er kommt aus der heiligen Stadt Ghom.«
»Wie heißt er?«
»Mohammed Musa Ghobal.«
Hussein Ali Bakir hatte noch nichts von dem neuen Imam und seiner Mission gehört. Er war nicht sehr fromm und betete selten in der Moschee, obwohl er schon seit mehr als fünf Jahren in Hamburg lebte. Nur an hohen Feiertagen oder bei besonderen persönlichen Anlässen kam er hierher. Diesmal wollte er Allahs Schutz für seine Frau Miriam und seine Tochter Eva Fatima erbitten, denn die beiden sollten morgen zum ersten Mal allein in das immer noch vom Bürgerkrieg heimgesuchte Beirut reisen.
Sie betraten auf Strümpfen den kreisförmigen, von einem umlaufenden Lichtband erhellten Gebetsraum. Der Vorbeter verkündete gerade zum zweiten Mal die Worte der al Fatiha-Sure: »Allhu Akbar ...« – »Gott ist der Größte. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Alle Lobpreisungen gehören Gott, dem Herren der Welten, dem All-Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herren am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir, und Dich allein flehen wir um Hilfe an ...«
Der junge Mann im teuren Kamelhaar-Jackett stellte sich zwischen die betenden Männer auf einen freien Platz in einer der vorderen Reihen. Seine Frau ging zu den anderen Frauen, die außerhalb des von einer kniehohen Brüstung umgebenen Gebetsraumes in einer großen Nische saßen. Die kleine Tochter spielte – nachdem sie die erste Scheu überwunden hatte – mit anderen Kindern auf dem Gang.
Die Gesichter der Gläubigen wandten sich der Mirhab zu, der mannshohen, oben zwiebelförmig zulaufenden Gebetsnische, die nach Mekka ausgerichtet ist. Sie beteten stehend mit seitlich angewinkelten Armen und geöffneten Handflächen, sie beugten die Oberkörper, sie knieten nieder und berührten mit der Stirn die Strohmatten, die über die wertvollen Perserteppiche gelegt sind, dem einzigen Schmuck in der innen sonst schmucklosen Moschee. Bei jeder dieser Gesten der Verehrung und Unterwerfung murmelten sie auf arabisch im Chor die vorgeschriebenen Gebetsformeln.
Hussein Ali Bakir beobachtete seine Vorderleute und seine Nachbarn aus den Augenwinkeln. Er hatte lange nicht in der Moschee gebetet. Er war unsicher und bemühte sich deshalb, sich synchron mit seinen Nebenleuten zu bewegen und so zu sprechen wie sie. Als sich alle auf den Boden hockten, setzte auch er sich nieder.
In der ersten Reihe erhob sich jetzt ein Mann, dessen weißer Turban schon Anziehungspunkt vieler Blicke gewesen war. Der neue Imam, der Korangelehrte, stellte sich mit dem Rükken zur Gebetsnische und mit dem Gesicht zur Gemeinde auf: ein kleiner, untersetzter Mann mit rundlichem Gesicht, randloser Brille und einem Backenbart, dessen Ausläufer sich den Hals hinunterzogen. Seine Augen wanderten während der Predigt von einem Zuhörer zum anderen, in einem bestimmten Rhythmus, von rechts nach links, von der hinteren Reihe zur ersten und wieder zurück. Jeder im Raum hatte den Eindruck, der Imam spreche ihn zeitweilig persönlich an.
Er predigte auf deutsch, wie es in der Hamburger Moschee üblich ist, weil die Gläubigen der islamischen Gemeinde aus mehr als einem Dutzend verschiedener Nationen kommen. Die meisten sprechen Deutsch oder verstehen es zumindest. Der Imam begann:
»Ich habe den Auftrag, alle, die hier versammelt sind, von Ayatollah Chomeini persönlich zu grüßen. Er hat mir aufgetragen, in Hamburg und später in anderen Gemeinden der Bundesrepublik und in Europa zu sprechen ...« Er sei stolz, nun an derselben Stelle zu stehen, an der einst der große Gelehrte und Revolutionär und Märtyrer Ayatollah Mohammed Hosseini Beheschti – »Friede sei mit ihm« – gestanden habe.
Der Imam hob seine Stimme.
»So wie es damals die Aufgabe von Märtyrer Ayatollah Beheschti war, als er hier in Hamburg gelehrt hat, so ist es heute auch meine Aufgabe, die Wahrheit zu verbreiten; denn aus den trüben Quellen der westlichen Medien ergießt sich eine Flut von Lügen, von Schmutz und Verleumdung über die religiösen, gesellschaftlichen und politischen Errungenschaften und Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten.«
Der Freitagsprediger setzte zu seiner Grundsatzrede an. Er erklärte, warum der einzige Weg zum Frieden in der Welt und zum persönlichen Glück das Leben nach den wahrhaftigen Regeln des Koran sei. Er sagte: »Eine kapitalistische Gesellschaftsordnung, deren oberstes Gebot die Profitmaximierung ist, steht zum Islam im grundsätzlichen Widerspruch – ebenso wie die Entmündigung des einzelnen durch die kommunistische Planwirtschaft. Der Imperialismus, der Kommunismus und der Zionismus sind unsere Feinde. Die Mächte, die diesen Ideologien anhängen, unterjochen die Völker des Libanon, Palästinas und Afghanistans – so wie sie früher den Iran unterjocht haben.« Die Stimme des Imams klang schrill, als er diesen Teil seiner Predigt beendete.
»Deshalb muß unser Ziel heißen: Nieder mit dem Imperialismus! Nieder mit dem Zionismus!«
Es war eine sehr gemischte Gemeinde, die dem Geistlichen lauschte. Außer ihrem Glauben hatten die Menschen in der Moschee wenig gemeinsam. Im Gebetsraum hockten Iraner, Iraker, Pakistani und Syrer, Türken, Tunesier, Marokkaner, Afghaner und Libanesen; auch dunkelhäutige Afrikaner und hellblonde Deutsche. Studenten in Jeans, Arbeiter in verschlissener Kleidung, Herren in Nadelstreifenanzügen und eine Handvoll junger Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die sich mit den Statussymbolen der westlichen Gesellschaft geschmückt hatten: mit teuren Armbanduhren, Seidenkrawatten und Anzügen italienischer Modeschöpfer.





























