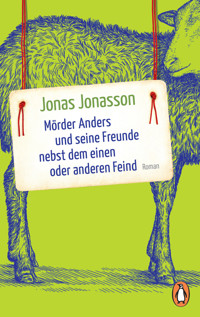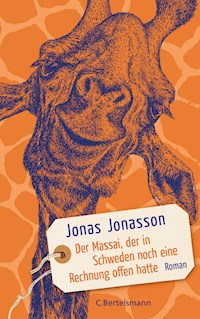
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine abenteuerliche Reise, eine geheime Mission, eine fast perfekte Rache
Ein geldgieriger Galerist ist entsetzt, als sein unehelicher Sohn Kevin vor der Tür steht. Um ihn schnell wieder loszuwerden, schickt er den Jungen wortwörtlich in die Wüste. Doch statt am anderen Ende der Welt zu verkümmern (oder in die Nähe hungriger Löwen zu geraten), taucht Kevin einige Jahre später wieder in Stockholm auf. Mit einem gewitzten Massai-Krieger an seiner Seite. Gemeinsam entwickeln sie einen ausgefeilten Racheplan und wollen noch dazu das Rätsel um zwei Bilder lösen, die der Massai mitgebracht hat. Denn es könnte sich dabei um millionenschwere Kunstwerke der deutsch-südafrikanischen Künstlerin Irma Stern handeln …
Ein Feuerwerk skurriler Ideen, ein slapstickreifer Culture Clash und ganz nebenbei noch eine Liebeserklärung an die Freiheit der Kunst – so etwas gelingt nur Jonas Jonasson!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Frech, verrückt und respektlos komisch – ein echter Jonasson!
Victor Alderheim, geldgieriger Kunsthändler zweifelhafter Gesinnung, verachtet alles, was aus fremden Ländern kommt: Menschen, Speisen, Kunstwerke. Dann trifft er Ole Mbatian, Massai im Besitz millionenschwerer afrikanischer Gemälde – aber ohne jeden Schimmer davon, was Geld ist. Ein wunderbares Chaos beginnt, mit einem Kultur-Clash der ganz besonderen Sorte …
Autor
Jonas Jonasson, geboren 1961 im schwedischen Växjö, arbeitete lange als Journalist und gründete eine eigene Medien-Consulting-Firma. Nach zwanzig Jahren in der Medienwelt verkaufte er seine Firma und schrieb seinen ersten Roman: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das Buch wurde ein Weltbestseller und verkaufte sich allein in Deutschland 4,4 Millionen Mal. Auch Jonassons weitere Bücher waren alle Nr.-1-Bestseller.
»Jonassons Bücher strotzen vor skurrilen Einfällen, warmem Humor und erzählerischer Leichtigkeit, ohne die dunkle Seite des Lebens zu verschweigen.« Süddeutsche Zeitung Magazin
»Großartig geschrieben und so beiläufig erzählt, dass man aus dem Lachen nicht mehr herauskommt.« NDR 1, Kulturjournal
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die schwedische Originalausgabe erschien 2020unter dem Titel Hämnden är ljuv ABbei Piratförlaget, Stockholm.
Copyright © Jonas Jonasson, 2020
First published by Piratförlaget, Sweden
Published by arrangement with Partners in Stories Stockholm, Sweden
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagabbildungen: © Evgeny Turaev/shutterstock; © val lawless/shutterstock; © pukach/shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25842-9V006
www.cbertelsmann.de
Patriotismus ist die Tugend der Boshaften.
Oscar Wilde
Schönen Gruß an Oscar, er denkt mir zu viel.
Tante Klara
Prolog
Es war einmal ein mäßig erfolgreicher Künstler in Österreich. Er hieß mit Vornamen Adolf und sollte später auf anderem Gebiet weltbekannt werden.
Der junge Adolf fand, richtige Kunst solle die Wirklichkeit unverfälscht abbilden, so wie das Auge sie erblickt. Ungefähr wie ein Foto, nur in Farbe. »Das Wahre ist das Schöne«, sagte er, wobei er einen Franzosen zitierte, von dem er ansonsten nichts wissen wollte.
Als Adolf nicht mehr ganz so jung war, ließ er Bücher, Kunst und sogar Menschen im Namen des richtigen Weltbilds verbrennen. Was zum bis dato größten Krieg der Menschheitsgeschichte führte. Adolf verlor ihn und starb.
Sein Weltbild indes schlummerte weiter vor sich hin.
1. Teil
1. Kapitel
Er hatte keine Ahnung, wer Adolf war, und von Österreich hatte er noch nie etwas gehört. Das brauchte er auch nicht. Er war Medizinmann in einem abgeschiedenen Dorf in der afrikanischen Savanne. Wo er so wenige Spuren auf der roten, eisenhaltigen Erde hinterließ, dass sich niemand mehr an seinen Namen erinnert.
Er verstand sich auf Heilkunde, doch die Kunde von seinem Können verbreitete sich ebenso wenig über seine Talsenke hinaus, wie das Weltgeschehen dort eindrang. Er lebte genügsam. Starb zu früh. Denn trotz seiner Fähigkeiten konnte er sich in der allergrößten Not nicht selbst heilen. Betrauert und schmerzlich vermisst von einer kleinen, treu ergebenen Patientenschar.
Der älteste Sohn war eigentlich noch zu jung, um in seine Fußstapfen zu treten, aber Brauch ist Brauch, und so würde es auch bleiben.
Dieser Nachfolger, gerade mal zwanzig Jahre alt, war noch unbekannter als sein Vater. Er erbte dessen gewisses Talent, nicht aber die Gutmütigkeit. Sich von nun an in Genügsamkeit zu üben, war nichts für ihn.
Die Veränderungen fingen damit an, dass der Junge eine neue Hütte für die Sprechstunden baute, mit extra Wartezimmer für die Patienten. Es ging damit weiter, dass er einen weißen Kittel statt der Shúkà trug, und gipfelte darin, dass er sich einen Namen und Titel zulegte. Der Sohn des Medizinmannes, dessen Name in Vergessenheit geriet, nannte sich fortan Doktor Ole Mbatian, nach dem sagenumwobenen Massai gleichen Namens, Anführer und Visionär, der Größte von allen. Das Original war schon lange tot und erhob keine Einwände aus dem Jenseits.
Mit allem Alten wurde auch die bisherige Honorarliste des Vaters ausrangiert. Der Sohn setzte seine eigene auf, eine dem großen Krieger angemessene. Nun reichte es nicht mehr, mit einem Tütchen Teeblätter oder etwas Trockenfleisch zu bezahlen. Die Behandlung einfacher Beschwerden kostete ab sofort ein Huhn, bei komplizierteren sollte es eine Ziege sein. In richtig schweren Fällen verlangte der Doktor eine Kuh. Vorausgesetzt, die Fälle waren nicht zu schwer; sterben war immer noch gratis.
Die Zeit verging. Die Medizinmänner in den umliegenden Dörfern konnten irgendwann einpacken, weil sie immer noch so hießen, wie sie hießen, und darauf bestanden, dass ein richtiger Massai nicht weiß gekleidet herumlief. Doktor Ole Mbatians Ruf wuchs dagegen mit seiner Patientenkartei. Die Umzäunung für Kühe und Ziegen musste am laufenden Band erweitert werden. Ole probierte seine Arzneimixturen an so vielen Menschen aus, dass er seinem Ruf gerecht zu werden begann.
Der Medizinmann mit dem geklauten Namen war bereits ein reicher Mann, als er die Geburt seines ersten Sohnes feierte. Der Kleine überlebte die kritischen Säuglingsjahre und wurde traditionsgemäß im Beruf seines Vaters unterwiesen. Dem zweiten Ole waren viele Jahre an der Seite seines Vaters vergönnt, bevor jener das Zeitliche segnete. Ole behielt den geklauten Vaternamen bei, ließ aber den Doktortitel weg und verbrannte den weißen Kittel, da Patienten von weit her berichtet hatten, dass Ärzte im Unterschied zu Medizinmännern mit Hexerei in Verbindung gebracht wurden. Und ein Medizinmann, der als Zauberer verschrien war, konnte nicht mehr allzu viele Tage im Beruf, wenn nicht gar am Leben bleiben.
Nach Doktor Ole Mbatian kam also Ole Mbatian, genannt der Ältere. Sein Erstgeborener, der heranwuchs und die Nachfolge von Großvater und Vater antrat, war wiederum Ole Mbatian der Jüngere.
Und mit ihm fängt diese Geschichte an.
2. Kapitel
Ole Mbatian der Jüngere erbte Namen, Vermögen, Ruf und Begabung von Vater und Großvater. In einer anderen Weltengegend hätte man dazu gesagt: Er wurde mit einem silbernen Löffel im Mund geboren.
Er erhielt eine gründliche Bildung, und zwar wie seine Altersgenossen auf Umwegen: über die Ausbildung zur Kriegskunst. Daher war er jetzt nicht nur Medizinmann, sondern auch ein hoch angesehener Massaikrieger. Niemand kannte sich besser aus mit den Heilkräften von Wurzeln und Kräutern, und kaum einer reichte im Umgang mit Speer, Wurfkeule und Messer an Ole heran.
Medizinisch hatte er sich auf die Behandlung von allzu ausuferndem Kindersegen spezialisiert. Unglückliche Frauen pilgerten zu ihm, von Migori im Westen bis Maji Moto im Osten, etliche Tagesreisen weit entfernt. Damit alle drankamen, hatte er als Bedingung mindestens fünf bereits geborene Kinder pro Hilfesuchender festgesetzt, mindestens zwei davon männlich.
Auch wenn der Medizinmann seine Rezepturen streng geheim hielt, ließ sich doch Bittermelone als ein aktiver Bestandteil der trüben Brühe herausschmecken, die die Frauen bei jedem Eisprung trinken sollten. Bei besonders feinem Gaumen war als weitere Komponente die Wurzel indischer Baumwolle zu erahnen.
An Reichtum übertraf Ole Mbatian der Jüngere alle, einschließlich Häuptling Olemeeli den Weitgereisten. Neben seiner großen Kuhherde besaß Ole drei Hütten und zwei Frauen. Beim Häuptling verhielt es sich genau umgekehrt: zwei Hütten und drei Frauen. Ole war schleierhaft, wie das gut gehen sollte.
Seinen Häuptling hatte der Medizinmann sowieso noch nie gemocht. Sie waren gleich alt und wussten schon von Kindesbeinen an, welche Rollen ihnen später einmal zugedacht waren.
»Mein Papa bestimmt über deinen Papa«, sagte Olemeeli, wenn er ihn ärgern wollte.
Auch wenn er damit theoretisch betrachtet recht hatte, verlor Ole junior doch nur ungern im Streit gegen ihn. Als Lösung bot sich an, dem künftigen Häuptling mit der Wurfkeule eins überzuziehen, worauf Oles Vater nichts anderes übrig blieb, als seinen Sohn vor aller Augen zu züchtigen, während er ihm gleichzeitig lobende Worte ins Ohr flüsterte.
Zu dieser Zeit war im Dorf Kakenya der Schöne an der Macht. Im Stillen quälte ihn das Wissen, dass sein Beiname zwar stimmte, aber genau genommen auch das einzig Beneidenswerte an ihm war. Nicht weniger bekümmerte es ihn, dass sein Sohn, der eines Tages sein Nachfolger werden sollte, offensichtlich bloß die Schwächen seines Vaters geerbt hatte, nicht dessen bemerkenswerte Schönheit. Außerdem gewann das Aussehen des jungen Olemeeli auch nicht eben dadurch, dass der Sprössling des Medizinmannes ihm zwei Schneidezähne ausgeschlagen hatte.
Kakenya der Schöne tat sich furchtbar schwer mit Entscheidungen. Hin und wieder konnte man das ja den Frauen überlassen, doch zu seinem Pech hatte er eine gerade Anzahl. Jedes Mal, wenn sie sich in einer Frage uneins waren (also so gut wie immer), stand er mit seinem Machtwort da und wusste nicht, wohin damit.
Auf seine alten Tage und mithilfe der ganzen Familie fasste Kakenya dann doch einen Entschluss, auf den er stolz sein konnte. Sein ältester Sohn sollte auf Reisen gehen, weiter als irgendwer je zuvor. Auf die Weise würde er voller neuer Eindrücke von der Welt da draußen wiederkehren. Die Weisheit, die er dabei ansammelte, würde ihn zu einem guten Mann machen, wenn es darum ging, die Nachfolge anzutreten. Auch wenn Olemeeli nie so schön wie sein Vater werden würde, konnte er doch ein energischer und zukunftsweisender Häuptling werden. So die Idee.
Leider kommt es ja häufig anders, als man denkt. Olemeelis erste und letzte weite Reise sollte auf väterlichen Befehl nach Loiyangalani führen. Nicht nur, weil es schon fast unvorstellbar weit weg lag, sondern auch, weil es hieß, dass man dort hoch im Norden neue Ideen zur Filterung von Meerwasser hatte. Erhitzter Sand und Vitamin-C-haltige Kräuter, kombiniert mit Seerosenwurzeln, waren altbekannte Methoden. Aber in Loiyangalani hatten sie offenbar etwas entdeckt, das einfacher und zugleich effektiver war.
»Begib dich dorthin, mein Sohn«, sprach Kakenya der Schöne. »Lerne von all dem Neuen, das dir auf deinem Weg begegnet. Danach kehrst du zurück und machst dich bereit. Ich spüre, dass meine Zeit bald gekommen ist.«
»Aber Papa«, sagte Olemeeli.
Mehr fiel ihm nicht ein. Er kam sowieso selten auf die richtigen Worte. Oder den richtigen Gedanken.
Die Reise dauerte eine halbe Ewigkeit. Jedenfalls eine ganze Woche. Endlich angekommen, stellte Olemeeli fest, dass man in Loiyangalani in vielen Dingen weit voraus war. Die Wasserreinigung war nur das eine. Außerdem hatte man etwas installiert, das Strom hieß, und der Bürgermeister schrieb seine Briefe mit einer Maschine statt mit Stift oder Kreide.
Olemeeli wollte eigentlich nur schnell wieder nach Hause, doch die Worte seines Vaters hallten in seinem Kopf nach. Daher sah er sich dieses und jenes etwas näher an, schließlich war er es seinem Vater schuldig. Leider stellte er sich beim Stromprüfen so ungeschickt an, dass er einen Schlag kriegte und minutenlang das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, berappelte er sich und versuchte es dann mit der Schreibmaschine. Doch zu allem Unglück blieb er mit dem linken Zeigefinger zwischen D und R stecken und zog die Hand vor lauter Schreck so heftig zurück, dass der Finger an zwei Stellen einriss.
Nun reichte es aber. Olemeeli befahl seinen Trägern, für die mühsame Heimreise zu packen. Er wusste schon, was er seinem Vater Kakenya berichten wollte. Schlimm genug war es, dass einen der Strom beißen konnte, bloß weil man einen Nagel in ein Loch in der Wand steckte. Aber die Maschine zum Schreiben war ja regelrecht lebensgefährlich!
Die Vorhersagen Kakenyas des Schönen trafen selten genug ein. Die Annahme jedoch, dass ihm nicht mehr viel Lebenszeit vergönnt sein würde, erwies sich als korrekt. Verschreckt trat der zahnlückenbehaftete Sohn die Nachfolge an.
Bereits am ersten Tag nach der Trauerfeier erließ der neue Häuptling Olemeeli drei Dekrete:
Erstens: Sogenannter elektrischer Strom durfte niemals im Dorf installiert werden.
Zweitens: Maschinen zum Schreiben durften nicht eingeführt werden, sowie
drittens: Das Dorf sollte in ein ganz neues Wasserreinigungssystem investieren.
So kam es, dass Olemeeli seit bald vier Jahrzehnten über die einzige Talsenke in Masai Mara herrschte, in der es weder Elektrizität noch Schreibmaschinen oder, in der Folgezeit, Computer gab. Es war das Tal, in dem nicht ein einziger der weltweit insgesamt sechs Millionen Handynutzer wohnte.
Er nannte sich Olemeeli der Weitgereiste. Und war ebenso unbeliebt, wie sein Vater es einst gewesen war. Hinter seinem Rücken bekam er einige weniger schmeichelhafte Spitznamen verpasst. Am besten davon gefiel Ole Mbatian dem Jüngeren »Häuptling Zahnlos«.
Der äußerst unbeliebte Häuptling und der anerkannt tüchtige Medizinmann, die beiden wichtigsten Männer im ganzen Dorf, verstanden sich immer noch nicht, konnten sich aber schlecht weiterkloppen wie in ihrer Kindheit. Ole Mbatian fand sich damit ab, dass der Rückständigste von allen nun mal das Sagen hatte. Dafür stellte Olemeeli der Weitgereiste sich taub, wenn der Medizinmann darauf herumritt, wer von beiden noch die meisten Zähne im Mund hatte.
Der Häuptling war für Ole Mbatian ein dauerhaftes, aber auch nur mäßiges Ärgernis. Mehr zu schaffen machte ihm etwas ganz anderes: nämlich dass er vier Kinder mit seiner ersten Frau und vier mit seiner zweiten hatte – acht Töchter, und nicht einen einzigen Sohn! Schon nach dem vierten Mädchen begann er mit seinen Kräutern und Wurzeln herumzuexperimentieren, damit das nächste Kind ein Junge würde. Doch diese medizinische Herausforderung überstieg seine Kräfte. Mit den Töchtern ging es so lange weiter, bis es nicht mehr weiterging. Die Frauen lieferten nicht mehr, auch ganz ohne Bittermelone oder indische Baumwolle in den Mixturen.
Nach fünf Generationen von Medizinmännern würde der Nächste in der Reihe kein Mbatian mehr sein, oder wie auch immer sie hießen. Weibliche Medizinmänner – ein Widerspruch in sich – kamen in der Welt der Massai nicht vor.
Lange Zeit konnte Ole sich damit trösten, dass Häuptling Zahnlos das mit dem Kinderzeugen auch nicht besser gelang: Er bekam sechs Mädchen.
Aber der Häuptling hatte ja noch eine zusätzliche Frau. Kurz vor Erreichen der Altersgrenze lieferte die ihrem Gatten einen Sohn und Stammhalter. Großes Dorffest! Der stolze Vater verkündete, dass die ganze Nacht durchgefeiert werden sollte. Und so geschah es denn auch. Alle vergnügten sich bis in den Morgen, außer dem Medizinmann, der Kopfschmerzen hatte und sich früh schlafen legte.
Das war nun viele Jahre her. Sehr viel mehr Jahre, als Ole vor sich zu haben meinte. Doch noch war er nicht bereit für den Großen Gott. Noch hatte er einiges zu bieten. Er kannte sein genaues Alter nicht. Merkte nur, dass er nicht mehr ganz so treffsicher wie früher mit Pfeil und Bogen umging, nicht mehr ganz so unfehlbar mit Speer, Wurfkeule und Messer war. Obwohl, mit der Wurfkeule schon noch, wenn er es sich recht überlegte. Schließlich war er der aktuelle Dorfmeister in dieser Disziplin.
Auch seine Geschmeidigkeit hatte nicht gelitten. Er bewegte sich mit der gleichen Leichtigkeit wie eh und je. Wenn auch nicht mehr ganz so bereitwillig. Er wurde allmählich bequem. Hatte Zahnschmerzen. Und Mittelchen dagegen. Seine Sicht war trüber als in jungen Jahren, doch das störte ihn nicht. Ole hatte alles Sehenswerte gesehen und fand überall hin, wo er hinfinden wollte.
Insgesamt mehrten sich die Hinweise, dass eine bestimmte Lebensphase in eine andere übergegangen war. Und dass Ole Mbatian deprimiert war. Wenn der Kummer um den Sohn, der nie geboren wurde, ihn zu fest im Griff hatte, verschrieb er sich selbst eine Mischung aus Johanniskraut und Rosenwurzel in Sonnenblumenöl. Das half gewöhnlich.
Oder er drehte eine zusätzliche Runde durch die Savanne. Auf ständiger Suche nach Wurzeln und Kräutern für seinen Arzneischrank war er schon im Morgengrauen auf den Beinen. Arbeitete, bis die Sonne zu heiß brannte. Machte sich am nächsten Morgen noch im Dunkeln erneut auf den Weg, die Ohren stets gespitzt nach Geräuschen der nahezu lautlos jagenden Löwen.
Wurden seine Schritte allmählich kürzer? Einst hatte Ole sich bis ganz nach Nanyuki aufgemacht. Ein andermal bis zum Fuß des Kilimandscharo und weiter den Berg hinauf. Jetzt kam es ihm so vor, als läge bereits das Nachbardorf in weiter Ferne.
Nichts deutete darauf hin, dass Ole Mbatian der Jüngere in nicht allzu ferner Zukunft in Stockholm, Europa und auf der ganzen Welt für einigen Wirbel sorgen würde. Der Massai wusste unendlich viel darüber, wie man die Heilkräfte der Savanne nutzte, doch rein gar nichts von der schwedischen Hauptstadt mitsamt dem ganzen Kontinent, zu dem sie gehörte. Und über die Welt wusste er nur, dass sie einmal vom höchsten Gott Ngai erschaffen worden war, der im Berg Kirinyaga wohnte. Ole Mbatian bezeichnete sich als Christen, doch es gab Wahrheiten, an denen die Bibel nicht rütteln konnte. Wie etwa die Schöpfungsgeschichte.
»Na schön«, sagte er zu sich.
Das hatte er sich so angewöhnt. Es bedeutete, dass er sich halt noch etwas weiter abrackern musste. Alles in allem war er guter Dinge.
3. Kapitel
Knapp achttausend Kilometer nördlich des Massaireiches, in einem Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm, übergab Lasse dem Käufer seines Lebenswerks die Schlüssel. Es war Zeit, in Ruhestand zu gehen.
Für den ehemaligen Kioskbesitzer war das nichts Aufregendes. Man kam auf die Welt, tat seine Pflicht, trat ab, starb und wurde begraben. Mehr nicht.
Umso aufregender – und vor allem schlimmer – war es für seine Stammkunden. Dass Lasse seinen Kiosk aber auch ausgerechnet an einen Araber verkaufen musste! Einen, der nicht mal den Senf der Marke Västervik kannte. Nicht mal wusste, dass das Würstchen auf der Soße liegen muss. Und der zu allem Überfluss auch noch Kebap in sein Angebot aufnahm.
So was konnte jeden fertigmachen. Victor war erst fünfzehn, als es geschah. Mit dem Moped am Kiosk abzuhängen, war jetzt einfach nicht mehr so wie früher.
Seine Freunde nahmen die neue Pizzeria auf der anderen Seite vom Platz als Treffpunkt, aber die wurde ja doch bloß von einem anderen Araber betrieben.
Was sollte das mit den ganzen Arabern? Und Iranern. Irakern. Jugoslawen. Keiner von denen kannte Västervik-Senf. Sie zogen sich komisch an. Redeten komisch. Konnten sie nicht mal richtiges Schwedisch lernen?
Das war das eine. Das andere war, dass seine Kumpels es nicht so sahen wie er. Sie wechselten nicht etwa von der Würstchenbude zur Pizzeria, weil aus dem Würstchen Kebab geworden war, sondern weil es in der Pizzeria einfach viel wärmer war. Als Victor ihnen klarmachen wollte, dass Schweden vor die Hunde ging, grinsten sie ihn an. Hie und da ein Jugoslawe oder Italiener brachte ja wohl ein bisschen Farbe ins Leben?
Victor wurde mit seinen Gedanken alleingelassen. Wenn die anderen in die Disco gingen, hockte er zu Hause in seinem Jugendzimmer. Wenn die anderen am Wochenende Fußball spielten, ging er ins Museum. Dort fand er Trost im ursprünglich Schwedischen, wie etwa dem französischen Rokoko und dem Neoklassizismus, den Gustav III. aus Italien nach Schweden importiert hatte. Aber vor allem bei der Nationalromantik: Was gab es Schöneres als einen Mittsommertanz von Anders Zorn! Was Tiefsinnigeres als den Leichenzug Karls XII., gemalt von Gustaf Cederström.
Das genaue Gegenteil eines Kebabs.
Seine Gymnasialzeit war die Hölle. Die Jungen in seiner Klasse fanden ihn komisch, weil er die Regentschaften der schwedischen Könige auswendig lernte, ab dem zehnten Jahrhundert. Und die Mädchen … tja, mit denen stimmte was nicht. Manche hatten sich ein Tuch um den Kopf gewickelt, damit wollte er nichts zu tun haben. Aber auch die richtigen Schwedinnen … Man kam schwer mit ihnen ins Gespräch. Worüber sollten sie denn auch reden? Wie kommt man einer nahe, ohne sie an sich heranzulassen?
Der Militärdienst war eine gewisse Befreiung. Ein Jahr Ordnung und Disziplin im Dienste der Nation. Doch nicht einmal bei der schwedischen Landesverteidigung gab es Ruhe vor Ausländern. Oder vor Frauen.
Als junger Erwachsener spielte Victor mit dem Gedanken an eine Politikerlaufbahn. Er abonnierte den Folktribunen, eine Zeitung, die sich in groben Zügen an dieselben Glaubenssätze hielt wie er, und ging zu Versammlungen mit Gleichgesinnten, wie er hoffte, ohne sich unter ihnen wohlzufühlen. Sie wollten die Dinge mit Gewalt verändern, was aber nur ging, wenn man zu Schlägereien bereit war, und das konnte mächtig wehtun. Schmerz als solcher war Victor durchaus ein Begriff, seit damals, als dreihundert Kronen aus Papas Brieftasche verschwunden waren. Ohne jeden Beweis hatte der Vater seinen fünfzehnjährigen Sohn nach Strich und Faden verdroschen.
Die Partei, die Victor zusagte, hatte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, wogegen er selbst ganz unten stand. Als Mitglied sollte man parieren und kooperieren. Nicht nur mit anderen Männern, sondern auch mit Frauen.
Aus all dem folgerte er, dass Schweden verloren war, falls seinen vorläufigen Freunden in der Widerstandsbewegung ihre Revolution misslang. Oder dass er die Sache selbst in die Hand nehmen musste – freilich ohne Prügel zu beziehen oder hinter Gittern zu landen. Auch wenn Schweden dem Verfall preisgegeben war, konnte man in diesem Land immer noch sein Glück machen, anders als in der Partei, wo man Rücksicht nehmen musste. Für Victor gab es kaum ein schlimmeres Wort. Rücksicht auf den Parteivorsitzenden, seinen Stellvertreter, dessen Frau und deren Katze. Mit Entschlossenheit, nicht mit Rücksichtnahme schützte man Schweden vor Parasiten.
Der gut zwanzigjährige Einzelgänger war keinem Menschen etwas schuldig. Er wollte ganz hoch hinaus und vom obersten Gipfel aus die Rücksichtslosigkeit walten lassen.
Notfalls brauchte das eben seine Zeit; und es machte überhaupt nichts, wenn es auf fremde Kosten ging. Was das genau für ein Gipfel sein würde, spielte auch keine Rolle, Hauptsache, er war hoch genug.
Sein Aufstieg fing damit an, dass er sich einen Job in Stockholms angesehenster Kunsthandlung angelte. Mit richtiger Kunst kannte er sich ja ein wenig aus, und im Vorstellungsgespräch schaffte er es, dem Kunsthändler Alderheim etwas von seiner Begeisterung für die ganze abscheuliche moderne Kunst vorzuschwafeln. Zur Sicherheit las er sich vorher einiges an, sodass ihm Sätze gelangen wie:
»Es ist wahrlich kein Leichtes, hier vor dem stadtbekannten großen Kunsthändler zu sitzen und die eigentliche Funktion des Gedankens zu transportieren.«
Eine Anspielung auf den Begründer des Surrealismus, wobei der angestrebte Arbeitgeber glücklicherweise nicht nachfragte, denn den Namen hatte Victor vergessen. Er wusste nur noch, dass er ein linker Dichter gewesen war und eine antifaschistische Gruppe gegründet hatte. Also ein Idiot.
Die Idee mit dem Kunsthandel war übrigens kein Zufall. Victor hatte sich das gründlich überlegt: Wer ernsthaft eine Veränderung erreichen wollte, der musste eine Position haben. Eine Schwuchtel aufzumischen oder einem Nigger Todesangst einzujagen, war gut und schön, führte aber zu keiner spürbaren Veränderung. Außer natürlich für den Betreffenden.
An eine einflussreiche Position kam man heran, indem man in den richtigen Kreisen verkehrte. Also musste sich Victor an Geld und Macht halten. Ganz unten in der Nahrungskette einzusteigen, hatte ebenso wenig Sinn wie in der Politik.
Der Kunsthandel war ein Spitzen-Sprungbrett, denn wenn die sozialliberalen Machtmenschen etwas gemeinsam hatten, dann ihre Begeisterung für Oper, Theater – und Kunst. Besonders den modernen Mist, den Alderheim vermarktete. Wenn Victor in diesem Laden Kontakte knüpfte, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich für ihn etwas Besseres ergab.
Die Arbeit an sich sah so aus, dass er Hauptverantwortlicher für die Kundenpflege war. Er hatte sich das Recht ausbedungen, sich Vorstand nennen zu dürfen. Eigentlich hatte Alderheim mehr an einen Assistenten gedacht, aber er war alt und müde und leicht zu überreden. Die wichtigste Aufgabe des Vorstands war es, die ankommenden Kunden von den Kunstwerken zu überzeugen, indem er sie von sich selbst überzeugte.
»In tiefster Seele bin ich eigentlich mehr der Cézanne-Typ«, konnte er mit entspanntem und doch schüchternem Lächeln säuseln. »Aber ich muss zugeben, dass es mich auch zu Matisse hinzieht.«
Worauf er noch einen draufsetzte:
»Immer dieser Matisse …«
Den Rest des Satzes (»… von mir aus kann er in der Hölle schmoren«) ließ er in der Schwebe.
Dann nahm der Kunde vielleicht an, dass der Kunstgeschmack des Vorstands irgendwo zwischen Impressionismus und Expressionismus verhaftet geblieben war, während Victor sich tatsächlich nur an seinen Plan hielt.
Alderheim ließ sich vom Charme des Vorstands blenden. Der Neue kam ihm immer mehr wie der Sohn vor, den er nie hatte.
Damals trug Victor noch den gewöhnlichsten aller schwedischen Nachnamen, Svensson. Dennoch kam es vor, dass ihn jemand aus dem Kundenkreis zu einer Vernissage oder etwas anderem Widerlich-Wichtigem einlud. Er ging pflichtschuldigst hin. Harrte aus, lauerte auf jede Möglichkeit, seinen Aufstieg fortzusetzen.
Er gab sich zwei Jahre. Wenn er in dieser Zeit nicht zum Zuge kam, musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Dass sich schon alles von alleine ergeben würde, konnte er nicht glauben. Doch dann fiel ihm die Zukunft in den Schoß, ohne dass er lange danach suchen musste. Sie hieß Jenny.
Die Frau gehörte zu allem, was Victor verachtete. Sie war unbegreiflich, schwach und gefühlsduselig. Die Vorzüge, die sie trotz allem aufzuweisen hatte, nutzte er, indem er einmal wöchentlich eine Edelprostituierte in einem Stockholmer Nobelhotel aufsuchte. Der Edelstatus hatte den Vorteil, dass er auf Rechnung über das Geschäftskonto zahlen konnte. Wobei der Sex als Bilderrahmen, Leinwand oder ähnlich Passendes deklariert wurde. Er war nicht der Ansicht, dass man vom anderen Geschlecht sonst noch irgendwas Vergnügliches zu erwarten hatte. Außer …
Victor merkte, dass der alte Alderheim frühzeitig begonnen hatte, mit seiner Tochter zu spekulieren. Als Victor dort anfing, hatte sie zwar gerade erst laufen gelernt. Er war neunzehn Jahre und neun Monate älter, da würde es also Geduld brauchen. Und den weiteren Zuspruch des Alten. Der selber fünfundzwanzig Jahre älter war als seine misstrauische Frau. Die hätte der Verbindung auf lange Sicht im Wege stehen können, wenn sie sich nicht rechtzeitig selbst vom Acker gemacht hätte.
Jenny wuchs heran, ohne auch nur das kleinste bisschen attraktiv zu werden. Sie hielt sich im Hintergrund. Besaß null Ausstrahlung. Kleidete sich unvorteilhaft.
Aber sie war eine Alderheim. Und würde eines Tages erben. Die Ehe mit ihr konnte Victor sowohl einen vornehmen Nachnamen als auch letztendlich das ganze Geschäft einbringen.
Wenn nur die Alte nicht gewesen wäre. Victor hatte sie im Verdacht, für die Partei der Linken zu sein, denn sie fand, es sei Jennys Sache, die Liebe zu suchen und zu finden. Und stellte die Gefühlsechtheit und Treue des Vorstands infrage. Da sie damit nicht ganz falsch lag, traf es sich gut, dass sie den Löffel abgab.
Es dauerte bloß ein paar Tage: Krebs im ganzen Körper. Sie hatte ihre Schmerzen mit keinem Wort erwähnt. Kam nur einfach an einem Montag nicht mehr aus dem Bett. Wurde am Mittwoch hinausgetragen. Eine Woche darauf begraben.
Seit dem Verlust seiner Alten saß der Greis tagsüber oben in der Wohnung und trauerte vergangenen Zeiten hinterher. Abends ließ er Jenny in der Bibliothek mit den Ledersesseln, seinen Lieblingskunstwerken an den Wänden und dem großen Aquarium ein Kaminfeuer anmachen.
Dort lud er den Schwiegersohn in spe zum Kognak ein. Im Laufe einer Woche konnten da so einige Gläser zusammenkommen, aber das Getränk schmeckte lecker, und es war für einen guten Zweck. Tagsüber nahm sich Victor mit immer eleganteren Lügen der Kunden an, während er Klein-Jenny herumkommandierte.
Alderheims Tochter wurde zwölf, dann vierzehn und fünfzehn. Beklagte sich nie, schien keine eigenen Kontakte zu haben. Schulterte neue Aufgaben mit der gleichen unbeteiligten Miene wie eh und je. Mit der Zeit übernahm sie sämtliche Putzdienste in Wohnung und Geschäftsräumen. So sparte Victor eine Halbtagskraft und konnte sich etwas mehr Sex kaufen, ohne dass es zu Buche schlug. Außerdem beauftragte er sie mit dem langweiligen Archivdienst im Keller, wo sie sowieso am liebsten herumschlich. Sie roch sogar nach Archiv.
Als alles kaum noch besser werden konnte, da schlug aus heiterem Himmel der Blitz ein, und zwar in Gestalt einer früheren Nutte! Plötzlich tauchte sie in der Kunsthandlung auf, neben sich einen pubertären Knaben.
»Er heißt Kevin«, sagte sie.
»Hä?«, sagte Victor.
Die Frau bat den Jungen, rauszugehen und auf dem Bürgersteig zu warten. Als er außer Hörweite war, sagte sie:
»Er ist dein Sohn.«
»Sohn? Scheiße, der ist doch schwarz.«
»Wenn du mich genau ansiehst, geht dir vielleicht auf, wie es dazu kommen konnte.«
Die Frau machte sich keine Vorwürfe. Es gehörte nicht zu ihrem Berufsbild, den Charakter jedes einzelnen Kunden zu überprüfen, ehe man mit ihm ins Geschäft kam. Es gab nur eine Regel: Schläger durften nicht wiederkommen; wer nicht schlug, war willkommen, solange er seine Rechnung bezahlte. In letztere Kategorie hatte dieser Mann gehört.
Victor musste den Laden schließen und die verlogene Frau und ihren Knaben fortschaffen, bevor Jenny aus dem Archiv raufkam. Der Alte hockte wie üblich in der Siebenzimmerwohnung und hörte und sah nichts.
Der höchst eventuelle frischgebackene Vater scheuchte Mutter und Sohn vor sich her bis zu einem Café in einem anderen Stadtviertel. Er fragte, was sie wollte.
Und das war das Allerschlimmste: Er sollte sich seiner Verantwortung als Vater stellen. In all den Jahren hatte sie ihm kein Wort von Kevins Existenz gesagt, aber ein schweres Leben hatte seine Spuren hinterlassen. Nicht zu fassen, wie sehr die Frau in den paar Jahren abgebaut hatte. Und jetzt brauchte sie Hilfe. Und der Junge verdiente ja auch einen Vater.
Wenn es doch nur um Geld gegangen wäre.
»Was denn für Hilfe?«, fragte er.
»Ich bin krank.«
»Wie krank?«
Die Frau verstummte. Kevin hatte Musik auf den Ohren, aber zur Sicherheit schickte sie ihn zum Kiosk auf der anderen Straßenseite, Süßigkeiten kaufen. Und sagte:
»Ich werde sterben.«
»Werden wir das nicht alle?«
Neuerliches Schweigen am Tisch, dann ergänzte die Frau:
»Ich hab Aids.«
Victor rückte mit dem Stuhl nach hinten. »Scheiße, verdammte!«
* * *
Er wollte alles leugnen, aber die Infizierte konnte schließlich Beweise für ihre Behauptung haben. Und was Victors Lebensplanung anging, kam sie haargenau zum falschen Zeitpunkt.
Sie ließ sich nicht so einfach vertreiben. Ein Leben lang konnte sie unangekündigt in der Kunsthandlung aufkreuzen und Blut spucken oder mit dem Nächstbesten über seine Vaterschaft plaudern.
Jedenfalls ihr Leben lang. Das zum Glück nicht mehr allzu lange dauern würde.
Also waren auf Zeit spielen und Schadensbegrenzung das Gebot der Stunde.
In den nun folgenden Verhandlungen mit der todkranken Mutter versprach Victor, bis zur Volljährigkeit des Jungen die Verantwortung für ihn zu übernehmen, wenn sie niemals in dessen Hörweite das Wort Papa in den Mund nahm. Und auch sonst nie.
»Der Junge?«, sagte die Frau. »Er hat einen Namen. Kevin.«
»Nun wollen wir meine Worte mal nicht auf die Goldwaage legen.«
4. Kapitel
Während Kevins Mutter mit Ableben beschäftigt war, nahm sich Victor eine Woche Urlaub. Der zunehmend gebrechliche Greis Alderheim musste jetzt seinen Arsch hochkriegen und sich erstmals nach Jahren wieder im Geschäft nützlich machen. Währenddessen legte sich der Vorstand ein Apartment im abgelegensten aller südlichen Vororte von Stockholm zu, in dem er sein plötzliches Problem verstecken konnte. Achtzehn Quadratmeter, Bett, Kochnische, Tisch und zwei Stühle.
Er setzte den Jungen auf den einen Stuhl, sich selbst auf den anderen und verkündete die geltenden Regeln.
Vor allem dürfe Kevin bloß nie auf die Idee kommen, Victor wäre sein Vater. Aus reiner Menschenliebe habe er die Verantwortung übernommen, da Kevins komplett verantwortungslose Mutter allmählich den Löffel abgab. Vormund wäre als Anrede eigentlich passend, aber wenn Kevin das nicht so recht über die Lippen kommen wolle, sei auch Chef völlig in Ordnung.
Der Junge nickte, auch wenn er noch nie im Leben einen Chef gehabt hatte. Einen Vormund erst recht nicht. Und schon gleich gar keinen Vater.
Zweitens dürfe Kevin Victor keinesfalls in der Innenstadt aufsuchen. Er wohne hier in Bollmora, wo er jeden Tag auf die nächstgelegene Oberschule und wieder zurück gehen werde. Wenn er sich an die Anweisungen hielt, versprach der Chef, dass es jederzeit Pizza im Tiefkühlfach geben würde.
Kevin wollte wissen, wie es seiner Mama ging.
»Scheiß drauf, jetzt hör gefälligst zu. Das hier ist wichtig.«
Die drohende Krise war abgewendet. Als die lästige Frau außerdem wenige Wochen darauf starb, konnte alles zum Normalbetrieb zurückkehren. Kevin benahm sich, wie es sich gehörte, machte in der Schule keine Probleme, beschwerte sich nicht übers Essen. Und vor allem: Er kam nie in die Kunsthandlung. Es war fast, als gäbe es ihn nicht, was an und für sich ja das Allerbeste gewesen wäre.
* * *
Jenny wurde sechzehn und irgendwann siebzehn, wenn nicht gar achtzehn, ohne dass Victor auch nur im Entferntesten ein sexuell motivierter Grund eingefallen wäre, sie anzufassen. Aber darauf kam es ja auch nicht an. Sie sollten bloß heiraten.
Der Alte war ein hervorragender Heiratsvermittler. Bearbeitete tagtäglich seine nahezu willenlose Tochter. Gelegentlich so, dass Victor es auf die Entfernung hören konnte. Alderheim argumentierte mit dem Wunsch, sein Lebenswerk möge über seinen Tod hinaus fortgeführt werden; Jenny sei zu jung und unerfahren, um die Verantwortung selbstständig zu schultern, Victor hingegen ein reifer, verantwortungsvoller Mann. Absolut zuverlässig. Ob Jenny wohl meinte, sie könne Gefühle für ihn entwickeln?
Ihre Antwort ließ sich im Nebenzimmer unmöglich verstehen. Etwas Stilleres als Jenny war höchstens im Aquarium des Alten zu finden.
Das mit der Kleinen würde schon werden. Aber was den Bastard in Bollmora anging, da drückte ihn der Schuh. Die Zeit verging, und der Tag rückte immer näher, an dem Kevin achtzehn wurde. Wenn der Knabe erst volljährig war, hatte Victor ihn nicht mehr unter Kontrolle. Da würde er Stunk machen. Denn Victor glaubte nicht an das Gute im Menschen. Ob es noch einen Monat, ein halbes oder ganzes Jahr dauern würde, war ungewiss. Sicher war nur, dass Kevin eines Tages aufkreuzen und Geldforderungen an ihn stellen würde. Erst einen Hunderter für irgendwas, dann mehr für ein Fahrrad, dann noch mehr für ein Auto, für Auslandsstudien, ein eigenes Haus … Wenn der Junge erst gelernt hatte, Victor als seinen Bankomaten ohne Kartenlimit zu nutzen, war kein Ende abzusehen.
Mist.
Der Vorstand musste sich darauf konzentrieren, mit dem Alten gut Wetter und Jenny schöne Augen zu machen; er sollte allmählich um ihre Hand anhalten und dafür sorgen, dass die dumme Nuss ihm das Jawort gab. Wenn Kevin in Bollmora sich auch nur räusperte, konnte alles den Bach runtergehen. Victor war das schon lange klar; es war nur eine Frage der Zeit, bis auch der Junge darauf kommen würde.
Mord war keine Lösung. Aber wenn der Junge trotzdem sterben würde? Das wäre etwas anderes. Das Problem war nur, dass achtzehnjährige Jungs dies selten von sich aus machten. Kevin müsste nachgeholfen werden.
Victor erinnerte sich an die Widerstandsbewegung, mit der er vor langen Jahren zu tun gehabt hatte. Man musste ihnen lassen, dass sie unverdrossen weitermachten. In regelmäßigen Abständen wurde einer oder eine von ihnen wegen Körperverletzung, Gewalt gegen Vollzugsbeamte, Volksverhetzung, illegalen Waffenbesitzes und dergleichen mehr eingebuchtet. Zwischenzeitlich feilten sie an ihrem Parteiprogramm. Sie hatten in so vieler Hinsicht die richtigen Ideen. Mit das Erste, was sie vorhatten, wenn sie sich an die Macht durchgeboxt hätten, war, alle zurückzuschicken, die hier nichts zu suchen hatten. Die Iraner in den Iran, die Iraker in den Irak, die Jugoslawen … tja, da wurde es komplizierter. Aber Kevin würde garantiert in Afrika landen.
Der Gedanke war verlockend. Das Problem war nur, dass man nicht auf die Revolution der Widerstandsbewegung warten konnte. Wie viele würden da schon mitmachen? Hundert? Zweihundert? Und die Hälfte saß eh schon im Knast.
Nein, wie üblich blieb alles an ihm hängen.
Er dachte über die Sache mit Afrika nach.
Dann noch etwas länger, bis er schließlich einen guten alten Atlas aus dem Alderheim’schen Bücherregal zog.
Mit dem Zeigefinger fuhr er langsam über den afrikanischen Kontinent, bis er fast von allein anhielt. Und dann fasste er einen Entschluss.
Kevin gehörte nach Afrika wie der Fisch ins Wasser.
5. Kapitel
»Hallo, Kevin. Wie ich sehe, gehen dir die Pizzen langsam aus.«
»Hallo, Chef.«
Victor nickte zufrieden. Der Junge kannte die Regeln und hielt sich dran. Wohlerzogenes Bürschchen. Schwarz, aber immerhin wohlerzogen.
»Du wirst bald achtzehn.«
»Genau genommen heute.«
»Da schau her! Ich hab mir gedacht, wir beide könnten das nächste Woche mit einer Reise feiern. Es ist doch bestimmt doof, nie aus Bollmora rauszukommen.«
Reise, das hörte sich toll an. Obwohl es Kevin hier gefiel; und der Chef hatte ihm ja befohlen, sich von der Innenstadt fernzuhalten.
»Gut, ich sehe schon, du hast verstanden. Aber jedenfalls muss ich jetzt auf Dienstreise nach Nairobi. Möchtest du nicht mit? Dich dort ein bisschen umgucken.«
»Nairobi?«, sagte der Junge.
»Kenia«, sagte Victor.
In dem Moment beschlich Kevin eine erste Ahnung, dass da etwas war zwischen ihnen beiden, fast so, als ob der Chef noch mehr als nur der Chef wäre. Klar, er war schroff, bisweilen richtig unfreundlich, aber im innersten Kern? Sie würden gemeinsam auf Fernreise gehen. Zusammen die Welt entdecken. Zusammen sein.
»Danke, Papa …«, rutschte es Kevin raus.
Nicht, weil er es tatsächlich für möglich hielt, aber in seinem Leben fehlte ihm halt so jemand.
»Sag nicht Papa zu mir!«
Es dauerte ein paar Tage, die Pizzakartons, die am meisten im Weg waren, zu entsorgen und alles mit Pass und Tickets zu regeln. Victor buchte einen Hin- und Rückflug in der Businessklasse für sich und einen Economy-Hinflug für Kevin.
Dann flunkerte er Jenny und ihrem mehr oder weniger senilen Vater vor, er müsse einen Abstecher nach London machen, um einen potenziellen Kunden zu bearbeiten.
»In ein paar Tagen bin ich wieder da«, sagte er. »So lange musst du den Laden schmeißen.«
»Aber …«, setzte Jenny an.
»Gut so. Küsschen.«
Wer wusste schon, zu welchem afrikanischen Land Kevin gehörte. Victor wählte das Reiseziel aus anderen Gründen: so viel Zivilisation, dass er selbst keinen Schaden nahm, von daher Kenia, nicht Somalia. Und wild genug, dass der Junge aufgeschmissen war, also kein Nationalpark mit nächster Bushaltestelle in fußläufiger Entfernung. In groben Zügen lief das – von Nairobi aus gesehen – auf fünfhundertfünfzig Kilometer ab in die Pampa hinaus.
* * *
Bislang hatte die Reise Kevins Hoffnungen enttäuscht. Im Flugzeug hatten sie das Pech gehabt, auf ganz verschiedenen Plätzen zu landen, sodass die Fantasien des Achtzehnjährigen geplatzt waren – von wegen Plaudereien über das Leben und die Zukunft. Einander kennenlernen. Und lieben.
Am Flughafen wartete ein Mietwagen, und Victor bot dem Jungen an, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Wie einem Ebenbürtigen. Vielleicht war es jetzt so weit?
Der Junge wünschte sich, die Fahrt möge lange dauern, sie saßen ja nebeneinander.
»Wo fahren wir hin, Papa?«, fragte er.
»Sag nicht Papa zu mir, hab ich gesagt.«
Damit war das Gespräch beendet.
Der Chef schwieg hartnäckig, während er den Range Rover mithilfe des Navis in die richtige Richtung lenkte. Aber es ging einfach immer geradeaus, nach Westen.
Auch der Junge schwieg, geschlagene drei Stunden lang. Was gab es schon zu sagen? Irgendwann war er es dann doch leid.
»Kannst du nicht sagen, wo wir hinfahren? Ich bin neugierig.«
»Ständig dieses Gequengel. Genieß die Aussicht, verdammt.«
Aus der A104 wurde die B3, dann die C12. Die Straßen nahmen an Breite wie auch an Qualität ab. Als die Dämmerung hereinbrach, wurde aus dem Asphalt Schotter. Victor und der Junge befanden sich schon eine ganze Weile in der endlos weiten Savanne. Am Äquator geht die Dämmerung rasch in Stockfinsternis über. Und gerade, als es um sie her nur noch schwarz war, hielt Victor den Wagen an.
»Jetzt sind wir da.«
»Wo da?«
»Wo du hingehörst. Steig aus.«
Was Kevin auch tat, während Victor bei laufendem Motor am Steuer sitzen blieb. Er ließ den Jungen neben einer Akazie zurück und fuhr ein Stückchen weiter bis zu einer Stelle, an der er wenden konnte. Auf dem Rückweg ließ er das Seitenfenster zu einem Abschiedsgruß runterfahren.
»Nimm’s mir nicht übel. Hier draußen läuft sicher alles bestens für dich. Ich glaube, du hast das im Blut.«
»Aber Papa …«, sagte Kevin.
»Scheiße, das gibt’s doch nicht«, sagte Victor und fuhr davon.
Der Junge war zurückgebracht, Auftrag erledigt. Für den Rest würde die Natur schon sorgen. Wer konnte Victor daraus schon einen Strick drehen?
Gut vierundzwanzig Stunden später stand er wieder in der Kunsthandlung. Um eine Reiseerfahrung reicher. Und ein Problem ärmer.
»Wie war es in London?«, wollte Jenny wissen.
»Heiß«, sagte Victor.
Es war der fünfundzwanzigste Februar.
* * *
Das Finanzamt weigerte sich, Kevin für tot zu erklären. Nachdem Victor sein Verschwinden bei der Polizei angezeigt hatte, verlangte das Amt von ihm, Formular 7695 auszufüllen, »Antrag auf Todeserklärung einer verschwundenen Person«. Danach wollten sie sich die Sache fünf Jahre lang überlegen. Fünf Jahre! Die Löwen dürften wohl kaum länger als fünf Minuten gebraucht haben.
Aber alles andere ging nach Victors Plan. Der ewig untröstliche Witwer im ersten Stock hatte inzwischen das ganze Geschäft ihm und der Tochter überlassen, und Jenny hatte Victor ihr Jawort gegeben, nachdem er erst tief Luft geholt und ihr dann einen Heiratsantrag gemacht hatte. Ersteres, um seine Abneigung zu überwinden, nicht etwa aus Nervosität, denn sie gab eh nie Widerworte.
Als Victor seinem Schwiegervater in spe die freudige Heiratsbotschaft überbrachte, erzählte er ihm auch gleich von seinem Vorhaben, in diesem Fall den Nachnamen von Tochter und Schwiegervater anzunehmen.
»Nach allem, was du für mich getan hast«, sagte er wahrheitsgetreu.
Dem Schwiegervater kamen die Tränen. Dass seiner geliebten Tochter so ein Glück zuteilwurde!
Bald würde die ganze Herrlichkeit Victor gehören. Fehlten nur noch Brief und Siegel.
Die paar Jahre, die es noch dauerte, bis der Alte von allein abtrat, waren anstrengend. Beim Kognak kam er regelmäßig darauf zu sprechen, dass ein Enkel unterwegs sein könnte. Victor wand sich da geschickt raus. Um nicht der fleischlichen Versuchung zu erliegen, buchte er sich wöchentliche Doppeltermine bei den Edelnutten. Mit Kondomen. Noch mehr Bastarde, ob echt oder erfunden, sollten ihm nicht in die Quere kommen.
Und dann war er da, der bis dato beste Tag in Victors Leben. Ausgerechnet am Weihnachtsabend plauderte der Alte. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte Victor sich nicht wünschen können!
»Liebe Jenny, lieber Victor. Ich werde bald mit Hillevi vereint.«
»Was sagst du da, Papa?«, fragte Jenny bestürzt.
»Ich habe überall im ganzen Körper Krebs, genau wie Mama.«
Halleluja, halleluja, dem Herrn sei Lob und Preis immerdar, dachte Victor.
»Wie furchtbar«, sagte er.
Jetzt standen ihm alle Türen offen. In zwanzig Jahren und elf Tagen aus dem Nichts zu den höchsten Höhen.
Victor wartete nicht viel länger, als bis die Leiche seines Schwiegervaters erkaltet war, dann traf er seine letzten Maßnahmen: Er gründete eine neue Aktiengesellschaft (Sieg oder stirb Immobilien GmbH), sicherte die Firma per Ehevertrag ab und brachte Jenny dazu, ihm die Kunsthandlung, die Siebenzimmerwohnung und das gesamte Vermögen zu schenken – woraufhin er das Geschenkte für eine Krone an die Firma verkaufte. Vertraglich wurde der Ehefrau im Scheidungsfall das Recht auf fünfzig Öre zugesichert. Alles andere sollte ihm zufallen.
Das Ganze war ein Klacks. Jenny unterschrieb wie immer alles, was Victor ihr unter die Nase hielt. In einzelnen Ausnahmefällen stellte sie eine Frage, aber keine, die sich nicht abwehren ließ. Zum Beispiel wollte sie wissen, warum ihrer beider Ehevertrag an die neu gegründete Firma geknüpft sein musste. Victor sagte, er wolle sie nicht mit bürokratischem Papierkram belasten, jetzt, wo sie Kinder kriegen wollten und alles.
Freilich hätte sie später den Vertragstext vor Gericht anfechten können, womöglich sogar mit gewissem Erfolg. Aber nur rein theoretisch. Victor wusste, dass sie praktisch nicht das Zeug dazu hatte. Und für fünfzig Öre war auch nicht allzu viel Rechtsbeistand zu kriegen.
Vieles war zu bedenken, damit alles nahtlos ineinandergriff. Nach all den Jahren im volksfeindlichen Kunsthandel brannte Victor ein bestimmtes Anliegen ganz besonders auf den Nägeln. Er verschleuderte zwölf Werke der Moderne und zerriss und entsorgte ein dreizehntes, einen mit hundertachtzigtausend Kronen ausgepreisten Erich Heckel. Oder »Erik Ekel«, wie Victor ihn bei sich nannte. Das Motiv war eine halb nackte Frau mit androgynen Gesichtszügen und grünen Lippen. Das Androgyne stellte eine so grobe Beleidigung von Schönheit wie auch Zucht und Ordnung dar, dass Victor aus Rücksicht auf das Gemeinwohl den Mist nicht einmal gratis unter die Leute bringen wollte.
Nach der einleitenden Kunst-Säuberungsaktion meldete er Jenny heimlich in dem Apartment in Bollmora an. Ob das wirklich nötig war, erschien fraglich, doch um mit der lästigen Justiz fertigzuwerden, musste man auf Nummer sicher gehen.
Danach hieß es endlich Bahn frei für den Scheidungswilligen.
»Möchtest du heute Abend Lachs oder Hähnchen?«, erkundigte sich Jenny eines Tages.
»Gerne Hähnchen«, sagte Victor. »Und dann möchte ich die Scheidung.«
Es kam nicht anders an als erwartet.
»Also Hähnchen«, sagte Jenny.
Papa war ja tot. Warum sollte sie versuchen, neues Leben in eine Beziehung zu bringen, mit der es sich ebenso verhielt?
Ein paar Wochen später wurde die Scheidung rechtskräftig, da Jenny immer noch alles unterschrieb. Victor erklärte es sich damit, dass sie unterbelichtet war. In Wahrheit wollte sie ihn nur loswerden. Und nichts wie weg.
Was ihr gelang. Und doch auch wieder nicht. Nach einem Schlummerzustand, der ihr ganzes bisheriges Leben angehalten hatte, erwachte sie eines Tages in einem Apartment in Bollmora, mit wenig mehr als fünfzig Öre und den Kleidern, die sie am Leib trug.
* * *
Dabei war Jenny nicht ganz so willensschwach, wie Victor dachte. Sie hatte sich frühzeitig entschieden, vorrangig mit Kunst Umgang zu pflegen, mit Menschen dagegen nur zweitrangig, und auch nur, wenn ihre Zeit es zuließ. Und Victor und die Umstände sorgten schon dafür, dass es gar nicht erst dazu kam.
Es stimmte, dass sie sich vor allem um ihren alten Vater und an zweiter Stelle um das Kellerarchiv kümmerte. Doch dort unten, unter Mappen und Dokumenten, war sie nicht einsam. Sie hatte Freunde wie Franz Kafka und August Strindberg in einem kleinen Bücherregal und schmückte die Wände mit billigen Papierreproduktionen in Originalgröße von Bildern Vincent van Goghs, Max Beckmanns, Isaac Grünewalds, Marc Chagalls, Ernst Ludwig Kirchners, Irma Sterns und noch einiger anderer.
In Gesellschaft der Künstler malte sie selber Ölbilder. Was ihr so schlecht gelang, dass ihr von Tag zu Tag klarer wurde, was für Genies ihre Freunde waren. Die Archivarin Jenny malte, und wenn sie damit fertig war, verriss die Kunstkritikerin Jenny das Ergebnis. Unterm Strich ein recht angenehmes Dasein. Dort, im fensterlosen Keller, war sie in ihrem eigenen Unglück glücklich. Es gab ihr das Gefühl, etwas mit ihrem Freund Kafka gemeinsam zu haben, der seinerseits fand, dass er nicht einmal mit sich selbst etwas gemeinsam hatte.
Es konnte vorkommen, dass sie sich fragte, wie sie mit so wenig zufrieden sein konnte; dann suchte sie im Internet nach einer Antwort, nach möglichen Gemeinsamkeiten zwischen sich und den Genies. Sie konnte nicht psychisch krank werden wie Munch (der seine eigene Angst gemalt hatte), Goya (der halluziniert hatte) oder Chalepas (der seine eben erst geschaffenen Skulpturen zerstört hatte), aber eine »neuropsychiatrische Beeinträchtigung« war nicht auszuschließen. Das musste also reichen.
Die höchst hypothetische Beeinträchtigung hatte sie nicht an der Entdeckung gehindert, dass der Vorstand ihr den Hof machte. Und dass ihr geliebter Vater die Verbindung begrüßte. Victor, ein gutes Stück älter, schien nichts von der Welt der modernen Kunst zu verstehen, die ihr Ein und Alles war. Aber er war der Favorit ihres Vaters und ein Garant für die Zukunft der Galerie. Der Vater war nie so weit gegangen, sich vorzustellen, dass sie selbst dafür infrage käme. Bis vor Kurzem war sie ja bloß ein Mädchen gewesen. Und jetzt nicht viel mehr als eine junge Frau.
Und überhaupt, was sollte das mit der Liebe? Außer der zu den unsterblichen und leider Gottes trotzdem toten Künstlern der Moderne.
Sie nahm seinen Heiratsantrag an. Oder hatte ihr Vater das getan? Zur Bestätigung hatte sie stumm genickt.
Vor einem Standesbeamten im Rathaus musste sie ihrem Vater zuliebe dann doch sagen, was sie sagte. Da sie für ihren neuen Mann keine innigen Gefühle aufbringen konnte, verspürte sie alles andere als Sehnsucht nach den ehelichen Pflichten, die sie erwarteten. Dass nichts daraus wurde, war zwar seltsam, passte ihr aber gut in den Kram. Wenn sie sich gerne vor jemandem auszog, dann vor Ernst Ludwig Kirchner. Nur zu gern hätte sie mit Marzella auf dem Bild im Moderna Museet in Stockholm getauscht. Oder mit einer der fünf nackten Badenden im Brücke-Museum in Berlin.
Kirchner war die fleischgewordene unglückliche Liebe. 1880 geboren. Nahm sich 1938 das Leben aus Verzweiflung darüber, was Adolf Hitler da durchzog.
Hinterher ist man immer schlauer. Der frischgebackene Ehemann bat sie um ihre Unterschrift, und sie unterschrieb. Er redete ja so viel und so schlimmes Zeug; wenn sie einfach machte, was er sagte, konnte sie zu ihren Freunden im Keller zurück, mit dem Gedanken, dass ihr Vater zufrieden war. Solange er lebte.
Tja, hinterher ist man immer schlauer. Zum Beispiel auch die Sache, dass sie nie miteinander schliefen. Mit dreiundzwanzig hatte Jenny immer noch keine Erfahrung. Sie war zwar lange genug zur Schule gegangen und hatte genügend Netflix geguckt, um die Grundvoraussetzungen zu begreifen. Salvador Dalís Meisterwerk Der große Masturbator weckte ihr Mitleid mit dem Spanier. Es hieß, Dalí habe beim Malen an sich selbst gedacht.
Dass Victor sich ihr nie näherte, schob sie auf Schüchternheit und Unsicherheit hinter der selbstsicheren Fassade. Er wusste ja fast nichts über Kunst. Schon gar nicht über moderne Kunst. In ihren Augen war er nie kleiner, als wenn er den Kunden sein »Immer dieser Matisse«-Sprüchlein aufsagte. Einmal hatte sie ihm in einem Buch dessen Harmonie in Rot gezeigt. »Was ist das denn für’n Scheiß?«, hatte er gesagt. »Sag nicht, du hast das gekauft!«
Immer dieser Matisse?
Jetzt hingegen verstand sie alles.
Er war kein unschuldiger Ahnungsloser. Sondern hatte Pläne. In denen sie nicht vorkam, oder nur als Mittel zum Zweck.
Verdammter Mist. Kein richtiges Zuhause mehr, keine Galerie, keinen Keller voller Freunde, kein Leben.
Da konnte sie ebenso gut ins Wasser gehen.
Sie kannte sich in den südlichen Außenbezirken Stockholms nicht aus, war nie zuvor dort gewesen, aber in der Hauptstadt und drum herum gab es ja überall Wasser. Man musste wohl einfach nur losgehen, egal in welche Richtung. Wie lange konnte es dauern? Eine Viertelstunde?
Sie ging langsam, hatte es nicht unbedingt eilig mit ihrem Tod. Sah sich sogar um. Offenbar wurde es allmählich Winter. Die Sonne schien, viele gingen mit Kinderwagen spazieren. Vermutlich war gerade Wochenende. Vielleicht Sonntag?