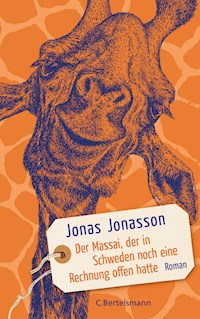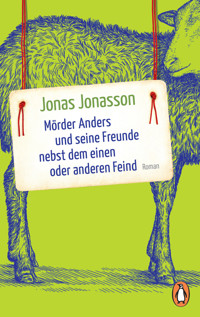
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mörder, der mit Jesus spricht, eine Pfarrerin, die mit Gott hadert, und ein frustrierter Hotelmitarbeiter, der von der Liebe überrascht wird. Ein unbeschreiblich skurriles Trio, das zu einer großen Mission aufbricht: Sie wollen die Menschen glücklicher und den eigenen Geldbeutel voller machen. Und das auf ihre ganz besondere Weise: tollkühn, unverfroren, mit viel Glück (und ein wenig Verstand) …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Johan Andersson – seit seinen zahllosen Gefängnisaufenthalten nur noch »Mörder-Anders« genannt – ist frisch aus dem Knast entlassen, braucht eine Bleibe, neue Freunde und ein wenig Kleingeld, um sich das Leben schönzutrinken. Da kommt ihm die Begegnung mit der Pfarrerin Johanna Kjellander, die wegen ihrer atheistischen Gesinnung frisch entlassen wurde, gerade recht. Johanna ist ebenfalls auf der Suche nach dem schnellen Geld und hat eine geniale Geschäftsidee: Zusammen mit dem Hotel-Rezeptionisten Per Persson gründen sie eine »Körperverletzungsagentur« mit Mörder-Anders in der Rolle des Auftragsschlägers. Das Geschäft läuft blendend. Bis Mörder-Anders plötzlich beschließt, friedfertig zu werden und riskiert, dass seine eigene Firma überflüssig wird …
Augenzwinkernd, raffiniert und mit einem Feuerwerk an genialen Einfällen hält Jonas Jonasson der modernen Gesellschaft einen Spiegel vor und hat mit Mörder-Anders einen unvergesslichen Anti-Helden erschaffen.
Autor
Jonas Jonasson, geboren 1961 im schwedischen Växjö, arbeitete zunächst als Journalist und gründete später eine Medien-Consulting-Firma. Nach 20 Jahren in der Medienwelt verkaufte er seine Firma und schrieb den Roman Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das Buch wurde zum legendären Weltbestseller. Auch seine weiteren Romane Die Analphabetin, die rechnen konnte (carl’s books 2013) und Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind (carl’s books 2016), wurden riesige internationale Erfolge. Jonas Jonasson lebt auf der schwedischen Insel Gotland.
Jonas Jonassons
Mörder Andersund seine Freundenebst dem einenoder anderen Feind
Roman
Aus dem Schwedischen von Wibke Kuhn
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan ovän) im Piratförlaget, Stockholm 2015.
Copyright © 2015 Jonas Jonasson
First published by Piratförlaget, Sweden
Published by agreement with Brandt New Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 bei carl’s books, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: bürosüd
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18232-8V005
www.penguin.de
Das hätte Dir gefallen, Papa.Deswegen widme ich es Dir.
1. TEIL Ein Gewerbe der ganz anderen Art
1. KAPITEL
Er, dessen Leben schon bald voll sein sollte von Tod und Gewalttaten, von Dieben und Gangstern, stand an der Rezeption eines der traurigsten Hotels von ganz Schweden und träumte vor sich hin.
Pferdehändler Henrik Bergmans einziger Enkel führte die gesammelten Kränkungen seines Lebens wie immer auf seinen Großvater zurück. Der Kerl war in Südschweden der Beste seines Fachs gewesen und hatte nie unter siebentausend Tiere pro Jahr verkauft, und zwar nur erstklassige.
Doch ab Mitte der Fünfzigerjahre begannen die Bauern, diese Verräter, Großvaters Kalt- und Warmblüter gegen Traktoren auszutauschen, und das in einem Tempo, das dem alten Herrn einfach nicht in den Kopf gehen wollte. Aus siebentausend Verkäufen wurden erst siebenhundert, dann siebzig, dann sieben. Innerhalb von fünf Jahren war das Millionenvermögen der Familie in einer Dieselwolke verraucht. Der Vater des noch ungeborenen Enkels versuchte 1960 zu retten, was zu retten war, indem er die Bauern der Gegend abklapperte und ihnen predigte, dass die Technik ein Fluch ist. Es gingen ja so viele Gerüchte. Zum Beispiel, dass man vom Dieselbrennstoff Krebs bekam, wenn man damit in Berührung kam, was sich ja schlecht vermeiden ließ.
Und dann fügte Papa noch hinzu, dass Diesel wissenschaftlichen Studien zufolge Unfruchtbarkeit beim Mann hervorrufen könne, aber das hätte er besser bleiben lassen. Denn erstens stimmte es nicht, und zweitens klang das gar zu lieblich in den Ohren der geplagten, aber dennoch ralligen Bauern, die jeweils drei bis acht Kinder zu versorgen hatten. Der Kauf von Kondomen war ihnen peinlich, im Unterschied zum Erwerb eines Massey Ferguson oder John Deere.
Großvater starb völlig mittellos, obendrein von seinem besten Pferd zertrampelt. Sein trauernder pferdeloser Sohn sattelte um, besuchte irgendeinen Kurs und bekam danach eine Stelle bei Facit AB, einem der weltweit führenden Hersteller von Schreib- und Rechenmaschinen. So brachte er es fertig, innerhalb eines Menschenlebens nicht nur einmal, sondern gleich zweimal von der Zukunft überholt zu werden, denn plötzlich tauchten elektronische Rechner auf dem Markt auf. Wie um das ziegelsteinschwere Produkt von Facit zusätzlich zu verhöhnen, passte die japanische Variante auch noch in die Innentasche eines Jacketts.
Die Apparate des Facit-Konzerns schrumpften nicht (jedenfalls nicht schnell genug), doch der Konzern selbst schrumpfte sehr wohl, um zu guter Letzt zu einem Nichts zu verschrumpeln.
Der Pferdehändlerssohn nahm seinen Abschied. Um zu verdrängen, dass er gleich zweimal vom Schicksal hereingelegt worden war, griff er zur Flasche. Arbeitslos, verbittert, ewig ungeduscht und niemals nüchtern, verlor er binnen Kurzem alle Anziehungskraft auf seine zwanzig Jahre jüngere Frau, die es erst noch eine Weile bei ihm aushielt und dann noch eine Weile.
Bis sich die geduldige junge Frau schließlich dachte, dass sie den Fehler, den falschen Mann geheiratet zu haben, rückgängig machen konnte.
»Ich will die Scheidung«, sagte sie eines Vormittags zu ihrem Mann, während er in weißer Unterhose mit dunklen Flecken durch die Wohnung taperte und irgendetwas suchte.
»Hast du die Kognakflasche gesehen?«, sagte ihr Mann.
»Nein. Aber ich will die Scheidung.«
»Ich hab sie gestern Abend auf die Spüle gestellt, du musst sie weggeräumt haben.«
»Schon möglich, dass sie im Schnapsschrank gelandet ist, als ich die Küche aufgeräumt habe, ich weiß es nicht mehr. Aber ich versuche dir die ganze Zeit zu erklären, dass ich die Scheidung will.«
»Im Schnapsschrank? Natürlich, da hätte ich gleich suchen sollen. Wie dumm von mir. Ziehst du hier aus? Dann nimmst du den kleinen Hosenscheißer da auch mit, oder?«
Ja, sie nahm das Baby mit. Einen semmelblonden Jungen mit freundlichen blauen Augen. Der weit später Rezeptionist werden sollte.
Die Mutter hatte eine Laufbahn als Sprachlehrerin ins Auge gefasst, aber das Baby war damals eine Viertelstunde vor der Abschlussprüfung gekommen. Jetzt fuhr sie mit dem Kleinen und ihrem ganzen Sack und Pack nach Stockholm und unterschrieb die Scheidungspapiere. Dann nahm sie wieder ihren Mädchennamen an, Persson, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das für den Jungen bedeutete, der bereits den Vornamen Per bekommen hatte (nicht, dass es unmöglich wäre, Per Persson zu heißen oder von mir aus auch Jonas Jonasson, aber es kann ein bisschen eintönig wirken).
In der Hauptstadt wartete eine Arbeit als Politesse auf sie. Da lief Per Perssons Mutter die Straßen auf und ab und musste sich mehr oder weniger täglich von männlichen Falschparkern pampig kommen lassen, vor allem von solchen, die sich das auferlegte Bußgeld problemlos leisten konnten. Der Lehrerinnentraum löste sich in Luft auf, der Traum, das Wissen zu verbreiten, nach welchen deutschen Präpositionen der Akkusativ steht und nach welchen der Dativ, und das Ganze an Schüler, denen das im Allgemeinen sicher herzlich egal war.
Aber als seine Mutter eine halbe Ewigkeit mit dem Job zugebracht hatte, der eigentlich nur vorübergehend sein sollte, ergab es sich, dass einer dieser ganzen pampigen Falschparker auf einmal in der Politessenuniform die Frau entdeckte. Eins kam zum anderen, und so saßen sie zum Essen in einem feinen Restaurant, in dem man den Strafzettel bei einem Kaffee mit Schuss fein säuberlich in der Mitte durchriss. Und als es dann wieder zum nächsten kam, hatte der Falschparker der Mutter von Per Persson auch schon einen Heiratsantrag gemacht.
Der Bräutigam war ein isländischer Banker auf dem Heimweg nach Reykjavik. Er versprach seiner zukünftigen Gattin das Blaue vom Himmel, wenn sie mit ihm mitkam. Den Sohn hätte er auch in Kauf genommen. Doch mittlerweile war schon so viel Zeit vergangen, dass der semmelblonde kleine Junge volljährig war und über sich selbst bestimmen konnte. Er rechnete sich in Schweden eine hellere Zukunft aus, und da niemand die folgenden Ereignisse mit dem vergleichen kann, was stattdessen hätte geschehen können, kann man nicht sagen, wie recht oder unrecht der Sohn mit dieser Rechnung hatte.
Per Persson hatte sich schon als Sechzehnjähriger neben dem Gymnasium, in das er sich nicht besonders reinkniete, einen Job besorgt. Er erzählte seiner Mutter nie detailliert, worin seine Arbeit bestand. Und er hatte seine Gründe.
»Wohin gehst du, mein Junge?«, konnte seine Mutter fragen.
»In die Arbeit, Mama.«
»So spät?«
»Ja, die haben fast immer offen.«
»Was machst du da denn eigentlich?«
»Das hab ich dir doch schon tausendmal erklärt. Ich bin Assistent in der … Unterhaltungsbranche. Zwischenmenschliche Begegnungen und all so was.«
»Wie – Assistent? Und was bedeutet …«
»Ich muss jetzt wirklich los, Mama. Wir können ja später weiterreden.«
Und wieder einmal hatte sich Per Persson erfolgreich herausgeredet. Natürlich erzählte er ungern Details, wie zum Beispiel, dass sein Arbeitgeber in einem großen, heruntergekommenen gelben Holzhaus in Huddinge, südlich von Stockholm, flüchtige Liebe portionierte und verkaufte. Oder dass sich dieses Etablissement Club Amore nannte. Oder dass seine Arbeit darin bestand, sich um die Logistik zu kümmern sowie den Anreißer und Kontrolleur zu geben. Jeder Besucher musste für den richtigen Zeitraum und die richtige Liebe das richtige Zimmer finden. Der Junge erstellte den Zeitplan, behielt die Zeit im Auge, horchte an den Türen (und ließ seiner Fantasie freien Lauf). Wenn er das Gefühl hatte, dass da was aus dem Ruder lief, schlug er Alarm.
Als seine Mutter auswanderte und Per Persson auch offiziell mit seiner Ausbildung fertig war, beschloss sein Arbeitgeber, die Branche zu wechseln. Aus Club Amore wurde Pension Sjöudden. Die lag zwar nicht an einem See, und auf einer Landzunge oder Udde auch nicht. Aber wie der Hotelbesitzer so schön sagte: »Irgendwie muss der Scheiß ja heißen.«
Vierzehn Zimmer. Zweihundertfünfundzwanzig Kronen pro Nacht. Gemeinschaftstoiletten und -duschen. Einmal die Woche neue Laken und Handtücher, aber auch nur dann, wenn die benutzten wirklich hinreichend benutzt aussahen. Der Besitzer hatte sich eigentlich nicht gewünscht, seinen Betrieb von Liebesnest auf drittklassiges Hotel umzustellen. Er hatte ordentlich Geld verdient, solange seine Gäste Gesellschaft im Bett hatten. Und wenn sich eine Lücke im Stundenplan der Mädchen auftat, konnte er selbst zu einer von ihnen unter die Decke schlüpfen.
Der einzige Vorteil an der Pension Sjöudden war der, dass sie nicht so illegal war. Der ehemalige Sexclubinhaber hatte acht Monate sitzen müssen, und seiner Meinung nach war das mehr als genug.
Per Persson, der sein logistisches Talent unter Beweis gestellt hatte, wurde die Stelle als Rezeptionist angeboten, und das war nicht das Schlechteste (von der miesen Bezahlung einmal abgesehen). Er musste das Ein- und Auschecken übernehmen, dafür sorgen, dass die Gäste bezahlten, die Reservierungen und Absagen im Auge behalten. Dabei durfte er es sich durchaus auch ein wenig gemütlich machen, solange es sich nicht negativ auf die Bilanz auswirkte.
Es war ein neues Unternehmen unter neuem Namen, und Per Perssons Auftrag war ein anderer und verantwortungsvollerer als zuvor. Das veranlasste ihn, seinen Chef aufzusuchen und ihm mit allem Respekt eine Gehaltsanpassung vorzuschlagen.
»Nach oben oder nach unten?«, fragte der Chef.
Per Persson antwortete, er würde eine Anpassung nach oben vorziehen. Das Gespräch hatte eine andere Wendung genommen als erhofft. Jetzt stand er da und hoffte, zumindest den Lohn zu behalten, den er schon hatte.
Genau so ging es auch aus. Sein Chef war jedoch so großzügig, ihm einen Vorschlag zu machen: »Zieh doch ins Zimmer hinter der Rezeption, verdammt, dann sparst du dir die Miete für die Wohnung, die du von deiner Mutter übernommen hast.«
Tja. Per Persson musste ihm zustimmen, auf die Art ließ sich ein wenig Geld einsparen. Da ihm sein Lohn ohnehin schwarz ausgezahlt wurde, konnte er ja versuchen, nebenher noch Sozialhilfe und Arbeitslosenunterstützung zu bekommen.
So kam es, dass der junge Rezeptionist völlig in seiner Arbeit aufging. Er lebte in seiner Rezeption. Es verging ein Jahr, es vergingen zwei, es vergingen fünf, und im Wesentlichen wurde die Lage für den Jungen nicht besser, als sie für seinen Vater und seinen Großvater gewesen war. Und daran bekam der verstorbene Großvater die Schuld. Der Mann war Multimillionär gewesen. Jetzt stand sein eigen Fleisch und Blut in dritter Generation hinter einem Tresen und empfing übel riechende Hotelgäste, die sich Mörder-Anders nannten oder auf ähnlich schreckliche Namen hörten.
Mörder-Anders war zufällig einer der Langzeitbewohner in der Pension Sjöudden. Eigentlich hieß er Johan Andersson und hatte sein ganzes Erwachsenenleben im Gefängnis gesessen. Mit Worten und Formulierungen hatte er sich noch nie leichtgetan, aber er kam schon früh dahinter, dass man trotzdem zu seinem Recht kam, wenn man Leute, die einem widersprachen – oder so aussahen, als wollten sie widersprechen –, einfach verdrosch. Und bei Bedarf auch gerne noch mal verdrosch.
Diese Art von Gesprächen führte mit der Zeit dazu, dass der junge Johan in schlechte Gesellschaft geriet. Seine neuen Bekannten überzeugten ihn davon, seine bereits gewalttätige Argumentationstaktik mit Schnaps und Tabletten zu unterfüttern, und da war es auch schon aus. Schnaps und Tabletten brachten ihm zwölf Jahre ein, als er zwanzig war, weil er dem Gericht nicht erklären konnte, wie seine Axt in den Rücken des größten Amphetamindealers in seinem Viertel geraten war.
Nach acht Jahren war Mörder-Anders wieder draußen und feierte seine Entlassung mit solchem Schwung, dass er kaum nüchtern war, als er schon vierzehn neue Jahre aufgebrummt bekam. Diesmal war eine Schrotflinte im Spiel gewesen. Aus nächster Nähe. Direkt ins Gesicht der Person, die die Nachfolge des Mannes mit der Axt im Rücken angetreten hatte. Kein schöner Anblick für denjenigen, den man zur Tatortreinigung gerufen hatte.
Mörder-Anders behauptete vor Gericht, es sei keine Absicht gewesen. Glaubte er zumindest. Vom Ablauf der Ereignisse wusste er nicht mehr allzu viel. Ungefähr so wie beim nächsten Mal, als er einem dritten Tablettengroßhändler die Kehle durchschnitt, weil der ihm unterstellt hatte, schlechte Laune zu haben. Der Mann mit wenig später durchschnittener Kehle hatte zwar in der Sache recht gehabt, aber das hatte ihm nicht viel genützt.
Mit sechsundfünfzig Jahren war Mörder-Anders wieder in Freiheit. Im Unterschied zu den Malen davor ging es nicht um einen vorübergehenden Besuch, sondern um einen permanenten Aufenthalt. So hatte er es zumindest geplant. Er musste nur dem Schnaps aus dem Weg gehen. Und den Tabletten. Und allem und jedem, der oder das mit Schnaps und Tabletten zu tun hatte.
Mit Bier war es nicht so schlimm, davon wurde er vor allem fröhlich. Oder halbwegs fröhlich. Oder zumindest nicht wahnsinnig.
Er hatte die Pension Sjöudden in dem Glauben aufgesucht, dass das Etablissement immer noch Erlebnisse der Art bot, die einem schwer abgehen können, wenn man ein Jahrzehnt hinter Gittern sitzt, oder auch drei. Nachdem er seine Enttäuschung über die veränderten Umstände überwunden hatte, beschloss er, stattdessen einfach einzuchecken. Er brauchte ja irgendeine Unterkunft, und über gut zweihundert Kronen pro Nacht konnte man sich im Grunde nicht aufregen, vor allem nicht, wenn man sich vor Augen hielt, wohin das Aufregen immer so führte.
Noch bevor er sich das erste Mal den Zimmerschlüssel geben ließ, hatte Mörder-Anders dem jungen Rezeptionisten, der ihm über den Weg lief, seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Zu dieser Geschichte gehörte seine Kindheit, auch wenn der Mörder fand, dass sie für die folgenden Geschehnisse nicht relevant war. Seine frühen Jahre hatten in erster Linie so ausgesehen, dass sich sein Vater nach der Arbeit volllaufen ließ, um die Arbeit weiter zu ertragen, und dass seine Mutter es ebenso machte, um seinen Vater weiter zu ertragen. Das führte dazu, dass sein Vater seine Mutter nicht mehr ertragen konnte und ihr das zeigte, indem er sie regelmäßig verprügelte, meistens, während sein Sohn dabei zusah.
Der Rezeptionist traute sich nach der ganzen Erzählung nichts anderes mehr, als Mörder-Anders mit einem Händedruck willkommen zu heißen und sich vorzustellen:
»Per Persson«, sagte er.
»Johan Andersson«, sagte der Mörder und versprach zu versuchen, in Zukunft so wenig Morde wie möglich zu begehen.
Daraufhin fragte er den Rezeptionisten, ob er wohl ein Pils entbehren könne. Nach siebzehn Jahren ohne konnte man schon eine leicht trockene Kehle bekommen.
Per Persson hatte nicht vor, seine Beziehung zu Mörder-Anders damit zu beginnen, dass er ihm ein Bier verweigerte. Aber während er ihm einschenkte, fragte er, ob der Herr Andersson sich vorstellen könne, Schnaps und Tabletten außen vor zu lassen.
»Ja, dann hat man mehr Ruhe«, sagte Johan Andersson. »Aber sag ruhig Mörder-Anders zu mir. So wie alle anderen.«
2. KAPITEL
Man musste sich über die kleinen Dinge freuen. Zum Beispiel darüber, dass die Monate vergingen, ohne dass Mörder-Anders den Rezeptionisten oder sonst wen in unmittelbarer Nähe des Hotels ermordet hätte. Und dass der Chef Per Persson gestattete, seine Rezeption jeden Sonntag für ein paar Stunden zu schließen. Wenn bei so einer Gelegenheit auch noch das Wetter auf der Seite des Rezeptionisten war – im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen in seinem Leben –, dann nutzte er die Gelegenheit, um das Hotel zu verlassen. Nicht, um so richtig einen draufzumachen, dafür reichte das Geld nie. Doch still auf einer Parkbank zu sitzen und nachzudenken, das war immer noch kostenlos.
So saß er auch da, mit vier eingepackten Schinkenbroten und einer Flasche Himbeersaft, als ihn auf einmal unvermutet jemand ansprach.
»Wie geht’s, wie steht’s, mein Sohn?«
Vor ihm stand eine Frau, nicht viel älter als er. Sie sah schmutzig und heruntergekommen aus, und an ihrem Hals leuchtete ein weißes Beffchen, wenn auch mit einem Rußfleck darauf.
Per Persson hatte sich nie mit der Religion befasst, aber eine Pfarrerin war eben doch eine Pfarrerin, und er fand, sie verdiente ebenso viel Respekt wie die Mörder, Junkies und der ganze Abschaum, mit dem er in der Arbeit zu tun hatte. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
»Danke der Nachfrage«, sagte er. »Es war schon mal besser. Obwohl – war es eigentlich noch nie, wenn ich genau drüber nachdenke. Mein Leben besteht eigentlich nur aus Qualen, könnte man sagen.«
Verdammt, das war jetzt aber ganz schön persönlich ausgefallen, dachte er. Am besten, er stellte die Dinge gleich noch mal richtig.
»Aber wie es mit meiner Gesundheit und meiner Gemütslage steht, ist nichts, womit ich die Frau Pastorin belästigen will. Wenn ich nur immer was zu beißen habe, lösen sich die meisten Probleme von allein«, sagte er und gab zu verstehen, dass das Gespräch beendet war, indem er seine Aufmerksamkeit auf den Verschluss seiner Brotbox wandte.
Dieses Signal wurde von der Pfarrerin jedoch nicht registriert. Stattdessen verkündete sie, dass sie es wahrhaftig nicht als belastend empfinden würde, ihm auf die eine oder andere Art zu Diensten zu sein, wenn sie ihm das Dasein dadurch etwas erleichtern könnte. Eine persönliche Fürbitte wäre da doch wohl das Mindeste?
Eine Fürbitte? Per Persson fragte sich im Stillen, was die schmutzige Pfarrerin sich davon versprach. Glaubte sie, dass es dann plötzlich Geld vom Himmel regnen würde? Oder Brot und Kartoffeln? Obwohl … was soll’s. Es widerstrebte ihm, jemand abzuweisen, der ihm nur Gutes tun wollte.
»Danke, Frau Pastor. Wenn Sie glauben, dass ein Gebet zum Himmel mein Leben erleichtern kann, werde ich mich bestimmt nicht dagegen wehren.«
Die Pfarrerin nahm lächelnd auf der Parkbank neben dem Rezeptionisten Platz. Und machte sich an ihre Arbeit.
»Gott, sieh auf dein Kind … wie heißt du eigentlich?«
»Ich heiße Per«, sagte Per Persson und fragte sich, was Gott wohl mit dieser Information anfangen sollte.
»Gott, sieh auf dein Kind Per, sieh, wie er leidet …«
»Na ja, also … leiden tue ich jetzt nicht so wirklich.«
Die Pfarrerin kam aus dem Konzept, meinte dann, sie fange wohl am besten noch mal von vorne an, und im Übrigen würde das Gebet seine Wirkung am besten entfalten, wenn sie nicht allzu oft unterbrochen wurde.
Per Persson entschuldigte sich und versprach, sie in Ruhe fertig fürbitten zu lassen.
»Danke«, sagte die Pfarrerin und setzte noch einmal neu an. »Gott, sieh auf dein Kind, sieh, wie er das Gefühl hat, dass es besser sein könnte, auch wenn er nicht so wirklich leidet. Herr, gib ihm Sicherheit, lehre ihn, die Welt zu lieben. Und die Welt soll ihn lieben. O Jesus, trag dein Kreuz an seiner Seite, dein Reich komme und so weiter.«
Und so weiter?, dachte Per Persson, wagte aber nichts zu sagen.
»Gott segne dich, mein Sohn, mit Kraft und Stärke und … Kraft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.«
Per Persson wusste nicht, wie sich eine persönliche Fürbitte anhören musste, aber was er da gerade gehört hatte, klang eher flüchtig zusammengeschustert. Und er war nahe daran, etwas in dieser Richtung zu sagen, als die Pfarrerin ihm zuvorkam: »Das macht zwanzig Kronen bitte.«
Zwanzig Kronen? Dafür?
»Sie wollen Bezahlung für Ihre Fürbitte?«, fragte Per Persson.
Die Pfarrerin nickte. Fürbitten könne man nicht einfach so runterleiern. Die erforderten Konzentration und Hingabe, sie verlangten einem Kraft ab – und auch eine Pfarrerin müsse ja auf Erden leben und nicht im Himmel.
Was Per Persson da soeben gehört hatte, hatte in seinen Ohren weder hingebungsvoll noch konzentriert geklungen, und er war beileibe nicht sicher, ob es wirklich der Himmel war und nicht etwas ganz anderes, was die Pfarrerin erwartete, wenn es eines Tages so weit war.
»Wie wär’s mit zehn Kronen?«, versuchte es die Pfarrerin.
Sie senkte den Preis, von wenig auf fast gar nichts? Per Persson musterte sie genauer und sah etwas … anderes? Etwas … Elendes?
Und da beschloss er, dass sie eher eine Schwester im Unglück war als eine Betrügerin.
»Möchten Sie ein belegtes Brot?«, bot er ihr an.
Die Miene der Pfarrerin hellte sich auf.
»Oh, danke, das wäre lecker. Der Herr segne dich!«
Per Persson meinte, aus historischer Perspektive deute eigentlich alles darauf hin, dass der Herr mit anderen Dingen beschäftigt sei, als ausgerechnet ihn, Per Persson, zu segnen. Und das Gebet, das der da oben gerade empfangen habe, würde daran auch nichts ändern.
Die Pfarrerin sah aus, als wollte sie etwas darauf erwidern, aber der Rezeptionist reichte ihr rasch seine Brotbox.
»Hier, bitte«, sagte er. »Essen Sie lieber etwas, statt weiter zu reden.«
»Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Psalm 25«, sagte die Pfarrerin, die mit vollen Backen sein Schinkenbrot kaute.
»Ja, wie gesagt«, meinte Per Persson.
Sie war wirklich Pfarrerin. Während sie die vier Brote des Rezeptionisten in sich hineinmampfte, erzählte sie, dass sie bis letzten Sonntag auch eine eigene Gemeinde gehabt hatte, bis sie mitten in der Predigt vom Sprecher des Gemeinderats mit der Aufforderung unterbrochen wurde, von der Kanzel zu steigen, ihre Sachen zu packen und zu verschwinden.
Das fand Per Persson ganz schrecklich. Gab es im Himmel denn nicht auch so was wie Kündigungsschutz?
Doch, natürlich, aber der Sprecher des Gemeinderats sah sich im Recht. Und die restliche Gemeinde stimmte ihm da vollauf zu. Übrigens einschließlich der Pfarrerin selbst. Mindestens zwei Gemeindemitglieder warfen ihr noch ein Gesangbuch hinterher, als sie hinausging.
»Wie du sicher ahnst, gibt es auch eine längere Version der Geschichte. Möchtest du sie hören? Ich war im Leben wahrlich nicht auf Rosen gebettet, das kann ich dir versichern.«
Per Persson überlegte. Wollte er hören, worauf die Pfarrerin gebettet gewesen war, wenn nicht auf Rosen, oder reichte ihm schon das Elend, das er ohne ihr Zutun mit sich herumschleppen musste?
»Ich bin nicht sicher, ob es mein Dasein aufhellt, wenn ich mir die Geschichten von anderen Leuten anhöre, die ebenfalls in der Finsternis leben«, sagte er. »Aber den Kern der Sache können Sie mir schon kurz darstellen, wenn es nicht zu langatmig wird.«
Den Kern der Sache? Der Kern der Sache sah so aus, dass sie seit sieben Tagen herumirrte, von Sonntag bis Sonntag in Kellern und weiß Gott wo geschlafen hatte, gegessen hatte, was sie gerade in die Finger bekam, und …
»Wie vier von vier möglichen Schinkenbroten«, bemerkte Per Persson. »Möchten Sie mein einziges Essen mit meinem letzten Himbeersaft hinunterspülen?«
Da sagte die Pfarrerin nicht Nein. Und nachdem sie ihren Durst gelöscht hatte, fuhr sie fort:
»Um es kurz zu machen: Ich glaube nicht an Gott. Und an Jesus gleich noch weniger. Mein Vater hat mich gezwungen, in seine Fußstapfen zu treten – also, in die Fußstapfen meines Vaters, nicht in die von Jesus –, als er zu allem Unglück keinen Sohn bekam, sondern nur eine Tochter. Aber mein Vater war wiederum auch nur von seinem Vater zu dieser Laufbahn gezwungen worden. Ob sie alle beide vom Teufel gesandt waren, lässt sich schwer sagen. Das geistliche Amt lag auf alle Fälle in der Familie.«
Dieses Konzept, ein Opfer im Schatten von Vater und Großvater zu sein, vermittelte Per Persson sofort ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit dieser Frau, und er meinte, wenn man es ihnen als Kinder erspart hätte, den ganzen Mist mit sich rumzuschleppen, den Generationen vor ihnen angesammelt hatten, dann hätte in ihrem Leben vielleicht ein bisschen mehr geklappt.
Die Pfarrerin verzichtete darauf, ihn auf die Notwendigkeit vorhergehender Generationen für die eigene Existenz hinzuweisen. Stattdessen fragte sie, welcher Weg ihn zu … dieser Parkbank geführt hatte.
Diese Parkbank, ja. Und eine düstere Hotelrezeption, in der er sowohl wohnte als auch arbeitete. Und sein Bier mit Mörder-Anders teilte.
»Mörder-Anders?«, wiederholte die Pfarrerin.
»Ja«, sagte der Rezeptionist. »Der wohnt in Nummer 7.«
Per Persson fand, dass er der Pfarrerin ruhig ein paar Minuten seiner Zeit schenken konnte, wenn sie ihn schon mal gefragt hatte. Also erzählte er vom Großvater, der seine Millionen verschleudert hatte. Vom Vater, der einfach aufgegeben hatte. Von seiner Mutter, die sich einen isländischen Banker geangelt und das Land verlassen hatte. Wie er selbst als Sechzehnjähriger in einem Freudenhaus gelandet war. Und wie er jetzt als Rezeptionist in dem Hotel arbeitete, in das man dieses Freudenhaus umgemodelt hatte.
»Und wenn ich mal zwanzig Minuten freihabe und mich auf eine Bank setze, in sicherem Abstand zu den ganzen Räubern und Gangstern, mit denen ich dienstlich zu tun habe, dann taucht eine Pfarrerin auf, die nicht an Gott glaubt, die erst versucht, mir mein letztes Geld abzuschwindeln, und mir dann mein Pausenbrot wegisst. Da haben Sie mein Leben, es sei denn, das alte Freudenhaus hätte sich dank Ihrer Fürbitte in ein Grandhotel verwandelt, wenn ich zurückkomme.«
Die schmutzige Pfarrerin mit den Brotkrümeln am Mund schaute beschämt drein. Sie meinte, es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass die Fürbitte so unmittelbare Ergebnisse erzielt habe, vor allem deshalb nicht, weil sie hastig hingeworfen worden war und der Empfänger ja sowieso nicht existierte. Jetzt tat es ihr leid, dass sie für solchen Pfusch Geld verlangt hatte, nicht zuletzt im Hinblick auf die Großzügigkeit des Rezeptionisten mit seinen belegten Broten.
»Erzähl mir doch gern mehr von diesem Hotel«, bat sie. Er habe nicht zufällig ein Zimmer übrig zum … Freundschaftspreis?
»Freundschaftspreis?«, sagte Per Persson. »Wann genau hätten wir denn Freundschaft geschlossen, die Frau Pfarrerin und ich?«
»Na ja«, meinte die Pfarrerin. »Was nicht ist, kann ja noch werden.«
3. KAPITEL
Die Pfarrerin bekam Zimmer Nummer 8, Wand an Wand mit Mörder-Anders. Aber im Gegensatz zu ihm, von dem Per Persson nie Geld zu verlangen wagte, sollte sein neuer Gast eine Woche im Voraus bezahlen. Den ganz regulären Preis.
»Im Voraus? Aber das ist doch mein letztes Geld.«
»Umso wichtiger, dass es nicht auf Abwege gerät. Ich kann Ihnen ja kostenlos eine Fürbitte runterrasseln, dann findet sich das vielleicht alles«, sagte der Rezeptionist.
In diesem Augenblick betrat ein Mann mit Lederjacke, Sonnenbrille und Bartstoppeln die Szene. Er sah aus wie die Parodie des Gangsters, der er wahrscheinlich tatsächlich war, und fragte grußlos, wo er Johan Andersson finden könne.
Der Rezeptionist richtete sich zu voller Größe auf und antwortete, dass man nicht so ohne Weiteres Auskunft darüber bekam, wer in der Pension Sjöudden wohnte. Hier sei man stolz darauf, die Privatsphäre der Gäste zu schützen.
»Beantworte meine Frage, sonst schneid ich dir den Schwanz ab«, sagte der Mann mit der Lederjacke. »Wo hast du Mörder-Anders versteckt?«
»Zimmer 7«, sagte Per Persson.
Der bedrohliche Typ verschwand im Flur. Die Pfarrerin sah ihm nach und fragte, ob da wohl Ärger im Anzug sei? Und ob der Rezeptionist glaube, dass sie in ihrer Eigenschaft als Pfarrerin irgendetwas tun könne?
Per Persson glaubte gar nichts, kam aber nicht dazu, das auszusprechen, denn da war der Lederjackenmann schon wieder zurück.
»Der Mörder liegt weggetreten auf seinem Bett. Ich weiß, wie er sein kann, deswegen ist es vorerst besser, man lässt ihn einfach liegen. Nimm dieses Kuvert in Verwahrung und gib es ihm, wenn er aufwacht. Schöne Grüße vom Grafen.«
»Mehr nicht?«, fragte Per Persson.
»Nein. Das heißt: doch. Sag ihm, dass fünftausend im Kuvert sind, keine zehn, weil er seinen Auftrag nämlich auch nur zur Hälfte ausgeführt hat.«
Der Lederjackenmann verschwand. Fünftausend? Fünf, die offenbar zehn hätten sein sollen. Und jetzt war es am Rezeptionisten, dem vielleicht gefährlichsten Mann von ganz Schweden diesen Fehlbetrag zu erklären. Es sei denn, er delegierte diese Aufgabe an die Pfarrerin, die ihm gerade ihre Dienste angeboten hatte.
»Mörder-Anders«, sagte sie. »Den gibt es also wirklich? Den hast du dir nicht bloß so ausgedacht?«
»Eine verlorene Seele«, sagte der Rezeptionist. »Sehr verloren sogar.«
Zu seiner Überraschung fragte die Pfarrerin, ob die sehr verlorene Seele derart verloren war, dass es moralisch vertretbar wäre, wenn die Pfarrerin und der Rezeptionist einen Tausender von ihm abzwackten, um sich in irgendeinem netten Lokal in der Nähe satt zu essen?
Per Persson erkundigte sich, was sie denn für eine Pfarrerin sei, wenn sie solche Vorschläge machte, musste jedoch zugeben, dass der Gedanke verlockend war. Allerdings gab es durchaus einen Grund, warum Mörder-Anders seinen Namen trug. Beziehungsweise drei, wenn sich der Rezeptionist recht entsann: eine Axt in einem Rücken, eine Schrotladung in einem Gesicht und eine durchgeschnittene Kehle.
Die Frage, wie angebracht es war, sich von einem Mörder heimlich Geld zu borgen, erledigte sich von selbst, denn der betreffende Mörder war aufgewacht und kam jetzt mit zerzausten Haaren über den Korridor angeschlurft.
»Ich hab Durst«, sagte er. »Ich bekomme heute Geld, aber es ist noch nicht da, und ich hab nichts, wovon ich mir ein Bier kaufen könnte. Oder Essen. Kann ich mir einen Zweihunderter aus deiner Kasse leihen?«
Das war eine Frage, aber andererseits auch wieder nicht. Mörder-Anders erwartete, dass er sofort seine zweihundert Kronen auf die Hand bekam.
Doch jetzt trat die Pfarrerin einen halben Schritt vor.
»Guten Tag«, sagte sie. »Ich heiße Johanna Kjellander und bin ehemalige Gemeindepfarrerin, jetzt aber nur noch ganz allgemein Pastorin.«
»Mit Pastoren hat man nur Ärger«, sagte Mörder-Anders, ohne sie anzusehen.
Mit mündlichem Ausdruck hatte er es nun mal nicht so. Er wandte sich erneut an den Rezeptionisten.
»Also, krieg ich jetzt das Geld oder nicht?«
»Da kann ich Ihnen so pauschal nicht zustimmen«, sagte Johanna Kjellander. »Natürlich gibt es auch auf unserem Gebiet den einen oder anderen, der eigentlich auf der Abschussliste stehen sollte, und leider gehöre ich wohl auch dazu. Das sind so Dinge, über die ich mich gerne mit Herrn … Mörder-Anders unterhalten würde. Vielleicht bei einer anderen Gelegenheit? Aber jetzt müssen wir zunächst über ein Kuvert mit fünftausend Kronen reden, das von einem gewissen Grafen beim Rezeptionisten abgegeben wurde.«
»Fünftausend?«, sagte Mörder-Anders. »Das sollten aber zehn sein! Was hast du mit dem Rest angestellt, du Scheißpastorin?«
Der verschlafene, verkaterte Mörder funkelte Johanna Kjellander wütend an. Der besorgte Per Persson, der keinen Pastorinnenmord an seiner Rezeption wünschte, warf rasch ein, der Graf lasse ausrichten, dass die fünftausend eine Teilzahlung seien, weil auch nur der halbe Auftrag ausgeführt worden sei. Der Rezeptionist und die anwesende Pfarrerin seien nur die unschuldigen Überbringer der Botschaft, er hoffe, dass Mörder-Anders verstehe …
Doch da ergriff Johanna Kjellander auch schon wieder das Wort. Die »Scheißpastorin« hatte sie nämlich ganz schön getroffen.
»Schämen Sie sich!«, sagte sie so entschieden, dass Mörder-Anders es um ein Haar wirklich getan hätte.
Sie fuhr fort, ihm müsse doch wohl klar sein, dass der Rezeptionist und sie nicht im Entferntesten daran gedacht hatten, ihm sein Geld zu mopsen.
»Allerdings sind wir gerade etwas knapp bei Kasse. Und wo wir gerade beim Thema sind, frage ich einfach mal, ob der Herr Mörder-Anders sich vorstellen könnte, uns für ein paar Tage einen von diesen fünf hübschen Tausendern zu leihen? Oder vielleicht eher für eine Woche?«
Per Persson war völlig verblüfft. Erst wollte die Pfarrerin Geld aus Mörder-Anders’ Kuvert nehmen, hinter seinem Rücken. Dann brachte sie ihn beinahe zum Erröten vor Scham darüber, dass er sie genau dessen verdächtigt hatte. Und jetzt fing sie auch noch an, mit dem Mörder über einen Kurzkredit zu verhandeln. Hatte die denn überhaupt keinen Überlebensinstinkt? Begriff sie nicht, dass sie ihn und sich selbst in Lebensgefahr brachte? Verdammtes Weibsstück! Er sollte der Pfarrerin schleunigst den Mund stopfen, bevor ihm der Mörder mit einer etwas endgültigeren Maßnahme zuvorkam.
Doch zunächst galt es zu versuchen, wiedergutzumachen, was sie angerichtet hatte. Mörder-Anders hatte sich auf einen Stuhl gesetzt, vielleicht vor lauter Verwirrung darüber, dass ihn diese Pastorin – die ihm in seiner Welt wahrscheinlich das Geld gestohlen hatte – gerade gebeten hatte, sich leihen zu dürfen, was sie ihm noch nicht hatte stehlen können.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, fühlt sich der Herr Mörder-Anders um fünftausend Kronen geprellt, ist das korrekt?«, sagte Per Persson und bemühte sich, möglichst hochgestochen zu klingen.
Mörder-Anders nickte.
»Dann muss ich wiederholen und unterstreichen, dass weder ich noch diese wahrscheinlich seltsamste Pfarrerin von ganz Schweden das Geld genommen haben. Aber wenn es etwas gibt – egal was –, das ich tun kann, um dem Herrn Mörder-Anders seine Situation zu erleichtern, dann zögern Sie bitte nicht, es mir zu sagen!«
»Wenn es etwas gibt, das ich tun kann …« ist so ein Satz, den jeder Angestellte im Dienstleistungssektor gerne von sich gibt, aber nicht unbedingt ernst meint.
Umso bedauerlicher, dass Mörder-Anders den Rezeptionisten prompt beim Wort nahm.
»Ja, gerne«, sagte er mit müder Stimme. »Bitte besorg mir meine verschwundenen fünftausend. Dann muss ich dich nicht verdreschen.«
Per Persson hatte überhaupt kein Bedürfnis, den Grafen zu suchen, der gedroht hatte, so unschöne Dinge mit einem von Pers liebsten Körperteilen anzustellen. Allein diesem Menschen noch einmal zu begegnen, wäre schon übel genug. Aber obendrein auch noch Geld von ihm zu verlangen …
Der Rezeptionist war schon zutiefst bekümmert, als er die Pfarrerin sagen hörte: »Selbstverständlich!«
»Selbstverständlich?«, wiederholte der Rezeptionist erschrocken.
»Gut!«, sagte Mörder-Anders, der gerade zweimal hintereinander ein »selbstverständlich« gehört hatte.
»Na, ist doch klar, dass Mörder-Anders geholfen wird«, fuhr die Pfarrerin fort. »Wir hier in der Pension Sjöudden stehen immer zu Diensten. Gegen eine angemessene Entschädigung sind wir jederzeit bereit, Mördern und Marodeuren das Leben leichter zu machen. Der Herr macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Oder vielleicht doch, aber wir wollen beim Thema bleiben: Könnten wir erst mal mehr darüber erfahren, um was für einen ›Auftrag‹ es hier ging und inwiefern er offenbar nur halb ausgeführt wurde?«
Per Persson wäre in diesem Moment am liebsten woanders gewesen. Er hatte die Pfarrerin gerade »Wir hier in der Pension Sjöudden« sagen hören. Sie hatte noch nicht mal eingecheckt, geschweige denn bezahlt, aber das hielt sie nicht davon ab, im Namen des Hotels finanzielle Verhandlungen mit einem Mörder aufzunehmen.
Der Rezeptionist beschloss, seinen neuen Gast aufrichtig zu hassen. Ansonsten fiel ihm nichts Besseres ein, als stehen zu bleiben, wo er war, an der Wand neben dem Kühlschrank seiner Rezeption, und zu versuchen, so uninteressant wie möglich auszusehen. Wer keinerlei Gefühle weckt, braucht auch nicht zusammengeschlagen zu werden, dachte er sich.
Mörder-Anders war ebenfalls einigermaßen verwirrt. Die Pfarrerin hatte in so kurzer Zeit so viel gesagt, dass er nicht mehr richtig mitgekommen war (und dazu kam eben noch, dass sie Pfarrerin war, das machte die Dinge noch schlimmer).
Sie schien ihm eine Art von Zusammenarbeit vorzuschlagen. So etwas ging normalerweise übel aus, aber anhören konnte man sich das Ganze ja trotzdem mal. Man brauchte die Leute nicht immer gleich zu verprügeln – im Gegenteil, es konnte auffallend oft das Klügste sein, sich diesen Teil bis zum Schluss aufzusparen.
So kam es, dass Mörder-Anders erzählte, worum es sich bei seinem Auftrag gehandelt hatte. Er hatte niemand umgebracht, für den Fall, dass sie das denken sollten.
»Nein, einen Mord nur halb auszuführen, wäre ja auch schwierig gewesen, nicht wahr?«, überlegte die Pfarrerin laut.
Mörder-Anders erklärte, er habe beschlossen, mit dem Morden aufzuhören, denn der Preis sei ihm zu hoch: Wenn es noch mal schiefging, dann käme er erst wieder als Achtzigjähriger aus dem Gefängnis.
Die Sache war jedoch die, dass er gerade mal auf freiem Fuß war und sich eine Unterkunft gesucht hatte, als es auch schon von allen Seiten Anfragen regnete. Die meisten von Leuten, die gegen üppig bemessene Entschädigung Feinde und Bekannte aus dem Weg geräumt haben wollten, das hieß im Klartext: ermordet. Also genau das, womit Mörder-Anders sich eigentlich nicht mehr befassen wollte. Beziehungsweise womit er sich eigentlich nie wirklich befasst hatte, das war einfach immer alles so passiert, irgendwie.
Abgesehen von diversen angetragenen Auftragsmorden gab es auch das eine oder andere Jobangebot der vernünftigeren Art, wie den Auftrag, von dem hier die Rede war. Er sollte einem Mann, der Mörder-Anders’ Auftraggeber – dem Grafen, einem alten Bekannten – ein Auto abgekauft hatte, beide Arme brechen. Der Mann hatte das Auto mitgenommen und dann die Kaufsumme am selben Abend beim Blackjack verspielt.
Die Pfarrerin hatte keine Ahnung, was Blackjack war, denn mit so etwas hatte sich keine ihrer beiden Gemeinden im geselligen Beisammensein nach dem Sonntagsgottesdienst beschäftigt. Dort hielt man es eher mit der Tradition des Mikadospiels, was von Zeit zu Zeit auch ganz unterhaltsam sein konnte.
»Er hat das Auto mitgenommen, ohne zu bezahlen?«
Mörder-Anders erklärte, wie das mit der Legalität in den weniger legalen Kreisen von Stockholm gehandhabt wurde. Im vorliegenden Fall ging es um einen neun Jahre alten Saab, doch das Prinzip blieb dasselbe: Ein Kredit für ein paar Tage war beim Grafen nie ein Problem. Kummer gab es erst, wenn das Geld nicht auf dem Tisch lag, sobald die Rückzahlfrist abgelaufen war. Und das bedeutete in erster Linie Kummer für den Kreditnehmer, nicht den Gläubiger.
»So was wie ein gebrochener Arm?«
»Ja. Oder zwei, wie gesagt. Wenn das Auto neuer gewesen wäre, wären wahrscheinlich noch die Rippen und das Gesicht in den Auftrag mit eingegangen.«
»Zwei gebrochene Arme, aus denen dann einer wurde. Hast du dich verzählt, oder was war da los?«
»Ich hab mir ein Fahrrad geklaut und bin mit einem Baseballschläger auf dem Gepäckträger zu diesem Dieb gefahren. Als ich den Kerl zu fassen kriegte, hatte er seine neugeborene Tochter auf dem Arm und bat um Gnade oder wie das heißt. Da ich tief in mir drin ein gutes Herz habe – das hat meine Mutter immer gesagt –, hab ich ihm stattdessen seinen anderen Arm zweifach gebrochen. Und ich hab ihm erlaubt, zuerst das Baby aus der Hand zu legen, damit es sich nicht wehtat, wenn ich zuschlug und er zu Boden ging. Und zu Boden gegangen ist er auch. Mit Baseballschlägern kann ich umgehen. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich ihm genauso gut beide Arme brechen können, als er da wimmernd am Boden lag. Ich hab gemerkt, dass ich nicht immer so schnell denke, wie mir lieb wäre. Und wenn dann noch Schnaps und Tabletten im Spiel sind, denke ich überhaupt nicht mehr. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
Die Pfarrerin hängte sich an einem Detail seiner Erzählung auf:
»Hat deine Mutter das wirklich gesagt? Dass du tief in dir drin ein gutes Herz hast?«
Per Persson fragte sich dasselbe, blieb aber bei seiner Strategie, mit der Wand hinter der Rezeption zu verschmelzen, so gut und geräuschlos wie möglich.
»Ja, hat sie«, sagte Mörder-Anders. »Aber das war, bevor ich ihr alle Zähne ausgeschlagen habe, kurz nachdem mein Vater sich totgesoffen hatte. Da hat sie nicht mehr viel gesagt, jedenfalls nichts Verständliches. Was für eine dumme Alte, echt. Scheiße auch.«
Die Pfarrerin hätte ein paar Vorschläge gehabt, wie man Familienkonflikte beilegt, ohne sich gegenseitig die Zähne auszuschlagen, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wollte sie erst mal die Informationen von Mörder-Anders zusammenfassen, um zu überprüfen, ob sie alles richtig verstanden hatte.
Sein letzter Auftraggeber wollte also fünfzig Prozent Rabatt, wobei er sich darauf berief, dass Mörder-Anders einen Arm zweimal gebrochen hatte statt zwei Arme einmal?
Mörder-Anders nickte. Wenn sie mit fünfzig Prozent den halben Preis meinte, dann ja.
Ja, das meinte sie. Und sie fügte hinzu, dass dieser Graf wohl in einer sehr heiklen Lage stecke. Egal: Pfarrerin und Rezeptionist waren bereit zu helfen.
Da der Rezeptionist nicht bereit war, ihr zu widersprechen, konnte die Pfarrerin fortfahren.
»Gegen eine Provision von zwanzig Prozent suchen wir den genannten Grafen auf, in der Absicht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Aber das ist noch gar nichts. Denn unsere Zusammenarbeit wird erst in Phase zwei so richtig interessant!«
Mörder-Anders versuchte zu kapieren, was die Pfarrerin da gerade gesagt hatte. So viele Worte und so ein seltsamer Prozentsatz. Aber bevor er bei der Frage war, worin »Phase zwei« bestehen könnte, war ihm die Pfarrerin schon vorausgeeilt.
Die zweite Phase beinhalte, dass Mörder-Anders’ kleines Unternehmen unter der Führung des Rezeptionisten und der Pfarrerin ausgebaut wurde. Diskrete PR-Arbeit, um den Kundenkreis zu erweitern, eine Preisliste, damit man gar nicht erst Zeit mit Leuten verschwendete, die sich seine Dienste nicht leisten konnten, sowie eine ganz klare ethische Leitlinie.
Der Pfarrerin fiel auf, dass der Rezeptionist genauso weiß wurde wie der Kühlschrank an der Wand, gegen die er sich drückte. Und dass Mörder-Anders völlig den Faden verloren hatte. Sie beschloss, eine Pause einzulegen, damit der eine wieder zu Sauerstoff kam und der andere nicht auf die Idee verfiel zuzuschlagen, statt ihren Vorschlag zu überdenken.
»Ich muss Mörder-Anders übrigens wirklich für sein gutes Herz loben«, sagte sie. »Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Baby nicht einen Kratzer abbekommen hat! Ja, ja, die Kinder … solcher ist das Reich Gottes, diese Aussage finden wird schon im Matthäusevangelium, Kapitel 19.«
»Ist es das? Finden wir die dort?«, fragte Mörder-Anders und vergaß einen Moment lang, dass er vor einer halben Sekunde den Entschluss gefasst hatte, zumindest diesen Kerl zu verdreschen, der die ganze Zeit danebenstand und keinen Mucks machte.
Die Pfarrerin nickte fromm und verzichtete auf Bekanntgabe der frohen Kunde, dass nur wenige Zeilen später im selben Evangelium stand, man solle nicht töten, seinen Nächsten lieben wie sich selbst und – à propos ausgeschlagene Zähne – seine Mutter und im Übrigen auch seinen Vater ehren.
Der Zorn, der in Mörder-Anders aufsteigen wollte, legte sich wieder. Das merkte auch Per Persson, der endlich wagte, an ein Leben danach zu glauben (genauer gesagt: daran, dass sowohl die Pfarrerin als auch er dieses Gespräch mit dem Gast aus Zimmer 7 überleben würden). Der Rezeptionist begann nicht nur wieder zu atmen, sondern erlangte auch sein Sprachvermögen zurück und trug etwas zur Unterredung bei, indem er Mörder-Anders mehr oder weniger erfolgreich erklärte, was zwanzig Prozent von etwas sind. Der Mörder entschuldigte sich damit, dass er im Laufe der Zeit ein echter Crack im Zählen von Gefängnisjahren geworden sei, aber über Prozent wisse er nicht viel mehr, als dass ungefähr vierzig davon im Rum seien, und manchmal sogar noch mehr in Produkten aus diversen uneinsehbaren Kellern. In einer der früheren polizeilichen Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass er seine Tabletten mit achtunddreißigprozentigem gekauftem Alkohol und siebzigprozentigem Selbstgebranntem hinuntergespült hatte. Freilich konnte man polizeilichen Ermittlungen nicht immer trauen, aber wenn sie damals recht gehabt hatten, dann war es natürlich nicht überraschend, wie die Dinge gelaufen waren – mit hundertacht Prozent Alkohol im Blut und den Tabletten obendrauf.
Inspiriert von der guten Stimmung, die sich in der Rezeption ausbreiten wollte, versprach die Pfarrerin, dass sich der Umsatz von Mörder-Anders’ Unternehmen demnächst verdoppeln würde – mindestens! –, wenn er dem Rezeptionisten und ihr gänzlich freie Hand bei seiner Vertretung ließ.
Gleichzeitig war Per Persson so schlau, zwei Bier aus dem Kühlschrank an der Rezeption zu holen. Mörder-Anders kippte das erste hinunter, brach das zweite auch gleich an und beschloss dann, dass er genug von dem begriffen hatte, was man ihm hier erklärt hatte.
»Na, verdammt, dann ist das jetzt abgemacht.«
Dann leerte der Mörder auch das zweite Bier mit wenigen raschen Schlucken, rülpste, entschuldigte sich und reichte den beiden als symbolische Geste zwei von den vorhandenen fünf Tausendern mit einem »zwanzig Prozent haben wir ja gesagt!«.
Die drei restlichen Scheine schob er in die Brusttasche seines Hemdes, wobei er verkündete, dass ihn jetzt ein Brunch in seinem Stammlokal um die Ecke erwarte und er daher keine Zeit mehr für weitere geschäftliche Besprechungen habe.
»Viel Glück mit dem Grafen!«, sagte er an der Tür, bevor er verschwand.
4. KAPITEL
Der Mann, den sie den Grafen nannten, war nicht im Adelskalender zu finden. Tatsache ist, dass er überhaupt nirgendwo zu finden war. Er hatte an die siebenhunderttausend Kronen Schulden beim Finanzamt, aber so nachdrücklich die Behörde ihn auch in den Briefen darauf hinwies, die sie an die letzte bekannte Adresse des Grafen schickte – die Mabini Street in der philippinischen Hauptstadt Manila –, es kam einfach kein Geld von ihm. Und auch nichts anderes. Das Finanzamt konnte ja nicht ahnen, dass die Adresse völlig willkürlich gewählt war und die Briefe bei einem örtlichen Fischhändler landeten, der sie nach dem Öffnen benutzte, um Tiger Shrimps und Tintenfisch darin einzuwickeln. Während der Graf bei seiner Freundin in Stockholm wohnte, der Frau, die sie die Gräfin nannten und die mit dem Vertrieb diverser Rauschmittel ganz groß im Geschäft war. Unter ihrem Namen betrieb er fünf Gebrauchtwagenfirmen in den südlichen Vororten der Hauptstadt.
Er war schon zu analogen Zeiten dabei gewesen, als man ein Auto noch mit einem Schraubenschlüssel auseinander- und wieder zusammenbauen konnte und kein Informatikstudium dafür brauchte.
Aber er hatte den Übergang in die digitale Epoche besser geschafft als manch anderer, sodass aus einem einzigen Unternehmen innerhalb weniger Jahre fünf wurden. Im Kielwasser dieser Entwicklung kam es zu finanziellen Unstimmigkeiten zwischen dem Grafen einerseits und dem Finanzamt andererseits – was einen fleißigen Fischhändler auf der anderen Seite des Erdballs gleichermaßen freute, wie es ihn manchmal auch geringfügig irritierte.
Der Graf gehörte zu den Leuten, die Veränderungen eher als Chance denn als Bedrohung betrachten. In Europa und auf der ganzen Welt wurden Autos gebaut, die eine Million Kronen kosten konnten, wenn man sie kaufte, die man jedoch für fünfzig Dollar schon stehlen konnte, mithilfe von Elektronik und Gebrauchsanweisungen in fünf Schritten aus dem Internet. Die Spezialität des Grafen bestand lange Zeit darin, in Schweden zugelassene BMWX5 aufzuspüren und seinen Partner in Danzig zwei Männer schicken zu lassen, die den Wagen holten, nach Polen brachten, ihm eine neue Geschichte verpassten und ihn vom Grafen reimportieren ließen.
Das hatte ihm eine ganze Weile eine Viertelmillion Kronen netto pro Auto eingebracht. Bis BMW aufgewacht war und in jedem neuen und jedem besseren gebrauchten Fahrzeug Ortungssender einbauen ließ. Ohne irgendein Gefühl für Fairplay teilten sie das den Autodieben vorab nicht mit. Und auf einmal stand die Polizei in seinem Zwischenlager in Ängelholm und kassierte sowohl Autos als auch Polen ein.