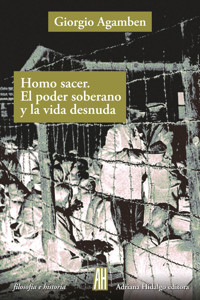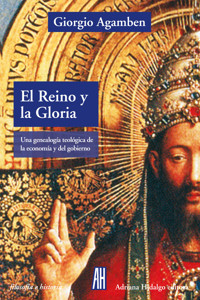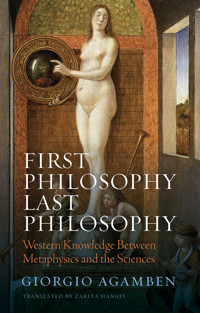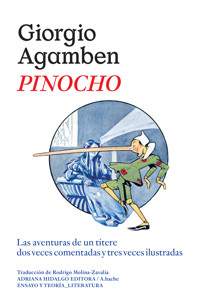13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den späten sechziger Jahren nahm Giorgio Agamben an Martin Heideggers Seminaren im südfranzösischen Le Thor teil. Damals entstand auch sein erstes Buch L’uomo senza contenuto, das 1970 erstmals erschien. Selbstbewußt und radikal stürzt er sich auf klassische Positionen der Ästhetik, er konfrontiert Platon, Kant und Hegel mit Künstlern und Autoren der Klassischen Moderne. In einer Zeit, in der die Kunst nicht länger die Funktion hat, das Wesen der Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen, wird sie zu einer selbstzerstörerischen Kraft, der Künstler, so Agamben, zu einem »Menschen ohne Inhalt«. Agambens erstes Buch liegt nun endlich auch auf Deutsch vor. »Agamben hat die verwaiste Stelle des Meisterdenkers eingenommen.« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
In den späten sechziger Jahren nahm Giorgio Agamben an Martin Heideggers Seminaren im südfranzösischen Le Thor teil. Damals entstand auch sein erstes Buch L’uomo senza contenuto, das 1970 erschien. Selbstbewußt und radikal stürzt er sich auf klassische Positionen der Ästhetik, er konfrontiert Platon, Kant und Hegel mit Künstlern und Autoren der Klassischen Moderne. In einer Zeit, in der die Kunst nicht länger die Funktion hat, das Wesen der Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen, wird sie zu einer selbstzerstörerischen Kraft, der Künstler, so Agamben, zu einem »Menschen ohne Inhalt«. Agambens erstes Buch liegt nun endlich auch auf deutsch vor.
Giorgio Agamben, geboren 1942, lehrt Philosophie an der Universität Venedig. In der edition suhrkamp liegen vor: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben (Homo sacer I, es 2068), Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge (Homo sacer III, es 2300), Ausnahmezustand (Homo sacer II.1, es 2366), Das Offene. Der Mensch und das Tier (es 2441), Profanierungen (es 2407), Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentar zum Römerbrief (es 2453), Die Sprache und der Tod (es 2468), Signatura rerum. Über die Methode (es 2585), Herrschaft und Herrlichkeit. Zur theologischen Genealogie von Ökonomie und Regierung (Homo sacer II.2, es 2520). Das Sakrament der Sprache. Eine Archäologie des Eides (Homo sacer II.3, es 2606).
Giorgio Agamben
Der Mensch ohne Inhalt
Aus dem Italienischen
von Anton Schütz
Suhrkamp
Die italienische Originalausgabe erschien 1970 unter dem Titel
L’uomo senza contenuto im Verlag Rizzoli (Mailand).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Giorgio Agamben 1970
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin
Deutsche Erstausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-76850-1
www.suhrkamp.de
Inhalt
§ 1 Was das Unheimlichste ist
§ 2 Frenhofer und sein Doppelgänger
§ 3 Der Mensch von Geschmack und die Dialektik der Zerrissenheit
§ 4 Die Wunderkammer
§ 5 »Die Urteile über die Dichtkunst sind wertvoller als die Dichtkunst selbst«
§ 6 Ein sich selbst vernichtendes Nichts
§ 7 Die Entbehrung ist wie ein Gesicht
§ 8 Poiesis und Praxis
§ 9 Die ursprüngliche Struktur des Kunstwerks
§ 10 Der Engel der Melancholie
Anmerkungen
Für Giovanni Urbani als Zeugnis der Freundschaft und des Dankes
§ 1 Was das Unheimlichste ist
In seiner dritten Abhandlung Zur Genealogie der Moral unterzieht Nietzsche Kants Definition des Schönen als interesseloses Wohlgefallen einer radikalen Kritik. Kant, schreibt er,
»gedachte der Kunst eine Ehre zu erweisen, als er unter den Prädikaten des Schönen diejenigen bevorzugte und in den Vordergrund stellte, welche die Ehre der Erkenntnis ausmachen: Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit. Ob dies nicht in der Hauptsache ein Fehlgriff war, ist hier nicht am Orte zu verhandeln; was ich allein unterstreichen will, ist, dass Kant, gleich allen Philosophen, statt von den Erfahrungen des Künstlers (des Schaffenden) aus das ästhetische Problem zu visiren, allein vom ›Zuschauer‹ aus über die Kunst und das Schöne nachgedacht und dabei unvermerkt den ›Zuschauer‹ selber in den Begriff ›schön‹ hinein bekommen hat. Wäre aber wenigstens nur dieser ›Zuschauer‹ den Philosophen des Schönen ausreichend bekannt gewesen! – nämlich als eine grosse p e r s ö n l i c h e Thatsache und Erfahrung, als eine Fülle eigenster starker Erlebnisse, Begierden, Überraschungen, Entzückungen auf dem Gebiete des Schönen! Aber das Gegentheil war, wie ich fürchte, immer der Fall: und so bekommen wir denn von ihnen gleich von Anfang an Definitionen, in denen, wie in jener berühmten Definition, die Kant vom Schönen giebt, der Mangel an feinerer Selbst-Erfahrung in Gestalt eines dicken Wurms von Grundirrthum sitzt. ›Schön ist, hat Kant gesagt, was o h n e I n t e r e s s e gefällt.‹ Ohne Interesse! Man vergleiche mit dieser Definition jene andre, die ein wirklicher ›Zuschauer‹ und Artist gemacht hat – Stendhal, der das Schöne einmal une promesse de bonheur nennt. Hier ist jedenfalls gerade Das a b g e l e h n t und ausgestrichen, was Kant allein am ästhetischen Zustand hervorhebt: le désintéressement. Wer hat Recht, Kant oder Stendhal? – Wenn freilich unsere Aesthetiker nicht müde werden, zu Gunsten Kant’s in die Wagschale zu werfen, dass man unter dem Zauber der Schönheit s o g a r gewandlose weibliche Statuen ›ohne Interesse‹ anschauen könne, so darf man wohl ein wenig auf ihre Unkosten lachen: – die Erfahrungen der K ü n s t l e r sind in Bezug auf diesen heiklen Punkt ›interessanter‹, und Pygmalion war jedenfalls n i c h t nothwendig ein ›unästhetischer Mensch‹.«1
Die Erfahrung der Kunst, wie Nietzsche sie in diesen Worten beschreibt, hat nichts gemeinsam mit einer Ästhetik. Es geht in ihr vielmehr darum, den Begriff der »Schönheit« von der aisthēsis, der Sinnlichkeit des Betrachters, zu reinigen, um die Kunst aus dem Blickwinkel ihres Schöpfers zu betrachten. Diese Reinigung resultiert aus der Umkehrung dessen, was das Kunstwerk in der Perspektive der Tradition ist: An die Stelle der Dimension des Ästhetischen – der sinnlichen Aneignung des schönen Objekts durch den Betrachter – tritt die schöpferische Erfahrung des Künstlers, der im eigenen Werk unepromesse de bonheur erkennt. Am äußersten Punkt ihres Schicksals – in der »Stunde des kürzesten Schattens« – verläßt die Kunst den neutralen Horizont der Ästhetik, um sich in der »goldenen Scheibe« des Willens zur Macht wiederzuerkennen. Pygmalion, jener Bildhauer, der der Liebe zu seiner eigenen Schöpfung derart verfallen ist, daß er wünscht, sie möge nicht mehr zur Sphäre der Kunst gehören, sondern zum Leben, ist das Symbol dieser Wendung im Bereich des Nenners der Kunst, des Übergangs von der Idee einer interesselosen Schönheit zu der des Glücks, der Idee einer unbeschränkten Ausdehnung und Steigerung der Werte des Lebens. Zugleich verlagert sich der Schwerpunkt der Reflexion über die Kunst fort vom interesselosen Betrachter hin zum – interessierten – Künstler.
Daß er diesen Wandel vorausgesehen hat, ist ein Zeugnis mehr für die Richtigkeit von Nietzsches Vorhersagen. Vergleicht man diese Stelle der dritten Abhandlung über die Genealogie der Moral mit den Ausdrücken, derer sich Antonin Artaud im Vorwort zu Das Theater und sein Double zur Beschreibung des Todeskampfs der westlichen Kultur bedient, fällt gerade in diesem Punkt eine überraschende Übereinstimmung auf. »Unsre abendländische Vorstellung von Kunst und der Gewinn, den wir aus ihr ziehen, sind schuld am Verlust unsrer Kultur«, schreibt Artaud: »Unsrer trägen, unbeteiligten Vorstellung von Kunst setzt eine authentische Kultur eine magische und ungestüm egoistische, das heißt beteiligte Vorstellung entgegen.«2 Die Ansicht, daß die Kunst keineswegs eine desinteressierte Erfahrung ist, war in anderen Zeiten offenbar allgemein geteiltes Wissen. Wenn Artaud in »Das Theater und die Pest« auf den Beschluß des Pontifex Maximus Scipio Nasica hinweist, alle Theater Roms dem Erdboden gleichzumachen, sowie auf die Attacken, in denen der heilige Augustinus seiner Wut gegen das Theater, das den Tod der Seele verursacht, freien Lauf läßt, so spricht sich in Artauds Worten die ganze Sehnsucht aus, die ein Geist, für den das Theater nur »in einer magischen, furchtbaren Verbindung mit der Wirklichkeit und mit der Gefahr«3 Bedeutung besaß, für eine Epoche empfinden mußte, die eine derart konkrete und interessierte Idee vom Theater besaß, daß sie es zum Heil der Seele und der Stadt für erforderlich hielt, die Bühnen zu zerstören. Daß man heute nach derartigen Ansichten vergeblich suchen würde – selbst bei Befürwortern der Zensur –, muß nicht erst eigens erläutert werden; daß dagegen da, wo es zum ersten Mal zu einer autonomen Betrachtung des ästhetischen Phänomens als solchem kommt – in der Gesellschaft des europäischen Mittelalters –, dies in Form einer Haßkampagne gegen die Kunst geschieht, liegt weniger auf der Hand. Und doch ist dies nachzulesen in bischöflichen Sendschreiben, welche die musikalischen Innovationen der ars nova, die Modulation des Gesangs und den Gebrauch der fractio vocis, aus der Messe verbannten, da sie mit ihrer Faszination die Gläubigen ablenkten. Im übrigen hätte Nietzsche unter den Zeugnissen, die für interessierte Kunst Stellung nehmen, auch einen Passus aus Platons Politeia zitieren können – einen Passus, der oft wiederholt wird, wenn von der Kunst die Rede ist, ohne daß die Haltung, die sich in ihm ausspricht, einem modernen Ohr deshalb weniger anstößig klänge. Platon sieht ja bekanntlich im Dichter eine Bedrohung des Gemeinwesens und eine mögliche Ursache seines Untergangs. »Einem Mann also«, schreibt er,
»[…] wenn uns der selbst in die Stadt käme und auch seine Dichtungen uns darstellen wollte, würden wir Verehrung bezeigen als einem heiligen und wunderbaren und anmutigen Mann, würden ihm aber sagen, daß ein solcher bei uns in der Stadt nicht sei und auch nicht hineinkommen dürfe, und würden ihn, das Haupt mit vieler Salbe begossen und mit Wolle bekränzt, in eine andere Stadt begleiten.«4
Und mit einer Wendung, die unsere Sensibilität nur in Schaudern versetzen kann, ergänzt Platon später, dies müsse geschehen, weil »in den Staat nur der Teil von der Dichtkunst aufzunehmen« sei, »der Gesänge an die Götter und Loblieder auf treffliche Männer hervorbringt«.5
Doch schon vor Platon stoßen wir im Zusammenhang mit der Kunst auf eine solche Verdammung oder wenigstens auf einen solchen Verdacht, und zwar in einem Dichterwort. Am Ende des ersten Stasimon der Antigone läßt Sophokles den Chor den Menschen, soweit er techné besitzt (in dem weiten Sinn, den die Griechen diesem Wort beilegten, bezeichnete es die Fähigkeit, ein Ding hervorzubringen, es vom Nichtsein zum Sein zu bringen), als »das Beängstigendste« charakterisieren. Diese Macht, erklärt der Chor weiter, könne zum Heil, doch ebenso auch zum Untergang führen, bevor er seine Sicht in einer Weissagung zusammenfaßt, die Platons Bann über die Dichter vorwegnimmt:
»Nie sei Gast meines Herdes, Nie mein Gesinnungsfreund, Wer solches beginnt.«6
Edgar Wind hat bemerkt, daß das für uns so erstaunliche Verdammungsurteil Platons damit zu tun hat, daß die Kunst auf uns nicht mehr den Einfluß ausübt, den sie auf Platon hatte.7 Die Kunst findet bei uns also nur deshalb eine so gnädige Aufnahme, weil sie aus der Sphäre des Interesses herausgetreten und in die des bloßen »Interessantseins« eingetreten ist. In einer Skizze zum Mann ohne Eigenschaften, die Musil zu einem Zeitpunkt verfaßte, als ihm die endgültige Zentralgestalt seines Romans noch nicht klar vor Augen stand, wird Ulrich (hier noch unter dem Namen Anders) beim Eintreten in das Zimmer der klavierspielenden Agathe von einem dunklen und unwiderstehlichen Verlangen erfaßt, das ihn dazu treibt, auf das Instrument, welches das ganze Haus mit solch trostloser Schönheit erfüllt, mehrere Revolverschüsse abzufeuern. Und wahrscheinlich würden wir – ließen wir es darauf ankommen, die friedfertige Aufmerksamkeit, die unseren gewohnten Umgang mit dem Kunstwerk kennzeichnet, zum Gegenstand einer schonungslosen Analyse zu machen – uns am Ende mit Nietzsche in Übereinstimmung finden, nach dessen Ansicht seine Zeit absolut kein Anrecht darauf hatte, eine Antwort auf Platons Frage nach dem moralischen Einfluß der Kunst zu geben, und zwar aus diesem Grunde: »Hätten wir selbst die Kunst – wo haben wir den Einfluss, i r g e n d e i n e n Einfluss der Kunst?«8
Platon hatte, wie die klassisch-griechische Welt im ganzen, von der Kunst eine Erfahrung anderer Art – eine Erfahrung, die mit Interesse und ästhetischem Genuß nur wenig Gemeinsamkeiten aufwies. Die Macht, die die Kunst über die Seele ausübt, erschien ihm ausreichend, um die Grundlagen seiner Stadt zu zerstören; doch er verbannte sie nur widerstrebend und nur gezwungenermaßen, »da wir es uns bewußt sind, wie auch wir von ihr angezogen werden [hōs xynismen ge hēmin autois kēloumenois hyp’autēs]«.9 Um die Effekte der Kunst auf die Vorstellungskraft zu bestimmen, bedient sich Platon der Formulierung »göttliche Angst« (theios phobos) – eines Ausdrucks, der uns heute gewiß kaum geeignet scheint, die Formen zu definieren, in denen wir uns als aufmerksam-bereitwillige Betrachter der Kunst zuwenden. Und doch finden wir uns genau damit konfrontiert, von einem bestimmten Zeitpunkt ab sogar immer häufiger: Wir müssen uns nur die Aufzeichnungen ansehen, in welchen Künstler der Moderne ihre Erfahrungen mit der Kunst niedergelegt haben.
Parallel zu dem Prozeß, im Zuge dessen sich der Betrachter eingeschlichen hat in den Begriff der Kunst (mit dem Ergebnis, daß dieser der Stellenwert eines topos ouranios des Ästhetischen zufiel), dürfte in der Sphäre der Künstler somit eine genau entgegengesetzte Entwicklung stattgefunden haben. Für den, der sie hervorbringt, wird die Kunst eine immer beängstigendere Erfahrung, und im Hinblick auf diese kann der Begriff einer interessierten Kunstbetrachtung bestenfalls als Euphemismus gelten. Denn was hier auf dem Spiel steht, ist keineswegs die Erzeugung eines schönen Werks; für denjenigen, der es hervorbringt, ist das Kunstwerk vielmehr eine Angelegenheit, in der es um Leben und Tod seines Urhebers geht, oder doch eine, in der seine geistige Integrität auf dem Spiel steht. Die zunehmende Ungefährlichkeit, welche die Begegnung des Kunstbetrachters mit dem Werk charakterisiert, geht in der Erfahrung des Künstlers, für den das Glücksversprechen, la promesse de bonheur, der Kunst die Rolle eines Gifts einnimmt, das seine Existenz verseucht und zerstört, Hand in Hand mit wachsender Gefährlichkeit. Das Handeln des Künstlers erweist sich als mit einem extremen und stets zunehmenden Risiko verknüpft, gleichsam als handele es sich um ein Duell, bei dem der Künstler – wie Baudelaire es ausdrückt – »vor Entsetzen aufschreit, ehe er besiegt wird«.10 Wie wenig es sich bei dieser Formulierung um eine Metapher handelt – eine der vielen Metaphern, die zu den »Requisiten des literarischen Histrionen«11 gehören –, ist in den Worten ausgesprochen, in denen der von »Apollo geschlagen[e]«12 Hölderlin an der Schwelle des Wahnsinns sagt: »[Ich] fürcht’ […], daß es mir nicht geh’ am Ende, wie dem alten Tantalus, dem mehr von Göttern ward, als er verdauen konnte.«13 Diese Erfahrung spricht auch aus dem Zettelchen, das man nach Vincent van Goghs Tod in seiner Tasche fand und auf das der Maler gekritzelt hatte: »Und meine eigene Arbeit, nun, ich setzte mein Leben dabei aufs Spiel, und mein Verstand ist zur Hälfte dabei drauf gegangen.«14 Ähnlich erklärte auch Rilke in einem Brief an Clara: »Die Kunstwerke sind stets das Ergebnis eines eingegangenen Risikos, einer bis an ihr Extrem, an den Punkt, an dem der Mensch nicht mehr weitermachen kann, getriebenen Erfahrung.«
Eine weitere Vorstellung, der wir bei Künstlern immer häufiger begegnen, ist die, daß die Kunst grundlegend gefährlich ist – nicht nur für den Künstler, sondern auch für die Gesellschaft. So stößt Hölderlin in den Notizen, in denen er den Sinn seiner unvollendet gebliebenen Tragödie Der Tod des Empedokles auf den Punkt zu bringen versucht, auf eine enge Verbindung, ja auf ein einheitliches Prinzip, das der anarchischen Unbelehrbarkeit der Agrigenter ebenso zugrunde liegt wie der titanischen Poesie des Empedokles; in einem unausgeführten Entwurf zu einer Hymnendichtung erkennt er in der Kunst sogar die wesentliche Ursache von Griechenlands Untergang:
»Nämlich sie wollten stiften Ein Reich der Kunst. Dabei ward aberDas Vaterländische von ihnenVersäumet und erbärmlich ging Das Griechenland, das schönste, zu Grunde.«15
Man kann dies zurückweisen, muß dann aber auch in Kauf nehmen, daß es so in der modernen Literatur keinen Monsieur Teste geben würde, keinen Werf Rönne, keinen Adrian Leverkühn – allenfalls noch den Jean-Christophe Romain Rollands, eine hoffnungslos abgschmackte Romanfigur.
Alles scheint somit darauf hinzudeuten, daß sich die Künstler selbst, würde es ihnen überlassen sein zu beurteilen, ob der Kunst Zutritt zur Stadt zu gewähren sei, mit Platon in Übereinstimmung finden und für die Notwendigkeit optieren würden, die Kunst zu verbannen.
Wenn es sich aber so verhält, dann handelt es sich beim Eintritt der Kunst in die ästhetische Dimension und bei der scheinbaren Möglichkeit, sie nach Maßgabe der aisthēsis des Betrachters zu verstehen, nicht um die unschuldigen und natürlichen Phänomene, die wir in ihnen zu sehen gewohnt sind. Und darum gibt es – falls es uns im Ernst darum zu tun ist, die Frage der Kunst in unserer Zeit zu stellen – wohl nichts Dringlicheres als eine Destruktion der Ästhetik, die das gewohnheitsmäßig als Evidenz Erlebte entthronen und sich bereit finden würde, die Zuständigkeit der Ästhetik als Wissenschaft vom Kunstwerk anzufechten. Es ist jedoch fraglich, ob die Zeit für eine derartige Destruktion reif ist und ob sie nicht eher den schlichten Verlust eines möglichen Horizonts, vor dem das Kunstwerk verstanden werden könnte, nach sich ziehen würde – und damit das Aufreißen eines Abgrunds, der sich dann nur durch einen radikalen Sprung bewältigen ließe. Aber vielleicht sind ein solcher Verlust und ein solcher Abgrund eben das, was uns am meisten not tut, wenn wir wollen, daß das Kunstwerk seine ursprüngliche Rolle wieder einnimmt. Und wenn es wahr ist, daß der grundlegende architektonische Mangel eines Hauses erst in dem Moment sichtbar wird, in welchem es in Flammen steht, so könnten wir uns heute in einer besonders günstigen Lage befinden, den authentischen Sinn des ästhetischen Projekts des Westens zu begreifen.
Vierzehn Jahre bevor Nietzsche die dritte Abhandlung zur Genealogie der Moral publizierte, hat ein Dichter, dessen Wort wie ein Gorgonenhaupt über dem Schicksal der westlichen Kunst steht, von der Dichtung nicht verlangt, daß sie schöne Werke hervorbringe oder einem desinteressierten ästhetischen Ideal genüge, sondern daß sie das Leben ändere und dem Menschen die Pforten Edens wieder öffne. Rimbauds Begegnung mit dem Terror findet in dieser Erfahrung statt, in der la magique étude du bonheur, die magische Erforschung des Glücks, alle sonstigen Zwecke verdunkelt, um sich selbst als einzige Fatalität von Dichtung und Leben zu setzen.
Die Einschiffung nach Kythera – ins Kythera der modernen Kunst – soll den Künstler somit nicht dem versprochenen Glück zuführen; sie soll ihm vielmehr Zugang zum Unheimlichsten verschaffen, nämlich zu jenem göttlichen Terror, der einst Platon dazu bewog, die Dichter aus seiner Stadt zu verbannen. Nietzsches Appell aus dem Vorwort zur Fröhlichen Wissenschaft – »Nein, wenn wir […] überhaupt eine Kunst noch brauchen, s o i s t e s e i n e a n d r e K u n s t ! […] V o r A l l e m : e i n e K u n s t f ü r K ü n s t l e r , n u r f ü r K ü n s t l e r ! «16 – gewinnt seinen rätselhaften Sinn wieder, wenn er als der letzte Moment in jenem Prozeß erkannt wird, in dem die Kunst sich von ihrem Betrachter reinigt, um sich unversehens, in wiedererrungener Integrität, mit ihrer eigenen absoluten Bedrohlichkeit konfrontiert zu sehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!