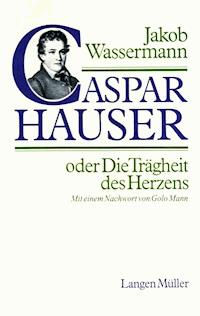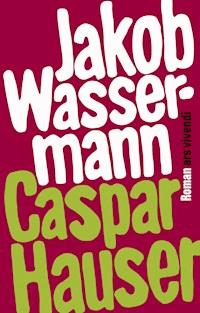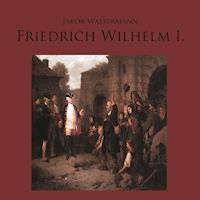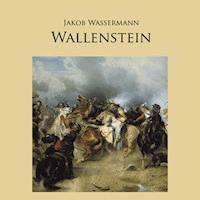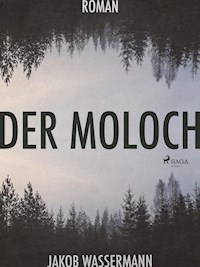
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Zwischen Podolin und Lomnitz, wo sich die Ebene aus einer flachen Mulde zu einem unscheinbaren Hügelchen anhebt, lag der Ansorge-Hof." Dorthin, in einen der nördlichsten Winkel der kaiserlich-königlichen Monarchie, hatten sich der fünfjährige Arnold und seine Mutter zurückgezogen, als sich in ihrem Leben mit einem Mal alles geändert hatte. Ein Zugunglück kostete dem Vater das Leben. In aller Stille wächst Arnold zu einem kräftigen, anspruchslosen, in sich gekehrten Mann heran, der sich eng mit der Natur im Umkreis des Gutshauses verbunden fühlt. Doch bald erweist es sich, dass das Leben Herausforderungen für Arnold bereithält. Er verliebt sich in die Magd Slasha, um nach kurzer Zeit zu bemerken, dass seine Leidenschaft für sie schnell wieder abgekühlt ist. Die Behandlung des Juden Elsasser, die allem rechtlichen Empfinden zuwiderläuft und dessen Tochter Jutta ins Kloster verschleppt wird, wühlt Arnold auf. Als dann noch seine Mutter stirbt, wird Arnold klar, dass er sich jetzt den Herausforderungen des Lebens stellen muss.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jakob Wassermann
Der Moloch
Saga
Der MolochCopyright © 1902, 2019 Jakob Wassermann und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711488287
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Frau Ansorge
Erstes Kapitel
Zwischen Podolin und Lomnitz, wo sich die Ebene aus einer flachen Mulde zu einem unscheinbaren Hügelchen erhebt, lag der Ansorge-Hof. Das Wohngebäude lehnte mit der Rückseite gegen die wilden Hecken, die den weitläufigen parkartigen Garten begrenzten. Das Haus, mit den weissgekalkten Mauern tief in die Erde gebohrt, erschien durch eine zum Tor führende Steintreppe und durch die zopfigen Verzierungen um die Fenstervierecke als ein Mittelding zwischen Bauern- und Herrenhaus. Das überhängende Ziegeldach leuchtete wie eine mächtige Kapuze brennend rot über die Landschaft. Vom Dorf war nur der Kirchturm zu sehen, denn unvermutet, durch eine Laune der Natur, erhebt sich bei Podolin ein schroffer Erdhügel, der den träg einherziehenden Fluss zwingt, ihm in weitem Knie auszuweichen. Podolin selbst liegt auf der sanfter abfallenden Seite des Hügels, ist aber gegen Süden bis hart an den Fluss herangebaut, so dass die Hauptstrasse des Dorfs nahezu die Gestalt eines S hat. Ringsumher dehnt sich wellig-ebenes Land, das nicht allzu reichlich mit Baum und Busch bedeckt erscheint.
Zwischen dem Dorf und dem Ansorge-Hof breitete sich ein häuserloser, öder Erdstrich. Nur ein grosser Zimmerplatz lag am Flussufer, und von ihm strömte Sommer und Winter der Geruch frisch behauener Baumstämme aus.
Die meisten Leute in der Gegend erinnerten sich genau des Tages, an welchem Frau Ansorge in einer altertümlichen vierschrötigen Kutsche von der Ostrauer Strasse her ins Dorf eingefahren war, begleitet von ihrer Dienerin Ursula, die den fünfjährigen Arnold auf den Knien hielt. Der damalige Bürgermeister hatte die Frau hinübergeführt auf den Hof, der seit mehr als hundert Jahren einem ehemals reichen und nun zugrunde gegangenen Bauerngeschlecht gehört hatte. Bald begann eine ruhige, doch unablässige Geschäftigkeit das Aussehen des verwahrlosten Gutes zu verändern. Stall und Scheune wurden instand gesetzt, Zäune aufgerichtet, der versandete Brunnen wurde tiefer gegraben, der Viehstand verbessert, neue Möbel, neue Pflüge, neues Gesinde beschafft, und das Wohnhaus erhielt ein neues Dach.
Drei Monate früher hatten Frau Ansorges Wünsche noch andern Lebenszielen gegolten, als in der mährischen Einsamkeit Ruhe vor der Welt zu suchen. Sie hatte die Vergnügungen der Geselligkeit und alle jene Freuden geliebt, welche ihr der Reichtum ihres Mannes verschaffen konnte. Alfred Ansorge war einer der grossen Kohlenwerksbesitzer des Ostrauer Reviers gewesen. Allerdings hatten ihn seine Geschäfte gezwungen, einen grossen Teil des Jahres in der traurigen, russigen Stadt zuzubringen, aber desto schöner war dann der Gegensatz zu der in Wien, im Gebirge oder auf Reisen verbrachten Zeit. Von einer solchen Reise kehrte die Familie, Mann, Frau und Kind, anfangs Dezember nach Ostrau zurück. Die Winternacht, der sie entgegenfuhren, besiegelte das Schicksal der drei Menschen. Eine Viertelstunde vor dem Ziel lief der Eisenbahnzug auf ein falsches. Geleise und prallte in vollem Rasen gegen einen aus Schlesien kommenden Personenzug. Dieselben zusammenprasselnden Wagenteile, die dem entsetzt auffahrenden Mann den Kopf zermalmten, waren der Frau zum Schutz geworden und hatten sie und den Knaben umgeben wie die Bretter eines Sarges. Als man sie befreien konnte, lag das Kind unversehrt zwischen ihren zu einem Bett erweiterten Schenkeln. Nur ihre Augen zeigten, was in ihr vorgegangen war, als sie in dem Verlies gelegen, das Brausen des Windes im Ohr, der Rettung ungewiss, ungewiss auch, was mit dem Knaben sei. Vierzehn Tage lang vermochte sie nicht zu gehen, zu reden und zu hören. Ihre Seele schien erfroren, schien nichts mehr aufzubewahren als die furchtbaren Laute dieser Stunde, die am Rande des Lebens und am Anfang des Todes lag. Doch wie das Wasser unter der Eisdecke des Stromes fliesst, trieb ihr dunkler Wille einer neuen Form des Lebens zu.
Der Anwalt Borromeo aus Wien, ein Bruder Frau Ansorges, ordnete die Hinterlassenschaft des Mannes, wohnte dem Begräbnis bei und nahm den Knaben in seine Obhut. Bald wurde Frau Ansorge innerlich und äusserlich ruhig; sie vermochte sich mit Den laufenden Geschäften zu befassen und bekundete sogar eine eindringlichere Teilnahme als der geschäftsgewohnte Bruder. Sie sorgte für die beste Verzinsung des Kapitals, nachdem alle liegenden Gründe veräussert waren, und kaufte, ohne ihren Vorteil zu übersehen, das Gut bei Podolin, dessen Weltentlegenheit ihre Wahl beeinflusst hatte.
Ihr Fuss wurde vorsichtig im Schreiten wie der eines Blinden. Sie tat keinen unnotwendigen Schritt und vermied jede überflüssige Bewegung. Sie hasste alles Fahrige, Eilige, alles Springen, Laufen und Tänzeln. Was auf Rädern lief und nur entfernt einer Maschine ähnlich sah, erregte ihren Abscheu. Im Hause durften keine Wanduhren ticken, vor den Fenstern mussten Büsche gepflanzt werden, denn sonderbarerweise konnte sie weder den Anblick der Horizontlinie noch den der langhinlaufenden Strasse ertragen. Spiegel und Bilder liebte sie nicht; nichts, was an der Wand oder an der Decke hing. Ihr Bett lag flach und knapp über den Dielen.
In solchem Kreis des Ruhens wuchs Arnold empor. Auf dem Grunde schwarzen Unheils malte sich wie etwas Rosiges sein junges Leben. Die beharrende Furcht der Mutter war eine Schranke um ihn, aber eine unsichtbare. Nicht etwas Nennbares und Wechselndes, sondern ehern und unablässig als Naturkraft wirkend, bildete sie die Quelle seiner Gewohnheiten; sein Herz blieb rein von Unfrieden, auch hatte er nichts von der Zuchtlosigkeit, die durch regellose und eifersüchtige Geselligkeit entsteht.
Er zeigte als Kind oft ein verstocktes, ja grämliches und mürrisches Wesen. Mit zusammengezogenen Brauen und gespreizten Schrittchen stapfte er herum wie ein kleiner Bär. Dies reizte natürlich die Leute auf dem Hof zum Lachen; besonders Ursula äffte Arnolds Gebaren nicht ohne Bosheit nach. Das empörte den Knaben; denn für die Neckereien der Erwachsenen besass er damals und auch später nicht das geringste Verständnis; sie erschienen ihm als ein unrechtmässiger Eingriff in seine persönliche Freiheit. Mit schiefem Blick und zwischen die Schultern eingezogenem Kopf stand er bei solchen Gelegenheiten da, und wenn der feindliche Spott kein Ende nehmen wollte, zog er die Lippen auseinander, jappte jähzornig, machte zwei Fäuste, die er gleich Puffern links und rechts an der Brust hielt, sprang auf den Plagegeist los und biss und schlug. Doch solche Zornwütigkeit zeigte sich mit den Jahren immer seltener, und statt ihrer stellte sich eine verächtliche Blick- und Wortsparsamkeit ein, die dem Bewusstsein der Körperkraft entsprang und recht possierlich wirkte.
Die Verlorenheit des Aufenthaltes entzog Arnold jedem Bildungszwang. Durch die weitgehenden Verbindungen Friedrich Borromeos bildete die Militärpflicht Jahre voraus keine Sorge mehr für Frau Ansorge. Sie selbst lehrte ihn lesen und schreiben. Um ihn auch weiterhin unterrichten zu können, studierte sie Tag und Nacht mit wahrer Wut, und so wurde sie seine Lehrerin in Sprachen, Geschichte, Geographie und den niederen Fächern der Mathematik. Ihn im Dunkel der Unwissenheit zu lassen, darin sah sie keine Sicherheit. In seinem fünfzehnten Jahr besass er die Durchschnittsbildung der jungen Leute seines Alters. Er hatte keinen Ehrgeiz in geistigen Dingen und fand Vergnügen an körperlicher Arbeit. Die Mutter wünschte ihn mittelmässig und so am meisten geschützt gegen die Stürme des Schicksals. Der Anschein befriedigte sie.
In der drängendsten Zeit der aufwachenden Mannbarkeit verriet sich an ihm eine unruhige Überschwenglichkeit und Phantasterei, die seiner Natur fremd war. Da kam es vor, dass er während einer ganzen Sommernacht sich in den Wäldern herumtrieb, nach den Sternen starrte, in die Erde hineinhorchte und mit eigentümlicher Angst den Aufgang der Sonne erwartete. Ein andermal entfernte er sich in der Früh und kam erst am zweiten Tag zurück. Vierzehn Stunden war er gegangen, um zu erfahren, was hinter dem Wald, hinter den Hügeln der Ferne lag, und traurig hatte er den Heimweg angetreten, als immer wieder dieselben Äcker und Wiesen, dieselben unansehnlichen Häuschen an derselben Strasse erschienen waren.
Bald verging das aufgeregte Wesen wieder und kehrte sich fast in sein Gegenteil, so dass er den Eindruck eines mürrischen und phlegmatischen Burschen machte. Ohne sichtbare Freude der Wahrnehmung, ja sogar ohne Frohsinn, liess er Sommer und Winter und wieder Sommer und Winter vorbeiziehen, denn dieser Wechsel und nicht die Ereignisse der Welt war für ihn das bedeutendste Schauspiel auf dem Zifferblatt der Zeit, das er mit trockener Selbstgenügsamkeit verfolgte. Er war träg und schwieg gern aus Trägheit, auch gegen die Mutter. Es bestand zwischen ihnen kein gefühlvolles Streben nach Annäherung, auch keine geheimnisvolle Abgeschlossenheit. Jeder schien in einem eigenen Land, nach eigenen Gesetzen zu leben. Die Einfachheit der Tage und der Beschäftigungen bestimmte den Charakter ihres Verhältnisses. Arnold war nie trotzig oder aufgeblasen gegen die Mutter, aber sie war für ihn mehr eine ältere Genossin als eine Achtungsperson. Später zeigte er in den kurzen Gesprächen mit ihr eine spöttische Aufmerksamkeit, die ihm nicht übel zu Gesichte stand und die Frau Ansorge vielleicht nur darum ein wenig ängstigte, weil sie etwas an sich hatte, was wie ein Zeichen geistiger Überlegenheit aussah. Aber die Sache war einfach die, dass Arnold nicht mehr ausschliesslich die Mutter, sondern auch die Frau in ihr erblickte, die er, in komischem Männlichkeitswahn, sich untergeordnet glaubte.
Die Beziehung zwischen den Geschlechtern war nie ein schwüles Mysterium für ihn gewesen. Seine früh erwachte Sinnlichkeit, abgelenkt durch körperliche Arbeit, hatte keinen Anlass zu dunklen Träumereien gefunden. Als er mit sieben Jahren zum erstenmal das Belegen einer Stute mit ansah, da begriff er das gewaltige Weben, welches scheinbar aus dem Nichts eine neue Kreatur erschafft. Obwohl sich sein Blick langsam für dergleichen Schauspiele abstumpfte, so vergass er doch niemals den herrlichen Anblick des sich bäumenden Hengstes, sein schaumtriefendes Maul, die geblähten Nüstern, die feurig lohenden Augen, die schweissbedeckte dampfende Haut.
Nun war er zwanzig; es ging auf den Sommer zu, und ein wunderliches Drängen und Wühlen meldete sich bisweilen in seinem Innern. Oft war es, als ob das Herz aufgeschwellt wäre durch einen schrecklichen Überschwang zielloser Kräfte, die des Nachts, in einem Traum etwa, den eigenen Körper, in dem sie wohnten, zu erschüttern und zu verwunden trachteten.
Da heiratete die Kleinmagd auf einen fremden Bauernhof fort, und die neuankommende war in ihrer Art eine Schönheit, braun wie eine Kastanie, frisch und voll Rasse. Sie war aus dem Polnischen und hiess Salscha. Als Arnold sie gewahrte, sie stand am Brunnentrog und wusch, ihre Bewegungen hatten etwas Rauhes und Herausforderndes, da besann er sich lange, schaute gegen das sonnenbeschienene Gelände und blinzelte mit den Augen. Aber er konnte nicht helfen, es zog ihn hin. Er machte nicht viel Umstände; als er vor Salscha stand, fragte er einfach, ob sie ihn haben wolle, und zwar hatte er dabei einen strengen Ton und sah finster aus, als fordere er etwas, das ihm seit langem gehörte und unrechtmässig vorenthalten war. Die Magd lachte und liess ihn stehen. Aber zwölf Stunden darauf war sie die seine. Ohne zu schleichen, ohne Belauern und Überlisten, das war seine Sache nicht, nahm sie Arnold und war bei ihr nachts in der Kammer oder mittags im Heu, wenn alles auf dem Hof unter der senkrechten Sonne schlief. Kurze Zeit glaubte Salscha guter Hoffnung zu sein, doch damit war es nichts. Und als die Glut des Sommers abnahm, verschwand plötzlich Arnolds hastiges Liebesfeuer, und Salscha war ihm nichts mehr denn ein leeres Gefäss, dessen Inhalt er hatte trinken müssen, um den eigenen Körper vor Verderben zu bewahren. Sein Herz wurde wieder ruhig.
Zweites Kapitel
Das Laub zeigte schon alle herbstlichen Farben. Gelb, violett, purpurn und zinnoberrot wogte es in der abendlichen Luft. Ferne Waldstände glichen einem Girlandenbehang in der tiefen Sonne, der Arnold langsam entgegenging. Aus der Ebene ertönte bäuerlicher Gesang, vom leise sausenden Oktoberwind bald verweht, bald überdeutlich gemacht. An einem Tümpel in den Wiesen stand Maxim Specht, der Podoliner Lehrer, und plätscherte mit einem Baumzweig im Wasser. Bisweilen blickte er gegen den Ansorge-Hof, als ob er von dort jemand erwarte. Er war erst seit zwei Monaten in Podolin; Arnold hatte noch nicht mit ihm gesprochen.
An der Zauntür des Hofes angelangt, lehnte sich Arnold lässig an den Pfosten und betrachtete die ruhig vorbeitrippelnden Hühner, die sich langsam nach ihrer Schlafstätte in der Scheune aufmachten und bisweilen leise gackerten, als ob sie einander gute Nacht wünschten. Draussen schob sich Maxim Spechts Gestalt schwarz und scharf zwischen die Ebene und den flammenden Himmel.
Kleiderrauschen veranlasste Arnold, sich umzudrehen. Zu seinem Erstaunen bemerkte er zwei Frauen, die, aus dem Tor tretend, an ihm vorübergingen. Die eine der beiden, ein junges Mädchen, lächelte verlegen und verschmitzt mit halbabgewandtem Gesicht. Während er ihnen nachschaute, kam der Lehrer voll Eile den beiden Frauen entgegen und schlug mit ihnen die Richtung nach dem Dorf ein.
Als Arnold in die Stube trat, fragte er, wer dagewesen sei. Frau Ansorge wandte ihm langsam das Gesicht zu, das so viele Falten zeigte wie ein Baumblatt Adern. „Sie machen Besuche,“ erwiderte sie vorsichtig, „Nachbarsvisite; sie glauben, das muss so sein. Sie haben das Haus des verstorbenen Michael Becker geerbt und sind nach Podolin übersiedelt. Hanka heissen sie.“
Ursula brachte das Abendessen, und Arnold setzte sich hungrig zu Tisch. Seine Wissbegierde war befriedigt. Er bemerkte nicht, dass die Mutter durch die neuen Ansiedler nachdenklich geworden war, denn ein neuer Mensch war ihr eine neue Gefahr. Der Pfarrer, der Doktor, die Post- und Gerichtsbeamten waren ausser den Bauern die einzigen, die man hier zu Gesicht bekam.
Kaum war die Lampe angezündet, als es an die Tür klopfte und Maxim Specht eintrat. „Ich bitte vielmals um Entschuldigung,“ sagte er gewandt und liebenswürdig, „das Fräulein hat einen Schal hier vergessen.“ Er lächelte, wobei das Liebenswürdige, Gesellschaftliche noch stärker hervortrat und daneben etwas Überlegenes wie bei jemand, der zu beobachten fähig ist und sich dessen freut.
Das Tuch hing über einem Stuhl, und Arnold gab es dem Lehrer, „Es ist sehr gelb, das Ding“, meinte er lachend. Er schnupperte und steckte die Nase in den gestrickten Stoff. „Pfui!“ rief er.
„Es ist parfümiert“, sagte Specht verwundert. „Finden Sie das schlecht?“ Er sah Arnold an wie einen jungen Bären, dessen Kraft und Dressur zu allerlei geschäftlichen Unternehmungen locken. Er hatte in Podolin viel reden hören von dem Leben auf dem Ansorge-Hof. Arnold seinerseits betrachtete das Gesicht des Lehrers, das im Lampenlicht ihm zugewandt war, mit spöttischer Aufmerksamkeit. Er empfand Misstrauen und zugleich eine unklare Regung der Kameradschaft.
Dem Lehrer, der den abweisenden Blick Frau Ansorges auf sich ruhen fühlte, geboten Takt und Bescheidenheit, sich zu entfernen. Mit einer leichten Bewegung warf er das gelbe Tuch über die Schulter, verbeugte sich galant und wünschte gute Nacht.
Drittes Kapitel
Vor Aufgang der Sonne erwachte Arnold. Als er gewaschen und angekleidet war und in den Stall hinüberging, leuchtete schon der frühe Tag. Er liebte diese Stunde, besonders jetzt, in der Oktoberklarheit und -frische. Die Waldränder am Horizont waren rosig bemalt. Die Rinder wurden zur Tränke geführt, sie blökten freundlich.
Ehe Arnold nach Podolin ging, wo er mit dem Fleischer Uravar wegen einer Kuh unterhandeln sollte, kehrte er ins Haus zurück, um zu frühstücken. Er fand Elasser, einen Hausierer aus dem Dorf, bei Frau Ansorge. Der Jude kam jeden Monat zwei- bis dreimal, um Stoffe und Wolle, auch sonstige Gegenstände für den Haushalt zu verkaufen.
Glasser begrüsste Arnold buckelnd, während er Stirn und Glatze, die trotz des kühlen Morgens schon schweissbedeckt waren, mit einem blauen Tuch trocknete. Sein langhängender brauner Bart verhüllte fast den Ausdruck eines ziemlich gutmütigen Gesichts. Er steckte das Geld, das er empfing, mit liebevoller Sorgfalt in einen schmutzigen alten Lederbeutel, huckte seinen ansehnlichen Pack auf den Rücken, grüsste ehrerbietig und ging.
Arnold trank seinen Topf Milch und sagte: „Ich geh’ jetzt ins Dorf.“
Der Weg wurde leicht in der windstillen und würzigen Luft. Die Welt atmete Frieden. Indem Arnold rege vorwärtsschritt, fühlte er sich gelaunt, tagelang zu wandern. Er hob einen dicken Ast auf, der am Wege lag, brach ihn entzwei wie ein Rohr und warf die Stücke in den Fluss, dessen mühselig hinfliessendes Wasser nichts von der Reinheit des Himmels wiedergab.
Podolin streckte sich lang hin. Die Häuser, arm und schmutzig, entfernten sich nur an einer Stelle von der Strasse und bildeten, den Hügelrücken hinan, einen weiten Platz, an welchem die Kirche, das Pfarrhaus, die Schule, die Post und das Gerichtsgebäude standen. Uravar wohnte am Eck hoch oben. Als Arnold in den Laden trat, erblickte er den jüdischen Hausierer, hektisch rot im Gesicht, mit leidenschaftlichen Gebärden auf den Metzger einsprechend. Uravar hockte nachlässig, die Hände in den Taschen, auf der Kante des langen Tisches, der mit Blut und Fleisch bedeckt war, knirschte mit den Zähnen und lachte. Sein bartloses Gesicht war rot und glänzend wie das rohe Fleisch; am Kinn hatte er eine Warze mit fünf langen Haaren, welche aussah, als ob beständig eine Kreuzspinne auf seine Lippen zukröche.
„Wenn Sie mir nicht geben wollen mein Geld,“ sagte der Hausierer, „werd’ ich Ihnen verklagen bei Gericht.“
Uravar schlug sich auf die Schenkel und zeigte die blendend weissen Zähne. „Judd, geh furt, sonst holl ich Hund“, sagte er und warf einen beifallhaschenden Blick auf Arnold, der still auf der Schwelle stand.
Elasser wurde erregt. „Ich fürcht’ mich nicht vor Ihrem Hund“, antwortete er. „Ich fürcht’ mich nicht einmal vor Ihnen, wie soll ich mich vor Ihrem Hund fürchten. Geben Sie mir mein Geld und die Sach’ hat sich gehoben.“ Sein Gesicht sah fahl aus, und die Augen fielen kummervoll und ermüdet in ihre Höhlen. Rettungsuchend blickte er an Arnold vorbei auf den öden Platz, als Uravar sich von seinem Sitz herabschnellte und mit ausholenden Schritten auf ihn zuging. Er packte Elasser mit beiden Armen um den Leib, hob ihn empor und schleppte ihn gegen die Türe. Aber zwei Hände klammerten sich mit solcher Kraft um seine dicken Schultern, dass die Schlüsselbeinknochen krachten und zurückgedreht wurden. Mit einem Wutgebrumm liess Uravar den Juden zur Erde gleiten, drehte sich schwerfällig um, den Kopf geduckt, und blickte Arnold, der ihn nun losgelassen hatte, tückisch an. Arnold erwiderte den Blick mit solcher Ruhe, dass der brutale Mensch den Kopf duckte und das Kinn herabzog, wodurch die Kreuzspinne zusammenschrumpfte.
Glasser huckte keuchend seinen Pack auf. „Der Herr wird dafür zu büssen haben“, sagte er, auf Uravar deutend. „Einem Besoffenen und einem Heuwagen muss man ausweichen, heisst es. Aber gegen Gewalttätigkeiten sind da die Gerichte.“ Er nickte Arnold zu und verliess den Laden.
Angewidert und nicht imstande mit dem Fleischer zu reden, trat Arnold auf den Platz hinaus und sah gedankenvoll hinunter, die Augen gegen die blendende Sonne mit der Hand beschirmend. Trotzdem kam es ihm vor, als sei der Sonnenschein trüber geworden.
Hinter den Kindern, die jetzt dem gegenüberliegenden Schulhaus entströmten, wurde Maxim Specht sichtbar. Er schritt ohne weiters auf Arnold zu und sagte mit anerkennendem Ausdruck: „Sehr schön, sehr gut. Ich habe vom Fenster aus zugesehen. Endlich einmal hat dieser Kerl eine Lektion erhalten.“ Er lachte mekkernd, wobei seine Augen ganz klein wurden und freundschaftlich glänzten. Dann lud er Arnold ein, ihn ein Stück Wegs zu begleiten; oft schon hätte er sich eine nähere Bekanntschaft gewünscht, sagte er. Obwohl sein Anzug ärmlich war, sah er adrett aus; im Gespräch war er ungezwungen und zugleich zurückhaltend. Er war sehr neugierig in bezug auf alles, was Arnold betraf.
„Wie können Sie denn das aushalten hier, das eintönige Leben?“ fragte er. „Was tun Sie denn den ganzen Tag über?“
Arnold gab, so gut er konnte, Auskunft.
„Sie sind also eine Art Verwalter auf dem Gut Ihrer Frau Mutter?“ meinte Specht. „Und wird Ihnen das nicht langweilig?“
„Langweilig? Nein; langweilig ist es nicht!“
„Waren Sie nie in der Stadt?“
„Nein.“
„Überhaupt noch nicht? Wie merkwürdig! Dem Äussern nach sind Sie doch ein Städter. Ihre Sprache, Ihr Gesicht, Ihr Benehmen, alles ist wie bei einem Städter. Sehr merkwürdig!“
„Ist denn das so etwas Besonderes, ein Städter?“ erkundigte sich Arnold.
„Na, etwas Besonderes . . . das will ich nicht gerade sagen. Aber wenn Sie die Stadt noch nicht kennen, da steht Ihnen ein grosser Genuss bevor. Haben Sie noch nie Sehnsucht danach gehabt? Nein! Wie merkwürdig! Ich sage Ihnen, es ist etwas Herrliches um so eine grosse Stadt. Theater, Konzerte, reiche Leute, schöne Damen, Paläste, Kirchen, kolossale Strassen und abends ein Lichtermeer! Das können Sie sich nicht vorstellen. Es ist wie ein Traum. Hier versumpft man ja, glauben Sie mir.“
Verwundert schüttelte Arnold den Kopf. Da es ihm zu heiss wurde, zog er seine Lodenjacke aus, wobei er stehenblieb und den Lehrer durchdringend und verständnislos anschaute.
Sie waren gegen die Nordseite vors Dorf gekommen. An der Strasse lag eine Art Meierhof: ein schmuckes Wohnhaus, Stall, Scheune, alles sauber und neu ums zäunt. Wie eine appetitliche Speise auf dem Teller lag das kleine Gut in der Ebene. Unter dem Haus stand ein junges Mädchen, auf den Lippen ein Kinderlächeln. Als Specht sich von Arnold verabschiedet hatte, schlug sie den gelben Schal fester um Brust und Schultern und ging dem Lehrer entgegen.
Viertes Kapitel
Es war Nachmittag; Arnold sass am Fluss und schaute ruhig nach der Angelschnur, die sich in weitem Bogen zum Wasser senkte. Er hatte das Hemd über der Brust geöffnet; es war ungewöhnlich schwül geworden. Nicht das kleinste Fischlein wollte sich verbeissen; den schwarzen Fluss kräuselte keine Welle. Der Himmel hatte sich umzogen; über den schlesischen Wäldern lag ein Wetter.
Salscha, vom Dorf herkommend, blieb neben Arnold stehen und fragte ihn, was er mit dem Fleischer Uravar gehabt habe, der schimpfe wie ein Teufel auf ihn.
Arnold brummte etwas vor sich hin.
Weshalb er sich da hineinmische, fuhr das Mädchen fort, dem Juden werde er ja doch nicht zu seinem Recht verhelfen können.
„So? Warum denn nicht?“ fuhr Arnold auf.
Na, die Juden seien eben keine rechten Menschen, sie behexten das Vieh und zu Ostern schlachteten sie Christenkinder.
„Dumme Sans“, murmelte Arnold verächtlich. „Der Jud ist arm, hat neun Kinder zu Haus, und wenn er zu Gericht geht, wird er auch sein Recht bekommen.“
„Natürlich, als ob das Recht bei den Gerichten nur so vorrätig wäre!“ höhnte Salscha.
Arnold zuckte die Achseln und schwieg.
Salscha setzte sich auf einen Stein neben Arnold, die Knie unter den Röcken weit voneinander, die Augen nicht von ihm wendend. Weit und breit war kein Mensch zu sehen; eine Viertelstünde der Liebe schien erwünscht. Aber endlich merkte sie die Kälte Arnolds. Mit bösem Blick schielte sie nach der Angel, stand auf und ging. Lange noch hörte Arnold ihr gleichmässiges und erzürntes Trällern über die Wiesen klingen.
Arnold schnellte die Angel aus dem Wasser und machte sich auf den Heimweg, da der Regen nahte. Über Podolin wetterleuchtete es. Er schulterte die Rute und schritt fest über den dürren Ackerboden. Frau Ansorge sass bleich in der Mitte des Zimmers, als er eintrat, denn sie fürchtete Gewitter, besonders die des Herbstes.
Aber die Wolken verzogen sich wieder.
Arnold erzählte, dass ihn der Lehrer in Podolin angesprochen und ihm mit allerlei wunderlichen Ausdrücken von dem Leben in der Stadt vorgeschwärmt habe.
Frau Ansorge runzelte finster die Stirn. „Der Windbeutel“, sagte sie; „er soll seine Weisheit für sich behalten.“
Sie stellte sich ans Fenster und blickte gegen den Himmel, wo ein Regenbogen stand.
„Komm einmal her, Arnold“, sagte sie.
Arnold trat an ihre Seite.
„Siehst du den Regenbogen? Jetzt steht er schön und gross vor dir. Kommst du zwischen Gassen und Häuser, so bleibt nicht mehr viel von ihm übrig. Und soviel deine Augen davon verlieren, so viel Glück und Ruhe verlierst du selber. Und die Stadt, das ist nichts anderes als eine Unmenge von Gassen und Häusern. Sie verwirren dich nur, die Windbeutel, sie sind leer wie gedroschenes Stroh.“
Fünftes Kapitel
Hankas, die neuen Bewohner von Podolin, hatten Besuch. Der Bruder von Agnes Hanka, Alexander, war aus Wien gekommen. Er wollte nur drei Tage bleiben; Erbschaftsangelegenheiten waren zu besprechen. Auch wegen Beate kam er, die seine Schussbefohlene war. Agnes hatte sie einst auf seinen Wunsch zu sich genommen. Vor Jahren hatte er die arme Waise den Händen böswilliger Verwandten entrissen, der Familie seines Gutsinspektors in Böhmen. Alexander Hanka, den alle Welt für die Vernunft und Hausbackenheit selber hielt, hatte damals phantastische Pläne gefasst. Ein Ideal schwebte ihm vor: ein von der Gesellschaft losgelöstes Weib, innerlich frei und kräftig, unverblendet und natürlich, das er für sich, für ein von der Gesellschaft losgelöstes Leben auferziehen wollte. Seitdem waren acht Jahre verflossen, und er sah auf sein ehemaliges leichtgläubiges Ich etwas gelangweilt herab. Beate selbst fand die gleichmütige Gesinnung bequem. Wer nicht dankbar zu sein braucht, ist wenigstens ehrlich; sie schäfte den Beschützer, denn sie wusste, was sie an ihm hatte, und war zutraulich gegen ihn.
Als Doktor Hanka in Podolin ankam, stand die Sonne schon tief im Westen. Harzgeruch würzte die Luft, Bauern gingen vorbei und grüssten. Am Rain weideten Kühe und blickten mit Ruhe und Missbilligung auf den städtischen Ankömmling.
Agnes und Beate waren nicht zu Hause. Hanka erfuhr, dass seine Schwester beim Pfarrer, Beate man wisse nicht wo sei. Damit gab er sich zufrieden, setzte sich auf die Bank vor dem Haus, rauchte, schlug die langen Beine übereinander und wartete. Die Stille und der grosse Himmel, dessen Anblick in solchem Umfang ihm ungewöhnlich war, liessen ihn seine anfängliche Verdriesslichkeit über den Landausflug vergessen.
Während er noch in Nachdenken versunken war, es fing schon an zu dämmern, klang ein überraschtes Ach an seine Ohren. Beate stand hinter ihm, und mit ihr war Maxim Specht gekommen. Beate, indem sie eine ungeschickte Tanzstundenhöflichkeit annahm, machte die beiden Männer miteinander bekannt. Der Lehrer und Beate sahen belustigt und aufgeräumt aus. Mit offenbarem Vergnügen an seinem Talent, Erlebtes wiederzugeben, erzählte Specht, dass sie auf der Lomnitzer Strasse Arnold Ansorge begegnet seien und sich gut dabei unterhalten hätten.
„Er fragte, ob ich schon einen Liebhaber hätte“, platte Beate lachend heraus.
„Nicht was er sagt, ist so amüsant,“ erklärte Specht, „sondern wie er zuhört, wie er verwundert ist, wie er jedes Wort bedenkt. Er ist nicht dumm.“
„Wer ist Arnold Ansorge?“ fragte Hanka kühl, dem die Art Spechts nicht sympathisch war. Indes kam auch Agnes Hanka. Bruder und Schwester begrüssten einander herzlich, Alexander mit der ihm eigenen Gravität und spöttischen Zurückhaltung, Agnes mit einem Ausdruck unbegrenzter Hochachtung vor dem Bruder. Da sie schwerhörig war, redete sie wenig, aus Furcht, misszuverstehen, und aus noch grösserer Furcht, den zu bemühen, mit dem sie sich unterhielt.
Alle vier gingen ins Haus. Specht verabschiedete sich bald. Sein Taktgefühl sagte ihm, dass er übers flüssig, und seine Empfindlichkeit, dass Hansa nicht zufrieden sei mit der Anwesenheit eines Fremden. Als Specht gegangen und Agnes in der Küche beschäftigt war, erkundigte sich Hanka bei Beate nach dem Lehrer.
Beate blickte den umherstolzierenden Frager mit damenhafter Nachlässigkeit an. Sie hatte die Hände über den Knien verschränkt, sass vorgebeugt und trippelte leise mit den Fussspitzen. Sie begann von Specht zu schwärmen, der arm sei, aber nach ihrer Überzeugung, es zu etwas Grossem bringen würde. Nur die Not habe ihn hierher verschlagen, bald wolle er die Schulmeisterei an den Nagel hängen. „Er ist ein Sozialist,“ fuhr sie flüsternd fort, „aber das sag’ ich dir nur im Vertrauen, es soll Geheimnis bleiben.“
Hanka blieb mit gespreizten Beinen vor ihr stehen, wiegte sich in den Hüften, schmunzelte gutmütig, und um seinen Mund zuckte die Ironie wie in kleinen Schlänglein. Sogar in den Bewegungen seines hageren Körpers drückte sich Wohlwollen und Spott aus. Zum erstenmal heute sah er Beate voll und deutlich an; sie gefiel ihm, besonders behagten ihm die schmalen, schwarzen Linien der Brauen über den perlmutterglänzenden Augen. Darauf erblickte er sein eigenes Bild, denn hinter dem dunklen Kopf des Mädchens hing der Spiegel. Nie glaubte er Hässlicheres gesehen zu haben, eine dicke, lange Nase, eine niedere Stirn; ein blasses Mephistogesicht. Bestürzt wandte er sich ab. „Wir haben uns ja schon zwei Jahre lang nicht gesehen“, sagte er. „Wie gehts dir denn, Beate? Einmal schrieb mir Agnes, du hättest dich fortgestohlen, um zu tanzen. Wie verhält sich das?“
Seine vor Fülle vibrierende Stimme mit den tiefen O-Lauten erregte Beates Lachlust. „Es macht mir jetzt gar keine Freude mehr, zu tanzen“, log sie und kettete gleich eine zweite Lüge bequem an: „Ich lese nämlich sehr viel.“
„Hm—m, Herrn Spechts Einfluss“, sagte Hanka mit hölzerner Würde. Zugleich sah er im Geist den jungen Lehrer mit dem gutrasierten Gesicht und dem flinken Benehmen.
Die Fenster waren offen, die fühle Herbstluft strich herein, die Lampe brannte freundlich, und altvertraute Bilder schauten von der Wand. Beate nahm fleissigtuend einen Strickstrumpf, und Agnes steckte den vom Herdfeuer erhitzten Kopf durch die Türspalte, um zu erfahren, ob Alexander auch den richtigen Hunger habe. Hanka stellte allerlei Betrachtungen über das Landleben an, rauchte schweigend seine Zigarette und sandte bisweilen einen kurzen Blick nach Beate.
Agnes trug zu essen auf, wie für eine Soldatenkompanie. Dabei entschuldigte sie sich, dass sie dies oder jenes nicht habe bekommen können. Beate reichte Hanka eine Schüssel um die andere, so dass er sich in eine Art Betäubung hineinass. Er schob die Lippen vor, machte eine Schnauze, drehte den Hals wie eine Ente im Wasser und sagte, es tue ihm leid, dass er morgen schon wieder abreisen müsse. Beate wiederholte es lauter für Agnes, und diese sah ihn vorwurfsvoll an.
Das junge Mädchen ging bald schlafen, und die Geschwister hatten eine ernsthafte Unterredung. Mitten darin verlor sich Hankas Geist in die Breite und spielte mit den lichten Gestalten eines Traumzustandes. Oben am Haus öffnete sich ein Fenster. Beates Stimme sang ein Lied, das sie von den Tschechinnen gelernt hatte.
Kudy, kudy, vede cestička
Pro mého Jenička . . .
Der Liebste ist zwar in die Ferne gegangen, bedeutet es, um sich eine Reiche zu suchen, aber das kann nicht hindern, ihn noch weiter zu lieben.
Sechstes Kapitel
Da in der Nacht leichter Frost eingetreten war, umhüllte Arnold am Morgen die Fruchtstöcke für den Winter mit Stroh. Salscha half ihm, trug das Stroh aus der Scheune und legte es in lange Bündel. Sie war mürrisch und traurig und suchte Arnold durch Gleichgültigkeit aufmerksam zu machen. Er stand auf der Leiter, und während er den Arm hinunterstreckte, um ein Bündel zu ergreifen, begegnete er Salschas Blicken. Die Polin wurde blass, zog die Lippen von den Zähnen zurück und stiess einen leisen Pfiff aus. Eine Sekunde lang stand sie noch schweigend, dann kehrte sie um, ging ins Haus, trat entschlossenen Schrittes vor Frau Ansorge hin mit der Miene eines Menschen, der endlich einmal viel zu sagen hat. Frau Ansorge legte die Stickerei auf den Schoss und lächelte Salscha entgegen. Dadurch wurde das Mädchen um alle Fassung gebracht, sie hielt den nackten Arm vor die Augen und fing an zu schluchzen. Das Lächeln auf Frau Ansorges Lippen nahm nacheinander jeden Ausdruck der Frauenhaftigkeit an: Mitleid, Spott, Ratlosigkeit und leichte Geringschätzung; dahinter gleich einen feinen Schimmer der Freude über den, der solche Kränkung zufügen konnte. Sie stand auf, räumte ihre Arbeit beiseite, legte beide Hände auf die Schulter der Magd und sagte: „Das vergeht schon, Salscha. Gott hat genug andere für dich erschaffen. Sei nur stille jetzt, heut ist Kirmes, ich schenk’ dir einen neuen Unterrock.“
Arnold war von der Leiter gestiegen. Gleichmütig stiess er mit dem Fuss das Stroh aus dem Weg und wandte sich zum Gartentor, da er dort einen Mann stehen sah, der ein junges Mädchen an der Hand führte. Als er näher kam, erkannte er Elasser, den Hausierer. Ängstlich und demütig entblösste der Jude das kahle Haupt und fragte Arnold, ob er Zeugenschaft vor Gericht ablegen wolle gegen Uravar. Trotz seiner Ehrerbietung war er kurz, trotz der süssen Freundlichkeit war in seinen Mienen zu lesen, dass es für den Gebetenen keinen Ausweg gab, als zuzusagen, wenn es so weit kam. Arnold dachte nicht an anderes. Er blickte das Mädchen an, das Elsasser mit sich führte, und der Gegensatz, in dem die winzige Gestalt und die frühreifen Züge standen, erschreckte ihn. „Sag’ dem Herrn Dank, Jutta“, murmelte Elasser und schüttelte den Arm des Mädchens. Die Kleine betrachtete Arnold mit einem prüfenden und furchtsamen Seitenblick. Sie war dreizehn bis vierzehn Jahre alt, und mit ihren schwärmerischen Augen schien sie ermüdet von den Lasten der Generationen, die gleichsam das natürliche Wachstum ihrer Gestalt verhindert hatten.
Am Nachmittag ging Arnold ins Dorf. Gassen und Platz waren vom Kirchweihdunst erfüllt. Aus der ganzen Umgegend waren die Bauern zusammengeströmt. Geschrei und Musik waren nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Die Wirtsstuben konnten ihre Gäste nicht fassen, die überall im Flur und auf der Gasse hockten, auf Fässern, Blöcken, Ballen und Balken, schrien, spielten, handelten und Lieder johlten. Die Drehorgeln quietschten, die Heringbrater schrien, und Kinder schlüpften wie Eidechsen um die Beine der Erwachsenen. Aus der geöffneten Kirchentür strömte der Weihrauch in den Heringsgestank, und mit bunten Fähnchen und schläfrigem Gesang kam eine Prozession heraus, die sich im Gedränge kaum vorwärtsschieben konnte. Einige in der Nähe bekreuzten sich, knixten und stürzten wieder in den Trubel. Dabei wurde es Abend. Die Menge staute sich immer mehr. Arnold wurde in den Flur des „Goldenen Stern“ gedrückt, wo Tanzmusik erklang. Ein Mann schrie verzweifelt, seine farbigen Ballons waren in die Luft geflogen. Fünf Mägde, Arm in Arm wie Soldaten, schwenkten aus dem Tor und sangen lachend ein Lied. Hinter ihnen stand plötzlich Maxim Specht und winkte Arnold lächelnd zu. Er wollte folgen, aber ein Verkäufer von Zaubertränken versammelte die Zecher um sich, und der Durchgang war versperrt. Als er neben sich blickte, sah er auch den jüdischen Hausierer. Seine traurige Gestalt, das unbewegt demütige Gesicht und die nüchtern und gefasst prüfenden Augen wirkten so befremdlich in dem Haufen, dass Arnold ihn fragte, was er da suche. Elasser gab mechanisch Auskunft, als wenn er bisher mit niemandem hätte über etwas sprechen können, was ihn sehr zu bedrücken schien. Seine Tochter Jutta sei vom Hause weg, erzählte er mit einer fast geschäftlichen Freundlichkeit. Seit er vom Hof des gnädigen Herrn Ansorge zurückgekommen, sei sie verschwunden. Am Sonntag helfe sie manchmal beim Wirt Gläser spülen, aber sie sei nicht da. Wunderlich genug, dass Arnold auf einmal Sorge um das gesuchte Mädchen empfand, als ob er sich hier an Menschliches klammern müsse, wo er nur betrunkene Tiere sah. Er wurde nachdenklich und sah diese winzige Jutta irgendwo im Wald verirrt. Er wollte Fragen, aber Elasser war schon fortgedrängt, und Arnold befand sich neben der Saaltüre, dicht neben Specht und Beate. Specht fasste ihn sofort unter und fragte ihn vertraulich, wie es gehe. Verlegen zuckte Arnold die Achseln, denn er fand keinen Tonfall gegenüber dieser unerwarteten Liebenswürdigkeit. Neugierig sah er auf die Füsse der Tanzenden, denn die plumpen, gespreizten, lächerlichen und wilden Bewegungen reizten immer seine Schausust. Oben auf einer Estrade hockten wie Kobolde die Musikanten, durch den Dunst halb verwischt. Beate wandte sich erhitzt mit derselben unerklärlichen Vertraulichkeit, aber mit einem geheimnisvoll tückischen Glanz in den Augen zu Arnold und fragte, ob er denn nie beim Jahrmarkt gewesen sei, weil er so erstaunt starre. Auch die Schnelligkeit und falsche Heiterkeit, mit der sie redete, hatten etwas Unerklärliches. „O ja,“ antwortete Arnold gelassen, „aber ich habs vergessen.“ In der Tat, für ihn war ein Jahr eine unübersehbare Spanne Zeit.
Beate tanzte mit einem Bauernburschen von riesenhaftem Wuchs davon. Der heisse Saal mit seinen trüben Lichtern glich einer kleinen Hölle. Bald schien es Arnold, als drehten sich die Wände statt der Menschen. Er stand am Schanktisch, konnte weder vor- noch rückwärts, blickte zwischen Köpfen hinweg, über zuckende Schultern in den Dampf. Die Wirtin stellte Bier vor ihn hin; er hatte Durst, zahlte und trank. Er sah Beate vorbeifliegen, und ihre Röcke wehten. Der Bauer schien sie zu tragen, und seine grossen Stiefel polterten vernehmbar vor allen. Dann standen auf einmal wieder sie und der Lehrer dicht vor ihm. Beide sahen ihn nicht. Specht hatte das Mädchen am Oberarm gefasst und knirschte etwas durch die Zähne. Seine Unterlippe bewegte sich leidenschaftlich. Beate antwortete ihm mit einem langen Blick, der zugleich nachlässig, verliebt, unentschieden und von äusserster Wildheit war. Ihre Haare klebten an der Stirn, ihre Halsader pochte, ihre Ohren waren purpurrot, das Gesicht blass. Zwei betrunkene Bauern, die tschechisch lallten, verbeckten gleich darauf die beiden für Arnolds Blicke. Er drängte sich zur Türe durch. Er war schon im Freien, als er eine Stimme hinter sich vernahm. Es war Specht, der seinen Arm abermals in den Arnolds schob und höflich bat, mitgehen zu dürfen. Arnold wusste nichts zu entgegnen. Die Welt ist für jedermanns Füsse, dachte er. Er hörte den Lehrer keuchen von der Anstrengung des Nachlaufens.
„Bleiben wir doch noch zusammen“, bat Specht wiederum. „Ich möchte nicht gern allein sein. Es ist erst sieben Uhr, und wir könnten ganz gut noch einen Spaziergang machen.“
Arnold nickte, halb neugierig, halb gleichgültig. Bald hatten sie den Lärm hinter sich. Trotz der Dunkelheit war der Weg deutlich, denn der Viertelsmond stand im Westen. Der Frieden der Felder schien vertausendfacht durch das nun verklungene Marktgetöse.
Siebentes Kapitel
Elende Bauern“, sagte Specht, nachdem sie eine Weile lang schweigend gegangen waren. „An einem einzigen Sonntag werfen sie fort, was sie einen ganzen Sommer lang zusammengescharrt haben.“ Er redete in Wut und Hass und warf irgendeine Anklage, die mit seinen Gefühlen gar nichts zu schaffen hatte, irgendwohin.
Arnold schwieg.
„Und was ist das überhaupt für ein Leben!“ fuhr Specht mit einer verzweifelten Bewegung seines ganzen Körpers fort. „Wer bin ich hier? Was soll ich hier? Lauter Bauern, lauter Dummköpfe! Kein Mensch, mit dem man ein richtiges Gespräch führen kann. Pfui Teufel.“
Er ärgert sich, weil sein Mädchen mit einem andern getanzt hat, dachte Arnold, was macht er solches Wesen davon.
„Ich wundere mich nur, dass Sie’s hier aushalten,“ sagte Specht, „Sie sind doch auch schliesslich nicht auf den Kopf gefallen. Das ist doch keine Existenz für Sie. Sie müssen hinaus in die Welt. Man braucht Männer heutzutage.“
„Mir ist ganz wohl hier“, gab Arnold ruhig zur Antwort.
Das Dorf war längst verschwunden, sie schritten schweigend am Waldrand entlang. Die Wiesen glänzten silbern, Mondnebel erfüllten die Luft. Dicht vor ihnen tauchten die Mauern des Felizianerinnenklosters auf; über dem hohen Tor glänzte ein Kreuz.
„Wir sind sehr weit“, sagte Specht bedenklich. Mit verborgener Bewunderung heftete er den Blick auf Arnold, der ihm gegenüberstand, die Füsse in schreitender Stellung, das Gesicht mit einem Ausdruck des Lauschens emporgewandt, das braune Haar aus der Stirn gestrichen. Die etwas lange, gerade, aber breitrückige Nase verlieh dem Gesicht einen durchaus reifen Charakter.
Der Lehrer riss einen Zweig ab und zerbog ihn. Seine Haltung war sinnend und schwermütig. Ihm war, als sei sein Gemüt gereinigt worden, und er hörte mit ganz anderm Ohr das Rauschen, das der Wind in den Baumkronen verursachte. Seine Qualen rückten auf ein anderes Ufer, vor ihm floss ein Strom der Einsamkeit.
Sie gingen ein Stück weiter bis zum Fusse der Klostermauer. Dort setzte sich Specht auf eine Steinbank und erzählte von seiner Tätigkeit als Lehrer, von seinen Wünschen und Träumen, von seinem sozialen Ideal, das ihn anderswo hinweise als in mährische Einöden. Er erzählte von seiner Bibliothek, von seinen mit Studien verbrachten Nächten, und deutete dumpf und schamvoll sein kümmerliches Auskommen an. Sein Ton war einfach, wenn auch durch die Nacht etwas gedrückt. Ihm war, als müsse er diesem Menschen beichten, und er vergass die jüngeren Jahre Arnolds. Leicht erzeugt ohnedies eine solche Stunde festere Brücken zwischen Männern, als etwa ein Beisammensitzen im Sonnenschein. Freilich nicht bei Arnold, den keine innere Enge trieb, sich mitzuteilen. Aber da es für ihn nichts Längstbekanntes gab, kein alltägliches Schicksal, lauschte er dem Lehrer mit Interesse.
Endlich erhob sich Specht und meinte, es sei doch Zeit, nach Hause zu gehen. Während des Heimwanderns brachte er noch vielerlei vor, denn er hatte einen regen Geist, und mit Unrast suchte er Beziehungen und wünschte Sympathien.
Achtes Kapitel
Am andern Morgen, als Arnold und Frau Ansorge beim Frühstück waren, kam Ursula und erzählte, die Felizianerinnen hätten die Tochter des Juden Elasser zu sich ins Kloster gebracht.
„Vierzehn Stunden haben die Leute nicht gewusst, wo ihr Kind ist“, sagte sie. „Erst heut nacht haben sie es durch Zufall erfahren.“
„Und was ist dann geschehen?“ fragte Arnold.
„Der Jud ist mit dem Gendarmeriewachtmeister Wittek ins Kloster gegangen. Man hat sie aber nicht hineingelassen.“
„Eine wunderbare Geschichte“, bemerkte Frau Ansorge spöttisch.
Arnold erinnerte sich seiner gestrigen Begegnung mit dem Hausierer und an dessen beklommenes Wesen. „Man kann doch nicht ohne weiteres ein Mädchen rauben“, sagte er verwundert.
„Wahrscheinlich soll das Judenkind getauft werden“, antwortete Ursula.
Der Bäcker aus Podolin, der gleich darauf kam, bestätigte das Vorgefallene.
„Ich versteh’ das nicht“, sagte Arnold in wachsender Verwunderung zu seiner Mutter. „Können die vom Kloster ein Kind einfach stehlen?“
Frau Ansorge zuckte die Achseln.
„Man kann es doch nicht taufen, wenn die Eltern nicht wollen.“
„Vielleicht will das Mädchen selber. Wenn es vierzehn Jahre alt ist, braucht man die Einwilligung der Eltern nicht.“
„Wenn es aber nicht will? Dann müssen Sie es wieder entlassen, wie?“
Frau Ansorge zuckte abermals die Achseln. „Was gehen uns die fremden Leute an“, entgegnete sie gleichgültig.
Gegen Mittag machte sich Arnold auf den Weg nach dem Dorf. Auf dem Hauptplatz blieb er eine Weile unschlüssig stehen. Dann, fast wider Willen, trat er in den Ullmannschen Schnapsladen an der Ecke. Bauern, Knechte, Tagelöhner, Unterstandslose, ja sogar ein paar Weiber sassen dort und machten Lärm. Arnold liess sich ein Glas Tschai geben. Ein alter, dicker, gichtischer Bauer, der weithin nach Schnaps roch und dessen Mund verzogen war, als hätte er Zitronensaft auf der Zunge, sagte, jetzt sei die Zeit gekommen, endlich werde dem Juden der Garaus gemacht. Getauft oder verbrannt, schrie ein Bursche, dem die blosse Brust durch das zerrissene Hemd schien. Der Ladenbesitzer, selber ein Jude, mit einem Bart, der dünn und kranzartig um das ganze Gesicht lief, lachte mit weit aufgerissenem Mund. Eine pockennarbige Bäuerin behauptete, der Papst und der Erzbischof hätten den Felizianerinnen befohlen, alle Judenkinder zu taufen.
Arnold fragte den geleckt und hungrig aussehenden Geschäftsgehilfen nach der Wohnung Elassers und verliess dann den Laden.
Podolin, aus einer langgestreckten Reihe niedriger
Häuser bestehend, hatte nur eine einzige Seitengasse, und dort, dicht am Flussufer, wohnte Elasser. Die abschüssige Gasse war fast ungangbar durch Misthaufen, Kotpfützen, Schottergestein und umhergackerndes Geflügel. Von den Mauern des Elasserschen Häuschens war der grösste Teil der Mörtelbekleidung abgefallen. Arnold ging durch die offene Haustüre in ein gleichfalls offenes Zimmer zur Rechten, wo sich ihm ein ebenso wunderbarer als trauriger Anblick bot.
Neuntes Kapitel
Samuel Elasser hockte zusammengekauert, die Knie fast bis zur Brust emporgezogen, im Winkel eines schmutzigen Kanapees. Er hatte mit beiden Händen das Gesicht so vollständig bedeckt, dass darunter nur der braune Bart hervorquoll. Auf dem Kopf trug er ein altes, hintübergeschobenes Seidenkäppchen mit einer Quaste. Um ihn herum standen wie in einem abgemessenen Halbkreis sechs Kinder und blickten regungslos auf die kauernde Gestalt ihres Vaters. Eines von zwei Jahren kroch halb spielend, halb winselnd über die Dielen, und ein Neugeborenes lag eingehüllt in bunte Lappen, die wiederum durch einen grünen Gürtel zusammengehalten waren, auf einer breiten Bank neben dem Ofen. Die Frau stand vor dem Fenstersims und bewegte betend die Lippen und den Oberkörper. Ausser dem Gelalle des kleinen Halbnackten war kaum ein deutlicher Laut vernehmbar. Auf dem Tisch standen acht blecherne Kaffeetassen, an einem Strick vom Ofen zur Wand hingen rote Windeln zum Trocknen, und der Türe gegenüber nahm ein uralter Schrank den fünften Teil des Raumes ein.
Nachdem Arnold einige Minuten ruhig auf der Schwelle geblieben war, trat er ins Zimmer. Sogleich drängten sich die sechs Kinder in einen Knäuel zusammen. Glasser liess die Hände vom Gesicht fallen und blickte den Fremdling mit glasigen Augen an. Arnold war etwas verdutzt über die gepresste Trauer und düstere Niedergeschlagenheit, die hier herrschten. Er forschte unter den Gesichtern der Kinder, und als er das ihm bekannte der kleinen Jutta nicht erblickte, fragte er: „Ist sie noch nicht zurück aus dem Kloster?“
Die Frau drehte sich um und heftete aus ihren hervorquellenden, ermüdeten Augen einen ungewissen und furchtsamen Blick auf Arnold. „Weiss der Herr nicht, dass unsere Jutta geschleppt worden ist mit Gewalt ins Nonnenkloster?“ rief sie mit einer überscharfen Stimme. Ihre Züge, obwohl alt und hässlich, entbehrten nicht des Reizes, den das Leiden in jeder Form zu erteilen vermag.
Arnold blickte die Frau aufmerksam an. „Ja ja,“ erwiderte er, „aber das ist doch gegen das Recht.“
„Sehn Sie nur an,“ fuhr die magere Jüdin fort und hob sibyllenhaft den Kopf, „wie es bestellt ist mit dem Recht. Für die armen Leute gibts kein Recht, für arme Juden gibts kein Recht. Und mit was kann ich dienen? Mit wem hab’ ich das Vergnügen?“
„Es ist der gnädige Herr Ansorge“, klärte Elasser auf, mit einer Gebärde, die ebensowohl für ehrfürchtig als für kummervoll gelten konnte. „Der Herr kommt nicht in schlechte Absichten, Mutter. Erinnern Sie sich, gnädiger Herr, wie ich meine Jutta hab’ gesucht Sonntag? Wir haben gewartet und gewartet, und wer nicht gekommen is, war unsere Jutta. Und der ganze Abend ist geflossen, und endlich gegen elf is gekommen der Gehilf vom Uravar und klopft da draussen und meint, wir sollen doch einmal nachfragen im Kloster. Und ich denk’ mir noch und denk’ mir noch, ’s ist wahr, sie kann sein gegangen mit die Bänderchen zu die Nonnen, denn sie ist allein hausieren gegangen, und solche Sachen sind schon bereits vorgekommen, und der Gehilfe, der ’s Fleisch bringt ins Kloster, kann sie dort gesehn haben. Gnädiger Herr, meine Tochter ist eine gute Jüdin, warum soll sie bei den Nonnen geblieben sein? Und es war Mitternacht, bin ich noch gegangen, und der Herr Wachtmeister, ein freundlicher Herr, ist mit mir gegangen ins Kloster. Und wir verlangen die Oberin zu sprechen, aber die Schwester Pförtnerin sagt, wir sollen kommen in der Früh und meine Jutta wäre da. Und der Herr Wachtmeister sagt, warten wir bis in der Früh. Gut. Sie können sich denken, dass wir kein Aug’ zugemacht haben die ganze Nacht, und in der Früh um sechs bin ich abermals wieder gegangen mit dem Herrn Wachtmeister und verlang’ zu sprechen die Oberin. Un sie kommt, und ich verlang’ zu haben mein Kind. Und, gnädiger Herr, glauben Se mir, mein Herz is still gestanden, sie sagt, ich soll kommen in fünf Tagen, bis sich das Mädchen besser gewöhnt haben wird an die neue Umgebung.“
Elasser wand sich, als ob ihn die Eingeweide brennten. „Un so bin ich fortgegangen“, schloss er und atmete tief.
„Und der Wachtmeister?“ fragte Arnold, dessen Gesicht sich verfärbt hatte.
„Der Herr Wachtmeister is ein freundlicher Herr, aber er hat gesagt, leider, es ist vorläufig nichts zu machen. Man muss warten. So wart’ ich.“
Der Säugling auf der Ofenbank erwachte und begann ein dünnes Geheul, bis die Mutter hinging und ihm ein in Honig getauchtes, kugelartiges Leinwandstück in den Mund steckte. Auch das auf dem Boden kriechende Kind fing an zu weinen. Die Frau blickte gleichgültig herab, gab ihm mit dem Bein einen leichten Stoss, und als es platt auf der Erde lag, rollte sie es mit dem Fuss gleich einem Fässchen hin und her. Das Kind lachte, während die Mutter leise summte und mit der Hand den Säugling wieder in Schlaf schüttelte.
Elasser erhob sich, nachdem er lange vor sich hingebrütet hatte, und blickte Arnold ohne jede Schüchternheit mit funkelnden Augen an. „Was soll ich tun, lieber Herr?“ sagte er dumpf, und sein demütiger Tonfall wirkte sonderbar im Gegensatz zu seinem Aussehen. „Kann ich mir helfen, sagen Sie selber? Wenn sie sagt, ich soll kommen in einem Jahr, kann ich mir helfen? Und wenn ich keine Nacht mehr schliess’ ein Auge, kann ich mir helfen, lieber Herr?“ Er ging auf und ab.
Arnold verfolgte ihn mit den Blicken. Er begriff nicht, begriff nichts. Diese Verzweiflung schien ihm unverständlich.
„Papa,“ rief jetzt der älteste Knabe mit finsterer Entschlossenheit, „hör’ auf zu reden, bitt’ dich, vor dem Soi.“
„Keine Ruh’ will ich haben, keine ruhige Stunde, bis sie mir nicht mein Kind gegeben haben!“ rief Elasser mit scheuer Leidenschaftlichkeit. „Und wenn ich bis Wien zum Herrn Kaiser gehen muss, un wenn ich hungern un dürsten muss.“
„Und sollen Weib und Kinder gleichfalls hungern?“ fragte die Frau mit streng zusammengezogenen Brauen.