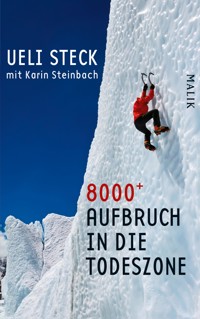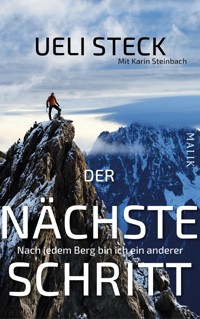
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zuletzt stellte der Bergsteiger Ueli Steck einen neuen Speed-Rekord durch die Eiger-Nordwand auf, bestieg innerhalb von 62 Tagen alle 82 Viertausender der Alpen und bezwang die Annapurna-Südwand in 28 Stunden im Alleingang. Doch die dramatischen Ereignisse der vergangenen Jahre haben ihn verändert: Der Konflikt am Mount Everest und das Lawinenunglück am Shisha Pangma haben ihn in seiner Wahrnehmung erschüttert und gleichzeitig ein Umdenken in ihm bewirkt. Nach einer Zeit des Rückzugs hat er die Freude am Klettern wiederentdeckt. In diesem Buch schildert der Ausnahmealpinist nicht nur seine spektakulären jüngsten Erfolge, sondern beschreibt außerdem, wie er die einschneidenden Zwischenfälle erlebt und verarbeitet hat – und gewährt so ehrliche Einblicke in seine Gedankenwelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97379-3
5. Auflage 2017
Oktober 2016
© Piper Verlag GmbH, München 2016; Nachwort 2017
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Covermotiv: Robert Bösch (Ueli Steck am »Peuterey Intégral« auf der italienischen Seite des Mont Blanc)
Der Verlag hat sich bemüht, alle Bildrechte entsprechend zu klären. Wo der Inhaber der Abdruckrechte nicht ermittelbar war, bittet der Verlag, ihm rechtmäßige Ansprüche mitzuteilen.
Karten: Eckehard Radehose, Schliersee
Litho: Lorenz & Zeller, Inning a. A.
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
1
Everest
Wenn die Welt plötzlich eine andere ist
Der höchste Berg der Erde übt auf viele Menschen eine große Anziehungskraft aus. Auch ich konnte mich, nachdem ich zu Beginn des neuen Jahrtausends die Herausforderungen des Höhenbergsteigens für mich entdeckt hatte, seiner Faszination nicht entziehen. 2011 kam ich bei meinem ersten Versuch auf der Nordseite bis rund hundert Meter unter den Gipfel, kehrte dann aber um, weil ich meine Füße nicht mehr spürte und keine Erfrierungen riskieren wollte. Ein Jahr später erreichte ich, gemeinsam mit meinem nepalesischen Kletterpartner Tenji, auf der Normalroute von Süden den höchsten Punkt. Zwar stieg ich ohne zusätzlichen Sauerstoff auf, dennoch fragten sich damals wohl manche, was der Ueli Steck auf einer breit getrampelten Aufstiegspiste an einem überlaufenen Modeberg suche.
Die Antwort war einfach. Am Mount Everest gab es eine ganze Reihe von attraktiven Routen und möglichen Projekten. Bevor ich daran denken konnte, einen technisch schwierigen Aufstieg zu versuchen, wollte ich wissen, was mich dort oben erwartete und wie leistungsfähig mein Körper in der extremen Höhe von 8848 Metern noch sein würde. Die Besteigung 2012 verlief ohne Probleme, meine Akklimatisierung funktionierte bestens. Das machte mir Mut, für die darauffolgende Saison eine anspruchsvollere Route zu planen. Es musste ja nicht gleich das sogenannte Hufeisen sein, die Traverse von Nuptse über Lhotse zum Everest, die schon seit Jahrzehnten als Vision durch die Himalaja-Literatur geistert. Schon die Überschreitung von Everest und Lhotse war ein bisher ungelöstes Problem. Zusammen mit meinem britischen Freund Jonathan Griffith – Jon lebt schon seit einigen Jahren in Chamonix – und dem Italiener Simone Moro, der vor allem für seine Wintererstbesteigungen von Achttausendern bekannt ist, nahm ich mir für das Frühjahr 2013 dieses Ziel vor.
Ende März flogen Jon und ich nach Kathmandu. Begleitet wurden wir von Peter Fanconi und dessen Freund Juan, die mit uns ins Basislager des Everest trekken und dann wieder zurückreisen würden. Simone war bereits in Nepal und dort als Helikopterpilot unterwegs, ihn würden wir auf dem Anmarsch treffen. Wie fast immer mussten wir am Flugplatz der nepalesischen Hauptstadt auf unseren Anschlussflug nach Lukla warten. In der Regel kann nur während weniger Stunden am frühen Morgen geflogen werden; behindern Wolken oder Nebel die Sicht, wird der Flugbetrieb eingestellt. Sobald klar ist, dass das Wetter schön genug ist, um zu starten, bricht jedes Mal große Hektik aus.
In Lukla dann ganz ähnliche Bilder. Bei guten Flugbedingungen landet eine Twin Otter nach der anderen. Die meisten Fluggesellschaften fliegen mit diesen kleinen Maschinen, denn die Landepiste ist gerade mal 527 Meter lang. Meist setzen die Flugzeuge etwas unsanft auf, dann müssen sie sofort stark bremsen, denn die Mauer am Ende der bergauf führenden Piste kommt sehr schnell näher. Auf der gegenüberliegenden Seite bricht die Lande- respektive Startbahn 600 Meter tief zum Fluss Dudh Kosi ab. Nachdem die Maschinen kurz hintereinander angekommen sind, beginnt ein chaotisches Treiben. Jeder will so schnell wie möglich sein Gepäck, es wird wild diskutiert. Wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, dass es Verwechslungen gibt und die Träger mit dem falschen Gepäck loslaufen.
Nach mittlerweile doch einigen Reisen in den Himalaja ließ ich mich von alldem nicht mehr irritieren. Ich freute mich auf den Anmarsch durch das Khumbu-Tal. Seit meinem ersten Besuch im Jahr 2001 war ich immer wieder hierher zurückgekehrt. Die Region hat es mir irgendwie angetan: Man wandert entspannt von Lodge zu Lodge und kann die grandiose Landschaft genießen. Aus den kargen Talböden steigen schneebedeckte, imposante Berge in die Höhe. Die Wege sind gut ausgebaut. Natürlich ist man auf ihnen längst nicht mehr allein unterwegs. Wir hatten eine etwas ruhigere Zeit erwischt; die Hauptsaison für Trekkingreisen ist der Herbst, dann besuchen Tausende von Bergsteigern und Wanderern das Tal. Zumindest war das bis zu den verheerenden Erdbeben vom Frühjahr 2015 so – seither ist der Tourismus in Nepal stark eingebrochen.
Die erste Etappe führte uns von Lukla nach Namche Bazar. Das Dorf in 3440 Meter Höhe gilt als Eingangstor zum eigentlichen Himalaja: Ab hier bewegten wir uns bereits zwischen hohen Gipfeln. Um keine Kopfschmerzen zu riskieren, weil wir noch nicht akklimatisiert waren, stiegen wir von hier nicht direkt ins 1600 Meter höher liegende Basislager auf. Wir ließen uns Zeit und liefen am nächsten Tag nur bis Pangboche. Am Morgen darauf besuchten wir das kleine Kloster und nahmen an einer Puja teil, einer buddhistischen Zeremonie, mit der in Nepal vor jeder Expedition die Götter gnädig gestimmt werden. Jon ging es nicht besonders gut, er hatte das Essen nicht vertragen, und sein Magen hatte rebelliert. Die Nacht hatte er mehr auf der Toilette als im Bett verbracht. Doch er trug es mit Humor. Im Himalaja gehört das einfach zum Spiel.
Nach dem Klosterbesuch wanderten wir weiter nach Dingboche. Dort, auf 4500 Metern, wollten wir zwei Nächte bleiben. Weiter talaufwärts ging es in Richtung Everest, ein anderer Weg führte ins Chukung Valley. Dieses Tal wird vom 5845 Meter hohen Pass Amphu Laptsa La abgeschlossen, der den Übergang ins benachbarte Makalu-Tal ermöglicht. Ich nützte den Ruhetag zum Lauftraining und folgte dem Tal nach Chukung und bis auf den Chukung Ri, einen 5546 Meter hohen Aussichtspunkt.
Nach diesem sehr schönen Auftakt setzten wir am zweiten Morgen unseren Anmarsch nach Lobuche fort, wo wir auf Simone trafen. Nun war unser Team komplett. Stetig näherten wir uns dem Everest-Basislager, das wir am 11. April erreichten. Die Bezeichnung »Lager« ist inzwischen eine Untertreibung, eigentlich handelt es sich um eine kleine Stadt auf 5300 Meter Höhe. Jahr für Jahr bauen die Veranstalter ihre Zelte auf der Moräne des Gletschers auf. Yaks und Träger bringen tonnenweise Material herauf. In der Klettersaison leben bis zu 1500 Personen hier – Bergsteiger, Sherpas, Küchen- und Begleitpersonal.
Vor mir lag eine spannende Zeit. Ich war voller Vorfreude und konnte mich kaum zurückhalten, gleich loszurennen. Schon am Tag nach unserer Ankunft absolvierte ich meinen nächsten Lauf, hinauf ins Lager 1. Es liegt auf 6100 Metern im Tal des Schweigens, oberhalb des Khumbu-Eisfalls. Der Gletscherbruch ist in hohe Eistürme und tiefe Spalten zerrissen. Jedes Jahr aufs Neue suchen darauf spezialisierte Sherpas, die »Icefall Doctors«, einen gangbaren Weg durch das Spaltenlabyrinth und präparieren ihn mit Fixseilen und Leitern. Es ist eine riskante Arbeit, die immer wieder Opfer fordert. Nicht nur Sherpas, auch Bergsteiger kamen schon durch zusammenbrechende Séracs zu Schaden oder ums Leben. Zu trauriger Berühmtheit brachte es der Eisfall, als im April 2014 eine Lawine sechzehn Sherpas tötete, die mit Versicherungsarbeiten beschäftigt waren.
Um die Arbeit der »Icefall Doctors« zu finanzieren, bezahlt jede Expedition eine zusätzliche Begehungsgebühr, die nicht in der Besteigungsbewilligung eingeschlossen ist. Ich war begeistert davon, durch den bereits fertig eingerichteten Eisfall zu joggen. Für diesen Zweck hatte ich mir ein Paar Laufschuhe mit Spikes zugelegt. Sie bewährten sich sehr, mit ihnen lief es sich viel angenehmer als in schweren Bergschuhen. Die 800 Höhenmeter hinauf ins Lager 1 fielen mir relativ leicht.
Nach zwei Tagen im Basislager verabschiedeten wir uns von Juan und Peter, die den Rückweg nach Lukla antraten. Für Jon, Simone und mich hingegen begann der Ernst der Expedition: die weitere Akklimatisierung. Am 14. April stiegen wir ins Lager 2 auf und gleich wieder ab. Zwei Tage später brachten Simone und ich erneut Material ins Lager 2 und blieben oben, um dieses Mal zu übernachten. Das Wetter zeigte sich stabil, wir kamen gut vorwärts. Wir beide waren vorerst die einzigen westlichen Bergsteiger im Lager, die Sherpas waren noch dabei, alles aufzubauen. Sie luden uns zum Abendessen in ihr Zelt ein. Es gab Dal Bhat, das klassische nepalesische Reisgericht mit Linsen – ein fürstliches Essen auf 6500 Metern! Wieder war ich beeindruckt von der ganzen Infrastruktur, die bis in große Höhen transportiert wurde. Schon das Sherpazelt, in dem wir saßen, empfand ich als luxuriös, aber das war noch kein Vergleich zu den Essenszelten, die für die Teilnehmer kommerzieller Expeditionen eingerichtet wurden. Diese waren noch einmal eine Stufe komfortabler.
Während die Sherpas am nächsten Morgen weiterarbeiteten und Zelt für Zelt aufbauten, starteten Simone und ich eine erste Rekognoszierungstour Richtung Westschulter des Everest, um uns die Verhältnisse anzuschauen. Unser Plan sah vor, von Lager 2 auf die Westschulter zu steigen, danach durch das Hornbeincouloir auf der Nordseite den Gipfel des Everest zu erreichen, von dort in den Südsattel ab- und weiter auf den Lhotse zu steigen – eine Überschreitung des höchsten und des vierthöchsten Berges der Erde. Im Jahr zuvor, als ich auf der Everest-Südseite gewesen war, hatten zwei amerikanische Teams die Hornbeinroute versucht. Sie hatten fleißig Fixseile verlegt, waren aber nach einem Monat nicht einmal bis zur Westschulter gekommen. Ich war sehr gespannt, was uns erwarten würde.
Als wir losgingen, war es bereits recht warm. Schon bald begann das Gelände, felsig zu werden. Die Kletterei war unschwierig, aber der Fels nicht überall fest; wir mussten aufpassen, dass wir keine Steine lostraten. Wir kletterten seilfrei und kamen dadurch rasch voran. Dafür, dass wir uns noch nicht lange in der Höhe aufhielten, ging es erstaunlich locker. Auf 6900 Metern sagte Simone, er habe genug und gehe wieder zurück. Ich stieg allein weiter. Ich war viel zu neugierig, wie steil und wie anspruchsvoll es dort oben weiterging und wie die Bedingungen waren. Die Schwierigkeiten hielten sich für mein Empfinden in Grenzen. Ein paar steilere Eispassagen entpuppten sich als blank, sie waren anstrengend für die Wadenmuskulatur, aber nicht problematisch.
Nach einiger Zeit spürte ich etwas die Höhe. Ich kam nicht mehr ganz so schnell vorwärts. Außerdem zogen langsam Nachmittagsnebel auf, es wurde kälter. Ich zog mir die Daunenhandschuhe über und schaute auf den Höhenmesser. 7200 Meter. Es war nicht mehr weit bis zur Westschulter, bis dorthin wollte ich noch steigen. Ich hoffte, einen Blick in die Nordwand werfen zu können, über die uns der weitere Aufstieg durch das Hornbeincouloir führen würde. Umhüllt von Wolken, ging ich weiter. Es war noch früh, ich hatte genug Zeit. Hier oben lag auf dem Eis wieder eine Schicht Schnee, sodass die Kletterei nicht mehr so mühsam und auch sicherer war. Schließlich stieg ich aus der Rinne aus und auf die Westschulter hinauf.
Die Sicht war eingeschränkt, sie betrug vielleicht zehn Meter. Schade. Einen Moment lang war ich enttäuscht, dass ich nicht in die Nordwand schauen konnte. Dann stieg ich noch etwas weiter auf, um zu sehen, wie die Schneeverhältnisse waren. Perfekter Trittfirn! Unglaublich. Genial. So wünschte ich mir das für den Gipfelversuch. Ich sah uns schon von hier losgehen, in der Nacht das Zelt verlassen und im Lichtkegel unserer Stirnlampen in Richtung Gipfel aufbrechen.
Genug geträumt. Ich begann abzusteigen. Langsam bekam ich Hunger. Während des Abstiegs sicherte ich die gefährlichsten Passagen behelfsmäßig ab, mit alten Fixseilen, die frühere Expeditionen zurückgelassen hatten. So würden wir es beim nächsten Mal, wenn wir mit Zelt und Schlafsäcken aufstiegen, etwas einfacher haben. Gegen Abend traf ich wieder bei Simone in Lager 2 ein. Diesmal mussten wir selbst kochen. Wir gönnten uns eine feine Rösti. Danach schlief ich recht bald und zufrieden ein. Nach sechs Tagen im Basislager war ich bereits auf 7500 Metern gewesen. Ich war in sechs Tagen höher aufgestiegen als die Amerikaner vom Jahr zuvor in vier Wochen.
Nach zwei weiteren Akklimatisierungsnächten in Lager 2 kehrten wir wieder ins Basislager zurück. Wir waren auf Kurs – beide fühlten wir uns fit, und am Berg herrschten sensationell gute Bedingungen. Unsere Motivation war riesig! All die Zweifel, die wir im Vorfeld gehabt hatten, waren ausgeräumt, viele potenzielle Faktoren, die uns hätten scheitern lassen können und die wir uns in der Vorbereitungsphase immer wieder kritisch angeschaut hatten, hatten sich erledigt. Der Aufstieg zur Westschulter war bereits erkundet und hatte sich als problemlos herausgestellt. Unser Team harmonierte, wir zogen alle am gleichen Strick. Alles schien perfekt. Da das Wetter sich ohnehin verschlechterte, entschieden wir, im Basislager zu bleiben und ein paar Ruhetage einzulegen. Im Moment konnten wir nichts anderes tun als warten.
*
Simone Moro hat neben dem Bergsteigen eine zweite Passion, das Helikopterfliegen. Er ist ausgebildeter Pilot und verfügt in Nepal über einen eigenen Helikopter, eine Ecureuil AS 350 B3. Eine leistungsstarke Maschine – im Jahr 2005 gelang es einem französischen Piloten, mit einer solchen Ecureuil auf dem Mount Everest zu landen. Obwohl es sich dabei um ein besonders leichtes und höhentaugliches Modell handelt, musste es für diesen Flug noch aufgerüstet werden, denn normalerweise ist es mit einem Helikopter nicht möglich, so hoch zu fliegen. Der geringe Luftwiderstand verringert die Leistung der Rotoren. Früher sah man in Nepal hauptsächlich russische Maschinen des Typs Mi-8. Sie wurden so lange geflogen, bis sie irgendwann abstürzten. Simone ließ seinen Helikopter in einem Frachtflugzeug von Italien nach Nepal transportieren. Beinahe täglich wird die Maschine für Versorgungsflüge ins Basislager eingesetzt. Die Bedingung seiner italienischen Versicherung lautete, dass er nur europäische Piloten ans Steuer der Maschine lassen dürfe. Deshalb fliegt Simone den Helikopter, der von der Fishtail Air in Kathmandu betrieben wird, so oft wie möglich selbst.
Die Wetterentwicklung sah für die kommenden Tage weiterhin schlecht aus. Wir nutzten daher die Möglichkeit, mit Simones Helikopter nach Namche Bazar zu fliegen. Er wäre nach einem Transport ins Basislager leer nach Lukla zurückgekehrt und konnte uns mitnehmen. Am Berg verpassten wir bei dieser Wetterlage nichts, unten würden unsere Körper sich gut erholen, und wir wären mit einem Tagesmarsch wieder zurück im Basislager. In Namche Bazar, auf weniger als 4000 Metern, schlief ich tief und fest. Am nächsten Tag absolvierten wir ein Joggingtraining nach Tame.
Nach drei Nächten in Namche Bazar ergaben sich wieder freie Plätze in Simones Helikopter, und wir flogen zurück ins Basislager. Das Wetter hatte sich so weit gebessert, dass wir eine zweite Akklimatisierungsrunde angehen konnten. Diese wollten wir auf der Normalroute absolvieren und nicht auf unserer geplanten Route – wir beabsichtigten einen Aufstieg im Alpinstil und wollten diesen nicht durch zu viele vorherige Erkundungen verwässern. Zu dritt stiegen wir am 27. April ins Lager 2 auf. Dort verbrachten wir einen vergnügten Abend. Die Stimmung im Team war gut, wir lachten viel und waren voller positiver Energie. Ich war überzeugt, dass wir schon bei diesem Aufstieg zwei Nächte auf 8000 Metern, in Lager 4 auf dem Südsattel, verbringen konnten. Und danach wären wir bereit für die große Traverse! Ich wollte so schnell wie möglich ausreichend akklimatisiert sein, um das erste Schönwetterfenster im Mai nützen und mit dem »richtigen« Bergsteigen anfangen zu können.
Da wir keinen Flaschensauerstoff benutzten, brauchten wir grundsätzlich rund doppelt so viel Zeit, um uns an die Höhe zu gewöhnen, wie die Teilnehmer einer »normalen« Expedition. Wer sich am Everest mit Sauerstoffflaschen bewegt, benötigt in Lager 3 auf 7300 Metern eine Nacht, um sich zu akklimatisieren – das reicht in der Regel aus, da faktisch gesehen der Everest mit künstlichem Sauerstoff nur einem Gipfel zwischen 6500 und 7000 Metern entspricht, je nachdem, wie stark man den Regler der Flasche aufdreht. Wir hingegen mussten im Minimum zwei Nächte in Lager 3 sowie zusätzlich zwei Nächte auf 8000 Metern verbringen. Nur so konnten wir vermeiden, bei der eigentlichen Begehung Gefahr zu laufen, höhenkrank zu werden. Dadurch standen wir unter erheblichem Zeitdruck. Wir wollten wirklich jeden Tag nutzen, der es zuließ, sich in der Höhe aufzuhalten.
Schon früh am nächsten Morgen stieg eine Gruppe Sherpas in Richtung Lhotseflanke auf. Sie setzten ihre Versicherungsarbeiten fort, bei denen der gesamte Aufstieg mit Fixseilen präpariert wird, damit die Teilnehmer kommerzieller Expeditionen einfach und sicher in die höheren Lager gelangen können. Auch sie standen unter dem Druck, das Fixieren der Seile rechtzeitig abzuschließen. Es ist eine mühevolle Aufgabe; die schwere Ausrüstung auf 7000 Meter hinaufzubringen und zu verlegen erfordert viel Kraft. Der Tag zuvor war für die Sherpas enttäuschend verlaufen: Unterstützt von drei westlichen Bergführern, hatten sie die Strecke bis zu Lager 3 fast zu Ende geführt, als sie kurz unterhalb des Lagers auf eine unüberwindliche Spalte getroffen waren. Sie hatten die gesamte Seilsicherung wieder abgebaut und mussten an diesem Morgen auf einer anderen Route nochmals von vorn anfangen.
So kam es, dass an diesem Tag sowohl die Sherpas als auch wir in der Lhotseflanke unterwegs waren. Sie weist zwischen dreißig und fünfzig Grad Steilheit auf. Das ist nicht sehr viel, normalerweise kann man aufrecht gehen, ohne die Eispickel einsetzen zu müssen. Aufpassen muss man, wenn man auf Blankeis trifft; dann sind die Eisgeräte hilfreich, um sicher über diese Stellen zu kommen. Wir hatten am Vortag gesehen, dass im linken Teil der Flanke noch ziemlich viel Schnee lag, der es uns ermöglichen würde, ohne große Mühe aufzusteigen. Bis ins Lager 3 mussten wir nur 800 Höhenmeter überwinden. Alexey Bolotov und Denis Urubko hatten uns dort ihr Zelt stehen lassen. Denis, ein Kasache, und Alexey aus Russland wollten eine neue Route in der Südwestwand des Everest eröffnen. Wir teilten mit ihnen das Basislager und versuchten, uns so gut wie möglich gegenseitig zu unterstützen. So benutzten wir während der Akklimatisation am Berg abwechselnd dasselbe Zelt und dieselbe Ausrüstung. Die beiden waren am Vortag von Lager 3 abgestiegen. Wir würden, je nachdem, wie wir uns fühlten, nach einer oder zwei Nächten in Lager 3 weiter in den Südsattel steigen und dort ein Zelt aufbauen.
Am Morgen ließen wir uns Zeit und verließen Lager 2 erst, als es etwas wärmer geworden war. Unter der Lhotseflanke trafen wir einen amerikanischen Bergführer. Er ermahnte uns, nicht an den Fixseilen zu klettern. Ich bestätigte ihm, dass wir einen weiten Bogen um die Fixseile machen und die Sherpas nicht bei ihrer Arbeit behindern würden. Jeder von uns hatte seine beiden Eisgeräte in den Händen, wir waren nicht auf die Fixseile angewiesen.
Nachdem ich über den Bergschrund geklettert war, traversierte ich gleich einmal fünfzig Meter diagonal nach links. Zum einen, um möglichst viel Abstand zu den Seilen zu erzeugen und sicher nicht den Sherpas in die Quere zu kommen, zum anderen, um dem Eisschlag auszuweichen – weiter oben hackten zwei Sherpas einen Standplatz ins Eis, in der Schusslinie hagelte es Eisbrocken. Etwas weiter oben wartete ich auf Jon. Da Simone noch ein gutes Stück unter uns war, nützten wir die Zeit zum Fotografieren. Es ist immer praktisch, wenn man das nebenbei erledigen kann, ohne viel Zeit zu verlieren. Mit Jon Aufnahmen zu machen ist einfach: Er ist fit und bewegt sich sehr autonom, auf und ab zu klettern ist für ihn kein Problem.
Schließlich stiegen wir weiter. Nach einer Stunde hatten wir die Höhe unseres Zeltes erreicht. Um dorthin zu kommen, mussten wir nach rechts hinüberqueren und dabei über die Seile der Sherpas steigen. Wir suchten uns dazu eine Stelle, die eisfrei war, damit wir im Trittschnee gehen konnten. Ein paar Meter über uns standen drei Sherpas, die an einem Standplatz an zwei Eisschrauben gesichert waren. Sie sicherten den Chef der Gruppe, Mingma Tenzing aus dem Khumbu-Dorf Phortse, der ein ganzes Stück höher im blanken Eis aufwärtskletterte.
Jon querte als Erster unterhalb des Standplatzes nach rechts. Kaum hatte er sich in Bewegung gesetzt, fingen die Sherpas an, ihn anzuschreien. Eine Minute nach Jon hatte ich die Stelle erreicht. Die Stimmung war gereizt. Jon ging weiter zum Zelt. Ich sah, dass Mingma begonnen hatte, sich abzuseilen. Er seilte direkt auf mich zu. Ich stoppte ihn mit einer Hand, da ich ungesichert im Hang stand und einen Absturz vermeiden wollte.
»Wieso fasst du mich an?«, brüllte er wütend.
Ich argumentierte damit, dass es unter uns 500 Meter hinuntergehe und ich nicht angeseilt sei.
»Wieso seid ihr hier?« Wieder brüllte er mich an.
»Weil da drüben unser Zelt steht.« Ich erklärte ihm, dass wir extra weit links im Schnee aufgestiegen seien, um sie nicht zu behindern. »Ihr macht euren Job – und wir den unseren. Es gibt genug Platz für alle.«
Um die Situation zu entspannen, bot ich ihm an, ihnen nach der Ablage unseres Gepäcks beim Versichern zu helfen. Aber das machte ihn nur noch wütender.
Als Simone zu uns aufgeschlossen hatte, fuchtelte Mingma mit einem seiner beiden Eispickel in seine Richtung. Simone erschrak.
»What are you doing?«, rief er panisch. Sein italienisches Temperament ging mit ihm durch. Zu allem Unglück benutzte er auch noch das nepalesische Wort »machikne« – in etwa gleichbedeutend mit »motherfucker« –, das für einen Nepalesen eine äußerst schwere Beleidigung darstellt.
Die Situation eskalierte. Zwischen Simone und Mingma entbrannte ein heftiges Wortgefecht, bei dem Mingma mehrmals mit einem Eispickel gegen Simone ausholte. Ich hatte in diesem Moment das Gefühl, dass es vernünftiger gewesen wäre zu schweigen. Aber ich bin eben auch ein Mensch, der lieber nichts sagt, als Öl ins Feuer zu gießen. Ich zuckte innerlich die Schultern und dachte mir: Was regt sich Mingma so auf? Wo ist das Problem? In diesem Augenblick wusste ich weder, was »machikne« heißt, noch ahnte ich, wozu diese Auseinandersetzung führen würde.
Ich ließ Simone und Mingma weiterdiskutieren und ging zu Jon ins Zelt. Bald darauf realisierten wir, dass die Sherpas ihre Arbeit abgebrochen hatten und abseilten. Ich reimte mir das so zusammen, dass sie, da sie ohnehin schon seit den frühen Morgenstunden Fixseile verlegt hatten, müde gewesen waren und wir ihnen als Grund, Feierabend zu machen, ganz recht gekommen waren. Es war zwar noch nicht spät, aber in der letzten Stunde war ein kalter, unangenehmer Wind aufgekommen. Wahrscheinlich war ihnen die Arbeit an die Substanz gegangen, und wenn man unter Stress steht, kommt es leicht zu einer Überreaktion.
Dass die Versicherungsarbeiten nun nicht weitergingen, war mir gar nicht recht. Ich befürchtete, dass der Ärger der Expeditionsunternehmen sich über uns ergießen würde, wenn ihre Kunden nicht ins Lager 3 aufsteigen konnten und sie das Gefühl hätten, wir seien daran schuld. Deshalb begann ich, die restlichen 260 Meter Seil, die noch zur Verfügung standen, bis ins Lager zu verlegen. Ich fühlte mich dafür verantwortlich, dass die Strecke fixiert war. Was ich dabei nicht bedachte, war der Stolz der Sherpas. Dass sie sich in ihrer Ehre verletzt sehen würden, weil wir innerhalb von kürzester Zeit ihre Arbeit erledigten, dass das einen schwerwiegenden Gesichtsverlust für sie darstellen würde, das war mir in diesem Moment nicht bewusst. Meine – im Nachhinein wohl etwas blauäugige – Vorstellung war: Ich brauche die Fixseile zwar nicht, aber wir können uns doch gegenseitig unterstützen, wir müssen doch nicht gegeneinander arbeiten, nur weil wir nicht dasselbe tun.
Während ich zuoberst die letzten Seile montierte, stand Simone in regem Funkkontakt mit Lager 2. Ich bekam nicht mit, was über Funk diskutiert wurde. Jedenfalls entschied Simone, dass es besser sei, nicht oben zu übernachten, sondern noch am selben Tag ins Lager 2 abzusteigen und die Angelegenheit zu regeln. Ich ärgerte mich etwas, denn das Ziel war ja gewesen, zur Akklimatisierung zwei Nächte auf 7300 Metern zu verbringen und dann unser Zelt auf den Südsattel zu bringen. Stattdessen machten wir uns auf den Weg nach unten.
*
Gegen Abend kamen wir an unserem Zelt an. Dort erwartete uns die amerikanische Bergführerin Melissa Arnot, um uns zu warnen, dass die Sherpas ziemlich erbost darüber seien, dass wir in der Lhotseflanke waren. Sie hatte schon den ganzen Nachmittag über Funk versucht zu vermitteln. Wir saßen eine Weile in dem relativ großen Materialzelt und diskutierten die Vorkommnisse. Schließlich verließ Melissa unser Zelt und wollte in ihr eigenes zurückkehren. Doch wenige Augenblicke später kam sie zurückgerannt und rief, wir sollten verschwinden, es habe sich eine wütende Meute gebildet.
Ich stellte mich auf eine Diskussion ein. Ich ging davon aus, dass wir darüber reden würden, wer sich richtig und wer sich falsch verhalten habe. Ich war bereit, mich dafür zu entschuldigen, dass ich dort oben gewesen war, auch wenn ich fand, dass niemand dazu berechtigt sei, einem anderen den Zutritt zu einem Berg zu verweigern.
Wir traten vor das Zelt.
Vermummte Gestalten mit Steinen in den Händen kamen auf uns zu. Simone und Jon rannten weg. Als die Sherpas auf unser Zelt zumarschierten, lief ihnen Marty Schmidt, ein Bergführer aus Neuseeland, entgegen und versuchte, einem Sherpa den Stein aus der Hand zu schlagen. Marty wurde gestoßen und getreten, ein Stein traf ihn am Kopf, und jemand schlug ihm ins Gesicht. Er wehrte sich und schlug zurück.
Mingma, der Leader der Sherpas, kam direkt auf mich zu. Bevor ich etwas sagen konnte, schlug er mir seine Faust auf die Nase. Einfach so.
Ein Stein kam geflogen und traf mich im Gesicht.
Ich war perplex, verstand nicht, was vor sich ging. Ich kauerte auf meinen Knien und hielt die Hände über meinen Kopf, um ihn zu schützen. Ich wehrte mich nicht, das hätte die Situation nur verschlimmert, dann wären alle auf mich losgegangen. Ein anderer Sherpa stand mit einem ziegelsteingroßen Brocken über mir und wollte ihn mir über den Schädel ziehen. Melissa stellte sich zwischen mich und die Sherpas, um das zu verhindern. Gegenüber einer Frau tätlich zu werden, das wäre gegen die Ehre der Sherpas gegangen.
Ich ergriff die Gelegenheit und verschwand ins Zelt. Ein großer Stein flog herein und verfehlte mich nur knapp, deshalb verließ ich es sofort wieder. Jon und Simone standen etwas weiter weg. Ich ging zu ihnen und sagte zu Jon: »Ich glaube, die Expedition ist beendet.«
Dann steuerten wieder Sherpas auf uns zu und attackierten Jon. Ein westlicher Bergführer kam uns zu Hilfe und trieb die Sherpas auseinander. Jon rannte zusammen mit Simone Richtung Gletscher. Mir war der Weg abgeschnitten. Mit Marty zog ich mich ins Zelt zurück. Er hatte eine blutende Wunde am Kopf.
»Gebt ihn heraus! Wir bringen ihn um!« Vor dem Zelt standen hundert aggressive Männer und riefen auf Englisch nach mir.
Greg Vernovage, ebenfalls ein amerikanischer Bergführer, und Melissa bewachten den Zelteingang und versuchten, die Sherpas zurückzuhalten. Neben ihnen stand ein einzelner Sherpa, Pang Nuru. Er hatte mit uns nichts zu tun, aber anscheinend das Gefühl, dass das, was hier vor sich ging, nicht in Ordnung war.
Ich hörte mit, dass heftig diskutiert wurde. Die Sherpas forderten, ich solle herauskommen. Ich sei der Erste, den sie totschlagen würden. Wenn sie mit mir fertig seien, würden sie die anderen beiden suchen.
Ich sah keinen Ausweg mehr. Fühlte mich machtlos. Wie sollte sich die Situation noch zu unseren Gunsten ändern? Was würde mit uns passieren? Es war vorbei. Ich konnte nichts tun, es lag nicht mehr in meiner Hand.
Mir ging durch den Kopf, dass das absolut lächerlich war – wie viele Expeditionen hatte ich schon unternommen, ohne dass etwas passiert war, wie viele kritische Situationen hatte ich überlebt, und jetzt kauerte ich hier am Everest in einem Zelt und wartete darauf, umgebracht zu werden. Das gab es doch nicht. Das Ganze war so absurd, dass es mich zur Verzweiflung brachte. Die Sherpas waren unberechenbar. Ich würde das nicht überleben. Es war hoffnungslos. Ich malte mir mein eigenes Ende aus, von einer hasserfüllten Menge gesteinigt.
Nach einer Weile forderten die Sherpas, dass Simone, der Mingma beschimpft hatte, hervorkommen solle. Ich sah eine kleine Chance, dass es vielleicht doch noch einen Ausweg gab. Jemand holte Simone, der sich auf dem Gletscher versteckt hatte. Er wurde ins Zelt geschubst. Melissa kam herein und erklärte Simone, was die Sherpas verlangten: Er solle sich hinknien und für seine Worte in der Lhotseflanke entschuldigen. Simone trat vor das Zelt. Sofort gingen die Sherpas auf ihn los. Er kniete nieder und entschuldigte sich. Währenddessen verpassten ihm die Sherpas Fußtritte und Schläge ins Gesicht.
Im allgemeinen Durcheinander wurde behauptet, wir hätten für die Lhotseflanke gar keine Bewilligung. Als dann endlich die Bestätigung aus dem Basislager kam, dass wir durchaus ein Permit hatten – wie hätten wir sonst nach unserem geplanten Aufstieg auf den Lhotse absteigen sollen? –, begannen die Sherpas sich zurückzuziehen. Bevor sie ganz abzogen, erklärten sie Greg und Melissa, dass wir eine Stunde Zeit hätten, den Berg zu verlassen, sonst würden sie uns alle umbringen.
Wir warteten noch einen Augenblick, bis uns Melissa bestätigte, dass wirklich alle weg waren. Sofort packten wir die nötigsten Sachen. Nur weg von hier! Endlich konnten wir wieder handeln. Unser Zelt lag ganz oben, wir wagten nicht, an all den anderen Zelten vorbeizulaufen. Wir verließen das Lager nach hinten und rannten über den Gletscher. Damit uns niemand sah, wählten wir eine Route durch die Spalten. Trotzdem hatten wir Angst, die Sherpas könnten uns folgen. Weiter unten lag eine große Querspalte, die sich über den ganzen Gletscher zog. Eine Leiter führte über sie hinüber. Mein ganzes Denken war davon eingenommen, dass wir diese Spalte erreichen mussten, dann konnten wir die Leiter kappen, falls uns jemand hinterherkam. In dem Moment traute ich den Sherpas alles zu. Aber es folgte uns niemand.
Noch wussten wir nicht, was uns in Lager 1 erwartete. Vielleicht hatten die Sherpas nach unten gefunkt, vielleicht würden uns dort andere in Empfang nehmen? Mit einem unguten Gefühl erreichten wir die ersten Zelte. Die Bergsteiger und auch die Sherpas waren entspannt, fragten uns, was passiert sei, schüttelten den Kopf. Wir antworteten nur kurz, wollten weiter. Was würde noch auf uns zukommen?
Als wir uns dem Khumbu-Eisfall näherten, wurde es langsam dunkel. Wieder stellten wir uns vor, dass die Sherpas ihren Kollegen im Basislager Bescheid gegeben hatten, dass uns in der Dunkelheit im Eisbruch jemand abpasste. Wenn sich da jemand versteckte und einen angriff, während man gerade über eine Leiter lief … Ich nahm einen Eispickel in die Hand, als Vorsichtsmaßnahme, im Eisbruch brauchte man den eigentlich nicht. Im Basislager angelangt, legten wir uns mit Helm auf dem Kopf und Eisgerät in der Hand schlafen.
Jon und Simone blieben im Basislager, aber ich wollte so schnell wie möglich weg. Simone konnte den Helikopter organisieren, und am nächsten Morgen flog ich nach Lukla. Ich hatte genug. Nach zwei Tagen holten mich die beiden allerdings wieder zurück, weil im Basislager eine Art »Friedensgespräch« stattfinden sollte. Wir alle unterzeichneten eine handschriftliche Übereinkunft, in der festgehalten wurde, dass wir einander verziehen hätten und in Zukunft auf Gewalt verzichten würden.
Tenji und andere Sherpas hatten unsere Sachen aus Lager 2 nach unten gebracht, erstaunlicherweise war alles noch da. Wieder blieb ich nur eine Nacht im Basislager, nahm am Morgen den Helikopter nach Lukla und von dort den nächstmöglichen Flug nach Kathmandu und in die Schweiz. Ich wollte nur noch nach Hause. Nepal war für mich fürs Erste abgehakt.
*
Noch während meiner Rückreise kam zwischen dem Basislager und Lager 1 mein Freund Alexey Bolotov ums Leben. Er stürzte tödlich ab, als auf einer Umgehungsvariante des Khumbu-Eisbruchs das Seil riss, an dem er abseilte. Er galt als einer der erfolgreichsten Höhenbergsteiger. Fünfzig Jahre alt war er geworden. Bevor ich nach den Angriffen auf uns das Basislager verlassen hatte, hatte ich ihm auf die Schulter geklopft. Alexey war offensichtlich traurig, dass wir abreisten, aber wir hatten keine andere Wahl. Ich sagte zu ihm: »Du machst mir Mut! Ich habe im Minimum noch dreizehn Jahre, in denen ich auf die höchsten Gipfel steigen kann, wenn ich Lust dazu habe.«
Das war unser letzter gemeinsamer Moment gewesen. Er konnte nun nicht mehr bergsteigen. Alexey wird immer in meinem Herzen bleiben, er war ein Idol für mich. Nach der Attacke waren seine Worte bei den verschiedenen Meetings im Basislager immer dieselben. Nachdem wir das Geschehen intensiv diskutiert hatten, stand er auf und sagte in seinem russisch eingefärbten Englisch nur drei Worte: »This is bullshit!« Dann ging er aus dem Zelt.
Expeditionen nehmen öfter nicht den erwarteten Verlauf. Im Vorfeld hatte ich mich mit allen Eventualitäten auseinandergesetzt, mir vorgestellt, was alles schiefgehen konnte. Wie mussten die Verhältnisse am Berg aussehen, damit die Traverse vom Everest zum Lhotse möglich wäre? Ich hatte mir genau überlegt, wie wir uns akklimatisieren mussten, damit wir über so lange Zeit auf mehr als 8000 Metern leistungsfähig blieben. Wir mussten mindestens zwei Nächte auf 8000 Metern verbringen, und das wiederum würde uns viel Substanz kosten. Bevor wir dann einen Versuch starten konnten, sollten wir uns wieder erholen können, also ins Tal absteigen, auf unter 4000 Meter, für fünf bis sieben Tage. Zudem galt es, in der Akklimatisierungsphase vorsichtig zu sein. Wer einmal krank wird, für den ist eine solche Expedition beendet. Eine dumme Erkältung reicht, und man ist aus dem Rennen. Selbst ein leichter Husten wirkt sich über diese lange Zeit auf 8000 Metern so stark leistungsvermindernd aus, dass man die Expedition abbrechen muss.
Es waren viele Faktoren, die den Erfolg beeinträchtigen konnten. Aber ich war überzeugt, dass wir alles detailliert geplant hatten und über die erforderlichen körperlichen Voraussetzungen verfügten. Wir waren auf dem besten Weg zu unserem Ziel. Doch dann nahm unser Projekt innerhalb kürzester Zeit eine Wendung, in deren Folge es nicht mehr ums Bergsteigen ging. Auf einmal waren wir in einen Konflikt zwischen Kulturen, um Macht und Geld verwickelt.
Wir westlichen Bergsteiger üben diese Tätigkeit aus eigenem Antrieb und aus Begeisterung und Motivation für das Klettern aus. Für die Sherpas im Himalaja ist das Bergsteigen eine der wenigen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ihre Lebensgrundlage. Wieso sollte sich ein Sherpa dafür interessieren, wer mit und wer ohne künstlichen Sauerstoff auf den Everest steigt? Wieso sich das Leben unnötig schwer machen? Ihnen geht es nicht um Stil oder Ethik, ihre Aufgabe ist es, möglichst vielen Leuten zum höchsten Gipfel der Erde zu verhelfen. Die besten Verdienstmöglichkeiten haben sie bei kommerziellen Expeditionen, von selbstständigen Bergsteigern wie uns bleibt wenig hängen. Und schließlich ist es ihr Gipfel, ihr Everest. In Nepal herrscht eine andere Kultur, das Land hat einen anderen Hintergrund, und diese Differenz erzeugt zwangsläufig Spannungen.
Sherpas befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie machen die Arbeit eines Bergführers, haben aber keine Autorität. Sie stehen am Ende der Entscheidungskette. Wenn am Matterhorn ein Bergführer zu seinem Gast sagt, man müsse umdrehen, weil er den Anforderungen nicht gewachsen sei, dann dreht man um. Am Everest ist das umgekehrt. Die Kunden setzen sich grundsätzlich über die Meinung und den Rat der Sherpas hinweg.
2012, bei meinem Aufstieg auf den Everest, habe ich das selbst erlebt. Die nepalesischstämmige Kanadierin Shriya Shah Klorfine stand nachmittags um zwei Uhr auf dem Gipfel, viel zu spät. Sie benötigte siebzehn Stunden vom Südsattel auf den Gipfel. Ihre Sherpas forderten sie immer wieder dazu auf, die Besteigung abzubrechen. Shriya lehnte das ab: Es sei ihr Traum, und sie habe viel Geld bezahlt. Im Abstieg ging ihr der Sauerstoff aus. Unterhalb des Hillary Step starb sie. Die Sherpas stiegen ohne sie ab. Es muss für sie frustrierend sein, immer wieder zu erleben, dass ihnen kein Respekt entgegengebracht wird.
In meinen Augen war die Auseinandersetzung in Lager 2 in erster Linie eine Machtdemonstration. Auch die Sherpas nehmen wahr, wie viel Geld an ihrem Berg umgesetzt wird. Der nepalesische Staat nimmt über die Besteigungsgenehmigungen horrende Summen ein, die aber in erster Linie in seinen eigenen Taschen verschwinden. Die großen Anbieter kommerzieller Expeditionen sitzen im Ausland und bringen ihre eigenen Bergführer mit. Den Sherpas bleibt der Knochenjob des Gepäcktransports, und wie überall sind nicht die, die am härtesten schuften, auch die, die am besten bezahlt werden. Es ist offensichtlich, dass die Sherpas einen größeren Anteil am Kuchen wollen.
Zu einem ähnlichen Machtkampf kam es im Jahr darauf. Nachdem im April 2014 durch den tragischen Lawinenabgang sechzehn Sherpas ums Leben gekommen waren, zerfiel die Gemeinschaft der Sherpas in zwei Gruppen: Die eine wollte die Arbeiten am Berg fortsetzen. Die andere argumentierte, aus Respekt vor den Toten könne man nicht weitermachen – es ging aber vor allem auch darum, mit dieser Entscheidung Druck auf die Regierung auszuüben, die soziale Absicherung der Sherpa-Familien zu verbessern. Nachvollziehbar waren beide Standpunkte, jedoch nicht die Tatsache, dass die zweite Gruppe der ersten mit Gewalt drohte, sodass diese schließlich auch nicht mehr an den Berg zurückkehrte. Durch den Streik der Sherpas wurde die Saison frühzeitig beendet.
Als in Lager 2 der erste Stein geworfen wurde, entlud sich wohl in einem einzigen Moment eine große Frustration von Menschen, die sich gedemütigt fühlten. Dass es ausgerechnet uns drei traf, hat verschiedene Gründe: das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, Simones unbeherrschte Wortwahl, den Umstand, dass ich die Fixseile noch fertig verlegte – das war zwar gut gemeint, stellte aber, wie mir erst im Nachhinein klar wurde, eine weitere Provokation dar. Wie es für manche Leute anscheinend auch eine Provokation ist, dass wir uns im alpinen Gelände so viel schneller und ausdauernder bewegen können als sie.
Zu den Vorkommnissen am Everest gab es viele Kommentare. Jeder interpretierte sie auf seine eigene Weise. Der Sachverhalt blieb in vielen Punkten umstritten. Wer was gesagt hat. Wer wen berührt hat. Wer Eisschlag ausgelöst hat. Auch was das Aufstiegsverbot anbelangt: Anscheinend gab es unter den kommerziellen Anbietern eine Abmachung, dass an diesem Tag niemand in die Lhotseflanke steigt. Ich selbst wusste von dieser Abmachung nichts.