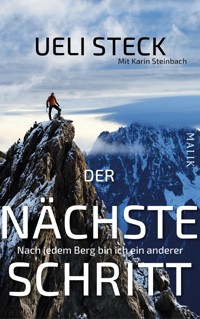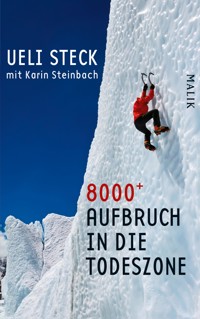12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ueli Steck hat die Grenzen des Kletterns verschoben. Kaum ein Alpinist ist an den großen Eis- und Felswänden der Welt so dynamisch und risikobereit unterwegs wie der sympathische junge Ausnahmebergsteiger aus dem Schweizer Emmental. Seine spektakulärste Leistung bisher: die Besteigung der drei großen Nordwände der Alpen in Rekordzeit. In knapp zwei Stunden durchstieg er die Matterhornnordwand, an den Grandes Jorasses stand er nach nur 2 Stunden und 21 Minuten auf dem Gipfel, für die Eigernordwand benötigte er keine drei Stunden. Erstmals lässt er jetzt ein breites Publikum an seinen atemberaubenden Gipfelsprints teilhaben und schildert packend die Herausforderungen, die es in den großen Wänden zu bewältigen gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Unter Mitwirkung von Karin Steinbach
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
4. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95636-9
© Piper Verlag GmbH, München 2010 erschienen im Verlagsprogramm Malik National Geographic
Umschlaggestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München
Umschlag- und Innenfotos: Robert Bösch
Übersetzer: Christine Kopp (Gespräch Ueli Steck/Walter Bonatti), Karin Steinbach (Gespräch Ueli Steck/Christophe Profit)
Karten: Eckehard Radehose, Schliersee
WOHER?
Warum hetzt jemand in 2 Stunden und 47 Minuten die Eiger-Nordwand hinauf? Im Februar 2008 fragten sich das vermutlich etliche Menschen, die durch Fernsehen oder Zeitung von meiner Speed-Begehung erfahren hatten. Die Frage nach dem Warum ist so alt wie das Bergsteigen. Schon in einem ganz normalen Tempo einen Berg hinaufzusteigen, nur um anschließend wieder absteigen zu müssen, ergibt ja wenig Sinn – außer dass es demjenigen, der das Ganze erlebt, tiefe Eindrücke vermittelt. Eindrücke und Erfahrungen, die ihm niemand mehr nehmen kann, die ihn prägen und die es, wie ich finde, wert sind, gelebt zu werden.
Wenn ich also trotz der offenkundigen Sinnlosigkeit des Speed-Kletterns versuche, meine Motivation nachvollziehbar zu machen, liegt das daran, dass mir das Bergsteigen sehr wichtig ist. Klettern ist für mich keine Sportart unter vielen, es bedeutet mir viel mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Für mich ist das Klettern zu einem Lebensinhalt geworden. Ich definiere mich sehr stark über das Bergsteigen und damit zwangsläufig über meine Leistung. Das mag vielleicht nicht sehr clever sein, doch ich habe in der Auseinandersetzung mit dem Schaffen und Scheitern meinen Weg gefunden. Ich bin damit glücklich.
Dabei ist die Frage, ob ich auf einem Gipfel gestanden habe oder nicht, über welche Route und in welcher Zeit ich dorthin gelangt bin, in einem größeren Zusammenhang völlig bedeutungslos. Schaut man ein Stück weit über den Tellerrand hinaus, erkennt man, dass es auf unserer Erde ganz andere Probleme gibt als die Frage, ob man den zehnten Grad klettern kann oder ob man es wagt, in eine Route free solo einzusteigen. Für meine begrenzte Welt haben diese Fragen jedoch eine enorme Bedeutung. Ich habe beim Bergsteigen sehr viel gelernt. Im Vordergrund steht dabei die Eigenverantwortung. Bergsteigen ist gefährlich, als Bergsteiger bewege ich mich in einem Umfeld mit zahlreichen Gefahrenquellen. Doch das Risiko ist subjektiv und individuell: Wie hoch es letztlich wirklich ist, hängt sehr stark vom eigenen Können ab. Ich gebe zu, dass ich das Risiko nicht scheue, doch ich bin bei jedem meiner Projekte davon überzeugt, es abschätzen zu können. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es »null Risiko« im Leben nicht gibt. Das müssen wir alle akzeptieren. Die Intensität eines Erlebnisses hängt vom Aufwand und nicht zuletzt vom Risiko ab. Je mehr ich investieren muss, desto intensiver nehme ich einen Erfolg wahr und desto länger bleibt er in meiner Erinnerung präsent.
Wer mich in Aktion sieht, denkt vermutlich: Der Ueli Steck kennt keine Angst. Aber eigentlich bin ich ein sehr ängstlicher Typ. Als Kind fürchtete ich mich jedes Mal, wenn mich meine Mutter in den dunklen Keller schickte, um ihr etwas für die Küche zu holen. Wenn ich am Abend allein zu Hause war, nahm ich immer mein Holzgewehr mit ins Bett – man weiß ja nie! Meine beiden Brüder sind wesentlich älter als ich, und das hatte zur Folge, dass ich meist ganz allein war, wenn meine Eltern ausgingen. Ich mochte das überhaupt nicht, mir war immer unwohl, wenn sonst niemand da war. Beim Einschlafen achtete ich ganz genau auf jedes Geräusch, das auf einen sich nähernden Einbrecher hindeuten konnte. Irgendwann war ich dann doch zu müde, die Augen fielen mir zu, und ich glitt in meine Traumwelt. Am nächsten Morgen war die Welt wieder in Ordnung: weit und breit kein Einbrecher und ich nicht mehr allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an die Situation, meine Angst legte sich, und bei uns im Emmental kam auch nie ein Einbrecher vorbei. Ich machte keine negativen Erfahrungen mit dem Alleinsein, und so entwickelte ich langsam das Vertrauen, dass schon nichts passieren wird. Heute sitze ich sogar sehr gern am Abend allein zu Hause und genieße es, einmal Zeit für mich selbst zu haben.
Angst ist aber ein sehr wichtiges Phänomen, und ich bin froh, dass ich Angst habe. Wovor hat man normalerweise Angst? Vor etwas Unbekanntem, davor, dass man sich überschätzen und der Situation nicht mehr gewachsen sein könnte, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Doch Unbekanntes kann man lernen, und irgendwann kann man eine Situation einschätzen. Hat man viel erlebt, hat man Erfahrungen gemacht, auf die man zurückgreifen kann, dann kann man auch mit einer neu auftauchenden Situation umgehen.
Beim Klettern befinde ich mich ständig in einer neuen Situation. Eine Wand, eine Route, Griffabfolgen sind mir zunächst unbekannt. Dann befasse ich mich damit. Die Wand nimmt Strukturen an. Ich lerne, diese Strukturen zu begreifen, es gibt Lösungen, und am Schluss ist alles ganz logisch. Wenn ich beim Sportklettern eine schwere Route in Angriff nehme, scheint sie beim ersten Mal völlig unmöglich zu sein. Ich kann die Griffe nicht halten, habe zu wenig Kraft. Vielfach bin ich am Abend nach so einem ersten Versuch entmutigt. Ich habe das Gefühl, es nie zu schaffen. Aber dann überwinde ich mich und gehe diese Route noch einmal an.
Ich weiß immer noch nicht, wo der nächste Griff ist, und noch bevor ich ihn sehe, geht mir schon wieder die Kraft aus. Nach ein paar Stürzen ins Seil erkenne ich ihn schließlich – ich komme einen halben Meter weiter. Jetzt die nächste Griffabfolge. Ich halte rechts einen Zangengriff, den ich fest zupressen muss. Er ist sehr rund; ihn zu halten erfordert einen immensen Kraftaufwand. Den rechten Fuß stelle ich hoch auf den guten Tritt, den ich zuvor als Griff verwendet habe. Ich setze mich mit maximal abgewinkeltem Knie auf die Ferse, mein Körperschwerpunkt liegt so genau über meinem Fuß. Jetzt löse ich die linke Hand von der Leiste und nehme zum Stabilisieren einen abschüssigen Zwischengriff. Den linken Fuß stelle ich auf die Leiste, auf der vorher die linke Hand war. Dann muss ich den rechten Fuß vom großen Tritt lösen und etwas nachziehen; ihn presse ich nur noch an die Wand. Erst jetzt ziehe ich mit der linken Hand weit nach links hinauf, auf einen abschüssigen runden Griff, auf dem ich mit meinen Fingerspitzen hinten eine kleine Kante ertasten kann. Blitzschnell drücke ich die Fingerkuppen in diese Struktur und lege noch meinen Daumen über den Zeigefinger, um zusätzlichen Druck auf den Griff geben zu können. Bevor ich nun einen Fußwechsel mache, greife ich mit der rechten Hand vom Zangengriff an einen Seitgriff.
Das ist ein kleiner Teil der Route »No Sika, no crime« (8b) im Berner Oberländer Klettergebiet Lehn – um genau zu sein, ungefähr ein Meter Kletterdistanz von insgesamt 26 Metern. Bei der zweiten Begehung versuchte ich die Bewegungsabläufe, die einzelnen Griffe und Tritte zu optimieren. Ich kannte die Route immer besser, Griffe, die am Anfang fast nicht zu fixieren waren, konnte ich auf einmal gut halten. So arbeitete ich mich Schritt für Schritt an die Durchsteigung heran. Abläufe automatisierten sich. Ich musste nicht mehr überlegen, es funktionierte einfach. Schließlich war ich so weit und konnte die ganze Seillänge klettern, ohne ins Seil zu fallen und ohne mich an einem Haken auszuruhen, mir gelang eine sogenannte Rotpunktbegehung. Ich musste die »No Sika, no crime« allerdings etliche Male probieren, bis alles zusammenpasste. Im Frühjahr 2001 reichten Kraft und Ausdauer bis zum Standplatz, und an der Umlenkung hängte ich das Seil mit Freude und Genugtuung in den Karabiner ein. Der Weg bis dorthin, das ist es, was das Klettern für mich so interessant macht – zu lernen, weiterzukommen, Lösungen zu finden.
Auch ich habe mich natürlich schon oft gefragt, wieso ich mir das eigentlich immer wieder antue. Wenn ich bei eisigem Wind versuche, eine Stelle zu klettern, in den Fingern absolut kein Gefühl mehr habe, der letzte Haken weit unter mir ist. Mir nichts anderes übrig bleibt, als weiterzuklettern, ich höchstens meinem Sicherungspartner noch »Pass auf!« zurufen kann, im Hinterkopf aber genau weiß, dass ein Sturz fatal wäre … Oder wenn ich im Biwak vor Kälte schlottere – man könnte ja auch einfach ganz gemütlich zu Hause sitzen bei einem Glas Rotwein, ein feines Abendessen genießen und später in einem warmen, bequemen Bett schlafen. Bis ins Letzte werde ich diese Frage wohl nie beantworten können, aber in Ansätzen verstehe ich, warum es mich immer wieder in genau diese Situationen zieht.
Mit Sport bin ich sehr früh in Kontakt gekommen. Meine zwei älteren Brüder spielten Eishockey, also wollte ich natürlich ebenfalls Eishockey spielen – übrigens eine ähnlich sinnfreie Tätigkeit wie das Bergsteigen. Unser Vater unterstützte uns dabei tatkräftig. Fast jeden Sonntagmorgen fuhr er mit uns auf die Eisbahn, wir drehten unsere Runden auf den Schlittschuhen, und zum Mittagessen waren wir wieder zu Hause. Später kam er bei Spielen mit dem Club immer als Zuschauer mit. Anschließend blieben dann die Ratschläge nicht aus. Diese Diskussionen brachten mich manchmal fast zur Verzweiflung. Warum hast du den Fehlpass gemacht? Wieso konnte der Gegner einfach rechts an dir vorbeilaufen? Ich dachte mir immer: Mach es doch selbst besser! Von der Tribüne aus zuschauen und kritisieren ist einfach, aber wenn du da unten stehst, sieht alles anders aus! Mein Ehrgeiz holte mich dann doch immer wieder ein, und beim nächsten Mal wollte ich es besser machen. Heute bin ich froh, dass ich einen solchen Vater habe, der mir – und ich denke, auch meinen Brüdern – oft geholfen hat. Die Ratschläge waren immer gut gemeint, auch wenn das im ersten Moment vielleicht nicht so aussah. Ich habe dabei gelernt, mich zu verbessern. Die naheliegende Lösung eines Problems ist, nach Ausreden zu suchen, die Verantwortung auf andere abzuschieben oder einfach zu sagen: Es ist halt passiert. Und es gibt ja auch wirklich Situationen, in denen man Pech hat, es einfach nicht gelingt – auch damit muss man umgehen können. Aber in den meisten Situationen kann man an sich arbeiten, und das hat mir mein Vater vermittelt.
Die Wende kam, als ich mit zwölf Jahren das Klettern entdeckte. Ein Freund meines Vaters, Fritz Morgenthaler, nahm mich mit in die Schrattenfluh. Daran erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Fritz war ein Kletterer der alten Schule, ich musste gleich im Vorstieg klettern. Gut fünfzehn Meter ging es im vierten Schwierigkeitsgrad auf die sogenannte Kleine Nadel hinauf, und auf dieser Strecke steckten nur drei Normalhaken. Es war eine Zitterpartie, aber schließlich hatte ich stolz den kleinen Gipfel erreicht. Das Schlimmste war aber dann das Hinunterkommen: Wir seilten uns in der Dülfertechnik ab. Fritz achtete darauf, dass ich mir das Seil richtig um den Körper legte, dann musste ich auf diesem winzigen Gipfel aufstehen und mein ganzes Gewicht dem Seil anvertrauen. Wie froh war ich, als ich endlich wieder Boden unter den Füßen hatte! In der Folge fuhren wir häufiger an die Heftizähne, meist mit dem Fahrrad von Langnau aus. Jedes Mal freute ich mich riesig darauf, im Schrattenkalk herumzuturnen, und Fritz brachte mir alles bei, was er wusste.
Für mich war das Klettern eine neue Herausforderung. Es war ganz anders als eine Mannschaftssportart, viel einfacher, denn wenn du die Route nicht hinaufkommst, liegt es grundsätzlich an dir. Mir wurde schnell klar: Ich wollte klettern! Mein Vater war von der Idee zunächst nicht so begeistert. Klettern war gefährlich. Lieber wäre ihm eine Karriere als Eishockeyspieler gewesen, das war harmloser, und als Eishockeyspieler konnte man auch noch gutes Geld verdienen. Ich brachte ihn jedoch dazu, dass ich mit dem Eishockeyspielen aufhören und mich aufs Klettern konzentrieren durfte. Vielleicht war das auch ein Emanzipationsschritt gegenüber meinen Brüdern: Hätte ich wie René und Bruno weiterhin Eishockey gespielt, wäre ich immer der kleine Bruder geblieben, der nicht an die beiden Großen heranreicht. Mein Vater gab mir einen wichtigen Satz mit auf den Lebensweg: Wenn du etwas machst, dann mach es richtig und so gut wie möglich. Das habe ich mir zu Herzen genommen; einen Teil meiner Leistungsorientierung habe ich sicherlich von ihm.
Ich wollte selbstverständlich besser werden und begann, für das Bergsteigen und Klettern zu trainieren. Auch wenn ich die Sicherungs- und Bewegungstechnik im Gebirge lernte, war es von Anfang an mehr als nur ein Abenteuer in der Natur. Natürlich schätzte ich das Panorama auf einem Gipfel, genoss das Hüttenerlebnis mit Freunden, aber es war immer der Ehrgeiz dabei, eine bestimmte Route zu klettern, bestimmte Griffe halten zu können. Ich achtete jedes Mal darauf, wie lange ich gebraucht hatte, um zur Heftihütte aufzusteigen. Und jedes Wochenende freute ich mich unglaublich darauf, endlich wieder in die Berge gehen und klettern zu können.
Lange hatte ich überlegt, bevor ich mir am Bahnhofskiosk mein erstes Rotpunkt kaufte, damals das Klettermagazin. Brauchte ich diese Zeitschrift wirklich? War sie ihren Preis wert? Sie kostete neun Franken fünfzig, und dafür hätte ich mir auch einen Karabiner kaufen können. Für die billigsten Karabiner zahlte man damals neun Franken fünfzig, und mehr Karabiner hätte ich dringend nötig gehabt, wenn ich mit meinem Vater klettern ging. Immerhin war ich mittlerweile schon stolzer Besitzer eines Seils, das ich günstiger bekommen hatte, weil es nur 42 Meter lang war anstatt der damals standardmäßigen fünfzig Meter. Außerdem hatte ich sechs Expressschlingen. Eine Expressschlinge besteht aus zwei Karabinern, die mit einer zehn bis fünfzehn Zentimeter langen, genähten Bandschlinge verbunden sind. Sie wird im Vorstieg mit dem einen Karabiner in einen Haken eingehängt, in den anderen Karabiner klippt man das Seil. Diese Zwischensicherung sorgt dafür, dass man bei einem Sturz möglichst frühzeitig vom Seil gehalten wird. Dass man das Seil nicht direkt mit nur einem Karabiner in den Haken einhängt, hat mit der Seilreibung zu tun: Meist stecken die Haken – rund zehn bis fünfzehn auf einer Seillänge, je nach Schwierigkeitsgrad – nicht direkt auf einer Linie, sie liegen mal weiter rechts, mal weiter links. Die Verlängerung durch die Expressschlingen ermöglicht trotzdem einen einigermaßen geraden Seilverlauf und verringert dadurch die Reibung, die entstehen würde, wenn das Seil im Zickzack verliefe.
Meist war es dann so, dass ich zunächst ganz stolz meine sechs Expressschlingen aus dem Rucksack holte. Danach – wenn es hoffentlich niemand sah – hängte ich die Karabiner aus den Schlingen aus, um zwölf Stück zur Verfügung zu haben, damit ich zwölf Zwischensicherungen einhängen konnte. Der Seilverlauf, den ich durch das direkte Einhängen produzierte, war natürlich alles andere als geradlinig, und die Reibung war am Ende der Seillänge so stark, dass ich das Seil kaum mehr nachziehen konnte und fast den Klettergurt verlor. Beim Ablassen war dann oft auch noch das Seil zu kurz, ich musste an einem einzelnen Haken umfädeln und abseilen oder die letzten Meter zum Boden abklettern.
Trotz all dieser Unannehmlichkeiten aufgrund meiner wenigen Expressschlingen war das Klettermagazin seine neun Franken fünfzig wert. In der Ausgabe wurde Wolfgang Güllich mit einem großen Porträt vorgestellt. Er war einer der ersten Kletterprofis – eine Karriere, die mir damals völlig unerreichbar schien. Aber das machte nichts, denn seine Geschichten waren, wie die Erlebnisse von Kurt Albert in Patagonien, Stoff für meine Träume. Als ich ein paar Monate später eine weitere Rotpunkt-Ausgabe kaufte – in der Zwischenzeit hatte ich mein Erspartes in drei neue Karabiner angelegt –, konnte ich aus dem alten Heft die ganzseitigen Fotos ausschneiden und in meinem Zimmer aufhängen. Bilder von Wolfgang Güllich in schwierigen Routen im Yosemite Valley und in Indian Creek oder von Kurt Albert in Patagonien bedeckten von da an die Wände meines Zimmers.
Mittlerweile besuchte ich die achte Schulklasse und musste mir Gedanken darüber machen, wie meine Ausbildung weitergehen sollte. Etliche Kletterer und Bergsteiger in meinem Bekanntenkreis waren Zimmerleute, zum Beispiel Thomas Reck, mit dem ich viele Wochenenden am Fels verbracht hatte. Der Beruf interessierte mich, und nach einer Schnupperlehre in den Sommerferien war ich mir sicher, dass ich ebenfalls Zimmermann werden wollte. Nach dem neunten Schuljahr begann ich eine Lehre in einer Zimmerei und schloss sie nach drei Jahren ab. Ich arbeitete auch weiterhin dort, musste mich allerdings nach etwas Neuem umsehen, als die Firma Konkurs anmeldete. Das war der perfekte Zeitpunkt, um ins Berner Oberland zu gehen. Bei unseren zahlreichen Touren dort hatte ich mir oft gedacht, wie schön es wäre, in dieser Gegend zu leben, mitten in den »richtigen« Bergen. Ich zog nach Grindelwald, an den Fuß des Eigers, wo ich schon lange hinwollte. Im Sommer verdiente ich mir meinen Lebensunterhalt als Zimmermann, im Winter am Lauberhorn-Skilift. Meine Bedürfnisse waren nicht groß, ich lebte sparsam, denn ich wollte möglichst viel Geld zur Verfügung haben, um meine Bergsteigerausrüstung zu vervollständigen und natürlich klettern zu gehen.
Als sich die erste Zusammenarbeit mit Sponsoren ergab, konnte ich mein Arbeitspensum reduzieren. Ich wollte den Sponsorenverträgen gerecht werden und versuchte, möglichst schwere Routen zu klettern. Immer mehr fokussierte ich mich auf meine Ziele. Dafür waren die Sponsoren nicht ausschlaggebend, aber sie bestärkten mich darin, denn mit jedem Sponsor, der mich unterstützte, wurde ich finanziell unabhängiger. Ich arbeitete weniger als Zimmermann und hatte mehr Zeit, die ich mit dem Bergsteigen und dem Realisieren von Projekten verbringen konnte. Mit jedem Projekt, das mir gelang, eröffneten sich in der Folge auch neue Horizonte. Das ist bis heute so geblieben. Hätte mir vor zwanzig Jahren, als ich begann, an Felsen herumzukraxeln, jemand gesagt, dass ich einst Profibergsteiger werden und mein Geld damit verdienen würde, hätte ich sehr wahrscheinlich gelacht. Trotzdem hätte mich das nicht davon abgehalten, in der Nacht davon zu träumen. Mittlerweile lebe ich tatsächlich vom Bergsteigen. Ich habe zum Glück genügend Expressschlingen und muss nicht mehr Angst haben, aufgrund der Seilreibung den Klettergurt zu verlieren. Auch muss ich nur noch selten abklettern, weil das Seil zu kurz ist.
Mir ist die persönliche Herausforderung wichtig. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Bergsteigern oder überlege mir, was ich machen könnte, um besser zu sein als sie. Ich vergleiche mich immer mit mir selbst. Das Resultat entscheidet darüber, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Von anderen wird das, was ich mache, vielfach als extrem wahrgenommen, doch für mich selbst sind meine Projekte nichts Extremes; sie sind einfach eine Weiterentwicklung, der nächste Schritt, der mir ganz logisch erscheint.
Ich bin fürs Klettern nicht ausgesprochen talentiert. Es gibt sicher viele Kletterer, die begabter sind als ich, die ein besseres Bewegungsgefühl haben. Ich bin auch kein besonders guter Ausdauersportler. Meine Stärke ist aber sicherlich meine Hartnäckigkeit. Wenn ich etwas erreichen will, dann arbeite ich daran. Ich kann mich sehr gut auf etwas fokussieren, lasse mich dann durch nichts stören oder davon abbringen. Dabei versuche ich, möglichst strategisch vorzugehen. Für mich muss die Vorbereitung perfekt sein, und ich versuche, jedes Detail zu optimieren. Dann gibt es für mich nur noch dieses eine Projekt. Tausend verschiedene Dinge auf einmal am Laufen zu haben ist nichts für mich. Ich muss eines nach dem anderen angehen. In dieser Hinsicht bin ich vielleicht, auf meine Art und Weise, auch ein bisschen engstirnig, entspreche dem klassischen Vorurteil gegenüber den Schweizern. Aber die Konzentration ist nur das eine; um weiterzukommen, um Erfolg zu haben, braucht es auch Mut und Risikobereitschaft, eine gehörige Portion Optimismus und schließlich das nötige Glück.
Auf der anderen Seite musste ich aber auch sehr viel investieren, um an diesen Punkt zu gelangen. Hinter meinen Begehungen, seien es technisch schwierige Kletterrouten oder die Speed-Begehungen kombinierter Touren, stehen endlose Stunden, in denen ich trainiert habe, um mich zu verbessern. Kleine Fortschritte – die Laufstrecke dreißig Sekunden schneller als beim letzten Mal – waren meine Motivation. Zum Glück habe ich ohnehin einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Kann ich mich ein paar Tage nicht körperlich betätigen, werde ich zuerst ungeduldig und irgendwann unausstehlich. Ein Wochenende bei schönstem Wetter nur mit Herumsitzen und womöglich reichhaltigem Essen zu verbringen ist für mich der reine Horror. Auch in den Ferien brauche ich Bewegung. Am liebsten gehe ich irgendwo im Süden klettern und genieße dort die Sonne und die Wärme.
So viel zu trainieren wäre unmöglich, wenn es mir nicht auch Spaß machen würde. Ich brüte gern mit Simon Trachsel, der mich tatkräftig unterstützt, über neuen Trainingsplänen. Mit der Zeit haben wir immer mehr Informationen zur Verfügung, was ich wie verbessern muss. Es entstehen Excel-Tabellen mit Daten, die uns die Richtung weisen. Am Anfang war ich vor Leistungstests eher nervös, hatte Angst zu versagen. Heute freue ich mich auf jeden Test. Ich sehe genau, wo ich stehe, und kann das Ergebnis mit meiner Selbsteinschätzung vergleichen. Mich selbst richtig einschätzen zu können ist ein ganz wichtiger Punkt für mich – zu lernen, mir selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ich kann nicht ununterbrochen hundert Prozent Leistung bringen, aber ich will spüren, wo ich momentan stehe. Und ich musste auch lernen, zwischendurch einmal einen Gang herunterzuschalten, sowohl meinem Körper als auch meinem Kopf etwas Luft zu lassen. Die Eiger-Nordwand in 2 Stunden, 47 Minuten und 33 Sekunden zu klettern, dazu wäre ich momentan nicht in der Lage. Das muss man wissen und auch akzeptieren, aber man muss sich davon nicht stressen lassen. Man muss aber dann auch wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wann es möglich ist, diese Leistung abzurufen und die Eiger-Nordwand hinaufzurennen.
Ausdauer- und Krafttraining vertragen sich nicht, das ist eine der Grundlagen der Trainingslehre. Ich brauche nun aber beides, für Unternehmungen in der Höhe vor allem Ausdauer, zum Klettern schwieriger Routen in erster Linie Kraft. Mein Wunschtraum wäre natürlich, als Marathonläufer den Schwierigkeitsgrad 9a zu klettern, am besten 365 Tage im Jahr … Ich teile mein Training sehr stark in Perioden ein, das hat mich um einiges weitergebracht. Wir konnten meinen Körper sozusagen tunen, wodurch ich leistungsfähiger wurde. Für die Speed-Begehungen der Nordwände von Eiger, Grandes Jorasses und Matterhorn musste ich mich voll auf Ausdauer und Schnelligkeit ausrichten.
Für mich ist immer das Projekt am wichtigsten, an dem ich gerade arbeite. Geleistetes, Geklettertes rückt sehr schnell in den Hintergrund. Meist ist es dann Nicole, meine Frau, die mich bei Selbstzweifeln auf den Boden der Tatsachen zurückholt und mir sagt, was ich alles schon geschafft habe. In den gelegentlich durchaus vorkommenden Momenten, in denen ich das Gefühl habe, zu gar nichts fähig zu sein, schubst sie mich ins »richtige« Leben. Dann kann ich mich wieder mehr distanzieren, nehme die kleinen Teilerfolge im Projekt wahr. Diese Entwicklung – von der Idee am Anfang über die kleinen Fortschritte, die mich dem Ziel näher bringen, bis zum Erfolg – empfinde ich als sehr kreativ. Ich sehe es auch als ein großes Privileg, so leben und mir aussuchen zu können, welches Ziel ich als Nächstes angehen will.
Ausgefeilte Technik und viel Selbstvertrauen
In 2 Stunden und 47 Minuten durch die Eiger-Nordwand
Ein wesentlicher Grund dafür, dass ich mit neunzehn Jahren nach Grindelwald zog, war der Eiger. Mit seinen 3970 Metern thront er majestätisch über dem Ort, ein Bollwerk aus Fels und Eis. Wer nach Grindelwald kommt, kann ihn nicht übersehen. Zwar fehlen ihm ein paar Meter zum Viertausender, doch das macht er mit seiner gewaltigen Nordwand mehr als wett – mit der »Wand der Wände«, die den Betrachter sofort in ihren Bann zieht.
1858 wurde der Gipfel des Eigers zum ersten Mal betreten. Der Ire Charles Barrington überzeugte die Grindelwalder Bergführer Christian Almer und Peter Bohren davon, einen Besteigungsversuch zu machen. Am 11. August überwanden sie von der Wengernalp aus die Westflanke, den heutigen Normalabstieg, und erreichten ohne nennenswerte Probleme um zwölf Uhr mittags den elfthöchsten Gipfel der Berner Alpen. Völlig undramatisch hatten sie den Nimbus der Unersteigbarkeit des Eigers zerstört. Nach zehnminütiger Gipfelrast im Nebel begannen sie den Abstieg, für den sie auf dem gleichen Weg vier Stunden benötigten.
Charles Barrington trat nach dieser Erstbesteigung nicht weiter als Bergsteiger in Erscheinung. Vor allem für Christian Almer aber war die Besteigung des Eigers der Anfang einer großen Bergsteigerkarriere. Als Bergführer gelangen ihm unzählige Erstbesteigungen in den Alpen.
Bereits 1878 standen mit vier jungen Männern aus Thun und Umgebung die ersten Bergsteiger, die ohne Bergführer aufgestiegen waren, auf dem Gipfel des Eigers und lösten damit einen Sturm der Entrüstung und scharfe Kritik in der Presse aus. Was der Eiger bei der Erstbesteigung an Widerstand hatte vermissen lassen, holte er nach, als der Nordost- oder Mittellegigrat, der kühnste der Grate, angegangen wurde. Der erste Versuch war schon 1874 gemacht worden, danach gab es viele weitere, die jedoch alle scheiterten. 1885 wurde der Nordostgrat schließlich erstmals begangen, allerdings im Abstieg, von dem bekannten Schweizer Bergführer Alexander Burgener und seinem österreichischen Gast Moritz von Kuffner. Es sollte dann noch 36 Jahre dauern, bis dem Japaner Yuko Maki mit den Führern Fritz Amatter, Samuel Brawand und Fritz Steuri die spektakuläre Begehung im Aufstieg gelang. Mithilfe einer drei Meter langen Holzstange stiegen sie 1921 über die plattigen Aufschwünge des Grats. Am 10. September um sieben Uhr abends standen die vier Männer auf dem Gipfel. Yuko Maki stiftete aus Freude über den Erfolg dem Führerverein Grindelwald die Mittellegihütte, die 1924 erbaut wurde. Das Originalgebäude kann heute ohne langen Zustieg bei der Station Eigergletscher der Jungfraubahn bestaunt werden; es wurde 2001, nach 77 Jahren, durch eine neue, größere Hütte ersetzt und ist heute ein Museum.
Für die nächsten Bergsteigergenerationen waren die Möglichkeiten am Eiger noch längst nicht ausgeschöpft. In den Dreißigerjahren rückten die Wände ins Blickfeld der Erschließer und wurden zum Ziel junger Alpinisten. Den gewaltigen Nordabstürzen der Hauptkette der Berner Alpen vom Eiger bis zum Lauterbrunner Breithorn widmeten sich insbesondere zwei Männer: der Deutsche Willo Welzenbach und der Schweizer Hans Lauper. 1932 kletterte Lauper mit Alfred Zürcher und den Bergführern Alexander Graven und Joseph Knubel durch die Nordostwand des Eigers. Seine Route war die erste über die Nordseite auf den Gipfel. Für Hans Lauper blieb es nicht die einzige Nordwand: Während seiner Bergsteigerlaufbahn gelangen ihm sämtliche Nordanstiege der Berner Hauptkette einschließlich des Lauterbrunner Breithorns.
An die Durchsteigung der eigentlichen Eiger-Nordwand hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch niemand gewagt. Sie galt, wie die Nordwände von Matterhorn und Grandes Jorasses, als eines der drei »ungelösten Probleme« der Alpen, aus denen später »die drei großen Nordwände« wurden. Dieser Begriff umschrieb die bedeutendsten Routen des gesamten Alpenraums. 1931 war das erste dieser »Probleme« gelöst worden: Nach einer sechstägigen Anreise auf Fahrrädern von München nach Zermatt erkletterten die Brüder Franz und Toni Schmid die 1100 Meter hohe Nordwand des Matterhorns. 1935 folgte die Durchsteigung der Nordabbrüche der Grandes Jorasses durch Rudolf Peters und Martin Meier, die eine Route durch den Nordpfeiler auf die Pointe Croz legten. Blieb noch die Nordwand des Eigers, eine 1680 Meter hohe Bastion aus Fels und Eis, die letzte große Herausforderung in den Alpen.
1935 erfolgte auch dort der erste ernsthafte Durchsteigungsversuch. Die beiden Münchner Max Sedlmayr und Karl Mehringer gelangten am 21. August bis auf das »Bügeleisen«. Vom schlechten Wetter überrascht, mussten sie im seither so genannten Todesbiwak ausharren und starben vermutlich am 25. August. Im folgenden Sommer ereignete sich das wohl bekannteste Drama der Eiger-Nordwand. Die Deutschen Andreas Hinterstoißer und Toni Kurz sowie die Österreicher Edi Rainer und Willy Angerer, die sich zusammengeschlossen hatten, kehrten wegen einer Steinschlagverletzung Angerers bei einsetzendem Schlechtwettereinbruch um. Ihr Abstieg über den vereisten Fels wurde durch den Umstand erschwert, dass sie das Quergangsseil im vierzig Meter langen, nach seinem ersten Überwinder Hinterstoißer benannten Seilzugquergang abgezogen hatten und deswegen weiter über die senkrechten Wandstufen abseilen mussten. Sie hatten sich bereits bis in Rufweite des Streckenwärters der Jungfraujochbahn nach unten gekämpft, als drei von ihnen durch Steinschlag und Neuschneelawinen ums Leben kamen. Toni Kurz, hilflos in überhängendem Gelände im Seil hängend, konnte von den Rettern nicht erreicht werden und starb einen Tag später.
Das daraufhin von der Berner Regierung erlassene Begehungsverbot der Nordwand war juristisch nicht durchsetzbar. Die vergeblichen Versuche und die zahlreichen Toten – im Juni 1938 stürzten die beiden Italiener Bortolo Sandri und Mario Menti ab – ließen den Eiger immer mehr zum Mythos werden. Am 22. Juli 1938 brachen die deutschen Bergsteiger Anderl Heckmair und Ludwig Vörg gegen drei Uhr morgens von ihrem Zeltlager auf den Wiesen am Wandfuß auf. Die Österreicher Heinrich Harrer und Fritz Kasparek waren schon einen Tag zuvor eingestiegen und hatten in den Felsen rechts vom Zweiten Eisfeld biwakiert. Weil Harrer keine Steigeisen hatte und sie deswegen Stufen ins Eis schlagen mussten, holten Heckmair und Vörg die beiden bereits um 11.30 Uhr in der Querung zum Bügeleisen ein. Die Deutschen waren bedeutend besser ausgerüstet und trainiert, auch ihre neuartigen zwölfzackigen Steigeisen verschafften ihnen erhebliche Vorteile. Nachdem sie sich zu einer Viererseilschaft zusammengeschlossen hatten, übernahm Heckmair bei zunächst noch guten äußeren Bedingungen die Führung. Doch am späten Nachmittag des 23. Juli schlug das Wetter wieder einmal um. Heftige Gewitter waren die Folge, eine ungemütliche Biwaknacht stand ihnen bevor.
Am nächsten Morgen erwachten sie in einer Winterlandschaft. Eine ungewisse Wetterbesserung abzuwarten erschien ihnen zu riskant, also machten sie sich durch den Sturm auf den Weg, über mit Blankeis überzogene und von Neuschnee bedeckte Felsen. Der »Tag des Anderl Heckmair«, wie Heinrich Harrer später schrieb, hatte begonnen. Die originalen Bilddokumente sprechen Bände: An diesem Tag machte Heckmair das Unmögliche möglich. Er setzte alles ein, seine außerordentliche Physis, sein spezielles Training, seine psychische Stabilität; am Limit kam all das zum Tragen. Er nahm volles Risiko in Kauf, denn ihm war bewusst, es gab nur noch eine Devise: Alles oder nichts. Sie mussten nach oben durchkommen, denn ein Abstieg hätte sicherlich in einer Katastrophe geendet. Sorgfältig sicherten sie, Seillänge um Seillänge stiegen sie höher, so überlegt und effizient wie möglich. Völlig ausgelaugt erreichten Anderl Heckmair, Ludwig Vörg, Fritz Kasparek und Heinrich Harrer am Nachmittag des 24. Juli den höchsten Punkt. Die Eiger-Nordwand war durchstiegen.
Nach einer der außergewöhnlichsten Leistungen in der alpinen Geschichte wurden die vier Bergsteiger im Tal als Helden empfangen – und postwendend von den Nationalsozialisten politisch vereinnahmt. Auch nach den Pionierzeiten des Alpinismus blieb die Wand stets unter Beobachtung der Medien, egal ob es um die erste Winterbegehung, die erste Alleinbegehung, die erste Begehung durch eine Frau, die Direttissima oder weitere neue Routen ging. Obwohl die Kletterei noch unterhalb von 4000 Metern endet, steht die Eiger-Nordwand, was ihren Bekanntheitsgrad betrifft, auf einer Stufe mit den Achttausender-Giganten des Himalaja. Der Höhepunkt der medialen Aufmerksamkeit war 1999 erreicht, als das Schweizer Fernsehen in Zusammenarbeit mit dem deutschen Sender Südwestrundfunk live aus der Eiger-Nordwand berichtete. Die Schweizer Stephan Siegrist, Evelyne Binsack und Hansruedi Gertsch und der Deutsche Ralf Dujmovits durchstiegen die Heckmair-Route mit Helm kameras, zusätzlich waren mehrere fixe Kamerapodeste in der Wand montiert worden. Von Helikoptern aus gefilmte Sequenzen ergänzten die authentischen Bild- und Tonaufnahmen aus der Wand. Zum ersten Mal wurde das Erlebnis einer Eiger-Nordwand-Durchsteigung für mehr als eine Million Fernsehzuschauer hautnah nachvollziehbar.
Auch mich hatte die Eiger-Nordwand früh zu faszinieren begonnen. Als junger Bergsteiger war Heinrich Harrers Die weiße Spinne Pflichtlektüre für mich. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, war mir klar: Wenn du ein richtiger Bergsteiger sein willst, musst du die Eiger-Nordwand klettern. Am Anfang meiner leidenschaftlichen Beziehung zu den Bergen war ich sehr viel im Fels unterwegs, das Sportklettern interessierte mich am meisten. Aber irgendwann wollte ich ein »kompletter« Bergsteiger werden und begann mit dem Eisklettern. Viele große kombinierte Bergtouren hatte ich allerdings noch nicht gemacht, als es 1995 so weit war: Markus Iff und ich saßen in unserem Zelt, auf genau diesen saftig grünen Wiesen in der Nähe des Salzegg-Skilifts unterhalb der Eiger-Nordwand, wo schon die Pioniere ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Wir waren vorbereitet, hatten trainiert. Im Jahr zuvor waren wir in zehn Stunden den Wetterhornpfeiler geklettert, der mit AS– (äußerst schwierig minus) bewertet war. Wir waren ziemlich schnell gewesen, doch leider nicht schnell genug, um den letzten Zug in Grindelwald, der um 21.50 Uhr abfuhr, noch zu erreichen. Mit schweren Beinen waren wir den ganzen Weg von der Glecksteinhütte hinunter nach Grindelwald gejoggt, aber fünf Minuten zu spät am Bahnhof angekommen. Die kalte Septembernacht auf dem harten Kiesparkplatz unter der Rettungsdecke wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Es war Sonntagabend, wir waren stolz auf uns, aber mein Lehrmeister hatte kein Verständnis dafür, dass ich montags nicht um sieben Uhr am Arbeitsplatz erschien. Seine knappen Worte drückten keinerlei Begeisterung über unseren Erfolg aus, nur eines: Bis Ende der Woche mussten die verpassten Stunden nachgearbeitet sein. Hundemüde arbeitete ich vier Abende lang weiter, während alle anderen nach Hause gingen. Am Freitagabend hatte ich 45 Stunden zusammen, und der Frieden war halbwegs wiederhergestellt.
So etwas sollte mir nicht noch einmal passieren. Diesmal hatten wir reichlich Zeit. Ich hatte mir die Ferien für diesen Sommer aufgespart und fünf Wochen Bergurlaub vor mir. Die Eiger-Nordwand war mit AS (äußerst schwierig) bewertet, sollte also im Bereich unserer Möglichkeiten liegen. Trotzdem schliefen wir in dieser Nacht im Zelt keine Sekunde. Frühmorgens um zwei starteten wir in die stockdunkle Nacht. Nachdem wir endlich unsere am Vorabend am Wandfuß deponierten Rucksäcke gefunden hatten, ging es los – Meter für Meter. Gegen Abend erreichten wir den Wasserfallkamin, der seinem Namen alle Ehre machte. Es war August, und durch den Kamin floss ein regelrechter Sturzbach. Meine neuen Plastikbergstiefel, für deren Kauf ich extra nach Italien gereist war, erwiesen sich als perfekt wasserdicht: Oben lief das Wasser in die Schuhe hinein, bis sie randvoll waren, hinaus lief gar nichts. Zwei Seillängen weiter oben bereiteten wir uns schließlich auf einem abschüssigen Band auf eine kühle Nacht vor. Von Kopf bis Fuß durchnässt, drängten wir uns in unserem Nylonbiwaksack aneinander und warteten den nächsten Morgen ab. Meine Fausthandschuhe waren am nächsten Morgen so steif gefroren, dass sie unbrauchbar waren, und mir blieb nichts anderes übrig, als in meinen trockenen Fingerhandschuhen zu klettern, an denen für das Klettern im Fels die Fingerspitzen abgeschnitten waren. Im Eis hätte ich allerdings lieber richtige Handschuhe gehabt. Mit kalten Händen und gefrorenen Kleidern setzten wir unseren Aufstieg fort. Am frühen Nachmittag waren wir dann endlich richtige Bergsteiger – wir standen auf dem Gipfel des Eigers, hatten die Sonne im Gesicht. Diesmal erwischten wir sogar den Zug nach Hause. Das warme Bett daheim ist eben doch besser als der ungemütliche Parkplatz von Grindelwald.
Beide waren wir stolz auf unsere geglückte Besteigung. Wir gönnten uns danach ein paar schöne Klettertage in der Schrattenfluh, wo wir zuvor an den Heftizähnen trainiert hatten, mit Steigeisen im Fels zu klettern. In der kleinen Heftihütte verbrachten wir drei schöne Tage, schliefen aus, aßen, kletterten an der Sonne. Mein Übermut wurde dann allerdings sehr schnell gestoppt. Bei einem eigentlich harmlosen Sturz ins Seil schlug ich unglücklicherweise etwas hart auf den Fels auf und brach mir den Fuß. Natürlich alarmierten wir nicht per Funk die Rettungsflugwacht, wir wollten uns nicht dem Gespött preisgeben. Ich stieg also mit einem gebrochenen Fuß ab, Markus trug das gesamte Material und stellenweise auch mich – ein etwas trauriges Ende unseres erfolgreichen Bergurlaubs.
Mittlerweile bin ich 28-mal durch die Eiger-Nordwand gestiegen, mehr als fünfzig Tage meines Lebens verbrachte ich in dieser Wand. Erstbegehungen, Freikletterrouten, etliche Abenteuer habe ich in ihr erlebt, und sie ist immer noch ein spezieller Ort für mich. Vielleicht, weil ich in dieser Arena immer wieder reizvolle Aufgaben fand, beispielsweise mit der Eröffnung neuer Routen wie der »Paciencia« oder der »Young Spider«. In den Alpen sind alle großen Wände bestiegen – allein in der Eiger-Nordwand gibt es 33 verschiedene Routen –, aber trotzdem kann man sich noch neuen Herausforderungen stellen. Heute muss man dafür etwas kreativer sein als früher, als es ausreichte, in eine bereits begangene Wand im Winter oder solo einzusteigen, um die Anforderungen zu erhöhen.
Der Walliser Michel Darbellay war 1963 der Erste, dem die Eiger-Nordwand im Alleingang gelang, innerhalb von zwei Tagen. Als ich 1995 vom Eiger zurück kam, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich mir überlegte, wie ich im Wasserfallkamin gesteckt hatte, von meinem Partner von unten gesichert – und so eine Passage im Alleingang, ohne Seil, ohne Sicherung? Bei diesem Gedanken lief es mir kalt über den Rücken. Wir kletterten zwar in der Schrattenfluh immer wieder einmal Felsrouten ohne Seilsicherung, aber das waren zwanzig bis fünfzig Meter in warmem, trockenem Fels. Diese Wand solo, das erschien mir völlig unmöglich.
Nach Darbellay taten es ihm Dutzende von Bergsteigern gleich, und für jeden Einzelnen war es mit Sicherheit ein eindrucksvolles Erlebnis, allein in dieser Wand zu klettern, sich völlig auf sich gestellt mit den Problemen auseinanderzusetzen. Allein waren sie auch schneller als in Seilschaft, und die Begehungszeiten waren im Alpinismus schon immer ein Qualitätsmerkmal. Seit Jahr und Tag schauten die Bergsteiger auf die Uhr und verglichen sich mit anderen, und noch heute freuen sich Wiederholer von Routen, wenn es ihnen gelingt, die im Führer angegebene Zeit zu unterbieten. Nachdem die Österreicher Leo Forstenlechner und Erich Waschak die Eiger-Nordwand 1950 erstmals in einem Tag, in achtzehn Stunden, geklettert waren und die Seilschaft Reinhold Messner/Peter Habeler diese Zeit 1974 auf zehn Stunden reduziert hatten, läuteten Alleingänger eine neue Ära ein: Der Berner Oberländer Bergführer Ueli Bühler beging die Heckmair-Route 1981 in knapp achteinhalb Stunden, der Slowene Francek Knez im Jahr darauf in sechs Stunden, der Österreicher Thomas Bubendorfer 1983 in sagenhaften vier Stunden und fünfzig Minuten. Diesen Rekord hielt er zwanzig Jahre, dann war der Südtiroler Christoph Hainz noch ein wenig schneller und benötigte vom Einstieg bis auf den Gipfel vier Stunden und dreißig Minuten.
Im Dezember 2005 überwand ich mich und beschloss, ebenfalls solo auf der klassischen Route durch die Eiger-Nordwand zu klettern. Das würde, im Vergleich zu manchen anderen Projekten, die ich bereits realisiert hatte, keine alpinistische Heldentat sein, aber für mich persönlich doch ein entscheidender Schritt. Ich übernachtete im Guesthouse am Eigergletscher. Weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich die gesamte Wand in einem Tag schaffen würde, packte ich einen 600 Gramm wiegenden Leichtschlafsack und einen Kocher ein, rund eineinhalb Kilo Zusatzgewicht, das mir aber bei einem eventuellen Biwak doch einen gewissen Komfort bieten würde. Im Schwierigen Riss, im Wasserfallkamin und im Quarzriss, den drei technisch anspruchsvollsten Seillängen, sicherte ich mich mit meinem sechzig Meter langen Seil. Sicherungsmaterial hatte ich reichlich dabei, Klemmkeile, Camalots – flexible Klemmgeräte – und Eisschrauben, eigentlich alles, was eine Zweierseilschaft auch mitführt. Nach zehn Stunden stand ich am Abend auf dem höchsten Punkt. Während der Begehung war ich von Robert – »Röbi« – Bösch und Bruno Roth gefilmt worden, und Röbis Anfrage per Funk, ob ich nicht auf dem Gipfel biwakieren könne, um weitere Aufnahmen zu ermöglichen, kam mir eigentlich ganz gelegen. So konnte ich dort oben die intensiven Stunden, die gerade hinter mir lagen, auf mich einwirken lassen. Ein Gefühl der Zufriedenheit erfüllte mich, aber so richtig realisiert habe ich es erst ein paar Tage später, daheim in der warmen Stube: Ich war die Eiger-Nordwand solo geklettert.
Ich hatte etwas durchgezogen, was mir zehn Jahre zuvor noch völlig unvorstellbar gewesen war. Das machte mich schon ein bisschen stolz, aber wenn ich es realistisch betrachtete, musste ich mir eingestehen: Es war zwar eine gute Leistung, aber als herausragend konnte man sie nicht bezeichnen. Die Zeiten von Bubendorfer und Hainz begannen mich zu beschäftigen. Vier Stunden fünfzig, ja sogar vier Stunden dreißig, wie war das möglich? War ich wirklich ein so langsamer Bergsteiger, oder hatte ich nur nicht das Beste aus mir herausgeholt? Eine Antwort auf diese Frage zu bekommen war ganz einfach: Ich musste es schlicht noch einmal probieren! Nach all den Jahren, in denen ich mich intensiv mit der Eiger-Nordwand beschäftigt hatte, war es nun die klassische Heckmair-Route, die mich interessierte.
In meinen Augen hat sich die Eiger-Nordwand vom letzten großen Problem der Alpen zur Herausforderung des modernen Alpinismus entwickelt. Eine solche Vielfalt an Klettermöglichkeiten wie hier ist einzigartig. Überwiegen auf der rechten Seite steile Freikletterrouten, so sind im zentralen Wandteil einige der längsten und anspruchsvollsten kombinierten Touren der Alpen zu finden. Selbst das in den letzten zehn Jahren aufgekommene Mixed-Klettern hat vor der Eiger-Nordwand nicht haltgemacht. Und der Zustieg ist akzeptabel, fast sportklettermäßig. Doch all das rückte nun in den Hintergrund – mein Thema war, wie ich möglichst schnell die Originalroute der Erstbegeher klettern konnte. Zunächst überlegte ich mir, welche Passagen ich ohne Seilsicherung verantworten konnte und wo ich mich sichern wollte. In der 1680 Meter hohen Wand blieben drei je rund fünfzehn Meter hohe Felspassagen übrig, in denen mir das Absturzrisiko zu hoch war, um ohne Seil zu klettern. Die restliche Strecke teilte ich in verschiedene Kategorien ein: schnelle Abschnitte, Passagen, die ich zwar ohne Seilsicherung kletterte, die aber trotzdem heikel waren, und leichtere Abschnitte, in denen auch eine Seilschaft gleichzeitig geht, ohne zu sichern.
Die drei Passagen, in denen ich mich selbst sichern wollte –Schwieriger Riss, Wasserfallkamin und Quarzriss –, musste ich so effizient wie möglich klettern, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ich brauchte eine zuverlässige Seilsicherung, die möglichst einfach und schnell war. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich schon öfter allein im Fels geklettert und hatte mich dabei selbst gesichert, beispielsweise bei mehreren Routen im achten und neunten Schwierigkeitsgrad an den Wendenstöcken. Ich fixierte das Seil jeweils am Standplatz und ließ es durch ein Sicherungsgerät an meinem Klettergurt laufen. Kletterte ich höher, lief das Seil durch das Gerät, und ich konnte wie beim Klettern in Seilschaft Zwischensicherungen einhängen. Bei einem Sturz blockierte das Sicherungsgerät hingegen den Seildurchlauf, ich wurde aufgefangen, wenn auch etwas statisch. Das funktionierte mit ein wenig Übung tadellos. Mit dieser Technik hatte ich mich auch bei meinem ersten Alleingang durch die Eiger-Nordwand selbst gesichert. Die Methode brachte nur einen Nachteil mit sich: Hatte ich den nächsten Standplatz erreicht, musste ich das Seil erneut fixieren, die zurückgelegte Kletterstrecke wieder abseilen, dabei meine Zwischensicherungen einsammeln und das untere Ende des Seils lösen. Dann konnte ich an dem jetzt oben fixierten Seil wieder aufsteigen. Ich musste also alles doppelt klettern und brauchte entsprechend viel Zeit – zu viel für eine Speed-Begehung. Für den Eiger musste ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Da es in jeder der drei problematischen Seillängen maximal fünfzehn Meter waren, die mir heikel erschienen, behalf ich mich mit einem dreißig Meter langen Seil, das ich mit einem Karabiner am unteren Standplatz einhängte. Beide Seilenden fixierte ich an meinem Klettergurt. Mit dieser Seilschlaufe konnte ich fünfzehn Meter gesichert nach oben klettern. Zusätzlich hatte ich die Möglichkeit, die vorhandenen Zwischenhaken mit einer sechzig Zentimeter langen Bandschlinge von unten einzuhängen und sechzig Zentimeter über dem Haken wieder auszuhängen, sodass ich für kurze Zeit auch über die Zwischenhaken gesichert war. Nach dem Ende der schwierigen Kletterstrecke löste ich ein Ende des Seils und konnte es am anderen Ende zu mir heraufziehen, ohne nochmals absteigen zu müssen. Diesem Vorteil stand allerdings ein gravierender Nachteil gegenüber. Die Seilschlaufe verhinderte lediglich den Totalabsturz. Bei einem Sturz wäre die Fallhöhe sehr groß gewesen, sie hätte sich aus meiner Höhe über dem Standplatz plus fünfzehn Meter plus Seildehnung zusammengesetzt und in jedem Fall ernsthafte Verletzungen bedeutet. Für mich ein akzeptabler Kompromiss.
Ende der Leseprobe