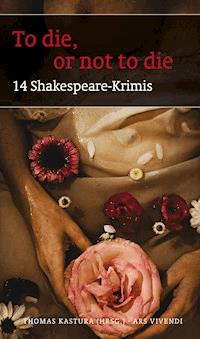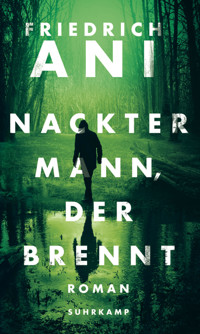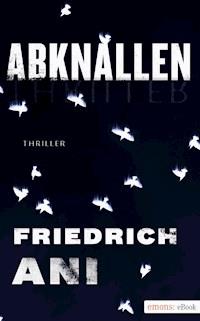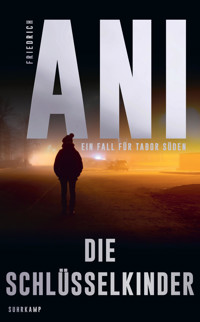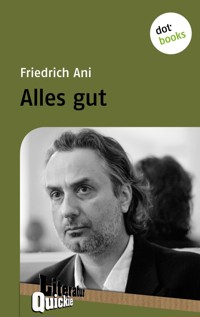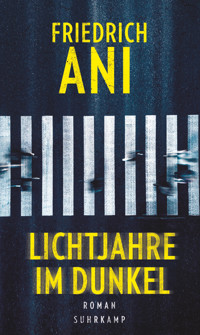9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Tabor Süden, der vielerfahrene und vielerleidende Spezialist für Vermisstenfälle, wollte seine Ermittlertätigkeit nie wieder aufgreifen, nachdem beim letzten Fall ein Mitarbeiter der Detektei das Leben verloren hatte. Doch seine ehemalige Chefin überredet ihn nun dazu, sich zum allerallerletzten Mal auf Personensuche zu machen. Er soll Cornelius Hallig auftreiben. Als Autor von Kriminalromanen war Hallig eine Zeitlang eine Berühmtheit, lebte mit seiner Mutter in einem Münchner Hotel und verschwand von einem Tag auf den anderen.
Friedrich Ani lässt seinen Ur-Ermittler Tabor Süden wiederauferstehen und bringt ihn auf die Spur des Autors Cornelius Hallig. Schon bald wird Süden sich der Parallelen zwischen seinem Leben und dem des Autors bewusst. Und so gerät die Suche nach Hallig letztlich zu einer Suche nach sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
FRIEDRICH ANI
DER NARR UND SEINE MASCHINE
Suhrkamp
I was only trying to cheat death. I was only trying to surmount for a little while the darkness that all my life I surely knew was going to come rolling in on me some day and obliterate me. I was only trying to stay alive a brief while longer, after I was already gone. To stay in the light, to be with the living, a little while past my time. I loved them both so. A fool and his machine. Yes, a fool and his machine.
Cornell Woolrich
1
Ein Mann in einer Bahnhofshalle, irgendein Mann in irgendeiner Bahnhofshalle. Ein Mann in einem weißen Baumwollhemd und einer schwarzen Jeans, eine grüne Reisetasche in der rechten und eine schwarze Lederjacke in der linken Hand. Er stand da und schaute hinauf zur elektronischen Anzeigetafel mit den zweispaltig von links oben nach rechts unten chronologisch angeordneten Abfahrtszeiten. Er las die Zielorte und vergaß sie gleich wieder. Immer wieder fing er von vorn an, den Kopf im Nacken, reglos am Rand des Gewühls.
Die Blicke, die ihn streiften, nahm er wahr wie einen fremden Atem, der manchmal nach Bier roch, manchmal nach strengen Gewürzen. Jemand rempelte ihn an und ging weiter. Jemand stellte sich vor ihn und starrte ihn an, zog eine Grimasse, wartete auf eine Reaktion und traute sich dann doch nicht, ihm auf die Schulter zu tippen.
Jedes Mal wenn die Stimme der Ansagerin aus den Lautsprechern schallte, hörte er hin und wartete auf den Namen einer Stadt oder die Nummer eines bestimmten Zuges. Er kam sich lächerlich vor. Nach dem Ende der Durchsage lauschte er weiter, und beim nächsten Knacken der Sprechanlage zuckte er zusammen. Wie ein Kind, das hinter der geschlossenen Tür, allein in seinem Zimmer, beim Klingeln der hellen Glocke im Flur aufschreckt und weiß, es wird zur Bescherung gerufen.
Am Himmel brannte die Sonne. In der Stadt herrschten fast dreißig Grad. Niemand dachte an Weihnachten, auch nicht der Mann, der allmählich das Gewicht seiner Reisetasche spürte. Er hatte sie seit dem Betreten der Bahnhofshalle noch nicht einmal abgesetzt.
Im Grunde dachte er an nichts. Er schaute und schwitzte und vergaß die Zeit und ein wenig auch sich selbst.
Vor einer Ewigkeit hatte er jeden Morgen die Halle durchquert, auf dem Weg zu seiner Dienststelle gegenüber der Südseite des Hauptbahnhofs. Damals gehörten die Stimmen und Geräusche, das Gewusel, die Hektik der Reisenden und das erstarrte Treiben der Sandler und Obdachlosen zur Membran seines Alltags, in dem er eine Funktion hatte, eine Bestimmung. Da war er Kriminalhauptkommissar in der Vermisstenstelle der Kripo, Besoldungsgruppe A 11, ein Fahnder auf der Suche nach den Schattenlosen. Später quittierte er aus freien Stücken den Dienst und verschwand. Nach seiner Rückkehr nahm er einen Job in einer Detektei an – so lange, bis die Tage mit Finsternis begannen und in Finsternis endeten.
Gestern hatte er seinem Vermieter die vollständig ausgeräumte, geweißte Wohnung gezeigt und ansonsten kaum ein Wort mit ihm gewechselt. Heute Mittag hatte er mit dem Handy, das ihm seine Chefin geschenkt hatte, ein Taxi gerufen und den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten geworfen. Auf der Straße hatte er sich nicht mehr umgesehen. Wie schon zu seiner Zeit als Kriminalist saß er im Taxi auf der Rückbank, hinter dem Beifahrersitz. Er ließ die Stadt an sich vorüberziehen und erinnerte sich an die Dunkelheit der vergangenen Monate, an den Tod, der der Arbeit der Detektei ein Ende gesetzt hatte, an seinen letzten Besuch auf dem Waldfriedhof, wo sein bester Freund beerdigt war und sein Vater grablos unter einer grünen Wiese lag.
»Wo geht die Reise hin?«, hatte der Taxifahrer gefragt.
Tabor Süden hatte geschwiegen. Er gab dieselbe Summe Trinkgeld, die die Fahrt gekostet hatte, und stieg aus. Er hatte einen Blick zum Neubau auf der anderen Straßenseite geworfen. Im vierten Stock war sein Büro gewesen, auf den anderen Etagen verteilten sich die Mordkommissare, die Brandfahnder und die Todesermittler. Im türkischen Imbiss im Erdgeschoss hatte er mit den Kollegen gelegentlich gegessen und mit seinem besten Freund und Kollegen Martin Heuer regelmäßig ein Bier getrunken. Nach und nach waren die Kommissariate ins Präsidium in der Innenstadt verlegt oder in einen Bürokomplex im Westend ausgelagert worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Stadt schon verlassen.
Heute, an diesem sonnigen, gewöhnlichen fünften Juli, ging er ein zweites Mal weg, lautlos, ohne jemandem eine Nachricht zu hinterlassen – wie so viele, deren Spur er verfolgt, deren leere Zimmer er erkundet und deren Schatten er wiedergefunden hatte. Ihn würde niemand wiederfinden, dachte Tabor Süden, als er sich auf der obersten Treppenstufe von der Straße abwandte. Seine Zukunft wäre die allumfassende Unsichtbarkeit.
Beinah beschwingt stellte er die grüne Tasche jetzt neben sich. Er legte den Kopf noch tiefer in den Nacken und schloss die Augen. Alles war einfach, alles war klar. Er würde einsteigen und aufbrechen. Er würde fahren und unterwegs sein. Zeiten und Orte würden sich ändern, und er wäre ein Teil von ihnen. Das Geld, das er bei sich hatte, würde eine Weile reichen, und alles andere war alles andere.
Und die Orte, an denen er gelebt hatte? Nichts als eine Landkarte aus Zufällen, dachte er, ab und zu verstreut eine Handvoll Rosen, an einer wahllos markierten Stelle – wie auf der Wiese der Anonymen, zum Gedenken an all die unscheinbar Verstorbenen in ihren schlecht beleuchteten Zimmern.
Er schlug die Augen auf. Vor ihm stand eine Frau in einem graugestreiften Hosenanzug.
»Ich wusste es«, sagte sie.
Ein Mann in einer grauen Cordhose und einem schwarzgrau gemusterten, knielangen Mantel aus Schurwolle, den er offen trug, die Hände in den Taschen. Unter dem Mantel ein olivfarbenes Polohemd. Er war nicht sehr groß, vielleicht eins siebzig. Seine dürre Gestalt mit der schmächtigen Brust verschwand fast hinter dem Ampelmast, wo er offensichtlich auf etwas anderes als das grüne Licht wartete. Er bewegte sich nicht von der Stelle. Seine schwarzen, staubigen Halbschuhe mit den schiefen Absätzen verharrten nebeneinander, Sohle an Sohle.
Unter der sengenden Sonne müsste der Mantel zu Schweißausbrüchen führen, doch das bleiche, hohlwangige Gesicht des Mannes blieb trocken.
Vor ihm hielten Autos, wenn die Ampel auf Rot sprang. Er sah über sie hinweg zu einem steingrauen, leerstehenden Haus auf der anderen Straßenseite. Das Haus gehörte zu seiner Vergangenheit, wie das steingraue, verwitterte Haus hinter ihm, wie er selbst, der steingraue Mann an einer gewöhnlichen Kreuzung an einem gewöhnlichen Julitag, der allenfalls durch die Hitze zu etwas Besonderem wurde. Nicht für Cornelius Hallig, der außerhalb jeder Temperatur zu existieren schien.
Er stand weiter da, die Hände in den Manteltaschen, die blassblauen Augen auf das einstöckige Haus mit den vergitterten Fenstern im Erdgeschoss gerichtet. Hin und wieder schaute er zum wolkenlosen, überirdisch blauen Himmel hinauf.
Ihm war bewusst, dass er sich gegenüber mehreren Menschen schäbig und eigentlich unentschuldbar verhielt. Er hätte ihnen zumindest eine Nachricht hinterlassen müssen, zwei oder drei hoffnungsfrohe Sätze, die möglicherweise zwar nichts erklärt, aber doch seinen guten Willen bewiesen hätten.
Natürlich hatte er darüber nachgedacht. Er hatte sogar Wörter auf einen Block gekritzelt. Am Ende lagen vier Papierknäuel auf dem Boden. In jener Nacht hatte er Genugtuung empfunden – ein Gefühl, das noch nachwirkte, als er vor vier Tagen gegen fünf Uhr morgens, zum ersten Gesang der Amseln, das Hotel, in dem er lebte, verließ und sich auf den Weg zu seiner neuen, vorübergehenden Unterkunft machte.
Alles in allem war seine Welt, dachte er, nicht viel mehr als ein Zimmer in einem in die Jahre gekommenen Hotel gewesen. Nach dem Tod seiner Mutter hatte sich sein Zimmer in eine Kemenate verwandelt, die er nur verließ, um in der Lobby ein Bier und einen Obstbrand zu trinken und Gespräche zu führen, deren Inhalte sich wiederholten wie die Farben an einer Ampelanlage.
Er ließ den Blick schweifen.
Hier war er groß geworden, zuerst im Haus an der Kreuzung und vom vierzehnten Lebensjahr an wenige hundert Meter weiter in einer Straße, die nach einem Arzt benannt war, der im neunzehnten Jahrhundert gegen die Sklaverei im Sudan gekämpft hatte.
Schon bevor er mit seiner Mutter dort einzog, hatte ihn der Name fasziniert – Emin-Pascha-Straße. Er stellte sich vor, dass er eines Tages den afrikanischen Kontinent bereisen würde, und alle Kontinente der Erde.
Er hatte Europa nie verlassen. Nach der mittleren Reife lebte er ein knappes Jahr in Berlin, anschließend wieder in München. In seinen Zwanzigern begann sein Erfolg als Schriftsteller. Er schrieb für Zeitungen und Zeitschriften, bald veröffentlichte er Romane und Kurzgeschichten. Mit dem Erfolg kamen die Einnahmen, und er unterstützte seine Mutter. Schließlich zogen sie gemeinsam in ein Hotel, wo sie sich häuslich einrichteten, sie in einem Doppelzimmer, er in einem Einzelzimmer. Und vor vier Tagen, nach mehr als dreißig Jahren, war er ausgezogen.
Aber das wusste noch niemand. Alle dachten, er folge einer Laune, treibe sich womöglich in bestimmten Kneipen herum, habe sich überraschend auf ein Abenteuer eingelassen. Stattdessen schlief er nachts in der Kammer seiner Bekannten und musste seltsame Träume ertragen.
Früher, in der großen Zeit – er nannte sie groß, weil er damals größer war –, erwachte er morgens mit einem Korb voller Schnappschüsse im Kopf. Manchmal – und gar nicht so selten, wie er im Nachhinein glaubte – verwandte er das eine oder andere Bild für sein unmittelbares Tagwerk, für eine Figur im Roman, eine Szene in einer Kurzgeschichte.
Zeitweise erschienen ihm seine Träume wie das Rohmaterial seiner Arbeit. Wenn er gegen Mitternacht das Licht ausmachte und nicht allzu betrunken war, freute er sich auf das, was geschehen würde, auf die Personen, die ihn erwarteten, auf das quirlige Leben, das weit außerhalb seines Zimmers, aber nie in der Wirklichkeit stattfand und nach dem er sich nicht einmal sehnte.
Anscheinend existierte in ihm eine Welt, die sein Unterbewusstsein eisern hütete und nicht an die Oberfläche ließ. So konnte er sein reales Leben nie ändern oder zumindest beschwingter ertragen.
Natürlich war das leichtfüßige Leben von seiner wahren Existenz weit entfernt, weiter als seine Schuhe vom blauen Himmel.
Dennoch: In der großen Zeit hatte er geträumt und gelebt. Dann hatte er nur noch gelebt. Er schlief nach Mitternacht ein und wachte im Morgengrauen auf, und die Nacht dauerte an und nannte sich Tag.
Seit vier Tagen schreckte er aus dem Schlaf hoch, umzingelt von Gestalten, deren Gesichter und Gewänder so furchterregend nah waren, als wären sie von grellen Scheinwerfern aus dem Dunkel einer Filmkulisse gestanzt.
In der ersten Nacht in der fremden Wohnung war er seinem Vater begegnet.
Obwohl sein Vater seit fast dreißig Jahren tot und er ihn in seinem Erwachsenenleben nur ein einziges Mal sah, hatte Cornelius Hallig ihn auf der Stelle erkannt, und sein Vater ihn. Sie hatten geredet. Doch wie die Stimme seines Vaters geklungen hatte, verschwieg sein Gedächtnis.
An den Namen seines Vaters hatte er ewig nicht mehr gedacht. Vinzenz Brauer. Seine Eltern waren nie verheiratet gewesen. In der Schule fragte ihn niemand nach seinem Vater, seine Mutter war nicht die einzige alleinerziehende Frau in Zamdorf. Als er geboren wurde, war sie vierundzwanzig und sein Vater weg. Ab und zu tauchte er auf und legte Geldscheine auf den Tisch. Der Tisch war rechteckig, etwa einen Meter breit und fünfzig Zentimeter tief. Die weiße, gehäkelte Tischdecke wurde an der vorderen Längsseite mit zwei Plastikklammern und an den Seiten mit jeweils einer Klammer am Verrutschen gehindert. Trotzdem strich seine Mutter, wenn sie Zeitung las oder eine Schnitte Brot mit Butter und Schnittlauch aß und dazu Kaffee mit viel Milch trank, in regelmäßigen Abständen mit der flachen Hand über die fleckenlose Decke.
Seit einer gewissen Zeit schaute er hinüber zum mittleren Fenster unter dem Balkon mit der schmiedeeisernen Brüstung. Das war das Küchenfenster, der Tisch hatte genau davorgestanden. Solange er sich erinnern konnte, hatte er an der Schmalseite gesessen, seine Mutter mit Blick zum Fenster, vor dem sie einen kleinen Garten angelegt hatte. Außer Schnittlauch wuchsen in den Beeten Dill, Rosmarin und Petersilie. Ein Rosenstrauch zierte das unscheinbare Areal. Er bildete sich ein, seine Mutter hätte einmal auch eine Handvoll Gurken geerntet. Die Menge des Salats, den sie mit Öl, Essig und Zucker anrichtete, reichte gerade für ein Schälchen, aus dem sie bei offenem Fenster und zum Gesang der Vögel gemeinsam kleine Stücke pickten.
Vielleicht hatte er das nur geträumt.
Das graue Haus mit den vergitterten Fenstern und dem rostigen Balkongeländer ragte als Erinnerungsruine in den flirrend heißen Tag. Hallig schaffte es nicht, das wie in Stein geschlagene Gesicht seines Vaters zu verscheuchen. Eigentlich waren es zwei Gesichter. Das eine, das am Tisch, war braun gebrannt und wurde vom Rauch einer Zigarette umschlängelt, das andere, das im Traum, bestand aus grauer Haut und erloschenen Augen.
An diesem Tag hatte er beide nicht erwartet.
Der Grund, warum er hierhergekommen war, hatte etwas mit dem Traum von letzter Nacht zu tun – wieder ein Traum voller Menschen und Ereignisse, die er sich kaum merken konnte. Beim Aufwachen hatte er den Eindruck, er wäre stundenlang auf den Beinen gewesen und durch Straßen gelaufen, die er vage wiedererkannte. In einem Hotel stieg er in einen Lift und im verkehrten Stockwerk wieder aus. Er hetzte Treppen hinauf und hinunter. Er suchte jemanden. Wenn er innehielt, rannten Leute an ihm vorüber, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Und dann, auf welchen Wegen auch immer, hatte er das Haus erreicht, nach dem er die ganze Zeit, unbewusst und unbeirrt, Ausschau gehalten hatte. Dieses Haus lag im Winkel zweier Straßen ohne Ampeln.
So war das damals. So war das heute Nacht im Traum.
Bei alldem hatte sein Vater keine Rolle gespielt. Aber jetzt war er da, er saß am Tisch und rauchte. Vor ihm lagen, einer neben dem anderen, Geldscheine. Blaue Geldscheine, glaubte der Junge sich zu erinnern, der an der Kreuzung stand und vierundsechzig Jahre alt war. Auch seine Mutter musste in der Küche gewesen sein. Er konnte sie nicht sehen, nur seinen Vater mit dem sonnengebräunten Gesicht und der unaufhörlich glimmenden Zigarette im Mundwinkel. In der Brusttasche seines karierten Hemdes steckte eine Packung Zigaretten und darin das Feuerzeug. Beim Reden verstand der Junge kaum ein Wort.
»Ich versteh dich nicht«, sagte der Mann zum Ampelmast.
Jemand hupte. Der Mann zuckte zusammen. Ein Autofahrer, der an der roten Ampel wartete, grinste ihn durchs offene Seitenfenster an. Dann gab er Gas und hupte noch einmal.
Cornelius Hallig blickte wieder zum Haus.
Den Dialekt hatte er nie zuvor gehört. Später erzählte ihm seine Mutter, sein Vater stamme aus Cham in der Oberpfalz. An jenem entscheidenden Tag, dachte Hallig beim Anblick der trostlosen Hausmauer, saß Vinzenz Brauer am Tisch und redete. Und plötzlich, mitten in einem Satz, bellte der Hund. Leise schnaufend hatte der schwarze, zottelige Mischling wie üblich in einer Ecke unter dem Tisch gelegen. Vielleicht hatte ihn ein bestimmtes, kehlig klingendes Wort aufgeschreckt. Vielleicht war er eingeschlafen und hatte sich im Traum verirrt und bellte um Hilfe. Kurz darauf lugte seine Schnauze neben dem Tischbein hervor. Verwundert blickte der Besucher auf das Tier. Zamo war sein Name. Sein Besitzer hatte ihn im letzten Sommer in der Hundepension gegenüber der Kreuzung abgegeben und nicht wieder abgeholt. Vom ersten Tag an befolgte er jeden Befehl, den der Junge ihm zurief. Die Mutter hatte nichts dagegen, wenn noch ein weiterer Hund auf dem Gelände hinterm Haus herumlief und sonst keinen Ärger machte.
»Er schlief vor meinem Bett«, sagte der Mann an der Ampel zu niemandem.
Der Junge, den jeder Linus nannte, hatte seinem Vater Zamo vorgestellt – wie eine Person, einen Menschen, einen Freund. Das war ein schöner Moment gewesen. Die Gewissheit darüber versetzte den vierundsechzig Jahre alten Jungen an der Kreuzung in einen Schockzustand. Nicht nur wegen des gestochen scharfen Bildes in seinem Kopf. Nicht nur wegen des Traumes in der letzten Nacht, wo er mit Zamo auf der Wiese hinter der Hundepension herumgetollt war. Nicht nur wegen des Erscheinens seines Vaters vor vier Tagen im Traum und jetzt schon wieder.
Wegen der Rückkehr jenes wundersamen Moments in der Küche – Vater, Hund und unsichtbare, aber anwesende Mutter – begriff Cornelius Hallig jetzt, dass er nicht bloß wegen des Unglücks, das sich am selben Tag ereignet hatte, und wegen seiner kindhaften, bis ins zerfleddernde Erwachsenendasein hineinreichenden Schuldgefühle diesen Ort noch einmal aufgesucht hatte.
Als er seinen vierbeinigen Freund seinem Vater vorstellte, indem er mehrmals Zamos Namen wiederholte – aus Furcht, sein Vater könnte ihn ebenso wenig verstehen wie er ihn –, glühte er vor Freude darüber, nie mehr allein sein zu müssen. Zamo würde sein lebenslanger Gefährte, sein absolutes Vertrauensgeschöpf sein.
Er war vier Jahre alt und ein Glückskind. In diesem einen Moment, dachte Hallig, war er selig gewesen, die Hand im weichen, warmen Fell des Hundes, unter den Augen von Vater und Mutter.
Wegschauen hätten sie sollen und er mit Zamo unter den Tisch kriechen und dort bleiben für alle Ewigkeit.
Denn dass sein Vater an jenem Morgen unangemeldet vor der Tür gestanden hatte, war der Beginn des Unglücks. Vinzenz Brauer brachte Geld mit und umarmte zum Abschied die Mutter seines Sohnes und auch seinen Sohn. Im Flur drehte er sich noch einmal um und sagte den Namen des Hundes, der ihm zaghaft hinterhergeschlichen war. Das war alles. Das war der Vormittag, der Mittag. Das war der Tag, der in die imaginären Geschichtsbücher der alleinerziehenden Mutter Rosemarie Hallig und ihres Sohnes Linus einging.
Zum letzten Mal war der Erzeuger aufgetaucht und hatte sich wohlfeil verhalten.
Zum letzten Mal lief der Junge mit seinem Hund nach draußen. Und zum ersten Mal vergaß er, Zamo an die Leine zu nehmen, wie üblich, wenn sie irgendwohin aufbrachen und die viel befahrenen Straßen überqueren mussten.