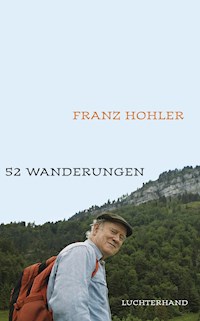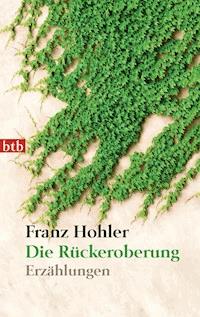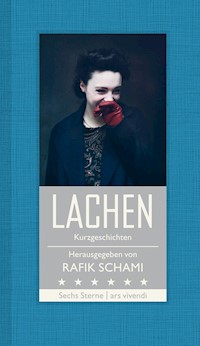5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der berühmtesten Schweizer Romane der letzten zwanzig Jahre
Roland hat das Alleinleben satt. Heinz kämpft um die Liebe seiner Ehefrau. Den Gemeindepräsidenten plagt eine unangenehme Kälteallergie – und diese drei Männer sind nicht die einzigen, die sich auf die Entwicklungen in der Nähe des Keltengrabs oberhalb von Zürich keinen Reim machen können: Was bedeuten die Risse, die sich im Erdboden zeigen und langsam größer werden? Daran, dass ein Vulkan ausbrechen könnte und ein neuer Berg aus dem Boden schließen könnte, denkt niemand. Aber eigentlich sollten doch alle gewarnt sein. Die Natur lässt schließlich nicht mit sich spaßen ...
Schullektüre, Auswahlthema zum Abitur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
btb
Buch
Roland hat das Alleinleben satt. Heinz kämpft um die Liebe seiner Ehefrau. Den Gemeindepräsidenten plagt eine unangenehme Kälteallergie — und diese drei Männer sind nicht die einzigen, die sich auf die Entwicklungen in der Nähe des Keltengrabs oberhalb von Zürich keinen Reim machen können: Was bedeuten die Risse, die sich im Erdboden zeigen und langsam größerer werden? Daran, dass ein Vulkan ausbrechen und tatsächlich ein neuer Berg aus dem Boden schießen könnte, denkt niemand. Aber im Grunde sollten doch alle gewarnt sein. Die Natur lässt schließlich nicht mit sich spaßen ...
»Da läuft ein atemberaubender erzählerischer Countdown.« Basler Zeitung
Autor
Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren, er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Franz Hohler ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, u. a. erhielt er 2002 den »Kassler Literaturpreis für grotesken Humor« und 2005 den »Kunstpreis der Stadt Zürich«.
Inhaltsverzeichnis
Für Ursula
1
An einem schönen Frühlingsnachmittag rannte ein Mann im blauen Trainingsanzug mit leichten Schritten durch den Wald. Die Sonne schien durch das frische Laub, die Vögel zwitscherten geradezu unglaublich, und der Autobahnlärm weit im Hintergrund klang friedlich und gleichmäßig wie das Rauschen eines Wasserfalls.
Der Mann fühlte sich gut und locker. Es war Montag, er hatte einen freien Tag und genoß es, daß er nicht demselben Rhythmus unterworfen war wie die Mehrzahl der Leute. An Wochenenden beispielsweise war dieser Weg voll von Joggern, da lief er nicht so unbeschwert, sondern hatte immer das Gefühl, er müsse sich mit den andern messen, freute sich, wenn er jemanden überholen konnte, und ärgerte sich über alle, die ihn überholten, besonders über die Frauen.
Jetzt aber waren nur vereinzelt alte Leute unterwegs, zwei graue Spaziergängerinnen drehten sich erschrocken um, als sie seine Schritte hörten, doch sein Kostüm wies ihn als harmlos aus. Der Mann sah in Gedanken den Tag kommen, an dem man in seinem Alter den Wald nur noch im Trainingsanzug betreten durfte, um niemanden zu ängstigen. Er war dreiunddreißig, hatte kurze, schwarze Haare und einen Schnurrbart, und als er nun an den beiden Spaziergängerinnen vorbeizog, ihnen einen Gruß zuwarf, den sie manierlich erwiderten, dachte er, wie sie wohl reagiert hätten, wenn er in einem Sträflingsanzug dahergekommen wäre. In seinem Gesicht jedenfalls gab es keinen Zug, der nicht auch einem Kriminellen oder Entwichenen hätte gehören können, und jedesmal, wenn er für ein Ausweisfoto in einen dieser Automaten ging und nachher seine eingezogenen Schultern und die weit aufgerissenen Augen sah, kam es ihm vor, als habe er das Fahndungsbild eines Terroristen in der Hand.
Dabei hatte er einen Beruf, bei welchem Solidität und Zuverlässigkeit zu den ersten Anforderungen gehörten. Er war Techniker beim Fernsehen, Aufzeichnungstechniker, und wenn seine Maschine nicht lief, gab es kein Fernsehen. Der Beruf war zwar nicht schwierig, aber anspruchsvoll, so, daß er dringend einen Ausgleich brauchte, schwimmen etwa oder velofahren oder einfach durch den Wald rennen.
Der Weg machte nun eine Kurve, und dahinter mußte der Mann einem kleinen Kind ausweichen, das ihm auf seiner Seite entgegenwatschelte, indem es die Hände um eine unsichtbare Lenkstange klammerte und dazu unablässig Motorengebrumm ausstieß. Halb belustigt und halb verärgert machte er einen Bogen um den winzigen Motorradfahrer, welcher so versunken in seine Fahrt war, daß er ihn überhaupt nicht wahrnahm. Ärgerlich war für den Mann die Störung seines Lauftakts, aber als die Mutter des Kindes, die gleich danach mit ihrem leeren Buggy folgte, ein Wort der Entschuldigung sagte, winkte der Mann ab — böse sein war sowieso etwas, das er nicht konnte. Die Frau hatte er übrigens auch schon gesehen samt ihrem Kind, sie war blond, klein und etwas füllig, sehr jung noch und hatte ein Strahlen auf dem Gesicht, als ob es nichts Schöneres auf der Welt gäbe als Mutter zu sein und ein Kind durch den Wald zu treiben.
Der Mann war geschieden und hatte keine Kinder. Nach zwei Jahren Ehe, in denen nichts von dem eingetreten war, was er erhofft hatte, war er beim Gedanken, dies gehe nun bis zum Lebensende so weiter, von einem solchen Grauen befallen worden, daß er allen seinen Mut zusammengenommen hatte, um seiner Frau die Scheidung vorzuschlagen, was sie zu seiner Überraschung sogleich annahm. Sie trennten sich dann im Frieden, und seither — das war vor fünf Jahren — lebte er allein in einer Zweizimmerwohnung in einem der Vororte von Zürich, die zahlenmäßig schon längst Stadtgröße erreicht hatten, ohne jedoch den geringsten städtischen Geist zu atmen, und obgleich sie alle auf -kon oder -wil oder -dorf endeten, waren sie auch keine Dörfer mehr, sondern gehörten zu diesen Kunstklumpen aus Stadt und Land, für die nur noch ein Fremdwort übrigbleibt: Agglomeration.
Von weitem war nun einer mit einem Schäferhund zu sehen. Der Hund war offensichtlich nicht an der Leine, trotz der Tollwuttafeln an sämtlichen Waldrändern. Der Mann haßte Schäferhunde. Gewöhnlich wurden sie von den Schäferhundehaltern an der Leine geführt und schauten einen an wie ein unterdrücktes Volk, deprimiert, feindselig, zu allem fähig. Der da vorn ließ seinen Untertanen also laufen, was den Hund aber auch nicht gemütlicher machte, so daß sich der Läufer der Begegnung entzog, indem er auf einen kleinen Pfad abschwenkte, der seitlich abbog. Er kannte den Pfad, ohne genau zu wissen, wo er hinführte. Das gefiel ihm an dem Wald hier, die vielen Pfade, deren Verbindung er sich nie wirklich merken konnte, so erlebte er in einem bekannten Gelände immer wieder Überraschungen.
Er hatte nun auf Wurzeln aufzupassen, die über den Boden krochen, ab und zu mußte er sich auch bücken eines Astes wegen, einmal kratzte ihn ein spitzes Blatt an der Hand, und er drehte sich um, um zu schauen, ob es eine Stechpalme war, wie er im ersten Moment dachte, und so war es auch, dann wurde es steiler, der Pfad begann sich etwas zu verlieren im Jungholz, ein am Boden liegender Baumstamm, auf welchen er mit einem kleinen Sprung hüpfte, war alt, morsch und feucht und brach unter seinem Tritt ein, dann konnte er nicht mehr rennen und stieg keuchend zwischen den brusthohen Bäumchen hinan, in Erwartung des nächsten größeren Waldweges. Als er ein metallisches Klirren hörte, wußte der Mann wieder, wo er war. Da oben erwartete ihn die Station Nr. 10 des Vitaparcours, die mit den Ringen. Zwischen Holzpfählen hingen drei Paar Ringe in verschiedener Höhe, an die man sich, wie einem eine Turnerfigur auf einer hellblauen Tafel schematisch nahelegte, hängen sollte, um dann mit den Beinen zu kreisen oder mit den Hüften zu wackeln. Gerade war ein Fitneßsuchender abgesprungen, um weiterzulaufen, und die leeren Ringe, die vorher gegeneinandergeschlagen hatten, baumelten noch zwischen den Balken. Dem Mann waren diese organisierten Übungen zuwider. Der Ort mit den Ringen kam ihm vor wie ein Richtplatz, und er setzte sich wieder in Trab, aber nicht in der Richtung des Sportlers.
Er lief bis zur neunten Vitastation, an welcher man aufgefordert wurde, über einem Baumstamm hin- und herzuhopsen, und wählte dann eine kaum sichtbare Spur, die sich linker Hand in ein Wäldchen mit jungen Tannen zog. Es war ein Wald im Wald, mit einer besonderen Stimmung, der Boden war federnd weich und schien die Geräusche aufzuschlukken, etwas dunkler war es auch, man sah die einfallenden Sonnenstrahlen einzeln und glaubte sie anfassen zu können. Zwei Rehe entfernten sich widerwillig, ohne besondere Eile, man merkte, daß sie sich hier zu Hause fühlten. Es ging nun noch einmal bergauf, der Mann strengte sich aber an, seinen Laufschritt beizubehalten. Dies gelang ihm nicht ganz, da er, als sich die Tännlein lichteten, über eine Wurzel stolperte und beinahe hinfiel. Damit war er aus dem Tritt und erstieg den kleinen Hügel, der vor ihm lag, im Gehen.
Oben setzte er sich tief atmend auf den großen Stein, der auf der Hügelkuppe lag, oder auf der Hügelfläche vielmehr, denn der Hügel war oben platt. Dies war einer seiner Lieblingsorte im Wald, hier waren Keltengräber gewesen, wie eine kleine, in den Stein eingeschraubte Tafel mitteilte, Gräber, die im letzten Jahrhundert von einem Postbeamten entdeckt wurden, der in seiner Freizeit als Archäologe tätig war, der hatte diesem Hügel offenbar angesehen, daß etwas Besonderes mit ihm verbunden war, und manchmal dachte der Mann, es sei ungerecht, daß der Hobbyarchäologe ein Jahrhundert Vorsprung auf ihn gehabt hatte, er wäre auch draufgekommen, daß dies kein gewöhnlicher Erdbuckel war. Jedenfalls saß er gerne hier und dachte nach oder dachte nichts und begnügte sich einfach damit, da zu sein und auf diesem Stein zu sitzen, unter dem vor ein paar tausend Jahren Menschen beerdigt worden waren.
Es wird nun Zeit, diesem Mann einen Namen zu geben, und ich möchte ihn Steinmann nennen, Roland Steinmann. Sie wissen genausogut wie ich, daß es eine Frechheit ist, eine erfundene Person mit einem Namen auszurüsten und damit so zu tun, als gäbe es sie wirklich, aber ich möchte Ihnen eine längere Geschichte erzählen, die sich zwischen Menschen abspielt, und da sehe ich einfach nicht, wie ich ohne Namen auskomme. Ich verspreche Ihnen dafür, daß, wer immer in dieser Geschichte auftaucht, seinen Namen mit einer Selbstverständlichkeit tragen wird, als sei er damit auf die Welt gekommen, und daß auch Sie sich allmählich in dieser erfundenen Welt bewegen werden, als gäbe es sie wirklich — vielleicht gibt es sie auch wirklich, ist denn nicht schon der Name einer bekannten Stadt gefallen? — und daß Sie am Schicksal unserer Hauptfigur, und das ist sie, vielmehr er, dem wir soeben durch den Wald gefolgt sind, daß Sie also am Schicksal dieser Figur Anteil nehmen werden und daß Sie sich, sollten wir diese einmal eine Weile aus den Augen verlieren, fragen werden, was macht wohl Roland Steinmann?
Jetzt gerade sitzt er immer noch auf dem Findling, schaut vor sich hin und ahnt weder, daß wir ihm zuschauen, noch daß er die Hauptfigur einer längeren Geschichte sein wird, er sieht lediglich am Fuß des Hügels einen feinen Riß, der längs des Hügels verläuft, und denkt, daß die Regenfälle der letzten Woche, die mancherorts zu Überschwemmungen führten, sogar auf jahrtausendealte Grabhügel eine Wirkung gehabt haben, steht dann auf und geht, begleitet vom Gelächter eines Hähers aus den Baumwipfeln, langsam weiter, gegen den Waldausgang zu.
Als er ihn erreicht, weicht er vor einem Reiter zurück, der elegant und bedrohlich auf dem Waldrandweg galoppiert, dann blickt er in die Weite; vor dem blauen Horizont heben sich die graue Kehrichtverbrennungsanlage und das schwarze Einkaufszentrum ab, und darüber erhebt sich grollend, mit einem roten Schweizer Wappen auf der Heckflosse, ein startendes Passagierflugzeug, ungewöhnlich tief, wie ihm scheint.
2
In einem einfachen Zimmer eines Begegnungszentrums im Jura saß eine Frau und schrieb einen Brief. Sie kam schlecht vorwärts, schaute immer wieder zum Fenster hinaus auf die Weide, die unmittelbar vor dem Gebäude begann, auf das Bauernhaus weiter hinten, dessen Silo in der Abendsonne einen langen Schatten warf, und auf das kleine Stück Wald im Hintergrund. Manchmal stand sie auch auf und ging etwas hin und her, aber mehr als ein paar Schritte waren nicht möglich zwischen dem Tischchen am Fenster, dem Bett an der Wand und dem Kasten und dem Waschbecken an der anderen Wand. Der Raum hatte in seiner Kargheit etwas Klösterliches, und dabei handelte der Brief von etwas ganz und gar Unklösterlichem.
Die Frau hatte zum erstenmal in ihrer bald zwanzigjährigen Ehe eine Liebesaffäre mit einem andern Mann, und das schrieb sie nun nach Hause, dem Mann, mit dem sie verheiratet war.
Die Sache mit dem andern Mann hatte sich zwanglos ergeben. Er war einer der Leiter des zweiwöchigen Kurses, an dem sie teilnahm, eines Kurses, in welchem die Grundkenntnisse der Heilpädagogik aufgefrischt wurden und der sich vor allem an Menschen wandte, die bereits in der Heilpädagogik tätig gewesen waren und den Wiedereinstieg suchten, also fast ausschließlich Frauen. In diesem Kurs versuchte man das neueste Wissen über den Umgang mit behinderten Kindern zu vermitteln, wobei Doris, dies der Name der Frau, welche den Brief zu schreiben versuchte, gelegentlich erschrak über die Vielfalt möglicher Schädigungen, von Schwachsinn bis Autismus. Obwohl es die heilpädagogische Grundhaltung war, jeden behinderten Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, war sie doch froh, zwei gesunde Kinder zu haben, eine sechzehnjährige Tochter und einen vierzehnjährigen Sohn. Es kam ihr auch oft der verspannte Gesichtsausdruck in den Sinn, den sie bei Eltern kannte, die ein debiles Kind in der Schule abholten oder es an einem Sonntag spazierenführen mußten, sei es auf einem Feldweg oder im Tram, und wie der Ausdruck um so härter wurde, je älter die Betreuten waren und je deutlicher die Eltern spürten, daß sie lebenslänglich mit einem Wesen verbunden waren, das sich nie von ihnen lösen würde außer durch den Tod.
Sie aber, Doris, hatte nichts Verspanntes, sie schaute sich gern an am Morgen im Spiegel, wenn sie ihr schwarzes Haar in den Nacken warf, um es zu einem lockeren Roßschwanz zu binden, sie war zweiundvierzig und immer noch neugierig auf das Leben.
Als der Kursleiter in einer Kaffeepause am Freitag der ersten Woche erwähnte, er werde übers Wochenende nicht nach Hause fahren, sondern mit dem Auto einen kleinen Ausflug nach Frankreich machen, ohne bestimmtes Ziel, hatte sie ihn spontan gefragt, ob sie mitkommen könne, und er hatte ebenso spontan gesagt, ja, das wäre schön. Dann meldete sich Doris zu Hause ab, sagte ihrer Tochter, welche das Telefon abnahm, sie verbringe das Wochenende mit Frauen, die sie kennengelernt habe, und fuhr dann mit Rolf, dem Kursleiter, durch den welschen Jura, und schon in Pontarlier, der ersten Stadt nach der französischen Grenze, bezogen sie ein ältliches Hotel, und sie waren sich beide einig, daß es ein Zweierzimmer sein sollte, Doris trank sich beim Nachtessen im Speiseraum mit den Kronleuchtern und den verblichenen Tapeten etwas Mut an, den sie aber eigentlich gar nicht brauchte, denn es wurde alles so selbstverständlich und fröhlich und unpeinlich, wie sie es nach den zwei, drei schlecht gelungenen Ansätzen zu Abenteuern in den letzten zwanzig Jahren kaum für möglich gehalten hätte, und sie freute sich von ganzem Herzen darüber.
Nun war es Montag, gegen Abend, und sie freute sich immer noch, nur hatte sie gemerkt, daß sie das ihrem Mann gegenüber nicht ebenso leichthin erwähnen konnte, wie es passiert war. Am Telefon über Mittag hatte sie ihn belogen, hatte sogar, ohne es vorher zu planen, zwei Kursteilnehmerinnen erfunden, welche zusammen wohnten und mit welchen sie das Wochenende verbracht habe, hatte diese auch in den Kanton Fribourg verlegt, möglichst weit weg, hinter die Sprachgrenze, in einen Weiler in der Nähe von Orbe, an dessen Namen sie sich nicht zu erinnern brauchte, hatte somit allen zufälligen oder absichtlichen Nachfragen vorgebeugt, und zwar so rasch und geschmeidig, daß sie sich über sich selbst wunderte.
Für sie war immer klar gewesen, daß, sollte sie einmal eine weitere Beziehung eingehen, daß dies dann ohne jede Heimlichtuerei zu geschehen hätte, so, wie es des Umgangs unter erwachsenen Menschen würdig war. Und nun war ihr das schon im ersten Anlauf mißglückt, mehr noch, sie hatte sich auf die allergewöhnlichste Art verhalten, so, wie sie sich vorstellte, daß sich reiche Frauen mit ruinierten Beziehungen auch verhalten würden. Das ärgerte sie, und es störte ihre Freude über die neue Begegnung, doch gleichzeitig merkte sie, daß es ihr schwerfiel, nochmals zu telefonieren und ihrem Mann zu gestehen, du, ich hab dir vorhin nicht die Wahrheit gesagt, und deshalb versuchte sie es nun mit einem Brief.
Aber auch das war schwieriger, als sie gedacht hatte. Obwohl ihr Mann häufig abwesend war, hatte sie ihm in all den Jahren wenig geschrieben, sie hatten meistens miteinander telefoniert, und schon die geschriebene Anrede »Lieber Heinz!« kam ihr irgendwie unwahr vor. Sie hatte sie wieder verworfen und war mittlerweile beim dritten Versuch angelangt, der mit »Hallo Lieber,« begann, und in dem sie ihm schrieb, es tue ihr leid, daß sie nicht imstande gewesen sei, ihm zu sagen, was wirklich geschehen sei am Wochenende, aber sie hätte sich eine Freiheit genommen, von der sie gelegentlich gesprochen hätten und die er sich ja schon öfters genommen habe.
Heinz, ihr Mann, war Filmkameramann beim Fernsehen, ein fähiger und heiterer Mensch, mit dem alle gern zusammenarbeiteten, er kam viel herum, und ein paarmal hatte er nach der Rückkehr von einer längeren Reise bekümmert den Kopf in Doris’ Schoß gelegt und sie um Verzeihung gebeten, und das hatte sie immer so gerührt, daß sie ihm auch verzeihen konnte. Er hatte ihr sogar empfohlen, es eben auch einmal zu versuchen, die Begegnung mit einem fremden Menschen sei das einzige wirkliche Abenteuer, das er noch kenne, und wenn er Abenteuer sagte, dann war das für ihn, der schon in Wüsten, auf Vulkanen und in Bürgerkriegsgebieten gefilmt hatte, kein Papierwort. Zugleich liebte er sie, das wußte sie, und sie liebte ihn auch, aber es ging ihr nun auf, daß ohne weiteres noch jemand Platz hatte in dieser Liebe, er solle sich nicht beunruhigen, schrieb sie, »ich komme mir vor wie ein Haus mit einem Gästezimmer, und nun ist dieses Gästezimmer bewohnt«. Als sie diesen Satz nochmals durchlas, machte sie aus dem Punkt ein Komma und fügte bei, »vorübergehend«.
Kaum sah sie jedoch das Wort »vorübergehend« auf dem Papier, stutzte sie. Woher wußte sie, daß es vorübergehend war? Wußte sie denn, wie es weiterging? Ob es überhaupt weiterging? Seit sie am Sonntagabend wieder am Kursort eingetroffen waren, hatten sie nicht mehr allein miteinander gesprochen, es machte Doris auch überraschend wenig aus, sich wieder unter den andern zu bewegen gemeinsam mit dem Mann, der für eine Nacht ihr Geliebter geworden war, dieses Geheimnis bereitete ihr sogar ein gewisses Vergnügen. Nur noch einmal in dieser Woche ungestört mit ihm ein paar Worte zu wechseln, das wünschte sie sich, aber mehr nicht. Rolf war verheiratet, eigentlich glücklich, hatte er gesagt, und sie war es auch, ebenso eigentlich, und sie waren übereingekommen, den Moment zu genießen, ohne weitere Ansprüche aneinander zu stellen, ein Geschenk, hatte Doris gesagt, ein Geschenk, das wir uns machen, und an dem wir uns noch lange freuen können.
Wenn es aber ein einmaliges Geschenk war, wieso mußte sie sich dann überhaupt rechtfertigen? Wer klagte sie an? Sie war ziemlich sicher, daß ihr lieber Heinz, dem sie schrieb, ihr auch nicht alles erzählt hatte, einmal hatte er gesagt, er leide darunter, daß immer er es sei, der beichten müsse, und war er nicht manchmal etwas zu unbeschwert und zu lustig nach Hause gekommen — was also quälte sie sich da herum mit Formulierungen, die letztlich nichts daran änderten, daß sie einfach fremdgegangen war und daß sie Spaß daran gehabt hatte? Es gab keinen Grund zu irgendwelchen Schuldgefühlen. Doris atmete tief auf, dann zerriß sie auch den dritten Entwurf, zerknüllte die Papierfetzen und warf sie in den kleinen Abfallkorb neben dem Waschbecken. Dann lehnte sie sich an den Fensterrahmen und schaute zum Waldrand hinüber, den die Dämmerung nun schon etwas weiter weggerückt hatte.
Etwas ging trotzdem nicht ganz auf.
Die Lüge gefiel ihr nicht, diese blödsinnige Lüge, in die sie sich verstrickt hatte, dafür kam sie sich zu erwachsen vor, und das mußte sie wiedergutmachen, vielleicht eher sich selbst zuliebe als ihrem Mann gegenüber.
Sie ging also nochmals zum Tischchen, setzte sich und schrieb in einem Zug:
Lieber,
wenn ich nach Hause komme, möchte ich mit Dir sprechen.
Kuß,
Doris.
Sie riß das Papier vom Schreibblock, steckte es in einen Umschlag der Begegnungsstätte, schrieb die Adresse und klebte die Fünfzigermarke drauf, die sie sich schon aus dem Automaten gekurbelt hatte.
Als sie aufstand, klopfte es.
»Ja?« sagte Doris und blieb stehen.
»Hallo«, sagte Rolf und schloß leise die Türe hinter sich zu, »ich möchte dich nur schnell küssen, nur schnell.«
»Ach, wie schön«, sagte Doris, ließ den Brief auf das Bett fallen und schlang ihre Arme um seinen Hals.
3
Im Wartzimmer eines erfolgreichen Hautarztes saß ein gut angezogener Mann und fühlte sich sehr unbehaglich. Er war Gemeindepräsident eines zürcherischen Agglomerationsortes und hatte es nicht gern, wenn er warten mußte. Eigentlich war er Stadtpräsident, und zwar hauptamtlich, denn der Ort hatte etwa 18 000 Einwohner, trotzdem wollte sich der Sprachgebrauch einfach nicht ändern. Während man in Zug, das nicht viel mehr Einwohner zählte, oder in Burgdorf, wo es sogar noch weniger waren, seit jeher vom Stadtpräsidenten sprach, hielt sich in allen Orten, die rasch vom Dorf zur Stadt geworden waren, der alte Ausdruck Gemeindepräsident mit einer Hartnäckigkeit, die einen ärgern konnte. Darüber hatten sie sich kürzlich bei einer schweizerischen Stadtpräsidententagung unterhalten, und es war ihm kein wirklicher Trost gewesen, daß alle Agglomerationskollegen der deutschen Schweiz das sprachliche Schicksal mit ihm teilten. Die Welschen hatten es besser, dort war man einfach »le maire«, ob man es in Genf war oder in Estavayer-le-Lac.
Nun wartete er also, und er fragte sich mit zunehmendem Unmut, weshalb dieser Arzt, bei dem er um 11 Uhr bestellt war, nicht pünktlich sein konnte. Bei ihm gab es das nicht, wenn er 11 Uhr sagte, dann war auch 11 Uhr gemeint, das wußten die Beamten, Architekten, Ingenieure und Kommissionsmitglieder, mit denen er Termine abmachen mußte. Gut, bei einem Arzt konnte ein Notfall dazwischenkommen, aber dieser hier war ein Spezialist, und was konnte es bei einem Hautspezialisten schon für Notfälle geben. Das war ein weiterer Grund seines Unbehagens, daß er ausgerechnet einen Hautspezialisten aufsuchen mußte, denn die Hautärzte hatten ja alle noch einen Zusatz auf ihrer Tafel, Haut- und Geschlechtskrankheiten stand da, und der Gemeindepräsident war so schattenhaft wie möglich durch den Haupteingang hineingeglitten und hatte erst nachher gesehen, daß im selben Haus noch ein Zahnarzt und eine Holzimportfirma ihre Räumlichkeiten hatten, daß also für allfällige Beobachter von außen sein Ziel gar nicht zu identifizieren war, und im Lift war er allein gewesen.
Trotzdem hatte er keines der aufliegenden Hefte angerührt, wer konnte denn wissen, wie mancher Syphilitiker oder AIDS-Kranke sich vor dem Umblättern eines letztjährigen »Nebelspalters« schon die Finger abgeleckt hatte. Der Gemeindepräsident schaute auch mit schlecht verborgenem Mißtrauen auf die andern Wartenden, momentan zwei Männer und eine Frau, die ihm alle bedrückt, verklemmt und mit einem eklen Geheimnis behaftet schienen, wogegen er am liebsten ein Täfelchen hochgehalten hätte mit der Aufschrift »Komme nur wegen eines Ausschlags«.
Daß er überhaupt einen Arzt brauchte, war ihm lästig. Er war nie krank gewesen, seit er im Leben stand, und wenn er Anzeichen einer Erkältung oder einer Grippe spürte, schluckte er ein Aspirin und ging zur Arbeit, als ob nichts wäre, und das hatte sich bewährt. »Krankheit ist Faulheit«, pflegte er im Scherz zu sagen, und jedesmal, wenn seine Söhne krank gewesen waren, hatte es Streit mit der Frau gegeben, weil sie ihnen immer noch einen Tag Hausruhe zusätzlich geben wollte, während er der Ansicht war, sobald das Fieber weg sei, müsse man auch wieder zur Schule gehen. Nun waren sie beide erwachsen und studierten an der ETH, der ältere Elektroingenieur und der jüngere Geologie. Er selbst hatte nur das Technikum absolviert und hatte es sich allein verdienen müssen, aber seinen Söhnen bezahlte er das Studium und war stolz darauf, daß er sich das leisten konnte. Beide wohnten noch zu Hause, führten jedoch ein selbständiges Leben im obern Stock des Hauses und mußten sich bei der Mutter anmelden, wenn sie zum Mittag- oder Abendessen dasein wollten. Der ältere stand ein Jahr vor dem Abschluß, und im Militär war er Leutnant, der jüngere hatte noch nicht ganz die Hälfte des Studiums hinter sich. Ihm, dem Vater, schien zwar Geologie ein etwas abgelegenes Gebiet mit unsicheren Berufschancen, aber er sah, wie sich der jüngere ins Zeug legte und vertraute darauf, daß er seinen Weg schon machen würde.
Nach einem Blick auf die Armbanduhr, welche viertel nach 11 zeigte, dachte der Gemeindepräsident schon daran, sich zu erheben und die Praxis mit einer Bemerkung über Abmachungen und ihre Einhaltungen zu verlassen, als eine Schwester eintrat und mit etwas zu lauter Stimme: »Herr Niederer, bitte!« sagte. Herr Niederer, das war er, obwohl sich auf das Wort »Herr« die andern Männer ebenfalls zum Aufstehen anschickten. Beide waren schon vor ihm dagewesen, aber offenbar wußte man doch, was man ihm schuldig war. Ohne sich von den andern Wartenden zu verabschieden, folgte er der lauten Schwester, die ihn in das Sprechzimmer führte, oder in eines der Sprechzimmer, denn offenbar fand im Zimmer daneben noch die vorhergehende Konsultation statt, deren Wortlaut wohl zu verstehen gewesen wäre, wenn man das Ohr an die Tür gehalten hätte. »Nehmen Sie Platz, bitte, der Herr Doktor kommt gleich«, sagte die Schwester und ließ ihn dann allein.
Er setzte sich auf den Stuhl gegenüber vom Pult, den sie ihm zugewiesen hatte, und schaute sich um. Das Pult war das Vorwerk einer wahren Festung von Fachliteratur, aus welcher ihn von den dicksten Buchrücken die Titel »Das Melanom« und »Allergische Syndrome« wie Kriegserklärungen anstarrten und seinen Blick auf die Wand abdrängten, deren unteren Teil eine Glasvitrine mit rätselhaften medizinischen Gerätschaften besetzte, während der obere Teil fast ganz mit großen, schematischen Tafeln behängt war. Auf diesen Tafeln prangten die verschiedensten Ekzeme und Geschwüre mit einer derartigen Deutlichkeit, daß der Gemeindepräsident wieder aufstand und ans Fenster trat, schließlich war er gekommen, um einen Arzt zu sehen und nicht irgendwelche eitrigen Plakate. Er war auch sicher, daß sein Leiden nichts mit diesen Bildern zu tun hatte, es war einfach ein Ausschlag, der sich vorübergehend an Körperteilen verbreitete, welche der Kälte ausgesetzt waren. Gestern z. B., als er zum Montagsritt war, hatte er sein Halstuch vergessen, und kaum befand er sich an den schattigen Stellen des Waldrandes, bekam er einen richtigen Halskragen voll roter Pickel, die sich über den Nacken bis zu den Ohren hinauf zogen und ihn unerträglich juckten, so daß er vorzeitig wieder zum Stall zurückkehren mußte. Auch das kalte Duschen, mit dem er früher den Tag begonnen hatte, war ihm nicht mehr möglich, denn dabei überzog sich sein ganzer Körper mit einer Himbeerhaut, die ihm sogar Atemnot verursachte. Vor einiger Zeit hatte er im Rotary-Club mit dem Apotheker Odermatt darüber gesprochen, und der hatte ihm den Spezialisten empfohlen, den er nun, mit dem Rücken zum Behandlungsraum, erwartete.
»Herr Niederer, was führt Sie zu mir?«
Der Gemeindepräsident zuckte zusammen und drehte sich um. Er hatte auf die Tramhaltestelle hinuntergeschaut und das leise Öffnen der Tür überhört. Der Mann, der in einem offenen, weißen Kittel vor ihm stand, war etwas größer und etwas schlanker und etwas jünger als er und sprach schneidig und knapp, wie jemand, der gern zur Sache kam. Das gefiel dem Gemeindepräsidenten, und er reichte ihm die Hand, ohne jene Bemerkung über die Wartezeit, die er eigentlich bereit hatte, und sagte: »Ein Ausschlag.«
Dann erzählte er ihm im Stehen, welcher Art der Ausschlag war, wann er sich einstellte, und daß er wieder verschwand, wenn der betreffende Körperteil nicht mehr in der Kälte war, und daß ihm das ganze etwa Anfang des Jahres zum erstenmal aufgefallen sei, auch kenne er inzwischen die Wassertemperatur, die seine Haut gerade noch ertrage, die Grenze liege bei 21 Grad, fügte er abschließend hinzu, nicht ohne einen kleinen Stolz auf seine exakte Selbstbeobachtung, die dem Arzt sicher imponieren mußte.
Dieser schien aber unbeeindruckt, hieß ihn sich setzen, setzte sich seinerseits vor seine Büchermauer und stellte ihm dann Fragen allgemeiner Art über seine Gesundheit, frühere Krankheiten, die es bei ihm eben nicht gab, ähnliche Phänomene in der Verwandtschaft, die es seines Wissens ebenfalls nicht gab, er wollte sogar hören, wann er zuletzt in zahnärztlicher Behandlung gewesen war, und wollte dann auch seinen Oberkörper sehen, Niederer mußte sich auf den Schragen legen, welcher an der dritten Wand neben der Tür stand, und der Spezialist griff ihm wie ein Sklavenhändler nach seinen Muskeln, drückte ihm auch in den Achselhöhlen herum, was dem Präsidenten ein glucksendes Lachen entlockte, das ihm etwas unpassend vorkam, aber er war einfach kitzlig.
Als er sich dann wieder anziehen durfte und der Arzt zu seinem Pult ging, war die Bestandsaufnahme offensichtlich abgeschlossen, und der Gemeindepräsident war froh, daß keine Fragen über sein Intimleben gestellt worden waren, denn da gab es bei ihm gelegentliche Besuche, an die er natürlich beim Auftauchen des Ausschlages auch gedacht hatte, aber er hatte immer eine solche Vorsicht walten lassen, daß er wirklich nicht wußte, auf welche Weise er sich womit hätte infizieren können.
»Sie können sich nochmals setzen«, sagte der Arzt, der bereits saß, und als nun der Gemeindepräsident seine Krawatte wieder anzog und sah, wie der Arzt den Blick auf das Pult senkte und mit seinem Kugelschreiber spielte, begann sein Herz etwas stärker zu schlagen, denn jetzt mußte die Diagnose kommen, und plötzlich fühlte er sich wie ein Angeklagter, der im nächsten Moment erfährt, ob er verurteilt oder freigesprochen wird. »Bitte«, sagte der Arzt und wies auf den Stuhl vor dem Pult, und nun mußte er sich setzen, weil ihm halb schlecht war vor unguter Erwartung, und er nahm sich vor, wenn er einen positiven Bescheid bekäme, die gelegentlichen Besuche einzustellen, was er sowieso schon lange vorgehabt hatte, und sollte der Bescheid negativ sein, blieb ihm wohl nichts anderes übrig.
»Sie haben«, sagte der Spezialist und hüstelte noch etwas, während sein Opfer innerlich aufstöhnte vor Ungeduld, den Schlag zu empfangen, »Sie haben eine Kälteallergie.«
Der Präsident war baff. Deshalb war er ja gekommen, weil er eine Kälteallergie hatte, das hatte ihm der Apotheker schon gesagt. Bevor er sich zur Frage aufraffen konnte, ob das etwas Gravierendes sei, holte der Spezialist zu seiner Erklärung aus, sagte ihm, daß seine Haut die Kälte nicht ertrage, und daß es nun, bevor man zu Maßnahmen dagegen schreite, darum gehe, abzuklären, was die möglichen Ursachen einer solchen Allergie seien, denn da er nicht damit auf die Welt gekommen sei, müsse es ja eine bestimmte Ursache haben. Schlimm sei das Ganze an sich nicht, sagte er, und hier richtete sich der Gemeindepräsident aufatmend auf, es sei nur, wie er ja selbst erfahren habe, unangenehm, und was die Ursache betreffe, so könne sie z. B. in einem schwelenden Infektionsherd liegen, der ihm vielleicht bis jetzt gar nicht aufgefallen sei, und hier knickte der Präsident wieder etwas ein, weshalb es zunächst wichtig sei, daß man eine möglichst umfassende Abklärung seines Gesamtstatus vornehme, und dann erst könne er ihm die therapeutischen Maßnahmen darlegen. Er solle sich also von der Schwester baldmöglichst einen Labortermin geben lassen und morgens nüchtern hier antreten zur Blutentnahme, Hämoglobin- und Kryoglobulinwerte müßten erfaßt werden, er solle den Urin mitbringen, und auch sein Stuhl müsse analysiert werden, des weiteren würden sie Röntgenaufnahmen seiner Lungen und seiner Zähne machen, aber alles hier im Hause, worauf er dann wieder, auch diesen Termin solle er sich bereits geben lassen, in Kürze zu einer Konsultation kommen könne.
Jetzt kam der Gemeindepräsident erstmals wieder dazu, eine Frage zu stellen, nämlich die, ob man denn etwas dagegen tun könne. Doch, das könne man, sagte der Arzt, aber es habe keinen Wert, daß er ihm zuviel davon sage, bevor er wisse, ob eine Infektion als Ursache vorliege oder nicht. Im Falle einer Infektion müsse man natürlich medikamentös vorgehen, aber auch da käme es sehr darauf an, ob es eine bakterielle Infektion sei oder ein Virus.
»Und was ist die Ursache, wenn es keine Infektion ist?« fragte der Präsident, der jetzt wieder etwas Boden unter den Füßen spürte.
Das sei dann, sagte der Arzt und hob dazu die Schultern, das sei dann jeweils, wie eben bei vielen allergischen Erscheinungen, sehr schwer zu sagen, aber machen könne man auch da etwas, wenngleich er, das müsse er ihm offen sagen, ein wirkliches Versprechen auf Heilung nicht geben könne, höchstens eine Art Wahrscheinlichkeitsprognose.
»Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?« fragte der Gemeindepräsident, in der Hoffnung, er komme in das ihm vertrautere Gebiet von Ziffern und Prozenten, und siehe da, der Spezialist enttäuschte ihn nicht.
»Was soll ich Ihnen sagen, Herr Niederer, damit Sie mich nicht festnageln?« sagte er lächelnd. »Fifty-fifty.«
Daran dachte der Präsident, als er im Lift ins Parterre fuhr und in seiner Mappe die Röhrchen und Gläschen für Urin und Stuhlgang trug, mit denen er übermorgen hier wieder erscheinen sollte, um am nächsten Montag auf Grund der Diagramme seiner Säfte und Ausscheidungen und der Bilder seines Innern zu erfahren, ob er einen Infektionsherd mit sich herumschleppte, oder ob man schlicht nicht sagen konnte, woher das kam, daß er die Kälte nicht mehr ertrug, und auf welche Weise man das seinem Körper austreiben konnte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Er fragte sich auch, ob diese ganzen Untersuchungen nicht einfach dazu dienten, die Einrichtungen dieses Erfolgsarztes zu amortisieren, welcher mit wehendem Mantel von einem Sprechzimmer ins andere eilte, um Prognosen auszuteilen, welche eigentlich nichtssagend waren. Trotzdem hatte er sich entschieden, dieses Testprogramm über sich ergehen zu lassen, er war 51, und schaden konnte es nichts, sich einmal gründlich untersuchen zu lassen, aber zugleich war er entschlossen, als er seine Mappe unter den Arm klemmte und mit erhobenem Kinn den Weg zur Tiefgarage einschlug, sich keinesfalls vom Präsidenten zum Patienten degradieren zu lassen, gleichgültig, ob etwas in ihm schwelte oder nicht.
4
Wenn Roland Steinmann mit dem Velo vom Fernsehen zu sich nach Hause fuhr, streifte er mit den Augen einen begradigten Bach, eine Kläranlage, eine Barackensiedlung für Jugoslawen und Türken, ein Baufirmengelände mit Zementsilo und Förderband, eine Holzbrücke, einen begradigten Fluß (so verschmutzt, daß man ein Fotonegativ darin entwickeln konnte, wie kürzlich in einer Aktualitätensendung gezeigt), das Trümmerdorf des Zivilschutzzentrums, das blasse Räuchlein des Kehrichtverbrennungskamins, die Wendeschlaufe einer Buslinie, eine eiserne Eisenbahnbrücke, ordentliche Schrebergärten, Volieren von Kleintierhaltern mit Fasanen und Mandarinenten, eine Bretterwand mit dem dauerhaften Menetekel »5 x Tschernobyl in der Schweiz«, das Fernheizwerk, überlebensgroß, Autobahnlärmschutzwände, die in der Landschaft standen, als hätte jemand gefährliches Gelände schraffiert, im Unterbau der Autobahn ein Restaurant mit Kaffeetrinkenden hinter den großen Scheiben, in der Autobahnunterführung eine Drechslerei und eine Fahrzeugwerkstatt, aus der manchmal ein vorwurfsvoller Blick fiel, weil Radfahren in der Passage verboten war, eine Einbahnrampe, die er ebenfalls widerrechtlich hinunterfuhr, Industriegebäude für Beschläge und Autos sowie Firmen, die irgendwelche Abkürzungen verwalteten, eine heruntergekommene Schokoladenfabrik, meist von einem verheißungsvollen Duft umgeben, direkt an der Durchgangsstraße ein älteres Haus mit dem Namen »Zum stillen Heim«, den Neontitel »Boutique Manuela« über einer verblaßten Aufschrift »Landwirtschaftl. Genossenschaft«, Wohnblöcke, leere Klettergerüste und knappe Sandhaufen, Abfallcontainer, durch Holzpalisaden kaschiert, gekreuzte Gartenzäune, Grillungetüme und Holzbacköfen auf sauberen Rasenflächen, und endlich, groß und gelb vor dem Abendhimmel, das Hochhaus, in dem er wohnte.
Er rollte die Rampe hinunter zur Tiefgarage, griff in seine Jackentasche und drückte auf die Taste des Fernbedienungsgerätchens, worauf sich das Garagentor mit einem leisen Jammern hob und ihn einließ, um sich gleich darauf mit einem Seufzer wieder zu schließen. Er fuhr zu seinem Parkabteil, stieg erst dort vom Velo und schob es neben das Rennrad in den Ständer, den er sich eigens für seine beiden Fahrräder gekauft hatte. Da die Wohnung nur mit Parkplatz vermietet wurde, hatte er beschlossen, die Parkfläche auf diese Art zu benutzen.
Das Auto hatte er bei der Scheidung seiner Frau gegeben und sich seither keines mehr gekauft. Zuerst war er einfach zu träg gewesen dazu, aber nach einer Weile hatte er gemerkt, daß es ihm gar nicht fehlte, ja daß er sich überraschend wohl fühlte dabei, und so war er Nichtautomobilist geworden, was in einer Zeit, da auf jeden zweiten Einwohner ein Auto kam, ein auffälliges Merkmal war, auffälliger als beispielsweise das Nichtrauchen. Warum man nicht rauchte, verstanden alle, warum man nicht Auto fuhr, verstand eigentlich niemand, im Gegenteil, die Leute fühlten sich fast angegriffen dadurch. Manchmal gab es eine Feindseligkeit ihm gegenüber, als würde er eine Pflicht verweigern, jedenfalls hatte es wegen seiner zwei Fahrräder auf der Parkfläche sogar eine Einsprache beim Hauswart gegeben, die Benützer der Nachbarflächen fürchteten angeblich, ein Fahrrad könne umstürzen und ihr Auto dabei zerkratzen, etwas, das noch nie geschehen war und auch nie geschehen würde, die einzigen Kratzer, die es gab, entstanden durch das Öffnen der Autotüren, welche in den viel zu engen Markierungen leicht an das nächste Auto anstießen. Die Leute stiegen hier unten nicht einfach aus, sondern sie wanden sich aus ihren Sitzen. Da fühlte er sich angenehm frei und unbelastet, statt eines Autos hatte er sich ein schönes Rennvelo gekauft, eins mit achtzehn Gängen, mit dem er gern zu seinen Waldläufen fuhr, und zur Arbeit begab er sich mit seinem guten alten Fünfgänger, von dessen Gepäckträger er nun seine Mappe nahm und zur Tür ging, die ins Treppenhaus führte.
Er wohnte in der dritten Etage des zehnstöckigen Hochhauses und hatte sich angewöhnt, immer zu Fuß zu gehen. Treppensteigen, hatte ein Zehnkämpfer in einem Interview einmal gesagt, sei eines der besten Fitneßtrainings, es belebe nicht nur die Beinmuskulatur, sondern aktiviere die Atmung und durchblute den ganzen Körper, und er könne dies eigentlich allen Menschen empfehlen, nicht bloß den Sportlern, sondern vor allem auch denjenigen, die einen sitzenden Beruf ausübten. Dieses Interview war über seine Aufzeichnungsmaschine gelaufen, vor ein paar Jahren, es war für ihn die letzte Arbeit eines ganzen Tages gewesen, und das Wort »sitzender Beruf« aus dem Munde dieses beweglichen, kerngesunden Mannes hatte ihn wie ein kalter Wasserstrahl getroffen. Es war ihm sofort klar, daß er gemeint war damit, er übte einen sitzenden Beruf aus, und wenn er nicht wollte, daß sein Fett allmählich über die Stuhllehnen hinunterhing, mußte er etwas tun. Von diesem Tag an benutzte er den Lift nur noch, wenn er halbtot war oder Lasten zu schleppen hatte, es war dieselbe Zeit, in der er begann, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, kurz nach der Scheidung. Auch das fällt auf, am Arbeitsplatz wie am Wohnort, wenn einer nicht Lift fährt, und auch das ist eine kleine Herausforderung. Wie oft hielt jemand, der schon im Lift war und ihn kommen sah, noch die Lifttür offen oder rückte eine Tasche zur Seite, die am Boden stand, um ihm zu zeigen, daß er gut noch Platz hatte, und dann brauchte es etwas Überwindung, abzulehnen und zu rufen, man gehe zu Fuß, und als letztes das Unverständnis auf den Gesichtern der Liftfahrer zu sehen, bevor sich die Tür zischend schloß und man durch das Milchglasfenster ihre Füße nach oben entschweben sah.
Er kam in den Eingangsraum und ging zum Briefkasten. Die Tageszeitung war da, die Konsumentenschutzzeitschrift »prüf mit« und eine Ansichtskarte seines Arbeitskollegen Gregy, der mit seiner Freundin eine halbjährige Weltreise machte. Die Karte kam aus Hawaii, und Steinmann las sie noch im Stehen, sie seien jetzt auf der andern Seite der Erde angekommen, es sei gewaltig, hier scheine immer die Sonne, und herzliche Grüße, abgebildet war ein Vulkan, der gerade eine Ladung glühender Lava ausspie.
»Haben Sie Post?« fragte eine Stimme sehr nahe und schnell.
Steinmann drehte sich um. »Monika, grüß dich, wie gehts?«
»Gut, und Ihnen?« fragte Monika sofort.
»Auch, danke«, sagte Steinmann, »ich habe gerade eine Karte aus Hawaii bekommen. Weißt du, wo das ist?«
Monika überlegte einen Moment. »Hawaii? Eine Insel, glaub ich.«
»Ja«, sagte Steinmann, »westlich von Amerika. Dort scheint immer die Sonne. Schreibt mein Kollege.«
»Oh«, sagte Monika.
»Und Vulkane gibt es auch, schau mal.« Er hielt dem Mädchen die Karte hin. Monika nahm sie in die Hand und schaute sie an.
»Lässig«, sagte sie und gab sie ihm zurück.
»Gefällts dir eigentlich in der Lehre?« fragte Steinmann.
»Mhm«, sagte Monika.
»Hast du viel zu tun?«
»Sie müssen halt einmal in den Laden kommen«, sagte Monika.
»Ja«, sagte Steinmann, »ich kaufe leider wenig Blumen.«
»Warum?« fragte Monika. »Blumen sind schön. Kaufen Sie bei mir einen Strauß und zeigen Sie ihn im Fernsehen.«
Steinmann lachte. »In der Tagesschau?«
»Ja«, sagte Monika, »stellen Sie ihn auf den Tisch, wo die immer dran sitzen. Ade, Herr Steinmann!«
Da ging sie, mit dem Rollbrett unter dem Arm, durch die gläserne Eingangstür auf die Straße. Sie war sechzehn oder siebzehn und war etwa gleich groß wie Steinmann mit seinem Meter sechsundsiebzig, eine dünne Person in Jeans und mit kurzgeschnittenen Haaren, knabenhaft in Gestalt und Benehmen, er sah sonst keine Mädchen, die Rollbrett fuhren, sie hatte mit viel Glück eine Stelle als Floristin im Blumengeschäft des großen Einkaufszentrums bekommen, eine Lehrstelle, vielleicht bloß eine Anlehre, aber sie mußte froh sein, überhaupt untergekommen zu sein, er vermutete bei ihr irgendeine Schädigung, eine zerebrale Störung vielleicht, die Eltern sprachen nicht darüber, waren auch nicht gebildet und schienen sich keine großen Gedanken zu machen. Sie wohnten im selben Stock ihm gegenüber, und bei Monika hatte er ein großes Prestige, weil er beim Fernsehen arbeitete. Sie stellte sich vor, daß er jeden Tag mit Stars zu tun hätte. Einmal hatte er der Oberstufenklasse, in der sie bis diesen Frühling zur Schule ging, eine Besichtigung des Fernsehens vermittelt, und damals hatte sie auch gesehen, daß er in den Aufzeichnungsräumen arbeitete, aber das änderte wenig an ihrer Vorstellung, daß er in den höchsten Kreisen verkehrte und ohne weiteres einen Blumenstrauß auf den Tagesschautisch stellen könnte. Sie zeigte ihm gegenüber eine Anhänglichkeit, von der er gar nicht wußte, womit er sich die verdient hatte. Ein paarmal hatte er mit ihr Federball gespielt, wenn sie an einem Samstagnachmittag allein mit ihren Rackets unter dem Arm auf dem Vorplätzchen gestanden hatte, und er wechselte immer ein paar Worte mit ihr, wenn sie sich im Treppenhaus begegneten.
Im Hinaufgehen dachte Steinmann, daß sie eigentlich einer der wenigen Menschen in diesem Haus und im Quartier war, die er wirklich mochte. Er war nach seiner Scheidung hierher gezogen und hatte nicht viele Kontakte, erwartete auch gar nicht, Kontakte zu haben, betrachtete alles als vorläufig und war einfach froh, daß er günstig untergekommen war, der Gedanke aber, hier zum Beispiel verwurzelt zu sein, wovon in der Begrüßungsbroschüre der Gemeinde die Rede war, erschien ihm absurd und unvorstellbar, er war genau jener Neuzuzüger, an den sich die Broschüre richtete, und er wollte ein Neuzuzüger bleiben. Die zahlreichen Vereine freuten sich, stand da weiter, und er wußte noch gut, wie er gedacht hatte, auf mich freuen sie sich vergebens. Sport und Bewegung ja, aber nicht im Turnverein, Bergsteigen gern, aber nicht im Alpenklub.
Mit der Zeit allerdings hatte er festgestellt, daß er es schätzte, wenn er jemandem zunicken konnte, den er kannte, und wenn auch zurückgenickt wurde, wenn man ihn also ebenfalls kannte, und zwar ganz gleich, wie oberflächlich und belanglos. Er spürte auch ein kleines Wohlbefinden, wenn man ihn in der Bäckerei mit seinem Namen ansprach, seit er einmal eine Torte bestellt hatte. Wäre man eine Familie mit Kindern, dann wäre alles ganz anders, das war ihm bald klargeworden. Im Sommer gab es hier in einem kleinen Wäldchen beim Sportplatz zweimal im Monat einen Familientreff, man versammelte sich abends um eine Feuerstelle, wo man Würste oder etwas Besseres briet, die Kinder, die sich kannten, spielten miteinander, die Erwachsenen saßen an den fest installierten Picknicktischen oder auf den Steinen ums Feuer herum, tranken etwas und unterhielten sich, alles ganz anspruchslos, und doch ging Steinmann ab und zu hin, wenn es einer seiner freien Abende war. Monika hatte ihn dahin gebracht mit ihrer Hartnäckigkeit. Einmal hatte sie ihn gefragt, ob er auch zum Wäldlifest komme, und als er nicht wollte, sagte sie, Sie müssen aber unbedingt kommen. Er war dann erstaunt über die ungezwungene Art, mit welcher er dort aufgenommen wurde, lernte in diesem Kreis ein paar Menschen kennen, die ihm gefielen, etwa Stebler, den Bastler, der aus seiner Garage eine Werkstatt gemacht hatte, die unter dem Namen »Dubeligarage« bekannt war, mit seiner Frau Helen und den drei Buben Fabian, Christian und Sämi, und viele von den andern sah er zwar nicht ungern, aber wenn sie gemütlicher wurden an einem dieser Sommerabende und vielleicht sogar zu singen begannen, zog er es vor, zu gehen, in sein Hochhaus, wo er bestimmt die Hälfte der Bewohner nicht kannte, und das ihm manchmal vorkam wie ein riesiger Korallenbau auf dem Meeresgrund, mit Höhlen, Nischen und Nestern für die verschiedensten Lebewesen, die geschäftig ein- und ausschwammen, und vor einem dieser Höhleneingänge stand er jetzt, und das Schildchen unter der Türklingel bestätigte ihm, daß er hier wohnte, er, Roland Steinmann, der Einsiedlerkrebs.
Als er mit dem Schlüssel die Tür öffnen wollte, widerfuhr ihm etwas Eigenartiges. Die Türe schnellte vor seinen Augen um eine Fingerbreite nach links und wurde sofort wieder zurückgeschoben. Zugleich war ihm, als hätte er einen Schlag gespürt, oder gehört, der gegen das Haus ausgeführt wurde. Er erschrak, und einen Moment lang wurde ihm so schwindlig, daß er sich an der Falle festhielt und mit dem Kopf gegen die Tür lehnen mußte. Was hatte sich da bewegt? Das Haus oder sein Kopf? War sein Kreislauf am Versagen? Dann aber atmete er tief ein, führte den Schlüssel vorsichtig ins Schloß, das wieder an seinem verläßlichen Ort war, öffnete die Tür und trat ein.
5
»Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen«, murmelten Vater, Mutter und Sohn mit gefalteten Händen und gesenkten Augen, dann sagten sie fast gleichzeitig »E Guete mitenand!« und die Mutter begann die Suppe aus der Porzellanschüssel in die Porzellanteller zu schöpfen.
Dem Gemeindepräsidenten war das Tischgebet zuwider, aber seine Frau bestand darauf, und da er einer christlichen Partei angehörte, schickte er sich darein, und wenn Besuch da war und seine Frau eigentlich auf das Tischgebet verzichtet hätte, bestand er seinerseits darauf, denn soviel wenigstens wollte er von dieser Sitte haben, daß man wußte, sie wurde in seinem Hause hochgehalten, in einer Zeit, in der alle herkömmlichen Werte am Zerbröckeln waren, und er weidete sich auch jedesmal an der Verlegenheit der Gäste, wenn man sie etwa beim Griff zum Brot mit dem Gebet überrumpelte. Der Sohn wußte einfach, daß er, wenn er mitessen wollte, auch mitbeten mußte, und hatte seinen Widerstand ebenfalls aufgegeben, ja, mit dem Älterwerden bekam das kleine Ritual für ihn bereits etwas Nostalgisches und erinnerte ihn an die Kindheit, von der er allerdings noch gar nicht richtig losgekommen war, solange er immer noch bei den Eltern lebte. Er schaute sich schon länger nach einer eigenen Wohnmöglichkeit um, ohne das den Eltern zu sagen, denn irgend etwas stimmte nicht an diesem Zustand, daß er da oben wohnte, in den Räumen seiner Kinderzeit, und daran war, jemand anderer zu werden als seine Eltern. Nur, es war unglaublich schwierig, in Zürich etwas zu finden, das zugleich geeignet und bezahlbar war, er dachte manchmal, der wirkliche geologische Unterbau dieser Stadt sei weder Kalk noch Mergel noch Molasse, sondern Geld.
Seine Mutter, die Frau des Gemeindepräsidenten, hatte ein schönes, etwas scharf geschnittenes Gesicht und immer noch schwarze Haare ohne einen einzigen Silberfaden, die sie meistens zu einem Chignon zusammengebunden hatte. Dies gab ihr eine gewisse Strenge, an der auch der weiße Pullover und die Hosen, die sie heute trug, nichts änderten, und sie übte diese Strenge gerne aus, zum Beispiel eben in der Durchsetzung des Tischgebets, welches für sie, ursprünglich zur Stütze des Religionsunterrichts der Buben eingeführt, zum täglichen Triumph über ihren Mann geworden war und mit Andacht wenig zu tun hatte. Sie hatte auf vieles verzichtet im Leben, damit sich ihr Mann und ihre Söhne entfalten konnten, und sie wollte sich mindestens einmal am Tag mit einem unüberhörbaren Anspruch bemerkbar machen, und wenn es nur eine Anrufung Gottes war.
»Was ist das?« herrschte sie ihren Hund an, einen braunweißen Collie, der sie mit der Nasenspitze in die Seite stieß, und zwar betonte sie, wie das im Gespräch mit Hunden üblich ist, das erste Wort des Satzes so stark, daß man das ganze für ein einziges Wortgebilde hätte halten können, Wasistas?
»Arco, gib Ruhe!« schnauzte der Gemeindepräsident, auch das eine erprobte Worteinheit, aber der Hund stupste unbeirrt weiter und wimmerte dazu, so daß sich die Frau schließlich vom Tisch erhob und die Türe zum Korridor öffnete, durch die er sogleich hinausschlüpfte.
»Ich weiß nicht, was er hat«, sagte sie, »seit mindestens zwei Stunden weiß er nicht, was er will.«
Dann setzte sie sich und begann ebenfalls zu essen. Es war eine Selleriecremesuppe, in welche sie einige frische Brennesselblätter fein gehackt hatte; sie las gerade ein Buch eines Fernsehkochs über die Verwendung von Kräutern und war gespannt auf die Reaktion der zwei Männer.
»Bist du vorwärtsgekommen heute?« fragte der Gemeindepräsident seinen suppelöffelnden Sohn.
»Nicht schlecht«, sagte der, »wenn es so weitergeht, bin ich in einer Woche fertig.«
Er hatte den ganzen Tag zu Hause hinter einer Seminararbeit verbracht, die er eigentlich in den Semesterferien hatte abschließen wollen.
»Und kommt etwas Rechtes heraus dabei?« fragte der Vater.
»Ich hoffs«, sagte der Sohn. »Allerdings nicht das, was sich der Professor gewünscht hat.«
Der Vater runzelte die Stirn. »Warum nicht?«
Im Korridor bellte der Hund.
»Weil es einfach nicht so ist, wie er vermutet hat.«
»Und du bist sicher, daß du recht hast?« fragte der Vater. Aus der Politik wußte er, daß es günstiger wäre, sein Sohn würde das herausfinden, was der Professor vermutet hatte.
»Ja«, sagte der Sohn, »ziemlich.«
»Hoffentlich nimmt er die Arbeit überhaupt an«, sagte der Vater.
»Muß er«, sagte der Sohn, »sonst wäre er kein Wissenschafter.«
Das Bellen des Hundes war jetzt in ein Heulen übergegangen, welches er beharrlich direkt vor der Stubentür ausstieß.
»Michele, laß ihn herein«, sagte der Gemeindepräsident, worauf seine Frau ungehalten aufstand und die Tür mit einem zweiten Wasistas wieder öffnete. Der Hund schlich mit gesenktem Kopf an der Bücherwand entlang zur Polstergruppe und kroch unter den Glastisch.
»Ich weiß wirklich nicht, was er hat«, sagte Michele, während ihr Mann zu seinem Sohn sagte: »Es kommt nicht nur auf die Wissenschaft an«, und diesen Ausspruch mit einem Blick betonte, den er von seinem über den Löffel gebeugten Kopf absandte, ein Schuß von unten sozusagen.
»In der Politik vielleicht, aber in der Wissenschaft schon«, entgegnete sein Sohn und schaute spöttisch über die Ränder seiner Nickelbrille zurück.
»Wissenschaft ist auch Politik«, sagte der Vater und hoffte, mit dieser Pauschale die Auseinandersetzungen zu Ende zu bringen.
»Was ist jetzt das wieder für ein Gemeinplatz?« fragte der Sohn und schüttelte den Kopf.
»Das ist eine Lebenserfahrung«, sagte der Vater, »warte nur, bis du älter bist.«
»Will noch jemand Suppe?« fragte die Mutter, die seit Jahren darauf spezialisiert war, drohende Konflikte mit Nahrungsangeboten zu ersticken.
»Danke, erst wenn ich älter bin«, sagte der Sohn mit einem Blick auf den Vater.
»Ist sie etwa nicht gut?« fragte die Mutter rasch.
»Ach wo, exzellent wie immer«, sagte der Sohn.
»Wie immer?«
»Sicher, ich hab nur keinen Riesenhunger.« Er aß dauernd Schokoperlen, während er arbeitete.
»Aber ich«, sagte der Gemeindepräsident, indem er mit einem Brotstück dem Tellerboden nachfuhr, »schließlich hab ich heute morgen gefastet.«
»Wie wars überhaupt, bist du nicht umgekippt bei der Blutabzapferei?« fragte der Sohn.
»Aber Thomas«, warf die Mutter ein.
»Erzähl ich später«, sagte der Gemeindepräsident, der nicht viel Medizinisches zum Kulinarischen ertrug.
Der Sohn kicherte, der Hund jaulte unter dem Glastisch hervor, der Gemeindepräsident hob seinen Teller, seine Frau füllte den Schöpflöffel und schüttete ihn mit einem Ruck ihrem Mann über die Hände, während die Schüssel vom Rechaud kippte und die ganze Selleriecremesuppe samt den unerkannt gebliebenen Brennesselblättern aufs Tischtuch floß und auch über dasselbe hinabtropfte, dem Sohn auf die Jeans.
Einen Moment lang saßen die drei entgeistert da, und auch der Hund war verstummt.
»Michele, was ist das?« fragte der Gemeindepräsident, aufgebracht und fassungslos.
»Entschuldigung, Manfred ... es war ... ich weiß nicht ... wie ein Schlag.«
Der Sohn lachte. »Ein Erdbeben! Endlich erlebe ich einmal ein Erdbeben!« Er war begeistert.
»Du meinst...?« fragte der Gemeindepräsident und stand auf.
»Was denn sonst?« sagte der Sohn und zeigte auf die Deckenlampe, die noch leicht hin- und herschwang.
»Kommt, helft mir«, sagte die Frau, »ich muß das Tischtuch auswechseln.«
Alle begannen nun, das Geschirr in die Durchreiche zu stellen, damit man das Tischtuch wegnehmen konnte. Plötzlich blieb der Gemeindepräsident mit der Weinflasche und dem Mineralwasser in der Hand stehen und fragte seinen Sohn: »Glaubst du, das wars? Oder kommt noch etwas nach?«
»Das kann man nicht wissen«, sagte der Sohn, knüllte das suppendurchtränkte Tischtuch zusammen und trug es in die Küche, indem er auf dem Parkettboden eine Tropfspur hinterließ.
»Halt!« rief die Mutter, »man hätte etwas darunterhalten sollen, eine Zeitung oder ein Wachstuch!«
»Zu spät«, sagte Thomas, »wohin damit?«
»Komm gib«, sagte die Mutter, die sich eine Schürze angezogen hatte, und Thomas übergab ihr erleichtert die feuchte Bescherung. Für Haushaltkatastrophen jeglicher Art fühlte er sich absolut nicht zuständig, es war ihm ein Rätsel, wie man zum Beispiel einen Spannteppich mit Hundekotze überhaupt wieder saubermachen konnte.
»Thomas!« rief der Vater aus der Stube.
Gern und schnell entfernte er sich aus der Küche.
Der Vater stand neben dem Telefon und hatte bereits den Hörer in der Hand. »Denkst du, daß der Stoß stark genug war für Schäden — Leitungsbrüche und so?«
»Das hängt von den Leitungen ab«, sagte Thomas und lachte. Sein Vater ärgerte sich. »Ich frag dich das nicht zum Scherz. Ich als Gemeindepräsident frage dich als Geologen, das erstemal, daß dein Studium zu etwas nützlich wäre — hallo? Herr von Arx? Niederer am Apparat, scheint ein Erdbeben gewesen zu sein, haben Sie Schadenmeldungen? Nicht? ... Ausgeleerter Kaffee, so so, ha ha, bei uns wars die Suppe. Also gut, falls es etwas gibt, ich bin zu Hause, bitte informieren Sie mich. Danke. Schönen Abend.«
Er legte auf. »Also, das war der Feuerwehrkommandant. Scheint nichts Ernstes gewesen zu sein.«
»Kann ich mal?« fragte Thomas und zeigte auf das Telefon.
»Wohin?«
»Ins Institut — vielleicht wissen sie dort mehr.«
»Gut, aber nicht zu lang, ich möchte erreichbar bleiben.«
Thomas wählte die Nummer, die er auswendig kannte.
»Hallo — Sandra? Was, du bist noch da? Thomas hier, sag mal, hast du das Beben gespürt vorhin? Nicht? Wirklich? Dann vergiß mal deinen zirkumpazifischen Gürtel und geh zum Seismographen. Ich? Zu Hause. Uns hats die Suppe umgeschmissen. Also. Ich warte.«
Der Vater stand daneben und schaute ihn fragend an.
»Das gibts ja nicht«, sagte Thomas, »die hat nichts bemerkt. In Zürich wird man richtig unempfindlich gegen Erschütterungen durch die S-Bahn-Bauerei - ein Dauererdbeben. So, komm schon«, sagte er und trommelte mit den Fingern auf das Telefontischchen. Dann fügte er hinzu: »Nicht daß der Alarmservice zusammenbricht.«
Sein Vater überhörte die Ironie und blieb neben dem Telefon stehen, aber es dauerte zwei, drei Minuten, bis Thomas’ Kollegin wieder am Apparat war.
Nun folgte offenbar eine längere Erklärung, welche Thomas nicht ganz zu verstehen schien. »Und vom Erdbebendienst ist niemand da? Typisch. Ein Erdbeben ist selber schuld, wenn es nach Büroschluß kommt. Dann warten wir halt ab, was der Bollag sagt, morgen. Tschau, Sandra, merci.« Er legte den Hörer auf.
»Und?« fragte der Vater.
»Da war ein Ausschlag auf dem Zürcher Seismographen, aber sie sagt, sie sehe auf dem Sammelseismographen, wo alle Daten aus der ganzen Schweiz zusammenlaufen, keine weiteren Ausschläge, außer einem Hauch Innerschweiz, dann wäre das so etwas wie ein Ortsbeben in der Gegend von Zürich, hausgemacht sozusagen, aber das ist wohl eher selten, deshalb ist sie nicht ganz sicher, ob die Geräte stimmen oder ob sie die Ausschläge richtig interpretiert. Wir fragen dann morgen den Professor.«
»Und vom Erdbebendienst ist niemand da? Ich denke, das ist eine Rund-um-die-Uhr-Stelle«, sagte der Vater, verwundert und verärgert zugleich.
»Da denkst du edel, hilfreich und gut«, sagte Thomas, »aber weit an der Realität vorbei. Der Erdbebendienst arbeitet von 8—12 und von 2—6, dafür arbeiten die Seismographen durchgehend, und wenn heute niemand von denen vom Stuhl gefallen ist deswegen, schauen sie sich die Streifen
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe Juli 2008, btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Copyright © 1989/2008 by Luchterhand Literaturverlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München unter Verwendung eines Motivs von Hans-Peter Zimmer, Landschaftsstudie © VG Bild-Kunst, Bonn 1980
KS . Herstellung: BB
eISBN 978-3-641-08252-9
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe