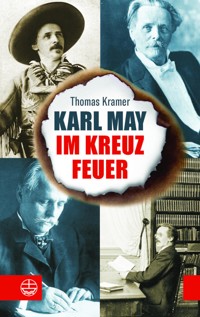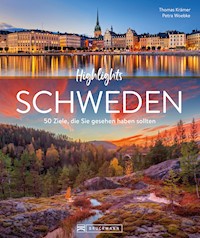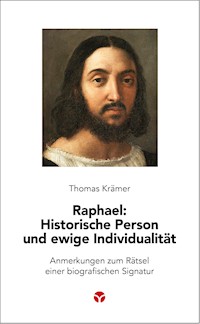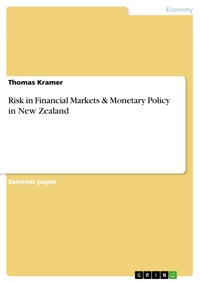Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jan Thorbecke Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Autoren wie Karl May, Thomas Mann oder T. E. Lawrence, der legendäre »Lawrence von Arabien«, Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Regisseure wie Ridley Scott oder Pop-Gruppen wie Boney M. haben alle etwas gemeinsam - sie beeinflussten und beeinflussen unser Orient-Bild mehr, als dies wissenschaftliche Berichte oder Dokumentationen je könnten. Thomas Kramer entwirft ein Panorama medialer Wahrnehmung des Nahen Ostens in der abendländischen Kultur zwischen Antike und Gegenwart. Er beschränkt sich dabei nicht auf den akademischen Bereich und die Produkte des "literarischen Höhenkamms", sondern erweitert den Blickwinkel um das breite Spektrum der Populärkultur. Der Leser wird überrascht sein, wie sehr Unterhaltungsmedien wie Abenteuerromane, Filme oder Computerspiele landläufige Orientbilder auch heute noch im Zeitalter der aktuellen Berichterstattung prägen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Anhang
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Thomas Kramer
Der Orient-Komplex
Das Nahost-Bild in Geschichte und Gegenwart
Jan Thorbecke Verlag
INHALT
Vorwort
Orientbilder der Antike – Perser, Griechen und der Beginn der Angst …
Rassismus in der Antike?
Die Barbaren kommen!
Aischylos’ »Die Perser« und Herodots »Perserkriege«
Alexander: Hybris und die Angst vor der Überfremdung
Gute Perser, schlechte Perser
Arische Ahnen – das Perserbild des Nationalsozialismus und seine Folgen
Das frühe Mittelalter: Islam ante portas?
Karl Martell – Retter des Abendlandes?
Markgraf Roland allein im Wald: die ewige Lust am Heldentod
Die Mauren in Spanien
El Cid vs. »Neger« Jussuf – wie Charlton Heston Spanien einte
Kreuzzüge und populäre Medien
Von Seldschük bis Osman – die Türken betreten die Bühne
Die Medienmaschine läuft an …
»Nathan der Weise« im »Königreich der Himmel« – Lessing und Ridley Scott
Gustav Freytags »Die Ahnen« – der »Nathan« desWilhelminismus
Muslime und Deutschritter – der Beginn einer großen Freundschaft
Hammer-Purgstall, die Assassinen und die Angst vor der Revolution
Waltraud Lewins »Federico«: Stauferkaiser im Nahostkonflikt
Türkenängste
1453: Der Fall von Byzanz und ein Computerspiel
Renegaten und Sklavenhändler in Exilroman und Nazipropaganda
Zar und Zimmermann: PeterI.
Prinz Eugen, der edle Ritter …
»Tausendundeine Nacht« und die kulturellen Folgen
Galland »Jones« und die Quelle des Abenteuers
Moderne Medien: Tausendundeine Idee
Harun Al-Raschid und Karl May – Orientalische Märchen prägen den Westen
Bagdads Kleinkriminelle, Aladins Wunderlampe und Meister Proper
Die deutsche Oper und ihr Orient
Sächsische und preußische Türken
Suleyman und Roxelane – eine Lovestory für Buch und Bühne
»Solimano«, »Die Entführung aus dem Serail« und die Haremslüge
Die orientalische Frage und die antisemitischen Antworten des19.Jahrhunderts
Wilhelm Hauff – ein harmloser Märchenonkel?
Karl Marx, Friedrich Engels und der Islam
Aidas Weg durchs Sternentor: Professorenromane und ägyptische »Herrenmenschen«
Die Lüge von der jüdischen Weltverschwörung: Schlüssel zum Orientverständnis?
Sir John Retcliffe – der vergessene Bestsellerautor
Die Protokolle der Weisen von Zion
Helmuth von Moltke und Monte Christo – zwei Grafen und ihre Missionen
Exkurs: Polen, »Araboneger« und der erwartete Mahdi
Henryk Sienkiewicz – ein Nobelpreisträger im Banne Karl Mays?
Ein Exilant und der »Negerislam«
Der »Führer« aus Afrika: islamistischer Terror aus NS-Perspektive
Islamistische Fanatiker – die DDR-Sicht
Radebeuler Orient
Karl Mays Naher Osten und der Völkermord an den Armeniern
»Ich liebe auch diesen Muhammedaner …«
Deutsche Vorlieben: Naher Osten, »Wilder Westen«
Kara Ben Nemsi vs. Lawrence von Arabien
Zwei europäische Ikonen und der Nahe Osten
Gefahr aus dem Harem und die Liebe im Felde
Max von Oppenheim – hat ein Deutscher den Dschihad erfunden?
»Einsatz in Afghanistan«
Orientalisieren im Nationalsozialismus
May, Lawrence und die Folgen
Im deutschen Dreischritt: Orientalismus, Antisemitismus und Wildwestromantik
T. E. Lawrence und Karl May in Ost und West nach 1945
Antiimperialismus und Antizionismus
DDR-Comics als Karl-May-Ersatz
Palästinenser und Indianer: getarnter Antizionismus inder DDR
»… als sei die Zeit stehen geblieben«
Orient im Fadenkreuz: amerikanische und syrische Computerspiele
»… gut durchgebratener, toter Hadschi«: Kein Happy End
Anhang
Anmerkungen
Verzeichnis der Abkürzungen
Literatur
Vorwort
Es war eine aufgeregte Liebes- und Mordgeschichte, die sie sahen, stumm sich abhaspelnd am Hofe eines orientalischen Despoten, gejagte Vorgänge voll Pracht und Nacktheit, voll Herrscherbrunst und religiöser Wut der Unterwürfigkeit, voll Grausamkeit, Begierde, tödlicher Lust und von verweilender Anschaulichkeit, wenn es die Muskulatur von Henkersarmen zu besichtigen galt, – kurz, hergestellt aus sympathischer Vertrautheit mit den geheimen Wünschen der zuschauenden internationalen Zivilisation. (Thomas Mann, Der Zauberberg, 1924)
Meine Söhne: Was nicht im Fernsehen läuft, interessiert sie nicht. (Grabräuber, Tomb Raider II, 2003)
Wir haben kein Problem mit westlicher Technologie. Das ist für uns einfach Handwerkszeug, auch wenn es aus Israel kommen sollte. […] Es sind die Ideen, die mit den neuen Medien kommen, die nicht gut sind. (Bilal Zein, Internetbüro der Hisbollah, 2003)
In gewohnter Wortartistik beschrieb Thomas Mann 1924 die Befriedigung typischer Erwartungen eines europäischen Publikums an einen »Orient«-Film. Auch über acht Jahrzehnte nach Erscheinen seines Romans »Der Zauberberg«, im wenig bildungsbürgerlichen Medienzeitalter von Superstarsuche, Gameboy und X-Box, scheint seine scharfsinnige Beobachtung nichts von ihrer Gültigkeit verloren zu haben.
Die Klage des griechischen Grabräubers über das Desinteresse seiner Söhne an jeglicher Schriftkultur in einem Action-Spektakel wie »Tomb Raider II« hat einen ernsten Hintergrund: Filmheldin Lara Croft, eine abenteuerlustige Archäologin, vermag universale Gefahren nur deswegen abzuwenden, weil sie nicht nur in Geheimgänge, sondern auch in heil’ge Bronnen1 pergamentener Quellen steigt. Lara und ihr amerikanischer Kollege Professor Henry Jones Jr., besser bekannt als »Indiana Jones«, können die Welt vor dem Missbrauch morgenländischer Mysterien retten, weil sie sich in der gesamten Kulturgeschichte auskennen.
In den letzten Jahren entstanden zahlreiche Untersuchungen zum westlichen Orientbild. Allerdings widmete man sich zumeist der akademischen oder hochliterarischen Beschäftigung Europas mit dem Nahen Osten.2 Die massenwirksame Prägung des Orientbildes durch Abenteuerbücher, Comics, Hollywood-Erfolge oder Videospiele blieb dabei zumeist unberücksichtigt. Erstmals werden nun gleichermaßen Höhenkamm und Trash, Produkte der Welt- und Erzeugnisse der Populärkultur untersucht. Beim Gang durch die Jahrhunderte wird demonstriert, wie Ereignisse, die für das Verhältnis von Orient und Okzident wichtig sind, in zeitgenössischen und aktuellen Medien verarbeitet werden. Ältere Werke fließen dabei stets in die modernen Produktionen ein. Sie werden als Ideenlieferant benutzt und nach jeweils herrschenden Standards um- und neu interpretiert.
Seit jeher beschäftigt das Morgenland, der Orient, die Phantasie der Menschen. Er ist gleichzeitig Wiege abendländischer Zivilisation und Geburtsstätte aller Weltreligionen. Nun ist der »Orient« allerdings keine geographisch beschreibbare Tatsache. Im Alltagsgebrauch bezeichnet man heute damit den islamisch geprägten Kulturraum mit Ausnahme Süd- und Südostasiens.3 Im Deutschen nennen sich Wissenschaftler, die sich mit dieser Region beschäftigen, Orientalisten.
Im Angelsächsischen geht die Begriffsbestimmung über den akademischen Rahmen hinaus: Dort sind »orientalists« all jene, die sich im weitesten Sinne dem Nahen Osten, gleich ob als Philologe, Schriftsteller oder Reisender, widmen. 1978 geriet das Buch »Orientalism« des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Edward Said zu einer Generalabrechnung mit jeglicher abendländischer Beschäftigung mit dem Nahen Osten seit der Antike. Demnach ist der Orient kein geographisch vom Okzident unterscheidbares Territorium, sondern eine westliche Idee; geschaffen zur Abgrenzung gegenüber den Anderen, den fremden Orientalen. Den deutschsprachigen Orientalismus klammerte Said in seinen Untersuchungen allerdings weitgehend aus. In den vergangenen Jahren bemühte man sich wiederholt, diese Lücke zu schließen. Dabei blieb ein entscheidender Aspekt allerdings unberücksichtigt: der deutsche Antisemitismus in seiner unheilvollen Symbiose mit dem Orientalismus zwischen dem 19.Jahrhundert und der Gegenwart von Karl Marx über Sir John Retcliffe bis heute.
Der »Orient-Komplex« als Produkt der Idee, weniger der Realität des Nahen Ostens wird nun anhand vielfältiger medialer Zeugnisse rekonstruiert. »Orientalisierend« wird als Synonym für die klischeebehaftete Darstellung des Morgenlandes gebraucht. Opern und historische Romane, Kinoproduktionen und TV-Serien finden dabei ebenso Berücksichtigung wie Comics, Abenteuerbücher oder Computerspiele.
Die Untersuchung schlägt den Bogen von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart. Rückblenden und Querverweise markieren Traditionslinien und machen auf Stereotype aufmerksam. Zunächst wird gezeigt, wie das Abendland in einer bestimmten Epoche den Orient wahrnimmt. Daran anknüpfend sieht man, wie Medien darauf folgender Jahrhunderte mit diesen nunmehr historischen Ereignissen umgehen und alten Bildern neue Farbtupfer hinzufügen. So diskutieren die ersten Kapitel die Entwicklung des europäischen Nahostbildes von der Antike bis zum Zeitalter der Französischen Revolution. Die Ausführungen zum 19.Jahrhundert zeigen dann, wie der weltumspannende »Triumphzug des Kapitals« und die daraus resultierenden sozialen Umbrüche die Verflechtung orientalisierenden Denkens mit antisemitischen Vorurteilen hervorbringt. Die abschließenden Kapitel verfolgen populärmediale Impressionen des Nahen Ostens von Nationalsozialismus und DDR bis in die unmittelbare Gegenwart.
Dieses Buch ist jenen gewidmet, die in Geschichte und Gegenwart mit Rassismen konfrontiert werden. Sie können sich darüber informieren, wie Autoren, Filmemacher, Graphiker oder Spieledesigner mit ihren Schöpfungen Vorurteile transportieren. Weder Autor noch Leser der vorliegenden Zeilen haben an der Eroberung Jerusalems im Ersten Kreuzzug oder an der Erstürmung von Akaba im Ersten Weltkrieg teilgenommen. Dennoch meint man, eine recht konkrete Vorstellung von diesen Ereignissen zu haben. In Wirklichkeit ist diese meist durch Historiengemälde, Romane oder Filme geprägt. Damit ist auch klar, weshalb im Folgenden gerade populären Medien besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird: Die meisten Menschen schöpften ihr Wissen über LudwigXIV., Richelieu oder Colbert nicht aus umfänglichen historischen Abhandlungen, sondern aus dem nicht minder dickleibigen Roman »Die drei Musketiere« von Alexandre Dumas. Was einen Sunniten von einem Schiiten unterscheidet, erfuhren Generationen Deutscher nicht aus religionsgeschichtlichen Nachschlagewerken, sondern aus »Karl Mays Gesammelten Werken«. Über CIA-Aktivitäten im Nahen Osten vermeint man aus den Thrillern von Tom Clancy, Hollywooderfolgen wie »Ausnahmezustand« oder Actionserien wie »24« oder »JAG« informiert zu sein.
Das bedeutet nicht, dass wissenschaftliche Untersuchungen und die »Literatur des Höhenkamms« auf den folgenden Seiten unberücksichtigt bleiben. Schließlich sind diese ja stets wichtige Quellen und Ideenlieferanten für Autoren des Unterhaltungsgenres. Weshalb aber finden sich in dieser Untersuchung auch und gerade zu ihren Lebenszeiten prominente, doch heute weitgehend vergessene Autoren wie Sir John Retcliffe oder Hans Dominik? Das hat einen einfachen Grund: Gerade deren Texte vermitteln den herrschenden Zeitgeist und fokussieren allgemein verbreitete Vorstellungen über den Nahen Osten und seine Konfliktpotentiale.
Viele mythenträchtige historische Figuren und Ereignisse des Nahen Ostens bewegen sich in der nebelverhangenen Grenzzone zwischen Sage und Wirklichkeit – was ihre politische Funktionalisierung sogar erleichtert. Für den Western ist dieses Phänomen seit John Fords Klassiker »Der Mann, der Liberty Valance erschoss« längst selbstverständlich. Denn was sagt der Sensationsjournalist, dem die wahre Geschichte hinter dem titelgebenden Revolverduell wenig publikumswirksam scheint: Das ist der Westen, Sir. Wenn die Wahrheit über die Legende herauskommt, drucken wir trotzdem die Legende. Dass es mit der Legendenbildung über den Nahen Osten nicht anders aussieht, zeigt dieses Buch.
Orientbilder der Antike – Perser, Griechen und der Beginn der Angst …
Rassismus in der Antike?
Die Antike kannte keinen Rassismus. Man war Grieche oder Römer, gleich ob schwarzer, gelber oder sonstiger Hautfarbe, ob über dem verlängerten Rücken ein Pigmentpunkt prangte oder eine Lidfalte tiefer saß. Die Idee der Polis bzw. des Imperiums konnte sich ethnische Diskriminierung um den Preis der Existenz nicht leisten. »Araber« war in Rom ein Sammelbegriff für nomadisierende Stammeskrieger, der nicht negativ besetzt war. Mit der Verabschiedung der »Constitutio Antoniniana« im Juli 212 n. Chr. durch Kaiser Caracalla war es jedem möglich, römischer Bürger zu werden. So findet sich 244 n. Chr. mit Philip sogar ein Herrscher arabischer Abstammung auf dem Cäsarenthron. Nicht umsonst berufen sich Demokratien der Moderne wie das britische Empire oder die USA auf diese Ideale.
Phantasien vom antiken Rassismus entspringen europäischem Wunschdenken des 19. und 20.Jahrhunderts. So erfand der polnische Schriftsteller Ferdinand Ossendowski (1876–1945), ein Abenteurer, Geheimagent und Okkultist, 1926 die folgende Rede eines römischen Befehlshabers an nordafrikanische Siedler, die eine Bittschrift zur Gleichstellung ihrer »barbarischen«, also arabischen Frauen und der aus den Verbindungen mit diesen entsprungenen Kinder an den Kaiser verabschiedet hatten: Bürger! Soldaten! […] Imperator und Senat wissen nur allzuwohl, dass diese Barbaren jetzt zwar gezähmt scheinen und sich willig unter den Fittichen des Römeraars niederlassen, dass sie uns aber in tiefster Seele fremd und feind sind. Lasst nur unsere Legionen einmal einen militärischen Misserfolg erleiden! Bezweifelt ihr etwa, dass dann sofort wieder Aufwiegler unter ihnen auftreten würden, dass sie Roms großes und bewunderungswürdiges Werk […] würden vernichten wollen? Und selbst, wenn dies nicht der Fall wäre, würde barbarisches Blut das Blut der Nachkommen römischer Bürger bereits derart verfälscht und eine Bevölkerung erzeugt haben, der gleiche Rechte wie echtbürtigen Römern nicht zugebilligt werden können.4 Solcherart Texte des glühenden Bolschewistenhassers und Antisemiten Ossendowski fielen bei breiten Leserkreisen der Weimarer Republik auf fruchtbaren Boden. Mit der historischen Realität der Antike haben sie allerdings nichts zu tun.
Wie aber war das Verhältnis der Griechen und Perser zu Zeiten von Aischylos und Herodot? Die Perser sind ein nach der Landschaft Persis im Südwesten des Iran benanntes indoeuropäisches Volk. Wiewohl damit ethnisch von den semitischen Stämmen wie den Arabern unterschieden, sind sie besonders seit der Revolution von 1979 den gleichen Vorurteilen wie diese unterworfen. Nach der bereits erwähnten Eroberung Babylons sowie ganz Kleinasiens und Ägyptens unter den Herrschern KyrosII. und KambysesII. wurde Persien ein Großreich, das sich nach Norden und Westen auszudehnen suchte. König DareiosI. setzte in der ersten Hälfte des 5.Jahrhunderts v. Chr. die persische Expansionspolitik fort, wodurch es unweigerlich zu macht- und wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen mit den griechischen Stadtstaaten kommen musste. Diese hatten auf dem Wasser neue, billigere Handelswege von der Ostküste Spaniens bis in die Häfen des Schwarzen Meeres erschlossen. Eine solch kostengünstige Variante trat in erfolgreiche Konkurrenz zum langwierigeren und damit teureren indisch-persisch-phönizischen Land-Wasser-Handel. Durants »Kulturgeschichte der Menschheit« aus den Dreißigerjahren des 20.Jahrhunderts zieht noch in einer Neuauflage von 1976 folgendes Resümee der Perserkriege: Das europäische System setzte sich gegen das orientalische durch […], weil es fast ein Naturgesetz ist, dass der raue kriegerische Norden den leichtlebigen, kunstschöpferischen Süden überwältigt.
Ohne erkennbare Skrupel feiert diese – in Europa und den USA weit verbreitete – Kulturgeschichte unter der Überschrift »Der Kampf um die Freiheit« die Perserkriege als Aufstand frühdemokratischer Europäer wider orientalische Despotie: Der griechisch-persische Krieg war der bedeutsamste Kampf der europäischen Geschichte, denn er ermöglichte erst die Bildung Europas. Er erkämpfte dem Abendland die Möglichkeit, sein eigenes Wirtschaftsleben unbelastet von einer Tribut- oder Steuerpflicht an Fremdherren und seine eigenen politischen Einrichtungen frei von der Diktatur orientalischer Herrscher zu entwickeln. Er ebnete Griechenland den Weg zu Versuchen mit der Freiheit; er bewahrte die griechische Seele dreihundert Jahre vor dem entkräftigenden Mystizismus des Ostens5 etc.
Die Bemühungen der Perser, das griechische Festland zu unterwerfen, scheiterten. Ihre zahlenmäßig weit größeren Söldnertruppen erlitten gegenüber den taktisch wie strategisch überlegenen, zudem besonders hoch motivierten Kontingenten der griechischen Stadtstaaten vernichtende Niederlagen. Der tatsächlich dabei bewiesene Opferwille und Kampfgeist der Hellenen sichert ihnen den Einzug in das Pantheon der Kriegsgeschichte. Doch damit nicht genug: Schlachten wie die von Marathon 490 v. Chr. oder zehn Jahre später bei den Thermophylen zählen seither als Meilensteine europäischer Triumphe über den Ansturm asiatischer Scharen. Diese Kriege bedeuten nicht zuletzt eine Wende im Kräfteverhältnis zwischen Orient und Okzident: Mit den Rachefeldzügen PhilippsII. 337 v. Chr. und seines Sohnes Alexander kündigten sich die europäischen Überlegenheitsphantasien kommender Jahrhunderte an und kreierten gleichzeitig einen Heros medialer Kultur des Abendlandes, dessen Glanz über mittelalterliche Heldenbücher und Renaissanceschauspiele bis hin zum modernen Hollywoodkino kaum zu überbieten ist.
Die Barbaren kommen!
Vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzungen entstand der Topos des »Barbaren«. Für die sich hochkultiviert dünkenden Hellenen waren dies im wörtlichen Sinne »Stotterer« – also jene, die des Griechischen nicht mächtig waren und in vermeintlich unverständlichen Zungen lallten. Die Bezeichnung des Anderen als einen unverständliches Kauderwelsch Sprechenden ist in verschiedenen Kulturkreisen zunächst nicht stigmatisierend. Für Griechen und Römer war ein Barbar einfach ein Nicht-Grieche bzw. Nicht-Römer.
1932 erfand der texanische Fantasy-Autor Robert E. Howard für ein Pulp-Magazin, also ein »Groschenheft«, den Barbaren der westlichen Vorstellungswelt: »Conan, den Cimmerer«. Howards Kurzgeschichten orientieren sich, ohne historische Authentizität zu beanspruchen, an antiken Vorbildern und Motiven. Bereits Homer erwähnt die Cimmerer als mythisches Volk, das an den Ufern des die Welt begrenzenden Meeres, dem Okeanos, in permanenter Dunkelheit hause. Tatsächlich waren sie ein den Persern verwandter indoeuropäischer Stamm, der über den Kaukasus nach Vorderasien eindrang und im Kampf mit den Lydiern um 600 v. Chr. aufgerieben wurde. 1982 verfilmt, fand man in dem blauäugigen Bodybuilder Arnold Schwarzenegger als Conan die perfekte Inkarnation der Sehnsüchte nach Erlösung vom Übel eines wulstlippig-negriden Phantasieorients durch einen unüberwindlichen Kämpfer.6
Das griechische bárbaros war nur ein Leihwort. Es wurde aus dem altindischen, indogermanischen barbara-h entlehnt. Damit bezeichnete man auch dort den Brabbelnden, Stotternden, sich außerhalb der eigenen sozialen Kreise Bewegenden. Barbaren sind – seit jeher und für alle– die Anderen: Kein Volk, keine Ethnie erweist sich als dagegen gefeit. Für den Einwohner des Fernen Ostens sind Europäer und Amerikaner langnasige »Barbaren« – selten wurde das im Kino besser thematisiert als in dem Hollywoodfilm »Der Barbar und die Geisha« mit John Wayne.
Die unschöne Kulturgeschichte der Bezichtigung des Anderen als Barbar würde eine Enzyklopädie der Verleumdung füllen. Der Barbar ist seit jeher fester Bestandteil jeglicher Selbstdefinition: Man definiert sich über den Anderen als Spiegelbild eigener Verfehlungen und Schwächen. So waren es nicht einmal die Perser, die von den Griechen allzu häufig als Barbaren beschimpft wurden, sondern die Bürger des jeweils verfeindeten Stadtstaates: Zum diskriminierenden Modewort wurde der »Barbar« also schon in der Antike im Konflikt zweier Mächte der westlichen Hemisphäre. Nachdem ein geeintes Griechenland die von Aischylos und Herodot so anschaulich beschriebenen Siege bei Salamis und Marathon errungen hatte, gerieten sich Sparta und Athen in die Haare. Der fast dreißigjährige Peloponnesische Krieg um die Vorherrschaft in Griechenland übertraf an Härte und Grausamkeit alle vorangegangenen Auseinandersetzungen mit den asiatischen Angreifern. Lachender Dritter des Kampfes zwischen dem Attischen Seebund um Athen und dem Peloponnesischen Bund um Sparta war Persien. Während sich die Griechen im Bruderkonflikt zerfleischten, erholte es sich von den erlittenen Niederlagen. Gestützt auf ein riesiges Heer, vermochte Großkönig Artaxerxes nach einigen schnell errungenen Siegen den ausgebluteten Gegnern 387 v. Chr. seinen »Königsfrieden« zu diktieren.
Für die Griechen war die Begegnung mit den ursprünglich persischen »Barbaren« prägend: Die triumphalen Siege stärkten das Selbstbewusstsein; durch die Abgrenzung von der persischen Monarchie gewann die athenische Demokratie ihre Identität, und mit ihrem verschwenderischen Luxus verkörperten die ungeliebten Nachbarn sowohl eine wunderbare Verlockung als auch den Inbegriff lasterhafter Verdorbenheit, die schnell prägend für westliche Orientreflexionen werden sollten.
Aischylos’ »Die Perser« und Herodots »Perserkriege«
Wie stellte sich dieses neue Bild in der medialen Übersetzung dar? Am Anfang dieses Streifzuges durch die Galerie abendländischer Orientbilder steht ein 472 v. Chr. uraufgeführtes Theaterstück, das der Welt nicht nur als Erstes seiner Art vom Kampf des Ostens wider den Westen berichtet, sondern als erstes Drama des abendländischen Kulturkreises überhaupt gilt: »Die Perser« von Aischylos. Da dessen Motive bis heute als Menetekel eines »Kampfes der Kulturen« präsentiert werden, ist ein Blick auf das Original von Interesse.
Die Tragödie spielt um 480 v. Chr. am persischen Königshof zu Susa, einer vormals prächtigen Palastanlage unweit der heutigen Grenze zum Irak. Im Stil der Zeit beschreibt ein Chor von Greisen aus persischen Fürstengeschlechtern die Unzahl der ganz verschieden ausgerüsteten und aus allen Teilen des Reiches stammenden Kriegerhorden, die Großkönig Xerxes gegen die Griechen führt. Er will damit die Schmach der Niederlage von Marathon rächen. Xerxes’ Mutter Atossa harrt besorgt der Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Ein Eilbote und der herbeibeschworene Geist von Darios, ihrem verstorbenen Mann, bestätigen die schlimmsten Erwartungen. Das kleine, doch disziplinierte griechische Heer und eine zahlenmäßig weit unterlegene, dafür mit Rammspornen ausgerüstete Flotte wendiger Schiffe der Hellenen hat die unorganisierten Söldnerhorden und die schwerfälligen Meeresriesen der Perser bei Salamis völlig aufgerieben. Mit Erscheinen des am Boden zerstörten Xerxes und seiner Klagen endet das Stück.
Bereits an dieser Stelle wird klar, wie hochaktuell das alles ist und bleibt. In seiner Sicht auf die größenwahnsinnige Verblendung, die Hybris eines Kriegsherrn, erfüllt bereits dieses erste abendländische Drama den Anspruch zeitloser Gültigkeit. Hier werden die Szenarien »verlorener Siege«, gleich ob in Griechenland, Russland oder im Irak, durchgespielt. Mit dieser Stoßrichtung brachte beispielsweise der Regisseur Dimiter Gottscheff »Die Perser« 2006 in einer Neuinszenierung auf die Bühne des Deutschen Theaters in Berlin.
Tatsächliche wie erfundene Ereignisse dieser frühen gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Ost und West sind uns durch einen weiteren Zeitgenossen überliefert: den – laut Cicero – »Vater der Geschichtsschreibung«, Herodot. Von ihm stammt die Geschichte der Perserkriege, die sogenannten »Historys Apodeixis«. Der 484 v. Chr. im damals zeitweise persischen Halikarnassos, dem heutigen türkischen Bodrum, geborene Autor erscheint in seiner Methode Aufklärern wie Voltaire (1694–1778) verwandt: Herodot wollte, ähnlich wie Aischylos, persische Misswirtschaft und Despotie anprangern. Damit konnte er gleichzeitig seinen attischen Landsleuten in ihrer Selbstüberhebung und ihrem Großmachtstreben einen Spiegel eigener Fehler und Schwächen vorhalten. Voltaire beabsichtigte mit seinem den Islam und seinen Begründer diskreditierenden Schauspiel »Mahomet«, das im 18.Jahrhundert nur in dieser maskierten Form angreifbare katholische Christentum und den Vatikan bloßzustellen. Der nachhaltigere Effekt war jedoch in beiden Fällen ein ähnlicher: Beim Publikum setzten sich vor allem die Vorurteile gegenüber der fremden Kultur fest: Im Orient, gleich ob Arabien oder Persien, herrschen Götzendienst, Despotie und Völlerei.
Herodot gleicht in seiner Darstellung des Fremden, in seiner Mischung aus philosophischen Überlegungen, moralischen Appellen sowie Reise- und Kriegsberichten weniger nüchternen Historikern als den Abenteuerschriftstellern und forschenden Soldaten des 19. und 20.Jahrhunderts: Ähnlich wie bei Karl May (1842–1912) oder T. E. Lawrence (1888–1935), dem legendären »Lawrence von Arabien«, bleibt seine Quellennutzung sowie die Authentizität der Darstellung umstritten und provoziert Kritik. So ist eine Modifizierung des Cicero’schen Urteils durchaus angebracht. Herodots Geist gebar seit jeher schwer unterscheidbare, eineiige Zwillinge: Er ist nicht nur der Vater der Geschichtsschreibung, sondern auch der literarischen Fiktion.7 Wie bei modernen Orientalisten war ein zweifelhafter Wahrheitsgehalt allerdings dem Mythos und der Langlebigkeit seiner Thesen dienlich.
In einem unterscheiden sich Aischylos und Herodot von den Autoren des 19. und 20.Jahrhunderts. Sie verspürten und vermittelten keine rassische Überlegenheit des eigenen Volkes. Der Perser ist nicht besser oder schlechter – er ist anders. Dafür entwickelte Herodot – in Anlehnung an die Lehren des Arztes Hippokrates in seiner Schrift »Über die Umwelt« – eine antike Klimatheorie. Fruchtbare, fette, üppige Regionen hoher Feuchtigkeit, wie wir sie im Orient – wozu in späterer Argumentation Afrika sowie der gesamte Mittelmeerraum zählen sollte – finden, machen die Menschen träge und faul. In ihrer behaglichen Sattheit sind sie den hungrigen Mägen entschlossener Kämpfer aus dem Westen bzw. Norden unterlegen. Sie ziehen ein bequemes Leben in sklavischer Knechtschaft dem harten Leben der Freien vor. Diese These hatte Langzeitwirkung: Sie findet sich noch in den politisch motivierten Lehren deutscher Geopolitiker des 20.Jahrhunderts wie denen Karl Haushofers (1869–1946) und seines Lieblingsschülers, des im ägyptischen Alexandria geborenen Führerstellvertreters Rudolf Heß (1894–1987). Dieser interpretierte Haushofers Theorien im Sinne des Nationalsozialismus. Schließlich bedurfte es der Begründung der Umlenkung des ewigen Germanenzuges nach Süden […] nach dem Land im Osten.8
Eine ihrer schönsten literarischen Blüten trieb die Lehre vom prägenden Einfluss des Klimas in Felix Dahns (1834–1912) historischem Roman »Ein Kampf um Rom« von 1876. Dort diagnostiziert ein hochgewachsener Wikingerfürst bei den stammesverwandten Ostgoten nach zwei Generationen des Lebens im entnervend-sonnigen Italien schon germanenuntypischen Kleinwuchs.9
Herodot ist um Objektivität bemüht. So preist er die persönliche Tapferkeit der Perser in Sieg wie Niederlage. Der antike Autor macht den Willen der Götter für militärisches Missgeschick verantwortlich.10 An keiner Stelle seiner Schriften erscheinen die Perser als minderwertiger denn ihre Widersacher – sie hatten eben nur Pech. Wäre der Olymp den Persern gewogen gewesen, hätten sie und nicht die Griechen gesiegt. Den Fehler, die eigentliche irdische Ursache für den letztendlichen persischen Untergang, verortet er nicht in der rassischen Ungleichheit, sondern im unterlegenen politischen System: Der Kampf der Griechen gegen die Perser ist nicht zuerst ein Kampf Ost gegen West, sondern ein Kräftemessen zwischen Despotie und Demokratie. Damit wird er zum Begründer der Argumentation einer Dualität, auf die seither westliche Abenteuerschriftsteller wie Politiker, jungtürkische Revolutionäre wie amerikanische Militärgouverneure zurückgreifen. Hier trifft Lenin auf Karl May und Atatürk auf Mao: Die einfachen Menschen des Orients sind genügsam und treu, gastfreundlich und tapfer bis zur Selbstaufopferung. Verkommen ist die jeweilige Oberschicht. Dabei konstruierte man schon früh die orientalische Variante unheiliger Allianz von »Thron und Altar«. Das schlechte Beispiel von Despoten verdirbt bei Herodot wie »Lawrence von Arabien«, beim Preußen Helmut von Moltke wie beim US-Thrillerautor Tom Clancy gute (Volks-)Sitten.
Alexander: Hybris und die Angst vor der Überfremdung
Laut Herodot beruht der Aufstieg der Perser auf ihrer einfachen, genügsamen Lebensweise. Die dadurch errungene Macht zerbricht durch Luxus und Despotie der Herrscher sowie Einflüsterungen griechischer Überläufer am Perserhof. Hier zeigt sich, dass Herodots Perserbild des Rassismus’ entbehrt: Griechen sind gleichermaßen verbrecherischer Handlungen fähig. Sein Bild der Perser konzentriert sich mit Fortschreiten des Textes auf das Hofleben. Im Mittelpunkt stehen dem Wahnsinn der Hybris, des Verlustes jeglichen Maßes, verfallene Großkönige. Sie akzeptieren keine menschlichen und allzu bald auch keine göttlichen Gesetze mehr – die Strafe des Olymps folgt auf dem Fuße. An dieser Darstellung orientiert sich noch 2007 Zack Snyders Film »300«, wenn er den Erzähler aus dem Off Xerxes’ Hybris als Grund moralischer bzw. militärischer Niederlagen bei den Thermophylen bzw. Salamis, Plataiai und Mykale anführen lässt.
In Alexander »dem Großen« (356–326 v. Chr.) verkörpert sich ein halbes Jahrhundert später erstmals die Urangst Europas vor einer östlichen, weiblichen Überformung, mit der der Verlust abendländischer Individualität im besten Hegel’schen Sinne unweigerlich verbunden wäre. Der Westen erliegt den süßen Verlockungen des Orients. 334v.Chr. überschritt Alexander den Hellespont. Vier Jahre darauf hat er die Perser endgültig überwunden. Danach versinkt er selbst in Größenwahn. Bereits Zeitgenossen nehmen ihn kaum noch als Europäer wahr.
Je weiter er in das fremde Schlaraffenland eindringt, desto mehr verfällt er dessen üppigem Charme. Das, wovor Aischylos und Herodot mit ihren anschaulichen Schilderungen des persischen Niedergangs ihre Mitbürger warnen wollten, die totale Selbstüberhebung, war nun eingetreten: Ihre Idee der Republik, verkörpert in Athen, unterlag dem grenzenlosen Despotismus eines Einzelnen. Das zivilisierte politische Klima ihrer republikanischen Heimat schuf Autoren wie Aischylos und Herodot. Beide genossen trotz ihrer Gesellschaftskritik hohes Ansehen bei den Mitbürgern.
Im Dunstkreis des Alleinherrschers Alexander gediehen bereits zu Lebzeiten unterwürfige Lohnschreiber wie Kallisthenes, der Autor des in der Antike weit verbreiteten populären Textes »Die Taten Alexanders«. Indem Kallisthenes behauptete, das Zeus-Amun-Orakel der ägyptischen Oase Siwa habe Alexander zum Sohn dieser europäisch-asiatischen Mischgottheit erklärt, erhob er seinen Geldgeber in den Olymp. Es war die Ironie der Geschichte – und sie wird sich bei Künstlern und Autoren in jeglicher Diktatur wiederholen –, dass Kallisthenes dem von ihm mitgeschaffenen Mythos zum Opfer fiel: Als Alexander den nur dem gottgleichen Großkönig vorbehaltenen persischen Brauch der Proskynese, bei der man auf die Knie fällt und dem Herrscher die Füße liebkost, an seinem Hof einführen wollte, wurde er ausgerechnet von Kallisthenes kritisiert – der daraufhin prompt in Ungnade fiel.11 Noch bis ins 19.Jahrhundert ließen sich europäische Fürsten im Wahn ihrer Gottgleichheit von asiatischen Despoten inspirieren. Dem bayerischen Märchenkönig LudwigII. (1845–1886) genügte das Füßeküssen auf iranische Art allerdings nicht. In fortschreitender geistiger Umnachtung überbot er das persische durch das chinesische Hofzeremoniell – in Gegenwart des Monarchen wurde nicht mehr gekniet, sondern gerobbt.
Der Kult um den gottgleichen Alexander beschleunigte den Verlust der Führungsrolle des antiken Griechenlands in der antiken Welt. Die Darstellung des Orients als Weib, das den männlichen Eroberer kastriert, hat in der abendländischen Kultur Tradition. 1905 erschien Jakob Wassermanns (1873–1934) Roman »Alexander in Babylon«. Den sinnlichen Versuchungen der »großen Hure«, personifiziert in der Baal-Priesterin Liblitu, vermag der Heerführer Hephästion nichts entgegenzusetzen. Sie ist die orientalische Geheimwaffe: Fühlst du, wie Asien zittert? Ich liebe dich, Zerstörer, trinke den Tod aus mir, deine Augen will ich dir aus dem Kopf schlürfen.12 Vampirgleich schlägt sie dem ihr verfallenen Griechen in sexueller Raserei die Zähne in seine Schulter und trinkt sein Blut. Der westdeutsche Schriftsteller Arno Schmidt (1914–1979) fand für Alexanders Verfallsprozess in seiner 1949 entstandenen Kurzgeschichte »Alexander oder Was ist Wahrheit« anschauliche Worte: Indem Alexander sich allmählich mehr und mehr – orientalisierte (Paschamanieren und die nichtswürdige Umgebung – annahm)13 richtete er das Reich zugrunde.
Im Hintergrund lauert immer die Angst um die Ansteckung mit dem »morgenländischen Bazillus«, der das gesunde europäische Blut zersetze. Sie peinigte Politiker wie Universitätslehrer, Philosophen wie Forschungsreisende. 1926 artikulierte T. E. Lawrence, der berühmte »Lawrence von Arabien«, diese in der Antike geborene Angst für die Moderne: Gebe Gott, dass niemand, der meine Geschichte liest, verführt von dem Zauber der Fremde, hinauszieht, um sich und seine Gaben im Dienst einer fremden Rasse zu erniedrigen. Wer sich und sein Selbst Fremden zum Eigentum gibt, führt das Leben eines Yahoo, hat seine Seele an einen Sklavenwärter verschachert. Er gehört nicht zu ihnen. Er kann sich gegen sie stellen, sich seine Sendung einreden, die anderen zurechthämmern und -biegen zu etwas, was sie aus sich selbst heraus niemals geworden wären. […] In meinem Falle brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich und ließ mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten: Sie zerstörten sie mir gänzlich. […] Ich hatte eine Form abgestreift, ohne eine andere anzunehmen; und das Ergebnis war ein Gefühl tiefster Vereinsamung im Leben und der Verachtung, nicht der Menschen, aber alles dessen, was sie taten.14
Gute Perser, schlechte Perser
Der Perser ist der orientalische Franzose […]. Aber das höfliche, schmeichelnde und oft kriechende Wesen des Persers hat nie einen vorteilhaften Eindruck auf mich gemacht; die gerade raue Ehrlichkeit des Arabers tat mir viel wohler.15
So äußert sich einberühmterdeutscher Autor im ausgehenden 19.Jahrhundert in einem seiner Romane.
Im Unterschied zu solch negativem Urteil über ihre Nachfahren genossen die antiken Herrscher Persiens im christlich-jüdischen Kulturkreis sogar einen zweifachen weltanschaulichen Bonus: Der erste liegt weit über hundert Jahre vor den durch Aischylos und Herodot beschriebenen Kriegen gegen die Griechen: KyrosII. begründete während seiner Herrschaft zwischen ca. 559v.Chr. und 530v.Chr. nicht nur das mehrere Jahrhunderte überstrahlende persische Weltreich, sondern beendete mit der Eroberung Babylons 529 v. Chr. die Gefangenschaft der Elite des jüdischen Volkes, die nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels von Nebukadnezar verschleppt worden waren.
Diese Gefangenschaft und die anschließende wundersame Errettung wurden sinnbildlich für die nationale Unterdrückung von Völkern und deren Erlösung. So wurde beispielsweise Guiseppe Verdis Oper »Nabucco« zu diesem Thema 1842 von seinen Zeitgenossen als Anspielung auf die Unterdrückung Italiens durch Habsburg im 19.Jahrhundert verstanden. Der »Freiheitschor« wurde zur heimlichen Hymne des Risogimento, der italienischen Unabhängigkeitsbewegung von Wien. Heute ist er fester Bestandteil jeder Opernmatinee. Selbst im Kostümfilm »Sissi– Schicksalsjahre einer Kaiserin« mit Romy Schneider intonieren ihn Mailänder Patrioten. Für die Disco-Generation arbeitete BONEY M. mit »By the Rivers of Babylon« den Stoff auf, und inzwischen spielen zahlreiche Reggaesongs und Rap-Texte mit dem Thema.
Dafür, dass Perserkönig Kyros die jüdische Gefangenschaft beendete und zudem die Errichtung des neuen Tempels in Jerusalem anregte, war ihm der Dank des Abendlandes stets gewiss. Der wurde ihm bereits von Xenophon, einem griechischen Renegaten in persischen Diensten, erstattet. Dieser antike Dichter salutierte Kyros mit seinem philosophischem Werk zur Staatsorganisation »Kyrupädie«. Im Italien der Renaissance wurde dieser »frühe Machiavelli« zum Bestseller. Geht es doch in beiden Schriften um das gleiche, bis heute aktuelle Thema: Die Schwachstellen von Demokratie und mögliche Alternativen, die beide Autoren in einem starken Alleinherrscher wie einem Großkönig oder einem Medici sehen.
Kyros in der Pose des Judenbefreiers war zudem ein beliebtes Motiv der Malerei. Dieses positive Bild setzt sich später in den orientalisierenden Phantasien Goethes oder Karl Mays fort. Apropos Karl May: Der Autor – und damit sei das Rätsel gelüftet, wer die Eingangszeilen dieses Kapitels verfasste – ließ sich in seiner Kyros-Begeisterung von einem Dichter der deutschen Klassik inspirieren: 1756/57 vergöttlichte Christoph Martin Wieland (1733–1813) mit »Cyrios – Ein unvollendetes Heldengedicht« den Perser. Beim deutschen Dichter waren er und seine Mannen keine verweichlichten Orientalen, sondern preußische Kriegsmänner. Wieland schwebte mit dem Versepos die Apotheose des von ihm bewunderten FriedrichII. mit seiner schlagkräftigen Armee als Sieger über die Heere der Habsburger oder der Bourbonen vor. Diese Gleichsetzung eines persischen Fürsten mit dem größten Feldherrn seiner Zeit führt zu einer Bemerkung von Wielands Weimarer Kollegen Herder. Bei ihm wird der zweite Bonuspunkt der Perser gegenüber den übrigen Orientalen betont: Hat Xenophon von den Sitten der alten Perser, unter denen Cyrus erzogen ward, wahr geredet, so mag der Deutsche sich freuen, dass er mit diesem Volk wahrscheinlich eines verwandten Stammes ist.16 Die Sprachwissenschaftler zu Herders Zeiten hatten nämlich die Verwandtschaft von germanischer und persischer Sprache entdeckt.
Großkönig DareiosI., Sohn des Judenbefreiers Kyros und Vater des Xerxes, präsentiert sich in einer riesigen Keilschrift in der Nähe des heutigen Kerman als der Achämenide, ein Perser, eines Persers Sohn, ein Arier.17 Erwähnte Achämeniden sind hier also als Glied eines arischen Stammesverbundes zu verstehen. Die Sassaniden, Herrscher des späteren neupersischen Reichs und Hauptwidersacher Roms im Osten, beriefen sich auf ihre achämenidischen Wurzeln und nannten ihr Land schließlich »Iran – Land der Arier«. Spätestens hier dämmert, wohin das in einem späteren Kapitel der Geschichte führen wird.
Aus der Verwandtschaft der Sprachen leitete man im romantisierenden Stil des 19.Jahrhunderts alsbald die Blutsverwandtschaft ihrer Träger ab. Aus ursprünglichen Ariern hätten sich schließlich die eigentlichen Iraner und Germanen entwickelt. So verkündete Friedrich Schlegel (1772–1829) schon 1819, dass die asiatischen Vorfahren der Germanen in Asien Arier hießen.18 Bereits neun Jahre früher hatte er gefordert, im Orient […] das höchste Romantische19 zu suchen. Schlegel und seine Nachfolger meinten damit den Orient der Sakuntala, der Zend-Avesta und der Upanischaden20, nicht die Lebenswelt des Islam.
Ignoriert man die gravierenden Unterschiede zwischen diesen beiden Kulturkreisen, kann das zu schwerwiegenden Missverständnissen führen. So sorgte das US-Leinwandspektakel »300« im Jahr 2007 für Aufregung. Der historische Hintergrund des Films ist die Schlacht bei den Thermophylen, wo sich 480 v. Chr. 300 Spartaner unter Führung von König Leonidas für die griechische Sache opferten. Der Streifen des US-Regisseurs Zack Snyder ist in den Augen europäischer Kritiker nicht nur ein faschistische(r) Action-Hit21, sondern auch und vor allem iran- und islamfeindlich. Allerdings wird mit »300« ein blutiges Märchen und keine reale Geschichte erzählt. Es käme ja auch niemand auf die Idee, den Brüdern Grimm eine verzerrte Darstellung des deutschen Mittelalters vorzuwerfen. Vor allem aber waren die persischen Filmbösewichter um Xerxes Vertreter einer Kultur, die vom Islam, als dessen Bannerträger sich der Gottesstaat am Golf heute definiert, 636 n. Chr. konsequent zerschlagen wurde.
Eigentlich müssten sich die Ayatollahs in Teheran bei Zack Snyder bedanken: In seinem Film inkarniert Xerxes die homophile, westliche Dekadenz eines Regimes, das der verhasste Schah repräsentierte. Dass Regisseur Zack Snyder vom Werbefilm kommt, sieht man seiner an Eisenstein und Leni Riefenstahl geschulten Filmsprache an. Das mag ästhetisch bedenklich sein. Irankritisch ist es deshalb aber nicht.
Arische Ahnen – das Perserbild des Nationalsozialismus und seine Folgen
Graf Joseph Arthur de Gobineau und Houston Stewart Chamberlain griffen in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts die Idee einer ursprünglichen arischen Rasse im Orient und ihrer welthistorischen Mission begeistert auf. Den Nationalsozialisten ging aber auch das noch nicht weit genug. Da es ihnen immer noch suspekt schien, dass die Vorfahren des »Herrenmenschen« aus dem Orient stammen sollten, drehte man den Richtungspfeil indogermanischer Wanderrouten noch einmal um 180 Grad. In Walther Gehls weit verbreiteten »Deutschen Geschichte in Stichworten« wird dem Leser 1940 erklärt, dass in nordischer Urzeit durch die Landnot der gesunden, daher kinderreichen nordischen Bauernrasse deren Jungmannschaft zur Wanderung […] über Europa und Asien hinein gezwungen wurde. Dort unterwarfen sie fremdrassige Grundschichten, wodurch die indogermanischen Völker: Kelten, Slawen, Griechen, Römer, Perser, Inder entstanden. Allerdings führte die spätere Rassenmischung […] zum Untergang der meisten indogermanischen Völker.22
Vor den Folgen der »Rassenmischung« hatte schon Alfred Rosenberg (1893–1946), der »Chefideologe« des Dritten Reiches, 1930 in seinem Hauptwerk »Der Mythus des 20.Jahrhunderts« eindringlich gewarnt: Einst ließ ein Perserkönig in die Felsenwand von Behistun folgende Worte meißeln: »Ich, Dareios, der Großkönig, der König der Könige aus arischem Stamme …« Heute zieht der persische Maultiertreiber seelenlos an dieser Wand vorüber, ein Zeichen für Tausende, dass Persönlichkeit mit einer Rasse zusammen geboren wird und mit ihr gemeinsam stirbt.23 Hier wird in extremster Form deutlich, wie die Vereinnahmung der Perser als Arier in rassistischen Orientalismus moderner Prägung umschlägt. Aus völkisch-nationalsozialistischer Perspektive bestand ja Erklärungsbedarf: Warum unterscheiden sich diese ursprünglichen Arier heute nicht mehr von den so verachteten »Untermenschen«, diesen »Esel- und Kameltreibern«? Durch die spätere blutmäßige Vermischung mit »unreinlichen« Semiten, also mit Arabern und Juden, sei es laut Rosenberg & Co. zu einer Aufweichung der Rasse und dem Verlust arischer Qualitäten gekommen. Indem man zeigte, was aus ursprünglichen »Edelariern« wie den Iranern wurde, wenn sie sich mit »rassisch Minderwertigen« einließen, demonstrierte man anschaulich die Gefahren von »Rassenschande« im Sinne der Nürnberger Gesetze. Dieses Szenario war schon in den Dreißiger- und Vierzigerjahren des 20.Jahrhunderts weder neu noch originell, zeigte aber nun die entsetzlichsten Wirkungen in der Praxis.
Auch und gerade deutsche Orientalisten stellten ihre Arbeit in den Dienst expansionistischer und rassistischer Anliegen. Unter den Akademikern der westlichen Demokratien findet sich keiner, der sich so vorbehaltlos mit einer verbrecherischen Politik identifizierte wie der deutsche Orientalist Walther Wüst. Besonderer »Verdienste« kann sich der Indogermanist als Kurator der von SS-Führer Himmler 1935 ins Leben gerufenen »Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe« rühmen. Wüst, der übrigens als Rektor der Münchener Universität maßgeblich an der Festnahme der Geschwister Scholl beteiligt war, und seine Kollegen bemühten sich, kruden Phantasien eine scheinwissenschaftliche Legitimation zu verleihen. Dazu wurden aufwändige Expeditionen, z.B. nach Tibet, unternommen. Selbst vor Menschenversuchen in den KZs schreckte man nicht zurück. Dort stand nach dem Überfall auf die UdSSR 1941 ausreichend geeignetes »Menschenmaterial«, Kriegsgefangene aus den asiatischen Sowjetrepubliken, zur Verfügung.
Persische Großkönige wie Kyros oder Dareios galten völkischen und NS-Ideologen als hervorragende arische Führerpersönlichkeiten. Als Glücksfall für die Verortung der alten Perser in der richtigen Rasse, ja als Ahnen der nachgeborenen Germanen, erwies sich ein Philosoph, dessen persönlicher Wirkungskreis mitunter sogar in die unmittelbare Nähe von Kyros gerückt wird: Zarathustra. Dessen spätgeborener Kollege Friedrich Nietzsche (1844–1900) wurde vom Nationalsozialismus zum geistigen Stammvater und Stichwortgeber des Dritten Reiches uminterpretiert. Sein populärstes Werk »Also sprach Zarathustra« war als blaue biegsame Kröner-Ausgabe24 hunderttausendfach verbreitet und galt als Westentaschenbrevier des gebildeten Nationalsozialisten.
Der Deutung der NS-Ideologen zufolge widerstand eine arische Phalanx von Ahnherren des Tausendjährigen Reiches über Jahrhunderte den anbrandenden semitischen Horden. Mit der Eroberung des Iran durch die Araber ab 636 n. Chr. setzte dann eine – ja eigentlich vom Koran abgelehnte – Welle der Zwangsislamisierung ein. Tausende Perser wurden ermordet, die Mehrzahl konvertierte vom zoroastrischen Glauben zum Islam, der den »arischen Geistesadel« in Haremsphantasien ertränkt haben sollte. Nur eine verhältnismäßig kleine Zahl emigrierte nach Indien, wo sie bis heute als zwar übersichtliche, doch einflussreiche Religionsgemeinschaft der Parsen, was nichts anderes als Perser bedeutet, dem Kulte der »Arier« huldigen.
Die alten Perser der Nationalsozialisten sind erhoben und ergriffen durch ein Bekenntnis zu höchsten sittlichen Werten, sie wollen nun als ordnende Segensbringer und nicht als blutige Despoten der Welt gegenübertreten […]. Es ist im Grunde das nämliche Werben um die Seele des Orients […]. Der Misserfolg […] führt sich natürlich auf die Unmöglichkeit zurück, die abgrundtiefen Rassengegensätze durch solche Irrationalien zu überbrücken […]. Für den armenischen Handelstypus bedeutet jedes Weltreich den ersehnten Freibrief zur Unterwanderung. […] Vor allem aber sind es die parasitären Elemente unter den Juden, welche als die eigentlichen Nutznießer des Reiches auf den Plan treten. So sah es 1935 der Althistoriker Fritz Schachermeyr.
Im gleichen Jahr taufte Reza Pahlewi, der Vater des letzten Schahs, Persien in Iran, also »Land der Arier«, um. Dieser symbolische Akt war Teil einer Annährung an die Achsenmächte und ein deutlicher Affront gegen Großbritannien und die USA. Doch wie erklärt sich, dass sein Sohn, Mohammed Reza Pahlewi, nach dessen durch die Alliierten erzwungener Abdankung diesen Kurs der Rückbesinnung auf das vorislamische Persien noch verstärken konnte? Zeit seiner Regierung nannte er sich mit einem neu geschaffenen Titel […] König der Könige, Licht der Arier […]. Er ersetzte die islamische Zeitrechnung durch eine achämenidische Ära. Nicht mehr die Hidschra, sondern die Gründung des Altpersischen Reiches bildete den Ausgangspunkt. Die Westmächte nahmen daran keinen Anstoß. Im Gegenteil: Mit modernen Waffen, Technologien und Beratern wurde der Ausbau des Landes zu einem Bollwerk der »freien Welt« – inklusive folternder Geheimpolizei, der Savak – inmitten des »orientalischen Chaos« forciert. Der Schah präsentierte sich im Gegenzug als verlässlicher Bündnispartner gegen nationalarabische und kommunistische Bewegungen. In den amerikanischen und westeuropäischen Medien beleuchtete man die Fassade des schönen Scheins: eine Demokratie westlichen Zuschnitts auf dem Weg in die Moderne. Dazu passte die arische, europanahe Vergangenheit besser als das Bekenntnis zum Islam. Als man 1971 die Gründung des Persischen Kaiserreichs durch Cyros den Großen feierte, stimmte auch Bundespräsident Gustav Heinemann in den Jubel ein: Iran hat jetzt die Schwelle zur modernen Zeit überschritten. Daher ist es gut, dass wir in diesen Wochen des Gedenkens an die Gründung des Perserreiches vor 2500 Jahren einen Augenblick verweilen. Es gilt, die Lehren der Vergangenheit richtig zu verarbeiten, um den Weg in eine glückliche Zukunft zu ebnen.25 Nicht einmal acht Jahre später, Anfang 1979, löste die brutale Theokratie der Mullahs die nicht minder bedrückende Autokratie des Schahs ab. Über Nacht war die westliche Berichterstattung über den Gottesstaat der Ayatollahs von den einschlägigen orientalisierenden Vorurteilen durchsetzt.
Zwei Filme sind repräsentativ für die westliche Wahrnehmung des vor- und des nachrevolutionären Iran: Der deutsche Pfingst-Hochglanz-Zweiteiler »Soraya« von 2003 idyllisiert den Weg der Märchenprinzessin an der Seite eines um seine Untertanen besorgten Landesvaters. Die Hollywood-Produktion »Nicht ohne meine Tochter« von 1991 demonstriert, wie religiöser Fanatismus nach dem Sturz des Schahs das Familienglück einer mit einem Iraner verheirateten Amerikanerin zerstört. Nach Quälereien und Misshandlungen durch ihren – mit Frau und Kind in sein Geburtsland zurückgekehrten – Mann gelingt es der Filmheldin schließlich, mit der gemeinsamen Tochter in die USA zu fliehen. Solche Probleme hatte Soraya nicht. Die »Deutsche auf dem Pfauenthron« war als zweite Gemahlin des letzten Schahs die meistfotografierte Frau der deutschen Regenbogenpresse. Eine Unzahl herzerweichender Reportagen trug Printprodukten wie »Das goldene Blatt« oder »Bild der Frau« den Beinamen »Soraya-Presse« ein. Die Tochter einer Deutschen und des persischen Botschafters war die ideale Projektionsfläche für Frauenträume der Nachkriegszeit. Für alle war etwas dabei: Soraya verkörperte nostalgische Sehnsucht nach der »guten alten Zeit« vor 1918, den neuen amerikanischen Luxus und das Märchen aus »Tausendundeiner Nacht«. Auch nach ihrer Scheidung – sie lieferte nicht den gewünschten Thronerben – blieb das Interesse an ihrem und dem weiteren Schicksal des Schahs in breitesten Kreisen der Bundesrepublik ungebrochen. Ließ sich die Mehrzahl weiter vom Glamour blenden, so registrierten andere, dass das von den USA gestützte Regime sich immer drastischerer Methoden bei der Verfolgung und Unterdrückung missliebiger Kritiker im eigenen, aber auch im Ausland, bediente. Anlässlich des Schah-Besuches kam es 1967 in Berlin zu erbitterten Studentenprotesten. Das unangemessen harte Vorgehen der Polizei forderte mit Benno Ohnesorg sogar ein Todesopfer.
Aktuelle Darstellungen des Nahen Ostens, die sich, je nach politischem Bedarf, in Feindbilder wandelten, wurzeln insbesondere im Konflikt der Hellenen und Perser, den »Perserkriegen«. Die Stilisierung antiker Konflikte als Gegensatz von Rasse und Kultur, als Beginn eines ewigen Krieges des Orients gegen den Okzident ist eine mediale Reflexion der Neuzeit. Das Beispiel der Schlacht bei den Thermophylen bietet dafür ein beeindruckendes Beispiel. Die Instrumentalisierung dieser Waffentat zur Legitimation sinnlosen Sterbens in Stalingrad durch Hermann Göring, die Hollywood-Produktion von 1962 »Der Löwe von Sparta« oder die Comicverfilmung »300« verkörpern Argumentationsmuster des 19.und 20.Jahrhunderts und – allen Authentizitätsbekundungen zum Trotz – nicht der Antike: Für die alten Griechen war das Opfer des Leonidas ein Beweis spartanischer Pflichterfüllung, aber kein Element zur Diskriminierung des als nicht minder ritterlich geschilderten Gegners Xerxes und seiner Soldaten.
Das frühe Mittelalter: Islam ante portas?
Karl Martell – Retter des Abendlandes?
Der Islam traf die Welt des 7.Jahrhunderts wie ein Naturereignis; die Wucht seiner Angriffe erwischte die Mehrzahl seiner Feinde eiskalt. Um zu verstehen, warum orientalisierende Vorurteile seit Mohammeds Tagen an den Islam gebunden sind, ja mit dem Wirken des Propheten und seiner Nachfolger erst entstanden, lohnt es, einen Blick auf jene fern zurückliegende Epoche zu werfen. Denn die Auseinandersetzung zwischen Orient und Okzident nimmt nicht erst mit den Kreuzzügen im 11.Jahrhundert ihren Anfang. Schon unmittelbar nach dem Tod des Propheten 632 n.Chr. trugen seine Anhänger die neue Lehre auf den Spitzen ihrer Lanzen über die Grenzen der Arabischen Halbinsel. Im Mittelpunkt der Diskussionen um einen friedfertigen Islam steht seitdem die Rolle des Dschihad, eigentlich die »Anstrengung« zu gottgefälligem Wirken, was aber durchaus auch als Aufruf zum Heiligen Krieg verstanden werden kann.
Erstmals in der Geschichte waren am Ausgang des 7.Jahrhunderts die bislang in Blutfehden zerstrittenen Wüstenstämme Arabiens unter der grünen Fahne des Propheten geeint. Hinter ihnen lagen karge Wüsten, vor ihnen fruchtbare Landstriche mit fetten Weiden und reichen Städten. Dieser Versuchung, zudem legitimiert durch das ganz eindeutig formulierte Gebot, die neue Lehre unter den Ungläubigen zu verbreiten, konnte man nicht widerstehen. Kein halbes Jahrhundert nach dem Tod Mohammeds herrschten seine Nachfolger über Syrien, Ägypten, den heutigen Irak, über den Iran sowie über das »Heilige Land«, dessen byzantinische Garnisonen schnell niedergekämpft wurden. Auch den Moslems galt Jerusalem als heilige Stadt, die nun für kommende Jahrhunderte zum Zankapfel werden sollte. Dort erwarteten die monotheistischen Weltreligionen am jüngsten Tage den Erlöser, es ist »das Königreich der Himmel«. So antwortet Sultan Saladin auf die Frage, was denn die Einnahme der Stadt Jerusalem für ihn bedeute, im gleichnamigen Historienfilm von 2004: Nichts. Und nach kurzer Pause: Oder alles.
Der erste islamische Eroberer Omar ließ 637 auf den Trümmern von Salomos Tempel die strahlende Al Axa-Moschee errichten. Durch die Eroberung durch den Islam wird Jerusalem zur eigentlichen Heiligen Stadt, die für die Christenheit endgültig die Weihen der leidgeprüften, zu befreienden Märtyrerin erfährt. Die Einnahme wird zum Anlass und Auslöser des bis dato gewaltigsten und folgenschwersten Ringens zwischen Islam und Christentum.
Doch schon bevor sich Kreuzritterheere zur Befreiung des Heiligen Grabes sammeln, kommt es zu einer Reihe heftiger Zusammenstöße zwischen den Glaubensstreitern beider Parteien. Denn schon im 7.Jahrhundert formieren sich die Heere der Kalifen in einer gewaltigen Zangenbewegung um Europa: Im Osten rannte man – zunächst erfolglos – gegen Byzanz an. Das berühmte griechische Feuer, eine Art frühes Napalm, setzte die angreifenden arabischen Schiffe in Brand. Nach sieben Jahren verlustreicher Belagerung Konstantinopels gaben die Araber 675 n. Chr. den Plan zur Eroberung auf. Beiseite legten sie ihn seither aber nie mehr.
Im Westen verlief der islamische Vorstoß zunächst erfolgreicher: Hier galt der Schlag den Westgotenreichen der Iberischen Halbinsel. 711 unterwarfen die Araber den größten Teil des heutigen Spaniens und Portugals. Der Name des Eroberers lebt bis heute in Gibraltar, das sich von »Gebel al Tarik«, also »Berg des Tarik«, ableitet, und in den Namen vieler Araber fort. Nur ein schmaler Landstreifen im Norden Spaniens behauptete sich und wurde zur Keimzelle des Widerstandes. 732 überwand eine arabische Streitmacht die Pyrenäen und fiel im Frankenreich ein. Der karolingische Hausmeier Karl Martell stellte sich ihnen entgegen und fügte ihnen zwischen Tours und Poitiers eine vernichtende Schlappe zu. Hundert Jahre später verliehen ihm seine Landsleute den Beinamen »der Hammer«. Mit beiden militärischen Abenteuern, der Eroberung Spaniens durch die Mauren und dem Einfall ins Reich der Franken, waren gleich drei Mythen und Identifikationsfiguren geboren, die das populäre Bild des Kampfes gegen den Islam in Westeuropa bis heute prägen: Karl Martell, Markgraf Roland und El Cid.
Jede große Macht des Abendlandes kreierte mindestens einen Helden im Kampf gegen den Islam. In Frankreich war es Karl Martell, der angeblich das christliche Europa vor den Ungläubigen rettete. Allein der symbolträchtige Kriegsname »der Hammer« impliziert Schlagkraft und Unüberwindlichkeit. Für Frankreich wurde er zum Nationalhelden. Schließlich ebnete »der Hammer«, ohne selbst die Krone zu tragen, den Weg für seinen Enkel, Karl den Großen.