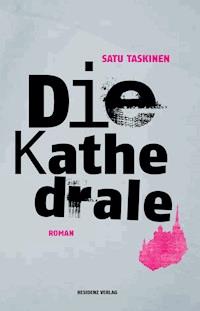18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Finnin Taru Korhonen ist dabei, in ihrer Wiener Küche einen Schweinsbraten vorzubereiten. Das ist eine ziemlich wichtige Angelegenheit, denn Mutter und Schwester ihres österreichischen Mannes kommen um 1 Uhr zum Essen. Ihre Nachbarin, die pensionierte Schauspielerin Frau Berger, wird mehr oder weniger freiwillig hinein gezogen in das Problem, den Schweinsbraten trotz mehrerer Unklarheiten in dem Rezept, das Taru ausgesucht hat, gelingen zu lassen. Unter größten Anstrengungen und trotz einiger herber Rückschläge scheint alles einen guten Weg zu nehmen, und Taru hat jetzt nur noch den einen Wunsch: "Bitte keine Überraschungen mehr." Dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Die Nichte ihres Mannes, die frühreife und politisch äußerst progressive 15jährige Elisabeth, platzt auch noch zum Essen herein. Frau Berger will partout den Schweinsbraten mitgenießen, obwohl sie Jüdin ist. Mutter und Schwester ihres Ehemanns benehmen sich heftig daneben. Und die Ehe mit dem Österreicher scheint unter dem familiären Druck an ihre Grenzen zu stoßen. Das Fest ihres Lebens, der Höhepunkt ihres krampfhaften Versuchs, sich in die Familie des Österreichers zu integrieren, misslingt. Stattdessen steigert es sich zu einer tragikomischen Kette von kleineren und größeren Katastrophen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
© 2011 by: Satu Taskinen
© 2013 für die deutsche Übersetzungby: TRANSIT Buchverlagwww.transit-verlag.de
Originaltitel: Täydellinen paisti, Teos, Helsinki, 2011 Die Übersetzung wurde gefördert durch FILI, Finnish Literature Exchange
Umschlaggestaltung und Layout: Gudrun FröbaISBN 978-3-88747-293 1
SATU TASKINEN
Der perfekteSchweinsbraten
Aus dem Finnischen von Regine Pirschel
Für alle meine Familien
Wo keine Scham ist, ist auch keine Tugend
Ich legte das Stück Schwein auf den Tisch. Von draußen drang schon zum zweiten Mal schrilles Kreischen herein. Ich ging zum Fenster und drückte die Nase ganz dicht an die Scheibe, aber da nichts Bedrohliches zu sehen war, lediglich die Hecke, die unseren Vorgarten von der Straße trennte, begann ich von vorn. Lieber Herr Fidler, wie Sie im Forum »Schweinsbraten« sehen können, halte ich eine Definition des perfekten Schweinsbratens für dringend erforderlich. Und dann, nach einer weitschweifigen Erklärung: fürs erste schlage ich die folgende vor. Ich hatte das Rezept viele Male durchgelesen. Gestern war ich damit im Supermarkt unterwegs gewesen und hatte alles gefunden außer Staudensellerie. Zum Rezept gehörte ein Foto, das ich als Vorlage an der Tür des Gewürzschranks befestigte. Der perfekte Schweinsbraten. Abbildungen dieser Art kannte man aus früheren Kinderbüchern, aus der Reklame und aus Speisekarten der Restaurants: auf einem Teller angerichtet ein bis zwei Semmelknödel oder Kartoffelknödel oder beides, eine Scheibe Braten, ein Löffel Soße, ein Klecks Sauerkraut. Das Rezept, das ich gewählt hatte, begann nett als Brief und war die Antwort auf die Frage, die ein Herr Fidler geschickt hatte: Sehr geehrter Herr Fidler. Sofern man anderthalb Kilo als zu viel empfand, sollte man laut Anweisung die ganze Sache am besten vergessen, sodass vor mir also ein Zwei-Kilo-Klumpen prangte mit reichlich Speck. In die Schwarte schneidet man Quadrate von 2 x 2 cm Größe. Anschließend würfelt man 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 mittelgroße Karotte und 100 g Staudensellerie. Ich nahm zwei leere Blatt Papier, auf das linke schrieb ich die Arbeiten, die zu erledigen waren, auf das rechte die eventuelle Einkaufsliste. Links zählte ich zusammen: Kochgeräte bereitlegen und Zutaten schneiden, Silber polieren, Tisch decken und Servietten falten, machte rund eine Stunde. Es war halb acht und noch viel zu erledigen. Im Rezept waren zudem gleichsam über Nacht neue Zutaten aufgetaucht. Wie etwa Maggikraut. Was um Himmels Willen war Maggikraut? Man schiebt den Braten mit der Speckschwarte nach unten in den Ofen und übergießt ihn mit einem halben Liter Hühnerbrühe. Inzwischen bereitet man die Soße zu. Laut Anweisung benötigte man für die Soße zerhackte Knochen. Zucker. Tomatenpüree. Entfernen Sie. Lassen Sie karamellisieren. Holzlöffel, Schaber. Nehmen Sie aus dem Ofen. Salzen Sie, pfeffern Sie, reiben Sie ein. Schieben Sie den Braten wieder in den Ofen. Häufig übergießen und den Bräunungsgrad der Schwarte beobachten. Den Ofen herunterschalten und den Braten garen lassen. Klappe einen Spalt geöffnet. Geben Sie inzwischen eine geschälte Knoblauchzehe in die Soße. Eine Prise Majoran und ein kleines Stückchen Zitronenschale. Lassen Sie die Soße durch Kochen eindicken und entfernen Sie vor dem Servieren Knoblauch und Zitronenschale. Ich blickte zum Fenster. In der Scheibe spiegelten sich meine Umrisse, sonst war nichts zu sehen, draußen herrschte dichter Nebel, wie so oft in Wien um diese Jahreszeit. Ich hatte keine Lust, einkaufen zu gehen. Vielleicht ließ sich ja der Sellerie beispielsweise durch Karotten ersetzen. Ich hatte insgesamt ein gutes Gefühl, und auch der Kaffee gluckerte zum Zeichen, dass er fertig war. Über den Gang zum Supermarkt würde ich später entscheiden, auf jeden Fall musste zunächst das Fleisch gewaschen und abgetrocknet werden. Nach getaner Arbeit setzte ich mich auf die Bank.
Es war lächerlich, dass für ein und dasselbe Gericht völlig entgegengesetzte Anleitungen existierten. Wenn es in der einen hieß, man solle den Braten häufig übergießen, damit er nur ja nicht austrocknete, wurde in der anderen das Übergießen ausdrücklich untersagt mit der Begründung, dass gerade dadurch die Kruste zäh und gummiartig würde. Im Obergeschoss hörte ich die Schritte des Österreichers, vom Schlafzimmer zur Toilette und anschließend ins Bad, wo sie verharrten, kurz darauf rauschte das Wasser. Ich blätterte lustlos durch den Stapel mit den Rezeptausdrucken. In den meisten hieß es, man solle »Schulter« kaufen, also war es wohl glaubhaft, und ich hatte mich daran gehalten. Auch hatte der Österreicher gestern richtig viel Gewese darum gemacht, und so hatte ich schließlich nachgegeben, obwohl ich der Schwiegermutter zum Feiertag Filet hätte anbieten mögen. Ich begann mich zu ärgern. Gerade das Rezept, das mir ursprünglich am besten gefallen hatte, hatte sich als das schlimmste von allen erwiesen. Der ultimative Schweinsbraten. 1,5 bis 2 kg Schweineschulter mit Schwarte. Ich strich das Blatt, das ich zerknüllt hatte, auf der Tischoberfläche glatt und band mein Haar zu festen Schwänzen, damit es mir nicht dauernd in die Augen fiel. Dann zog ich die Schürzenbänder fester. Was in aller Welt war Maggikraut? Ich konnte mich nicht erinnern, je diesem Wort begegnet zu sein. Maggisoße hingegen kannte ich mehr als gut. Und falls es nicht einmal die zu kaufen gäbe? Könnte man sie durch etwas anderes ersetzen? Durch Sojasoße? Die schüttete sich der Österreicher fast auf jedes Essen. Sojasoße passte eigentlich zu allem.
Frau Bergers Türklingel schrillte viele Male unter meinen Fingern, ehe ich drinnen Schritte und das Klimpern von Schlüsseln hörte, worauf sich die Schlösser eines nach dem anderen bewegten. Die Tür öffnete sich, und als erstes kam mir eine Wolke Zigarettenrauch entgegen, ich wich einen Schritt zurück. Als das Schlimmste vorbei war, reichte ich Frau Berger eine Tüte mit ihren Lieblingskäsecrackern.
»Kaffee?«
Ich nickte und wurde eingelassen. Ich folgte Frau Berger durch den Lförmigen dämmerigen, fast finsteren Flur in die Küche, die aus irgendeinem sonderbaren Grund ganz und gar rotgelb gestrichen war. Die Oberfläche des Spültisches blätterte von Woche zu Woche heftiger ab.
»Hier wird fleißig gewirtschaftet«, sagte ich.
Auf der Spüle türmte sich ein Kartoffelberg. Frau Berger, unsere Nachbarin, war eine kleine Frau, und während der Jahre, da ich sie kannte, war sie immer mehr zusammengeschrumpft. Ihre Nase und ihre Ohren hingegen wuchsen, und so ließ sich heute absolut nicht mehr sagen, ob sie in jungen Jahren schön gewesen war. Frau Berger antwortete mir nicht. Sie goss kalten Filterkaffee in einen kleinen Kessel, und mit dem dritten Streichholz gelang es ihr, den Herd anzuzünden. Ihre Bewegungen waren heute besonders fahrig, und ich sagte ihr, dass ich nicht sehr lange mit ihr Kaffee trinken könnte. Mutter und Schwester des Österreichers würden um ein Uhr zum Essen kommen. Maggikraut. 2 kg Schweineschulter mit Schwarte.
»So, so. Sie brauchen sich nicht dauernd zu entschuldigen. Ich werde es verkraften. Möchten Sie Kekse?«
Ich griff nach der Packung, die auf dem Tisch lag, und schüttete dunkelbraune Kekse auf einen Teller. Es folgte eine Weile Schweigen, und der Duft des warm werdenden Kaffees breitete sich in der Küche aus. Ich reckte mich, um aus dem oberen Teil des Holzschranks zwei Porzellantassen mit Untertellern zu nehmen. Die Türen waren aufgequollen, und man musste ziemlich kräftig ziehen, wenn man sie öffnen wollte. Der Schrank wackelte, das tat er immer, und noch bevor Frau Berger mich bat, vorsichtig zu sein, wusste ich, dass sie mich bitten würde, vorsichtig zu sein.
»Seien Sie vorsichtig, der Schrank wackelt«, sagte sie.
Zerhackte Knochen. Maggikraut. Ich erwähnte mein Rezept. Wir trugen alles, was wir brauchten, auf einem Tablett ins Wohnzimmer, und ich wartete auf irgendeine Fortsetzung, aber die kam nicht. Wir saßen gemeinsam an Frau Bergers Tisch, so wie schon unzählige Male zuvor. Mir gefielen ihre Porzellantassen außerordentlich, sie waren gelb, und eine von ihnen hatte einen Sprung. Frau Berger jedoch ordnete nur stumm ihre Spielkarten und ihre Kreuzworträtselhefte, obwohl es bereits nach acht Uhr war. Das Zimmer, in dem wir saßen, war voll mit irgendwelchen Dingen. Bilder, Vorhänge, Pillenschachteln auf einem Nebentisch, Videogeräte, und dazu Grünpflanzen, die vielleicht nicht viel jünger waren als ihre Besitzerin. Alles hatte seinen Platz, alles war aufgeräumt und geputzt, nur die Farbe an den Wänden und der Decke war vom Zigarettenrauch nachgedunkelt, wie in einem uralten Wiener Kaffeehaus. Es blieb mir ein ewiges Rätsel, ob das ein Zeichen für Echtheit oder einfach nur ekelig war. Mitten in all dem Kram saß Frau Berger wie auf einem Gemälde, und genau wie auf einem Gemälde schwieg sie. Warum war sie heute so still? Sonst redete sie doch ununterbrochen. Ich wartete eine Minute und noch eine zweite, aber als die Hausherrin ihrem Besuch immer noch keinerlei Aufmerksamkeit schenkte, beschloss ich, selber direkt zur Sache zu kommen.
»Schweinsbraten? Warum in aller Welt will jemand, der nicht hier geboren ist, unbedingt zum Feiertag Schweinsbraten machen?«, gab Frau Berger zur Antwort. »Warum quälen Sie sich? Lassen Sie es doch sein.«
Sie war aus ihrer Trance erwacht und sah mich mit erstaunt aufgerissenen Augen an. Sie hatte geglaubt, dass ich lieber ein finnisches Gericht zubereiten würde, und was wird in Finnland überhaupt gegessen? Ich lachte. Frau Berger scherzte bestimmt, auf Kosten von Ausländern ging das natürlich immer leicht. Sollte ich der Verwandtschaft, die nicht mal schwimmen konnte, etwa Heringsauflauf anbieten, fragte ich, und ob sie überhaupt ahnte, was Heringsauflauf war? Natürlich nicht. Als Einheimische musste sie doch wissen, dass am Feiertag für die Familienmitglieder des Österreichers nur ein einziges Gericht in Frage kam, dessen Name nicht extra erwähnt werden musste. Sie schnaubte, machte eine abwehrende Handbewegung. Ich kam erneut auf mein Thema zurück, deutete mit den Fingern an, wie dick der Stapel von Rezepten war, die ich am Ende gefunden hatte, aber Frau Berger zog nur ihre Strickjacke enger um sich, wie ein beleidigtes, schmollendes Kind. Ich begriff nicht im Mindesten, was der Grund sein könnte, und es interessierte mich auch nicht. Aber was hätte ich machen sollen? Entgegen meinen Gewohnheiten hatte ich inzwischen sämtliche Kekse vom Teller gegessen. In Wahrheit mochte ich Süßes gar nicht, aber auch das war Frau Berger nicht beizubringen, sondern sie bot mir stets Kekse, Waffeln, Reisbrei, Eierplinsen oder manchmal sogar selbstgebackenen Kuchen an, den ich natürlich nicht ablehnen konnte. Ich hatte noch kein Frühstück gehabt, denn es war mir unmöglich, gleich nach dem Aufstehen etwas zu essen. Jetzt hatte ich jedoch Hunger, sodass ich nach der Packung griff, die beiden letzten widerlich süßen, gefüllten Kekse aß, auf die leere Schachtel zeigte und sagte:
»Leer. Sie können neue auf die Einkaufsliste setzen.«
»Darauf wollte ich sowieso kommen.«
Frau Berger schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass ich zusammenfuhr. Ich bemerkte die aufgeschlagene Zeitung. Arbeitslosigkeit, Drogen, Einwanderer, Überschwemmungen, Neonazis, Preisanstieg, zunehmender Ölmangel. Ich hatte ihr schon wer weiß wie oft gesagt, dass sie aufhören sollte, Zeitung zu lesen, wenn sie davon doch nur schlechte Laune bekam. Die Nachrichten wären überall auf der Welt gleich. Und was hatten sie mit alledem hier zu tun? Mit uns und dem Feiertag? Frau Berger könnte für den Rest ihres Lebens Kopfstand machen, die Nachrichten würden sich dadurch nicht ändern.
Sie gab zu, dass ich recht hatte. Das Leben geht weiter, bis es endet. Sie konnte sich jedoch nicht den Zusatz verkneifen, dass in England immerhin die Sprache schön war. Und nicht so verlottert wie hier. Erneut schlug sie mit der Hand auf die Zeitung, aber nicht so hart wie vorhin. Es war ihr unerklärlich, wieso irgendein Einfaltspinsel auf die hirnverbrannte Idee gekommen war, anstelle des Wortes »Freude« das Wort »Spaß« einzusetzen, das erstens hässlich und zweitens falsch war. Um nur ein Beispiel zu nennen. Dann zündete sie sich eine Zigarette an. Ich tat es ihr gleich, obwohl ich mich dadurch keineswegs besser fühlen würde.
»Hätten Sie wenigstens Zeit für einen Gang zur Apotheke?«
Frau Berger beugte sich herüber und gab mir zwei Rezepte. Was war es? Schlaftabletten? Schmerztabletten? Irgendwelche Vitaminpräparate?
»Ich habe eigentlich nichts weiter im Haus als Erdäpfel, obwohl Feiertage bevorstehen und das alles. Dieses Land ist schrecklich, und genau so schrecklich ist sein Wetter. Schon wieder habe ich mehrere Tage nicht richtig geschlafen – von diesem Nebel bekomme ich Reißen in den Gliedern – sehen Sie einmal das hier.« Sie zeigte auf das Fernsehprogramm, ich wusste nicht, was sie meinte. »Als ich sechzig wurde, bedauerte ich, dass ich einst nicht nach England gegangen bin. Dort wäre alles besser, dachte ich, und das denke ich heute noch. Aber ich sagte mir damals auch, dass niemand mehr mit sechzig ins Ausland geht. Inzwischen sind mehr als zwanzig Jahre vergangen, und ich bedaure, dass ich nicht trotzdem gegangen bin.«
Das also war es. Es ging ums Einkaufen. Warum sagte sie das nicht einfach ganz normal? Jetzt kam wieder dieses England ins Spiel.
»Auch ich mag England. Ich bin nie dort gewesen.«
»Warum sind Sie nicht hingefahren, wenn Sie es doch so mögen?«
»Ich spare mir das auf.«
Sie fand meinen Gedanken offenbar absurd und sah mich von unten her an.
»So wie ich mir die besten Bissen auf dem Teller immer bis zuletzt aufhebe«, fuhr ich fort.
»Das ist Unsinn. Die besten Bissen muss man unbedingt dann essen, wenn der Hunger am größten ist. Man weiß nie, wann es zu spät ist.«
Sie wartete einen Moment. Dann ergänzte sie:
»Ich finde Sparen einfach dumm. Wegen der Inflation.«
Kann sein. Darauf wusste ich tatsächlich nichts zu sagen, mein Magen brüllte geradezu vor Hunger. Staudensellerie oder Karotte. Der Hunger machte die Beschäftigung mit dem Rezept – den bloßen Gedanken daran – zur Qual. Ich räusperte mich, um das peinliche Knurren zu übertönen.
»Wir bräuchten hier mehr Polizei. Hunderttausend tüchtige Polizisten. Damit man sich allein zur Bank wagen kann. Ich hege keinerlei Nationalgefühl für dieses Land. Die Leute jammern und klagen den lieben langen Tag und mögen nicht arbeiten. Die Ausländer machen sich nicht die Mühe, Deutsch zu lernen. Wo führt das hin? Soll ich etwa Türkisch lernen, damit der Schuster versteht, was ich will?«
Es folgte ein kurzes Schweigen.
»Noch Kaffee?«, fragte Frau Berger.
Ihre Augen blinzelten und glühten zugleich. Sie zündete sich eine neue Zigarette an, merkte, dass die vorige noch nicht aufgeraucht war, drückte sie aus und qualmte weiter.
Wie sie dort saß, sah sie aus wie ein Käfer, ein Käfer mit Brille und Perücke. Ab und zu hustete der Käfer heftig. Ich wusste nur zu gut, worauf sie aus war. Sie wollte, dass ich für sie einkaufen ging. Frau Berger lud mich gern zu sich zum Kaffee ein, um mit mir über Theaterstücke und Bücher zu reden. Zwischen den Hustenanfällen sagte sie, dass sie nicht beabsichtigte, mit dem Rauchen aufzuhören, weil laut Aussage des Arztes die Entgiftung ihres Körpers etwa sechs Jahre dauern würde, und sie fand, dass sie, falls sie zwischenzeitlich sterben würde, ganz umsonst aufgehört hätte. Das hatte eine gewisse Logik, makes sense, sagte ich. Sie passte jedes Mal auf unsere Wohnung auf, wenn wir nicht da waren. Und sie goss auch die Blumen, so gut sie konnte.
»Na schön. Haben Sie mal einen Stift?«
Frau Berger lächelte, während sie mir einen Kugelschreiber reichte. War es Zufall, dass es gerade jener war, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte? Während ich ihre Einkaufsliste durchging, rührte sie mit dem Löffel in ihrem Kaffee, ordnete den Stapel von Kreuzworträtseln und Fernsehprogrammen auf ihrem Tisch und legte die ausgebreiteten Spielkarten in die Schachtel. Eine halbe Packung Milch. Semmeln, frisch, keine abgepackten, drei Stück. Butter, ganz egal, welche Sorte, und drei Tuben süßen Senf, jenen mit dem rotbraunen Etikett.
»Und wenn es nur ganze Packungen Milch gibt?«
»Dann gar keine. Darf ich Sie bitten...«
Ich nahm meine Tasse und folgte der rauchenden Frau Berger in die Küche. Sie nahm noch einen Zug, ehe sie ihre Zigarette unter dem Wasserhahn löschte und in den Müll warf, zwischen all die Kartoffelschalen, gebrauchten Filtertüten, Mandarinenschalen, Apfelstrünke und Schlagsahnebecher. Sehr geehrter Herr Fidler. Maggikraut. Staudensellerie. 1,5 bis 2 kg Schweineschulter mit Schwarte. Es war fast neun Uhr, die Zeit drängte allmählich. Ich faltete das Rezept auseinander, das ich aus der Tasche gezogen hatte, und zeigte es Frau Berger. Ich versprach, auch in die Apotheke zu gehen. Außerdem würde ich ihr die Reste vom Mittagessen bringen, allerdings war unwahrscheinlich, dass etwas übrig bliebe, die Leute vom Lande essen viel. Der Österreicher war bestimmt derselben Meinung, das Essen reichte vermutlich hinten und vorne nicht. Ich merkte, dass sich mein Puls beschleunigte. Für gewöhnlich rauchte ich nicht auf nüchternen Magen, und die Zigarette hatte mich nervös gemacht, meine Hände zitterten regelrecht. Die Temperatur in der Küche hingegen wirkte beruhigend. Bei Frau Berger war es immer warm, viel wärmer als bei uns. Man hatte ihr die Fenster erneuert, und in ihrer Wohnung zog es nicht aus jeder Ecke so wie bei uns.
»Ich war ungerecht gegenüber den Türken. Das weiß ich wohl. Und die Nachrichten lese ich auch gar nicht mehr. Ich löse nur noch Kreuzworträtsel. Die Rätsel mag ich. Sie helfen mir, nachts einzuschlafen«, sagte Frau Berger.
Sie musterte mich prüfend wie ein Arzt. Schließlich starrte sie mir in die Augen, aber nicht so, als würde sie mich ansehen, sondern als hätte sie etwas ganz anderes im Blick. Wollte sie wieder das ewige Lied von ihrer Vergangenheit anstimmen? Sie sagte, sie erinnere sich jetzt, dass sie heute morgen von einem lauten und schrillen Kreischen erwacht war, das jedoch sofort aufgehört hatte, als sie aufgestanden war und laut gedroht hatte, die Polizei zu rufen.
»Apropos Schweine. Ich mag Polizisten. Sie haben einen hohlen Rücken und einen runden Bauch. Und eines kann ich schwören, nämlich dass Zucker früher süßer war als heute. Sind Sie ebenfalls der Meinung? Könnte es sein, dass man ihn mit irgendwas streckt?«
Polizisten? Zucker? Ich drückte meine Zigarette ärgerlich in einer Kartoffelschale im Mülleimer aus. Was sollte das alles? Irgendeine sonderbare, nach allen Seiten ausufernde, nicht im Hier und Heute angesiedelte Alte-Leute-Nummer? Ich hatte mir ihre Geschichten schon wer weiß wie oft angehört, hatte diesen mehrfach aufgewärmten scheußlichen Filterkaffee getrunken und versprochen alles zu tun, was sie wünschte, jetzt könnte sie ihrerseits mal Antworten geben. Wusste sie es oder wusste sie es nicht? Wollte sie mir helfen oder nicht? Man hätte denken können, dass sie sich freute, wenn jemand ihren Rat einholte. Haben Sie mal einen Mann gehabt?, hatte ich eines Tages gefragt. Haben Sie Kinder? Nein, hatte sie geantwortet. Ich versuchte es erneut. Ich erwähnte das Wetter, das sogar für Wiener Verhältnisse schon lange Zeit unerhört schlecht und feindselig war. Ich zeigte mit Daumen und Zeigefinger: so ein Stapel Rezepte. Die Sache sei ziemlich wichtig. Ich las das Rezept laut vor, da sie sich nicht bequemte, es selbst in die Hand zu nehmen. Ich wollte ein unvergessliches Fest. Ich wollte, dass alle zufrieden wären. Ich fragte nach Frau Bergers Interpretation des Rezepts, vor allem, was die Soße und die zerhackten Knochen betraf. Sofern sich nichts Gravierendes geändert hatte, würden die Gäste pünktlich sein und sofort an den Futtertrog wollen.
»Wovon reden Sie eigentlich?«, sagte sie, nachdem sie sich die Anleitung höchstens eine Sekunde lang angesehen hatte. »Sie benötigen überhaupt kein Rezept. Für einen Schweinsbraten braucht man nichts weiter als Kümmel, Salz, Knoblauch und einen guten Ofen. Das ist alles. Sie braten das Fleisch erst von einer Seite. Dann braten Sie es von der anderen Seite. So lange, bis es fertig ist.«
Das Wetter hatte sich noch weiter verschlechtert. Draußen war es kühl, grau, und es nieselte. Der Nebel war zum Schneiden dick, und ich war nun also gezwungen, einkaufen zu gehen, obwohl ich ursprünglich etwas anderes beschlossen hatte. Ich spielte mit den Zetteln in meinen Taschen: in der rechten hatte ich Frau Bergers Liste mitsamt den Rezepten für die Apotheke, in der linken die Anleitung für den Schweinsbraten und meine eigene Liste. Frau Bergers Einkaufsliste war am Ende länger geworden und enthielt neun anstelle der ursprünglichen sechs Posten, davon zwei mit Gewicht: Gurken und Milch. Ich würde mehr als genug zu tragen haben. Auch zur Apotheke musste ich. Aber wie hätte ich ablehnen können? Frau Berger berief sich auf ihre Schmerzen, aufs Wetter und auf ihren krummen Rücken. Sie hatte eine kranke Hüfte und kam kaum aus dem Haus, laut eigener Aussage störte es sie jedoch nicht, in ihrem Alter »wusste man bereits, was in der Welt passierte und musste nicht mehr extra hinausgehen«, und man konnte ja immer einen Nachbarn bitten, wenigstens eine Stange Zigaretten und Süßigkeiten mitzubringen. Frau Berger hatte ihr Leben eigentlich gut organisiert, von ihr konnte man lernen. Ich schob den Rucksack auf meinem Rücken zurecht und steckte die zweite Hälfte der kalten Toastbrotscheibe in den Mund. Ich war ganz allein in dem dicken Nebel mit einer Sicht von höchstens drei Metern. Wenn irgendwo in den Sträuchern jemand lauern würde, bereit, mich zu überfallen, wäre ich völlig ahnungslos. Im schlimmsten Falle lief ich dem Feind womöglich direkt in die Arme. Aus einigen Fenstern schimmerte gelbes, gemütliches Licht. Wie Weihnachten. In wenigen Wochen wäre die ganze Stadt voll von kleinen Handwerksbuden und solch gemütlichen Lichtern. Ja, in der Innenstadt, aber nicht hier, auf der Nordseite der Donau. Hier wäre es so grau und leer und feindselig wie jetzt. Auf der leeren Straße herrschte eine leere Atmosphäre und so würde es hier immer sein. Ich hörte ein Auto kommen. Es wurde lauter und lauter und schien schon fast neben mir zu sein, sicherheitshalber trat ich rasch zur Seite. Bald darauf fuhr das Auto vorbei, viel zu schnell. Meine Lederstiefel wurden nass, ich war in eine Pfütze getreten. Das Nummernschild hatte ich nicht gesehen, sonst hätte ich Anzeige erstatten können. Ich trabte weiter. Zunächst tastend, dann zuversichtlicher. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Umkehren? Auf der morgendlichen Straße vor mich hinfluchen? Einen der von Frau Berger so geliebten Polizisten rufen? Nein. Jetzt galt es, Ruhe zu bewahren, die guten Seiten der Dinge zu sehen. Etwa, dass ich aus objektiven Gründen und wegen Frau Berger den Staudensellerie quasi gezwungenermaßen einkaufen würde, was durchaus positiv zu werten war.
Frau Bergers sorgfältig geschriebene Einkaufsliste. Beim Diktieren ließ sie die Größe der Packungen oder die Marke der Lebensmittel nie unerwähnt, und das war gut so. Sie zürnte, wenn ich das Falsche brachte. Frau Berger aß Lebensmittel, die mir unbekannt waren, Backwerk, aus bestimmten Packungen, aus Packungen mit bestimmter Größe. Ich hatte sie, die pensionierte Schauspielerin, einmal gefragt, welche Rollen sie während ihrer Berufstätigkeit am liebsten gespielt hatte. Entgegen meinem Bild von der pedantischen und mürrischen heutigen Rentnerin hatte sie geantwortet. »Komödien« und von Hermann Bahrs »Konzert«, dem letzten großen Stück am Wiener Theater, in dem sie mitgewirkt hatte, erzählt. »Früher stellte das Theater gelegentlich noch etwas dar. Die heutigen Stücke sind schrecklich«, hatte sie gesagt, »in denen ist absolut kein Kern, es wird nur kreuz und quer über die Bühne gerannt und geschrieen, aber niemandem ist klar, was die Aussage sein soll. Das allerdings war schon immer so. Wissen Sie, Schauspieler sind ein dummer Haufen«, hatte Frau Berger gesagt. »Schauspieler sind wirklich dumm. Sie interessieren sich überhaupt nicht für das Stück. Sie interessieren sich einzig und allein dafür, dass sie ihr Foto auf dem Werbeplakat sehen. Und dass ihr Foto größer ist als das der anderen Schauspieler.« Sie hatte mir mehr Kaffee angeboten. Ich hatte meine Tasse hingehalten, obwohl es in meinem Magen schon gezwickt hatte. Ich hatte noch keine Lust gehabt zu gehen, und die leere Tasse ließ mich ans Ende denken. Ans Ende und ans Vorbeisein und an den nächsten Arbeitstag, der umso näher kam, je später der Abend und je kälter der Kaffee wurde. Ich hatte meinerseits Frau Berger von meinem Arbeitstag erzählt. Ich hatte eigentlich beschlossen, kein einziges Wort über meine Arbeit zu verlieren und über meinen Kunden, den – nach seinen eigenen Worten – Arbeit suchenden Alex Hauptmann, aber schon während ich es beschloss, hatte ich geahnt, wie es kommen würde. »Frau Berger, pflegen Sie an Ihren Beschlüssen festzuhalten? Tun Sie das, was Sie beschlossen haben, oder tun Sie dann etwas ganz anderes?« Ich hatte jedoch gar keine Antwort abgewartet, sondern gleich weitererzählt. Jeden Tag verließ ich die U-Bahn und passierte zwei Ampeln, um dann in ein großes Gebäude mit Glaswänden einzutreten, in dem ich arbeitete, und mit mir mehr als tausend andere Lehrer. Während ich an der Ampel wartete, dachte ich an meinen Kunden Alex Hauptmann ebenso wie an den Portier des Bildungszentrums.
»Es ist einfach lächerlich, Frau Berger, aber ich muss mir jeden Tag irgendwelche Methoden ausdenken, um vom Portier die richtigen Schlüssel zu bekommen. Weil er, noch bevor ich die Rezeption erreicht habe, mir freundlich einen guten Morgen wünscht (er erinnert sich sogar an meinen Namen) und mir dann irgendeinen x-beliebigen Schlüssel hinlegt oder sagt, die Kollegin hätte bereits alle mir zustehenden Schlüssel mitgenommen. Das stimmt jedoch nicht, aber wenn ich ihn darum bitte, in der Liste nachsehen zu dürfen, ist er beleidigt, und beim nächsten Mal ist alles noch viel schwieriger.«
»Ich habe meine Arbeitskollegin Sigrid Haydn beobachtet«, hatte ich weitererzählt. »Ich habe sie beobachtet, während sie zum Tresen des Portiers geht, da werden ein paar Worte gewechselt, und schwupp, gleiten die Schlüssel in ihre Tasche.« Sigrid hatte sich erboten zu helfen. Sie hatte eine Arbeitsteilung vorgeschlagen, dahingehend, dass sie die Schlüssel jeden Tag abholte, aber das war ja keine Lösung. Sigrid sagte: Warum können die Dinge nicht gut und einfach sein? Das ist ja mein Reden, erwiderte ich. Wenn ich bestimmen dürfte, dann wären die Dinge gut und einfach. Ob der Portier Champagner mag? Champagner macht alle Menschen fröhlich.
Frau Berger machte keine Pausen und hörte nicht zu. Wenn ich mal einen Moment schwieg, stand sie sofort auf. So auch damals. Sie sprang verdächtig behende von ihrem Stuhl hoch (wie krank war ihre Hüfte eigentlich?), wedelte heftig mit der Hand in Richtung Tür und beschleunigte die Schritte. »So«, hatte sie gesagt, »so hätte das aussehen müssen. Wenn eine Person sagt ›ich rette den Meister‹, wie sie laut Manuskript tatsächlich zu sagen hat, dann muss sie mit ihrem ganzen Körper zeigen, dass sie loseilt, um ihr Vorhaben auszuführen. Aber die Schauspieler lesen natürlich nur einen kleinen Teil des Textes. Sie lernen nichts weiter als die eigenen Repliken und dann das letzte vorherige Wort des Gegenspielers, damit sie wissen, wann ihr Einsatz kommt. Sie lernen lediglich die eigenen Repliken und können deshalb nicht begreifen, was sie sagen und sagen sollen.«
Frau Berger hatte die Hand in Richtung Tür geführt. »Schauspieler sind so dumm. Aber Christiane Hörbiger hatte etwas begriffen, als sie die Frau des Meisters spielte. Unter all den vielen gibt es immer jemanden, der begreift. Ihr war klar, was der Autor meinte, als er die Frau des Meisters zu dessen Geliebten sagen lässt ›ich bin einmal aufgewacht und da war mir, wie wenn Sie leise weinten‹. Frau Hörbiger erkannte den Spott hinter den besorgten Worten. Deshalb hob sie am Ende des Satzes die Stimme, gleichsam wie bei einer Frage, damit man ihr nicht vorwerfen könnte, sie behaupte etwas, sondern sie hatte ja nur ganz unschuldig gefragt. Ihre Rolle war wie ein zweischneidiges Schwert.« »Genau wie der Portier und Alex Hauptmann«, hatte ich ausgerufen. Da waren wir Freunde geworden. Frau Berger war herumgewuselt, hatte gezeigt, wie richtig Frau Hörbiger alles gemacht hatte.
Meine Gedanken wurden unterbrochen, als durch den Nebel erneut ein Geräusch zu hören war. Ich versuchte auszumachen, aus welcher Richtung das Fahrzeug diesmal käme. Es war unmöglich. Ich drehte mich hin und her und lauschte. Erst dachte ich »von dort« und ging auf die andere Straßenseite. Dann dachte ich »doch von drüben« und kehrte rasch zurück, ich hatte keine Lust, meine teuren Stiefel ein zweites Mal ins Wasser zu setzen. Dann plötzlich waren aus geringer Entfernung ein Bremsgeräusch und das Quietschen von Reifen zu hören, dazu ein ziemlich starker Aufprall. Ich konnte deutlich erkennen, dass die Geräusche tatsächlich von hinten kamen und dass meine ursprüngliche Annahme richtig gewesen war. Ich hockte mich in den Graben, von wo ich mir einen Eindruck vom Geschehen verschaffen und den Radfahrer beobachten konnte, der auf dem Boden lag und über seinen Sturz fluchte. Auf der nassen Straße waren kreuz und quer grüne, orange und braune Dinge verstreut. Um was es sich handeln mochte, wusste ich nicht, die Konturen waren nicht zu erkennen. Zu meinem Verdruss klingelte mein Handy. Ich versuchte die Hand auf den Apparat zu pressen, aber während ich ihn hervorholte, verstärkte sich natürlich das Klingelgeräusch. Ich drückte den grünen Knopf, obwohl ich keineswegs gezwungen war, im Gegenteil, ich hätte das Handy durchaus ganz abschalten können. Ich erkannte meinen Fehler zu spät. Dass die Finnland-Menschen aber auch immer so absolut schamlos am Telefon krähen mussten: Bist du es? Hallo, hallo.
Während ich Tuulikki zuhörte, musste ich sofort an ein Theaterstück oder einen Film denken: die Hauptdarstellerin sitzt lässig mit halbem Hintern auf einem Stuhl, sie ist voluminös und trägt bunte Sachen. Finnland-Mensch Tuulikki, die sich nach dem sogenannten Verschwinden meiner sogenannten Mutter zu meiner Patentante aufgeschwungen und erklärt hatte, beginnt ihren Redeschwall, ist entspannt und in jeder Hinsicht überströmend. Sie fließt gleichsam nach allen Seiten, aus ihr fließen all ihre Gefühle, ihre Lebensfreude, ihre Kreativität, ihre Energie und ihre Zufriedenheit, sie fließt in jede Richtung wie schweres und lebendiges Wasser. »Wie hat’s dir gefallen?«, Finnland-Tuulikki, die den größten Teil ihrer Zeit in Südfrankreich verbrachte, setzte stets mitten in der Szene ein, so als hätten wir schon mehrere Minuten am Telefon miteinander gesprochen und sie brauchte nicht erst die Situation zu checken. Was hätte ich sonst darauf sagen sollen als: »wirklich toll.« Obwohl ich gar nicht wusste, wovon sie sprach. Sie wollte wissen: »Welches der Teile?«
Der Teile?
»Wo bist du? Warum musst du flüstern?«
Das orange-braune Bündel hatte angefangen sich zu bewegen. Der Radfahrer hatte meine Anwesenheit bemerkt und rief in meine Richtung:
»Ist dort jemand? Sind Sie verletzt?«
Im Allgemeinen klingelte mein Handy wochenlang überhaupt nicht, und jetzt hatte ein Unbekannter Anruf meinen Aufenthaltsort verraten.
»Hallo, hallo?«, tönte es aus dem Apparat. »Ist dort jemand? Ich rufe an, um mich nach dem Paket zu erkundigen. Es war teuer.«
Das Paket.
»Hei! Bist du noch da?«
Klar hatte ich das Paket bekommen. Schon die dritte Woche lag es in der Küche, zwischen Heizkörper und Kühlschrank.
»Wer ruft denn dort im Hintergrund? Wo bist du eigentlich?«
Ja eben. Wo war ich eigentlich? Es dauerte eine Weile, aber dann erkannte ich deutlich das blaugraue Haus und davor das Schild, das die Passanten darauf aufmerksam machte: »Diese Hausecke ist kein Hunde-WC«. Die berechtigte, aber völlig wirkungslose Wut des Hausbesitzers war bemitleidenswert, denn gerade als Hundetoilette wurde sein Grundstück häufig benutzt, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Ich befand mich etwa auf der Hälfte der Strecke, auf der letzten Geraden vor dem Einkaufszentrum. Der Radfahrer stand auf. Er rief in den Nebel,
schüttelte die Faust. Schließlich gelang es ihm, seine verschiedenfarbigen Gegenstände aufzusammeln, und er setzte seinen Weg fort, schob aber seinen Drahtesel, an dem anscheinend irgendetwas verbogen war.
»Hei!«
»Ja, es kam vor ein paar Tagen, danke vielmals.« »Gut! Und?«
»Ich hatte noch gar nicht richtig Zeit...«
Ich stand auf und trat wieder auf die Straße. Der Radfahrer hätte sich gar nicht aufzuregen brauchen. Wenn ich mich nicht sehr irrte, war im Einkaufszentrum letzte Woche eine neue Fahrradwerkstatt eröffnet worden. Das hatte mich gefreut, ich mochte nämlich leerstehende Geschäftsräume überhaupt nicht, wenn man von der Straße her Einblick hatte. Sie waren gespenstisch. Furchterregend. Ich zog meine Sachen zurecht, schüttelte ein paar Grashalme ab. Meine Hosenbeine waren am Saum ein wenig feucht geworden.
»Die Familie des Österreichers kommt heute. Habe ich das nicht erzählt? Ich mache einen Schweinsbraten.«
Die Stiefel schienen in Ordnung zu sein.
»Des Österreichers?«
»Ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Einen schönen Feiertag!«
»Um diese Zeit? Wie viel Uhr ist es dort überhaupt? Zu dieser Stunde bist du ja normalerweise noch gar nicht wach.«
Toll. Touché. Erstaunlich, wie manche Menschen es fertig brachten, Jahrzehnte lang mit der Welt zu kämpfen, so als wären sie selbst kein Teil davon. Und eine Situation wieder mal genau wie im Kino. Denn es war doch verrückt, man schaute hin, und, obwohl man natürlich wusste, dass die Titanic (auch bei diesem dritten Besuch, oder war es schon der vierte?) sinken würde, dass Rhett Butlers Geduld tatsächlich irgendwann endete und dass der Tyrann nicht mal in den letzten Augenblicken des Zweiten Weltkriegs zur Vernunft kam, wünschte man es sich irgendwie. Man suchte nach einem Punkt, ab dem alles anders hätte laufen können. Ich lachte über meine eigene Dummheit. Ich sagte, dass ich später zurückrufen würde und schaltete das Handy aus.
Auf dem Vorplatz des Donauzentrums wurde mir schnell klar, warum auf der sonst so stillen Straße so viel Verkehr geherrscht hatte. Ich wich den Menschenmassen aus, indem ich flink wie ein Reh über die benachbarte Baustelle lief und wurde nicht erwischt, auch das ein Zeichen dafür, dass der Schweinsbraten ganz großartig gelingen würde. Aber kaum hatte ich meine eigene wie auch Frau Bergers Einkaufsliste gezückt und in der Halle des Eurospar eine Münze in den Wagen gesteckt, als mich auch schon irgendein Drängler beiseite schubste, als wäre ich ein störendes Tier. Ich erschrak, und bei meinem Versuch auszuweichen kam es zu Folgeschäden. Gerade so passieren auf der Autobahn Massenkarambolagen. Dies war genau die Art, wie überflüssigerweise das Leben von Menschen gefährdet wurde, die ganz normal und unter Einhaltung der Verkehrsregeln Auto fuhren. Tötet euch selbst! Mir doch egal. Aber lasst uns andere um Himmels willen in Ruhe. Ich sah dem Hektiker kopfschüttelnd ins Gesicht und zeigte auf den Mann vor mir, der einen Kinderwagen schob, gegen den ich in meinem Schrecken gestoßen war. Auch dieser Mann war wütend. Er sah aus wie jemand, der geduldig darauf wartete, dass ihm das Leben den ersten Anlass zum Lächeln bot. Der Drängler wiederum, der eigentliche Verursacher des Problems, verzog sich, als der wütende Mann Nummer zwei mich anschrie:
»Was fällt Ihnen eigentlich ein?«
Der Mann Nummer zwei hatte einen auffallend buschigen Schnauzbart, er trug einen teuer aussehenden Anzug aus glänzendem grauen Stoff, und bei näherem Betrachten sah er genauso aus wie Tom Selleck. Ich entschuldigte mich für meinen Anteil an dieser bedauerlichen Kette von Zusammenstößen. Ich stellte klar, dass ich nicht die einzige Schuldige war. Vielleicht nicht mal zur Hälfte. Wenn und falls es in der Halle eine Videoüberwachung gäbe, bekäme man von den Kameras die richtigen Informationen, ich war zum Werkzeug des eigentlichen Verursachers des Unglücks geworden, und Sie können mir glauben, dass diese blinde Rempelei in keiner Weise mein eigener Wille oder meine Absicht gewesen ist. Tom schnaubte nur. Er versuchte Windelpackungen im Wagen zu stapeln. Sein Kind könne die Sache bezeugen. Zum Zeichen der Versöhnung streckte ich meine Hand aus. Das Kind im Wagen sang und greinte abwechselnd. Es wollte irgendetwas, aber mir war nicht klar, was. Ich sagte zu Tom, dass sein Kind ein Anliegen habe. Toms Blick schweifte von meinem Gesicht zu den Füßen und dann wieder zu meinen Augen. Ich war froh, dass ich doch noch die neuen Lederstiefel mit den hohen Absätzen angezogen hatte. Meine Stimmung wurde milder. Ich straffte den Rücken ein wenig. Ich winkte dem Kind zu, ob nun Junge oder Mädchen, und bückte mich, um den winzigen Babyschuh aufzuheben, den es abgestreift hatte, aber Tom untersuchte den Zustand des Wagens und bemerkte meine Geste nicht, obwohl ich mich mit ausgestreckter Hand zu ihm umwandte, um ihm den Schuh seines Kindes zu reichen. Ich räusperte mich. Keine Antwort. Soll ich ihn an der Schulter stupsen? Der Junge (aufgrund des kräftigen Kinns und des runden Kopfes hatte ich entschieden, dass es sich um einen Jungen handelte) hielt einen rotweißen Lutscher in der Hand, an dem er nach dem Zusammenprall wieder andächtig leckte. Die österreichischen Farben. Ich drohte ihm mit dem Zeigefinger, spaßhaft und doch auch im Ernst. Dafür gab es einen triftigen Grund. Ich habe Lutscher nie ausstehen können. Nicht mal als Kind. Man kann sich damit die Zunge aufschneiden. Man kann daran ersticken, gerade bei solchen Zusammenstößen, Unachtsamkeiten, Unfällen. Tom sah gut aus, für den Vater eines so kleinen Kindes wirkte er recht alt. Aber in den besten Jahren, nicht zu jung, nicht zu alt, er war insgesamt schlanker und hatte weniger Falten als der Österreicher, was nicht heißen sollte, dass ich die Falten des Österreichers nicht mochte, sollte er sie ruhig haben. Aber warum schenkte mir Tom keinerlei Beachtung? Ich war ja ebenfalls noch nicht uralt. Ich nahm das seidene Kopftuch ab, das ich zu Ostern von Sigrid Haydn geschenkt bekommen hatte.
»Passen Sie künftig besser auf«, sagte Tom, drehte sich um und eilte mit seinem Kinderwagen davon.
Während all meiner Österreich-Jahre hatte ich hier noch nie jemanden Knäckebrot essen sehen. Trotzdem wurde es im Handel angeboten. Knäckebrot war der nächste Posten auf meiner Einkaufsliste, sodass ich Toilettenpapier durchstrich und Kurs auf das Brotregal nahm. Das Knäckebrot befand sich jedoch nicht mehr dort, wo es noch vor ein paar Tagen gewesen war. Ich versuchte mich zu konzentrieren, vernünftig zu denken, aber ich hatte den Eindruck, dass die Leuchtröhren des Einkaufszentrums irgendetwas Eigenartiges an sich hatten. Jedes, wirklich jedes Mal, wenn ich den Supermarkt betrat, büßte ich mein Denkvermögen ein. Ich sah mich gezwungen, kehrt zu machen. Ich hatte die zweitteuerste Variante von Toilettenpapier gewählt, wegen der Gäste. Diese Kleinigkeiten waren für ihr Wohlbefinden und das Gelingen des Festes stets mit entscheidend, das wusste ich von mir selbst. So waren die Menschen nun mal, und ich war ein Mensch. Gerade mit gelungenen Details wurden die wichtigsten Dinge kommuniziert. Ein Restaurant, in dessen Damentoilette es Tampons in einer kleinen hübschen Schachtel gab, erntete von mir immer besondere Anerkennung, seinem Personal verzieh ich viele Fehler, und ich empfahl das Lokal weiter – aber jetzt war ich mir gar nicht mehr sicher. Der Vergleich der Papierrollen war mit Zunahme der Sorten und Packungsgrößen schwierig geworden. Nicht mal mehr blind tastend ließ sich ohne weiteres durch die Folie hindurch erkennen, welche Sorte die dicksten Rollen hatte. Wenn mir jemand in der sogenannten »Schulzeit« hätte erklären können, dass die Berechnung der Funktionswerte gerade solchen Zwecken diente, wäre ich Mathematikerin geworden. Mathematiker hatten bestimmt immer Arbeit, und sie brauchten sich nicht jeden Tag mit dem Portier zu streiten. Aber von Lehrern kann man natürlich nicht neben allem anderen auch noch pädagogische Fähigkeiten verlangen. Man müsste jeweils zwei von ihnen in die Klassen stellen, so wie in unserem Bildungszentrum. Einen, der das Wissen hatte und einen, der es erklären konnte. Ich kam zu keinem rechten Ergebnis, und im Laden herrschte auf einmal großer Lärm. Meine Ohren dröhnten. Die Leuchtröhren waren störend hell. Ich hasste Einkäufe. Für gewöhnlich überließ ich sie dem Österreicher. Ich bedeckte für einen Moment mein Gesicht mit dem Tuch aus reiner Seide, das ich von meiner Arbeitskollegin Sigrid Haydn bekommen hatte, und bemerkte dabei, dass es dringend gewaschen werden musste. Ich atmete ein paar mal tief durch. Das änderte nichts an der Tatsache: Knäckebrot musste her. Ich begriff, dass ich damit vielleicht allein nicht klarkommen würde. Allerdings beschloss ich ganz umsonst, Rat zu suchen. Ein Angestellter ohne Sprachkenntnisse, Neu-Europäer vom Balkan oder von anderswo, machte mich mit seinem Schweigen nervös und nahm meine Frage nicht ernst. Es fielen ein paar böse Worte. Er machte einfach auf dem Absatz kehrt und ging. Was plagte all die Leute heute eigentlich? Und warum lag das Knäckebrot nicht mehr hier? Was dachten die sich dabei?
Dann kam mir aber doch irgendein Chef zu Hilfe. Er roch aus dem Mund, aber er verstand meine Frage. Er stand ungewöhnlich dicht neben mir, fasste mich bei der Schulter und drehte mich um.
»Hier sind Kekse und Zwieback, gute Frau. Und gleich daneben das Knäckebrot.«
Da war es tatsächlich, mit schwedischer Lizenz in einer deutschen Fabrik hergestelltes, nach Österreich importiertes Knäckebrot. Ich hatte meinem Helfer mindestens ebenso Unrecht getan wie Frau Berger den Türken, es war ja nicht seine Schuld, dass die Dinge auf der Welt so verworren waren. Ich wollte Frieden zwischen uns, rang mir einen Witz ab und sagte: dieses Brot ist ein bisschen so wie ich, wenn auch mehr aus dem Westen. Das war für den Mann vom Supermarkt eindeutig zu hoch. Ich seufzte. Dann fragte ich, warum das Knäckebrot nicht bei dem anderen Brot lag. Anzunehmen, dass das in sein Interessengebiet fiel. Zur Begründung sagte ich, dass Knäckebrot so wie Brot sei, nur trocken. Er aber hielt es mehr für Zwieback, eine bessere Antwort wusste er nicht. War er überhaupt ein Chef? Ich fragte, wo sein Vorgesetzter war. Kaffeetrinken, sagte er.
»Wissen Sie was?«, sagte ich, »ob Sie es glauben oder nicht, aber hier liegt der Grund, warum Finnland die Pisa-Studien gewinnt und Österreich sie verliert.«
»Bitte sehr«, sagte er.
»Wissen Sie, was die Pisa-Studie ist? Haben Sie Kinder?«
»Bitte sehr«, sagte er erneut und ging.
Ich hielt immer noch den Schuh von Tom Sellecks Sohn in der Hand.
Wer von hinten kommt, hat eindeutig Unrecht. Das bloße Hintensein und Vonhintenkommen reichen als Begründung dafür. Jeder, der die Fahrschule absolviert hat, kennt diese einfachste Faustregel beim Autofahren. Es braucht gar nicht weiter diskutiert zu werden, wenn erst mal geklärt ist, wer hinten und wer vorn war, schon unterwegs, schon in Fahrt. Aber ich wollte keine große Nummer daraus machen. Es war höchste Zeit, dass ich lernte, einen anständigen österreichischen Schweinsbraten zuzubereiten, wo ich jetzt schon so lange im Land war. Du wirst sehen, dachte ich und sah den Österreicher vor mir, er blickte zufrieden, stolz und froh. Sehr geehrter Herr Fidler. Zuallererst musste jetzt der Fall Maggikraut geklärt werden. Die Knödel könnte ich fertig kaufen, niemand würde den Unterschied merken. Für das Sauerkraut würden die vom Lande kommenden Gäste sorgen. So war es klipp und klar vereinbart. Ich legte den Kinderschuh ins Regal auf die Cracker. Auch deine Mutter wird staunen.
»Stop! Komm nicht rein. Auf keinen Fall!«
Stop. Na gut. Und die schweren Taschen? Durfte ich mich wenigstens bewegen? Ich stellte die Plastiktüten vorsichtig rechts und links neben mir ab, eine von ihnen kippte um, und Tomaten und Orangen kullerten heraus wie Bälle. Und Bälle waren die Tomaten und Orangen ja eigentlich auch.
»Halt!«
Der Österreicher kam mir in den Flur entgegen. Ein Feuer? Wasserschaden? Irgendein Tier? Ich baute auf den Österreicher in Notfällen, und womöglich war ein solcher Fall eingetreten. Gas? Ein leckender Herd? In Notfällen sollte man nicht fragen, sondern handeln, fragen war nervend, überflüssig und dumm. Wer hätte es gedacht, auch Scharlach muss der Gesundheitsbehörde gemeldet werden, damit sie dann tun kann, was sie vertraglich zu tun verpflichtet ist. Sämtliche Handbücher für Erste Hilfe waren voller guter Ratschläge, die man nicht befolgen durfte, wenn man die Maßnahmen nicht geübt hatte. Ja, was also? Durfte man oder durfte man nicht? Sollte man oder sollte man nicht? In jedem Erste-Hilfe-Buch, auch in jenen, die wir zu Hause hatten, stand gleich zu Beginn, dass man keine künstliche Beatmung durchführen soll, wenn man es nicht gelernt hat. Dass man viel Schaden anrichten kann, wenn man jemanden künstlich beatmet und es nicht beherrscht. Dass man unbedingt einen Kurs besuchen soll. Der Besuch ist freiwillig, aber empfehlenswert und gerade deshalb wichtig. Wegen des Trainings. Warnende Worte. Ich glaubte sie. Nun, und dann? In beiden Erste-Hilfe-Büchern, die ich gelesen hatte, folgten gleich nach der Titelseite die Anleitungen, wie man künstlich beatmete und Herzmassage praktizierte. Bei Erwachsenen anders als bei Kindern oder Babys. Und zum Schluss der warnende Hinweis, dass derjenige, der nicht half, also keine künstliche Beatmung oder Herzmassage durchführte, sich strafbar machte. Strafbar! Ja, was nun? Man musste quasi den anderen beatmen und sein Herz massieren und behaupten, man habe geglaubt, es zu können. Und hinter seiner Behauptung stehen. Denn wenn man bei den Hilfsmaßnahmen einen Schaden verursachte, den anderen tötete, versehentlich schädigte, konnte man sich damit trösten, dass auch die andere Alternative eine Straftat gewesen wäre. Immerhin konnte man sagen, dass man sein Möglichstes getan hatte, und das sollte doch etwas bedeuten. Man hatte einen Menschen künstlich beatmet, obwohl man sich geekelt hatte. In diesem Falle konnte man sich dadurch behelfen, dass man ein Taschentuch auf die Nase des Opfers legte und hindurchblies, Hauptsache, man beatmete, hieß es in dem Handbuch. Und wenn man sogar dazu außerstande war, weil dem Opfer Schaum oder etwas Ähnliches aus dem Mund kam, konnte man wenigstens das Herz massieren, rhythmisch pressen und auf professionelle Hilfe warten. So stand es in dem Handbuch, in dem alle Notsituationen aufgezählt waren, von Autounfällen über Stromschläge bis hin zu ansteckenden Kinderkrankheiten und zu Parasiten. Draußen vor unserem Haus hatte ich keine Einsatzfahrzeuge oder entsprechendes Personal gesehen. Ich hatte dennoch die Worte des Österreichers verstanden. Stop. Ich stellte also keine Fragen, sondern ließ ihn befehlen. Ich war sofort stehen geblieben, war erstarrt, steifer als ein Denkmal. Niemand könnte behaupten, dass ich nicht flexibel wäre. So müssen sich jene Leute fühlen, die ihr Geld damit verdienen, als Skulpturen in den Innenstädten herumzustehen. Manche von ihnen haben sich von oben bis unten silbern angemalt. Kann das gesund sein? Franz eilte mir entgegen, entspannt lächelnd, abwechselnd die Hand ausstreckend und Türen hinter sich schließend.
»Hier wartet eine große Überraschung.«
Bei einem Kleinkind, so hieß es, sollte man Mund und Nase mit dem eigenen Mund verschließen und vorsichtig pusten. Herzmassage war nur mit zwei Fingern erlaubt. Zu diesem Zweck zog man auf Höhe der Schultern eine gedachte gerade Linie und ging von dort dann zwei Finger breit (das wechselt!) nach unten. Dabei musste man Obacht geben, dass man die inneren Organe nicht zerquetschte. Beim Erwachsenen kam es nicht so drauf an, denn was war schlimmer, eine gebrochene Rippe oder der Tod? Eine Frage, die leicht zu beantworten war. Franz nahm mir den Rucksack vom Rücken, hob die Sachen vom Fußboden auf und gab mir den ersten Morgenkuss. Ich wischte mir mit einem Papiertaschentuch die Stirn. Er nahm auch das Taschentuch an sich und verschwand mit den Sachen in der Küche. Er war immer noch im Pyjama, seine Füße steckten in dicken Pantoffeln. Kaffeeduft zog bis in den Flur. Warum lief Franz im Pyjama herum?
»Warte dort!«, rief er aus der Küche.
Ich nahm meine grüne Strickjacke vom Garderobenhaken und zog sie an. Jetzt würde ich mich wenigstens nicht erkälten, denn das konnte ich mir nicht leisten. Erst zum Montag, wenn das Fest vorbei und die Gäste wieder abgereist wären. Allerdings würde das nicht passieren. Ich war noch nie zum Montag krank geworden. Egal, wie heftig eine Krankheit bei mir zuschlug, bis zum Sonntag Abend war ich, ungelogen, wieder kerngesund, und an meinem Befinden war nichts mehr auszusetzen. Der Österreicher kam zurück.
»... aber du bist ja ganz verschwitzt. Warum hast du nicht das Auto genommen?«, fragte er verwundert, als er meinen klatschnassen, jetzt kalten Rücken streichelte. Von oben nach unten und noch mal und noch mal. Das Auto genommen? Ich nahm nie das Auto. Ich bat ihn aufzuhören.
»Alles geht gut. Du wirst sehen. Du bist nur ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz natürlich«, sagte er.
Ich und aufgeregt? Ich war nur ein bisschen aufgeregt? Er selber sprang herum wie ein aufgescheuchter Hase. Hatte er wenigstens die Einkäufe ausgepackt, nachgesehen, ob etwas davon in den Kühlschrank musste? Der Österreicher pflegte, während er sprach oder wir uns unterhielten, wie ein Gummiband zu agieren, zu kommen, zu gehen, dabei zu reden, Fächer zu öffnen, im Kühlschrank zu wühlen, die Schuhe aus dem Flur in den Schrank zu räumen. Ich brauchte nur den Mund aufzumachen, wenn ich ihn in Bewegung setzen wollte, was manchmal sehr praktisch war, aber manchmal war das Ganze nur schwer zu durchschauen.
»Wo haben wir ..., hier!«
Der Österreicher griff nach Sigrid Haydns reinseidenem Geschenk, das ich um den Hals trug. Entschuldige, aber ich finde, dein Mantel braucht ein wenig Farbe, hatte Sigrid gesagt. Es war der erste milde Frühlingsmorgen gewesen, und wir hatten zusammen mit den anderen im Büro Kaffee getrunken. So wie immer hatte Sigrid auch an diesem Tag frische Butter und Brot mitgebracht und dafür Lob eingeheimst. Nehmt euch, so viel ihr wollt, hatte sie wie gewohnt gesagt und Dank geerntet. Ich hatte lachend gesagt, dass die Ehefrauen von Männern im Ölgeschäft eigentlich ohne Lohn arbeiten müssten. Jetzt verband mir der Österreicher mit Sigrids Tuch die Augen.
»Die Eier und die Milch«, sagte ich, »sie müssen in den Kühlschrank.«
»Nicht bei uns«, lachte Franz.
»Was hast du eigentlich vor?«
»Einen Moment noch, deine Haare ..., so! Drückt es irgendwo? Nein? Gut.«
Das Tuch war so fest gebunden, dass es mir unmöglich war, die Augen zu öffnen. Nur die Wimpern flatterten und begannen zu kitzeln. Der Österreicher fasste mich bei der Hand und zog mich entschlossen vorwärts. Ich bremste, aber er dachte nicht daran, nachzugeben.
»Hab keine Angst«, sagte er.
Ich machte einen Schritt. Dann einen zweiten. Und noch einen. Ich stieß mit dem Knie gegen die Ecke des Flurtisches, aber es tat nicht weh. Mein Aufschrei rührte mehr von dem Schreck. Waren wir schon am Ende des Flurs, war der nur so kurz? Mir kam er immer sehr lang vor, wie ein Tunnel. Der lange Flur hatte sogar meine Entscheidung beeinflusst, als wir seinerzeit auf der Suche nach einem gemeinsamen Heim all die unzähligen nichtssagenden Wohnungen besichtigt hatten.
»Wird es lange dauern?«
»Du musst keine Angst haben. Ich kümmere mich um dich«, versicherte Franz und strich über mein Knie.