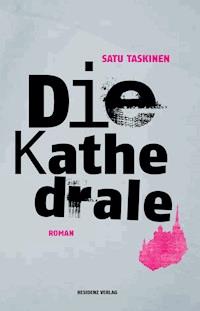
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tea lebt alleine und zurückgezogen, sie herrscht über ein Chaos aus Müll, den sie immer wieder neu sortiert. Doch wie wurde eine Tochter aus gutem Haus, eine Arztgattin und Mutter, zur Erbauerin schwankender Joghurtbechertürme - zum Messie? Als Teas Schwester Kerstin stirbt, trifft man sich zum Gottesdienst. Mit unterkühltem Humor und feinem Sinn für das Absurde beschreibt Taskinen, wie die würdevolle Trauerfeier einer bürgerlichen Familie in ihr Gegenteil kippt. Es tun sich alle Abgründe auf, die Tea zur verzweifelten Sammlerin jener scheinbar wertlosen Bausteine gemacht haben, aus denen ihr Leben besteht. Durch die Empathie ihres Erzählens gelingt es Satu Taskinen meisterhaft, uns mit der Grausamkeit des Familienlebens zu versöhnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Satu Taskinen Die Kathedrale
Satu Taskinen
Die Kathedrale
Roman
Aus dem Finnischen übersetzt von Regine Pirschel
Residenz Verlag
I – Finnish Literature Exchange für die Unterstützung.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
Die Originalausgabe »Katedraali« erschien 2014 im Verlag Teos, Helsinki.
Für die deutschsprachige Ausgabe © 2015 Residenz Verlag GmbH Salzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Thomas Kussin Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien Lektorat: Jessica Beer
ISBN 978 3 7017 4511 1
Für Ewald.
Für die Liebe. Für die Freude. Für das Mitgefühl.
Prolog
Am Unglücksort
Zu entgleisen ist viel erbarmungsloser und weit furchtbarer als gegen eine Wand zu prallen, sagte der eine Mann, er war klein, breit und philosophisch.
Das mag sein. Aber das ist keine Antwort auf eine ganz normale Frage, und ich müsste jetzt hier mal durch, Entschuldigung, sagte der andere Mann, er war lang, schmal und ungeduldig.
Ein Unfall war passiert, ein Auto war mitten auf der Straße in eine Baugrube gerutscht, Neugierige versammelten sich am Ort des Geschehens.
Ist Hilfe unterwegs?, wurde gefragt. Ja, die kommt schon, hören Sie nur. Sirenengeheul näherte sich aus mehreren Richtungen gleichzeitig, in irgendeiner Zentrale war wohl sicherheitshalber eine Art Großalarm ausgelöst worden. Bleiben würde, wer als Erster eintraf.
Auch Donner grollte. Die Frau des philosophischen Mannes mochte keinen Donner, der jagte ihr Angst ein. Sie verspürte eine wilde, mit Ehrfurcht gemischte Erregung, die ihr Herz schneller schlagen ließ und ihr Blut so stark in Wallung brachte, dass sich die Wangen röteten und die Achseln schweißfeucht wurden.
Es grollte erneut. Die Frau versuchte sich zu beruhigen: Kein Grund zur Sorge, es hat im Frühjahr ständig gedonnert, auch im Winter, im Herbst, ein ganzes Jahr lang. Nur selten wurde ein Unwetter daraus, es donnerte einfach nur. Doch dann meldeten sich andere Gedanken: vielleicht war es pures Glück gewesen, dass noch nichts Schlimmes passiert war, wo doch andererseits alles immer größer und heftiger ausfiel und häufiger auftrat, und außerhalb der Stadt schlug der Blitz auch schon mal in Passanten ein. Davon konnte man in der Zeitung lesen, zuletzt war ein 42-jähriger Mann von guter körperlicher Verfassung ums Leben gekommen. Oder waren das Zeitungen gewesen, die man nicht hätte lesen sollen? Wie viel Lüge war eigentlich erlaubt? Wie viel durfte jemand lügen, ohne dass er dafür ins Gefängnis kam, gab es so ein Gesetz überhaupt?
Der philosophische Mann dachte: Man muss abwarten, bis sich die Situation klärt.
Seine Frau dachte: Die Sirenen heulen, auch die Verkehrsbetriebe haben eigene Notfallfahrzeuge, die halten vor dem Blumengeschäft und dem Lebensmittelgeschäft, dem Call Shop, der Drogerie und der Pizzeria Azzurro, eine wahre Armada. Seine Frau beobachtete alles, sie war interessiert wie ein wachsames Tier, sie wusste auch, dass sie interessiert war wie ein wachsames Tier: die Hände raus aus den Taschen, als die Beobachtung, die Kartierung begann. Die Unfallhelfer näherten sich mit rhythmischen Schritten, sie schritten stets rhythmisch aus.
Der ungeduldige Mann dachte nervös: Wie lange wird das dauern? Die Straßenbahnen bildeten bereits eine Schlange.
Aber Straßenbahnen können nicht überholen, die Fahrer können ihre Fahrgäste nur bitten auszusteigen, sie können sich nur den Schweiß von der Stirn wischen und bedauern, mehr können sie nicht tun, wenn ein Auto mit schrecklichem Getöse in die Grube zwischen den Schienen gerutscht ist.
Die Polizei verbot den Leuten, die Straße an dieser Stelle zu überqueren, in einer Stadt gab es immer auch andere Wege.
Der ungeduldige Mann dachte: Ja, zum Glück, die gab es. Aber nicht alle Leute gehorchten, und die Polizei wiederholte das Verbot. Man musste entweder warten oder umkehren und einen anderen Weg nehmen, also vergessen Sie den Hut. Den Hut?, wunderte sich der ungeduldige Mann. Irgendjemandem war anscheinend bei diesem Wind und dem ganzen Chaos der Hut abhanden gekommen, ein guter Hut. In Australien fuhr man mit dem Traktor über solche Hüte, das war die dortige Art der Qualitätskontrolle.
Ich will die Grube sehen, sagte der ungeduldige lange Mann, aber der philosophische Mann und seine Frau verdeckten die Sicht. Eindeutig abgerutscht, aus der richtigen Bahn geworfen, geradezu entgleist, sagte der Philosoph und wich keinen Zentimeter. Er sprach mit starkzahnigem, sicherem Mund, sein Gebiss hatte im Laufe der Jahre eine eigene, leicht schiefe Form angenommen.
Seine Frau dachte bei sich, wie wach sie sich doch jetzt fühlte und wie schwer morgens immer das Aufwachen gewesen war, es sei denn, man konnte anschließend noch liegen bleiben und erneut einschlafen, und genau das konnte sie jetzt. Hätte man also besser aufpassen müssen, was man sich wünscht?
Der lange ungeduldige Mann musterte das Ehepaar: Wer war dieser Herr eigentlich? Müsste man ihn kennen? Gut, jetzt stehen wir also hier. Dass man hier warten musste und nicht mal über die Straße gehen durfte, daran war jemand anderer Schuld, vergessen Sie den Hut.
Der kleine philosophische Mann stand mit den Schuhspitzen am Rand der Grube, er hatte die Situation mit zwei Worten richtig eingeschätzt, steckte die Hände in seine Taschen, rührte sich nicht.
Der ungeduldige Mann dachte ärgerlich bei sich: Komme ich hier wirklich nicht mehr weiter, das kann nicht sein. Vielleicht konnte die Frau des philosophischen Mannes helfen. Wortreiches Bedauern usw., ich sollte jetzt wirklich weiter usw. Müssen wir jetzt wirklich miteinander streiten? Die Frau blickte in die Grube, war sie taub?
Die Frau sagte sich: Man hätte eben gleich einen anderen Weg nehmen müssen, man hat ja schon vom Anfang der Straße aus gesehen, was los war: die Menschenmenge, die Autoschlange, die aufgestauten Straßenbahnen. Es wäre einfacher, wenn ich nicht immer und bei jeder Sache unbedingt so unglaublich störrisch sein müsste. Esel. Ich sollte meine Augen benutzen. Esel. Esel. Esel.
Der ungeduldige Mann begann zu provozieren und zu scherzen, um die Aufmerksamkeit des Ehepaares zu gewinnen: Dürfte ich Ihren Mann vielleicht ein wenig schubsen? In Paris werden die Autos im Leerlauf geparkt.
Die Frau erstaunt: In Paris?
Ja, in Paris.
Die Frau: Schubsen? Meinen Sie das etwa im Ernst? Sehen Sie denn nichts? Was ist mit Ihnen? Sie wirken blass. Sind Sie krank?
Ihr Mann wich immer noch nicht, keinen Zentimeter. Vergessen Sie es, dachte der ungeduldige Mann, alles war nur ein Scherz, natürlich wird niemand in die Grube fallen.
Mein Vater, sagte der philosophische Mann. Mein Vater kam mal von der Straße ab, ein Unfall, der diesem ganz ähnlich war. Als Mann vom alten Schlag beschleunigte er in der Kurve, obwohl er natürlich vom Gas hätte gehen müssen. Er wusste schon, bevor die endgültige Kollision passieren würde, dass – der Mann wandte sich an seine Frau, für sie waren seine Gedanken und Worte stets bestimmt –, denk nur, ein Mensch, der sein Leben lang gewöhnt war zu handeln, konnte nichts weiter tun, als dazusitzen und mitsamt seinem Auto in den Graben zu fahren.
Er lachte kurz und sah seine Frau an. Sie hielt mit der einen Hand ihre Handtasche, die andere presste sie fest um den Regenschirm, dessen Spitze zum Himmel aufragte, erwartete sie sich davon jetzt Unterstützung und Sicherheit?
Das Stimmengewirr ringsum schwoll an, je mehr Publikum sich einfand. Und die Leute waren hilflos, ein halb in der Grube liegendes Auto, als wäre plötzlich die Straße unter ihm verschwunden, was ja tatsächlich der Fall war, und – auch das stand in der Zeitung! – einmal grasten acht Kühe nebeneinander auf dem Feld, da schlug der Blitz in sie ein. Es passiert so allerlei.
Der Philosoph sagte: Allerdings bin ich mir bei dieser Art von Unfällen nicht ganz sicher, es gibt ja so viele verschiedene Arten, vom Weg abzukommen. Oft hat der Mensch ja eine gewisse Vorahnung, manch einer sagt hinterher, ich wusste, dass das passieren würde, und ärgert sich, dass er nichts dagegen unternommen hat, obwohl es ihm vielleicht noch möglich gewesen wäre. Der Philosoph hatte es sich anscheinend zur Aufgabe gemacht, alle Dinge grundsätzlich zu überprüfen und die Ergebnisse dann den anderen mitzuteilen.
Der ungeduldige schmale Mann dachte ein wenig missbilligend: Die beiden Eheleute zählen sich offenbar zu den führenden Köpfen dieses Spektakels.
Die Frau sagte: Wenn und wenn und wenn, hör doch auf, das alles ist schlimm genug. Sie drückte den Arm ihres Mannes.
Sie dachte: Tiere, die nebeneinander stehen, suchen gegenseitigen Schutz. Wenn der Blitz einschlägt, bringt das Nebeneinanderstehen keinen Nutzen, im Gegenteil.
Der schmale Mann gestand sich ein, dass er die beiden andererseits verstehen konnte: Der Philosoph sprach von seinem Vater, der Vater war in seiner Rede gegenwärtig. Immer gab es Menschen, die gegenwärtig waren, und von ihnen redete man. Immer gab es einen Verursacher für alles. Immer mehr Menschen strömten herbei. Eine Straßenbahn nach der anderen musste anhalten, und wenn sich die Türen öffneten, stiegen aus den Waggons natürlich weitere fragende Fahrgäste, von denen sich einige im Halbkreis um die Grube versammelten, um zu schauen, andere waren im Handumdrehen verschwunden, wählten alternative Routen, nicht alle hatten Zeit, sie alle waren irgendwohin unterwegs, auf der Welt passierten täglich fast dieselben Sachen.
Und immer noch hörte man nur die Stimme des philosophischen Mannes, vielleicht war es seine Eigenschaft oder sein unabänderlicher Charakterzug, dass er nie von etwas abließ, sondern philosophierte und philosophierte und dasselbe Thema ständig drehte und wendete.
Kann sein, dass so ein Charakterzug, ein bestimmter Teil davon oder seine Kehrseite der Frau des Mannes, dieser Indie-Grube-Glotzerin, gefiel. Vielleicht war das schon seit Jahren der Grund dafür, dass sie immer noch mit ihm verheiratet war, ihn liebte, obwohl sie schon mindestens vor einem halben Leben zu dem Schluss gekommen war, dass er größtenteils einfach Stuss redete.
Jemand aß Eis. Ein Kind. Es war ebenfalls Teil des Publikums und aß Eis an diesem Frühlingstag, an dem man nicht wusste, ob es Regen oder Sonnenschein geben würde.
He!, wurde plötzlich gerufen. Hierher! Hier, macht Platz! Und die Leute, die aus den Straßenbahnen ausgestiegen waren (jene, die gewartet hatten, diejenigen, die ständig auf die Uhr gesehen hatten), stiegen wieder ein, bezogen die alten oder neue Plätze, die Bahnen setzten sich eine nach der anderen wie eine Karawane in Bewegung, dem ungeduldigen Mann fiel das Wort Mehltransportwaggons ein. Der philosophische Mann und seine Frau, die sich am Regenschirm festgeklammert hatte, traten jetzt gemeinsam vom Rand der Grube zurück, der Philosoph hatte irgendwie die Eingebung, dem ungeduldigen Mann zuzunicken, sollte das ein Gruß sein? Fehlten nur noch die Rose, die Schaufel Erde und das Kreuzzeichen, und wie ging es dem Fahrer des verunglückten Autos überhaupt?
Der ungeduldige Mann zögerte: Kann man jetzt einfach gehen?
Der Polizist sagte: Das kann man durchaus.
Die Frau war erleichtert, obwohl festzustellen war: Das Auto war natürlich Schrott, hoffentlich war es gut versichert, um den Fahrer kümmerte man sich mittlerweile, das Menschenleben war immer am wichtigsten, diesmal war der Fahrer des Unfallwagens mit dem bloßen Schrecken davongekommen, man weiß nie, und wer so spricht (wer? der Lehrer? die Eltern? eine andere Autoritätsperson?), schüttelt meist dabei auch den Kopf. Am besten sollte man daraus die Lehre ziehen, dass es nie genug Schuldbewusstsein gibt. Was ja auch wahr ist. Man weiß nie, wann man selbst dran ist. Um sich selbst muss man sich natürlich in erster Linie selber kümmern, man muss aufhören, ein Esel zu sein, man muss gesund essen und sich bewegen, vernünftig sein, und die Hauptverantwortung für alles trägt jeder unbedingt immer selbst, sogar wenn er ein Esel ist und sogar wenn es für seine Schwierigkeiten trotz alledem einen anderen eigentlichen Grund gibt. Aber sollte dennoch irgendetwas passieren, würde natürlich alles Erdenkliche getan werden, diese Dinge sind in diesem Teil der Welt selbstverständlich absolut geregelt.
Die Frau sah ihren Mann an, sie ballte die Hände in den Taschen zu Fäusten.
Man kann die Hände in den Taschen fest zu Fäusten zusammenpressen, wenn man nicht weinen will, die Tränen nicht mag, sie sogar fürchtet, verabscheut, keinerlei Fließen ertragen kann. Die Haare kann man aus der Stirn streichen, sie sind so geschnitten, dass man sie nach Belieben mit oder ohne Scheitel tragen kann. Man kann tief atmen und schauen und an andere Dinge denken, manchmal funktioniert es.
Der ungeduldige Mann dachte bei sich, dass diese Frau eigentlich recht schön war, woraus sich sein nächster Gedanke ergab: Nicken wir also zurück, sollte es tatsächlich ein freundlich gemeinter Gruß gewesen sein. Siehe da, dem Paar schloss sich auch ein kleines Mädchen an, jenes unauffällige kleine Kind, das Eis gegessen hatte.
Komm, komm, sagte die Frau zu dem Mädchen, das nun dem Ehepaar folgte.
Die Frau dachte: Sturm wird es heute sicherlich nicht geben, denn die Sonne hatte doch wieder über die Wolken gesiegt.
1.
Als Gleichgewicht bezeichnet man den Zustand eines mechanischen Systems, in dem sich kein Teil bewegt.
Um zehn Uhr morgens ist es endlich geschafft: duschen und anziehen. Ich kann mich aufs Sofa setzen, um Kräfte zu sammeln. Staub schwebt in einem frühlingshaften Lichtstreifen, das Licht ist durchs Fenster hereingekommen, durch die Gardine, hat eine Brücke vom Himmel nach hier drinnen gebaut, der Wind lässt die Gardine wehen, ist der Wind dieselbe Luft, die aus der Lunge kommt?
Ich kann den Kamm aus der Schublade nehmen. Die rechte Hand heben, so hoch es irgend geht, und den Kopf vorbeugen.
Ich setze die Zinken mitten auf dem Kopf ins feuchte Haar und lasse den Kamm durch das Gewicht des Arms vom Scheitel heruntergleiten. Der Schultermuskel ist fast gänzlich verkümmert, die Bewegung verläuft langsam und schmerzt. Hoch und hoch und hoch. Reicht das? Sehe ich schon halbwegs wie ein Mensch aus? Die Haare sind nachgedunkelt. Niemand könnte mehr von mir sagen, da kämmt sich eine Blondine. Und wo ist die Pinzette? Ich krame in der Schublade, nehme die Gegenstände einzeln heraus: das Schminkkästchen, in dem grüner und blauer Lidschatten und Rouge am meisten verbraucht sind, den Nagelhautschieber aus Orangenbaumholz, das Lippenstiftetui mit dem Lippenstift darin. Am Deckel des Etuis ist innen ein schmaler rechteckiger Spiegel befestigt, der rote Futterstoff beginnt sich an den Ecken zu lösen, und ich hatte schon lange vor, ihn festzukleben, das Etui wurde vor mindestens fünfundzwanzig Jahren in China hergestellt, in irgendeiner Seidenfabrik.
Es klingelt an der Tür. Ich stehe auf, suche Halt an der Sofalehne, dann an der Wand.
Ich schaue auf dem Fernsehtisch nach, blicke unter die Zeitungsstapel auf dem Sofa, überschlage die Möglichkeiten; hier ist seit Wochen niemand gewesen. Ich suche in diversen Tüten, Einkaufsbeuteln und Handtaschen. Eine der Taschen hat auf dem Boden ein Loch in der Größe eines Zeigefingers, sonst ist sie richtig gut und schick, hat sowohl Henkel als auch einen Schulterriemen. Auch Carlos findet es erstaunlich, wie gedankenlos die Leute Sachen wegwerfen, er hat recht, wenn er sagt, dass es unverantwortlich ist, die Mülltonnen mit brauchbaren Dingen zu füllen. Und: Nicht der ist reich, der viel hat, sondern der, der viel gibt. Statt selbstsüchtig, sollte man freigiebig sein, sollte auch mal an andere denken.
Es klingelt erneut an der Tür.
Ich spähe durch den Spion.
Aber ich kann jetzt nicht und habe keine Zeit.
Ich schminke mein Gesicht.
Ich creme die Schuhe ein.
Ich suche alles zusammen, was ich brauche.
Nach einer Stunde ertönt die Klingel, zwei mal kurz, das ist Mark. Ich öffne ihm die Haustür und horche auf die Geräusche im Treppenhaus: Es hallt, die Tür des Fahrstuhls wird auf und wieder zu gezogen, der Mechanismus setzt sich in Gang und der Fahrstuhl rumpelt herauf. Angesichts der Geräusche, die mit dem Vorgang verbunden sind, ist klar, warum Kinder den Fahrstuhl nicht alleine benutzen dürfen. Mark maulte deswegen immer wieder, als er noch klein war, aber eines ist klar: Auf der Welt muss es bestimmte Regeln geben. Ja, ist klar, lernte Mark wie ein Papagei nachzusprechen. Mark öffnet die Fahrstuhltür, kommt aus dem dunklen Flur auf mich zu wie eine Erscheinung, ist ja auch eine Erscheinung, kommt genau auf den Glockenschlag, wie angekündigt, lass dich umarmen, Mutter. Dagegen habe ich natürlich nichts, die Mutter zu umarmen ist gut und richtig. Mark bringt in seiner Kleidung den Geruch und die Temperatur der Luft da draußen mit. Ist es dort so kühl? Dann muss ich mir einen dickeren Mantel anziehen. Zigarettenrauch hängt in seinem Atem, auch in seinen Haaren, in den Gerüchen eines geliebten Menschen könnte man versinken. Ein Geruch kann einen allerdings auch abstoßen, Zigaretten tun niemandem gut. Wir müssen jedoch weiterkommen, also sage ich mir, das macht jetzt nichts und wir haben noch genug Zeit eine zu rauchen und zusammen eine Tasse Kaffee zu trinken, oder? Mark fragt, wie es mir geht, ich sage oh ja, oh ja, und gehe in die Küche. Ich zünde mir eine Zigarette an und lösche sie gleich wieder. Mark pflegt immer zu sagen: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn der Glaube fehlt, erreicht man nie etwas.
In der Küche sind zwei neue Motten aufgetaucht, ich hatte die Viecher eigentlich getötet, vielleicht haben sie hier irgendwo ein Nest? In einer Mehlpackung?
Ich habe nicht nach der Feier gefragt, ja, nicht mal nach der Einladung, obwohl ich mir vorgenommen hatte: Sobald Mark kommt, frage ich. Ich lasse kaltes Wasser aus dem Hahn laufen, leere das abgestandene Wasser aus dem Elektrokocher und fülle ihn mit frischem, der Kocher ist schwer, das Handgelenk hängt in einer komischen Stellung und schmerzt, der Kocher ist einfach zu schwer, er hat einen völlig unsinnigen Platz neben dem Herd, er müsste in der Nähe des Wasserhahns stehen, da ist schließlich eine Steckdose und alles. Ich drücke auf den Plastikknopf des Kochers. Unter dem Finger fühle ich eine Null und eine Eins. Ich drücke fest und lange, genau wie die Türklingel, damit auch bestimmt eine Reaktion kommt. Manchmal fließt der Strom nicht, manchmal funktionieren Maschinen und Knöpfe nicht, sie haben ihre Macken oder einen eigenen Willen.
Das Wasser beginnt zu brausen, während es sich erwärmt. Ich wische meine Hände am Geschirrtuch ab, was nimmst du?
Keine Antwort.
Ich finde Mark im Wohnzimmer mit der Fernbedienung in der Hand, der Fernseher läuft.
Wie?
Was nimmst du, Kaffee oder Tee?
Ganz egal.
Mark schaut im Stehen fern, sein Rücken ist gerade und breit, oben breiter und unten schmaler, so wie es bei jüngeren Männern sein soll, zieh doch die Jacke aus, dir wird heiß und du könntest dich erkälten. Mark folgt der Aufforderung, legt seine Jacke auf die Sessellehne, sieht sich um, prüfend, fragt, was ich eigentlich gemacht habe. Das hört sich an wie ein Tadel. Wie aus dem Mund des Zahnarztes. Der hat gesagt, ich soll nachts eine Beißschiene benutzen, weil ich offenbar mit den Zähnen knirsche, aber ich will nicht.
Wieso?
Ach, ich wollte einfach nur wissen, was du inzwischen so gemacht hast.
Ich habe die Pinzette gesucht.
Hast du sie gefunden?
Nein.
Wir stehen einen Moment da, ich stütze die Hände auf den Sessel, etwas weniger Gewicht.
Dann kommt Mark mit in die Küche, man geleitet mich hier von einem Raum in den anderen, Mark wird von meinen Kartons gebremst, schiebt sie beiseite, glaubt immer noch nicht, dass man ihnen ausweichen und nicht sie bewegen soll, einer der Kartons kippt um, sein Inhalt ist ein großer Haufen Gratiszeitungen. Mark sagt: Mit dieser Wohnung muss etwas geschehen. Er sammelt die Zeitungen ein, legt einen Teil des Stapels aufs Sofa, den Rest lässt er auf dem Fußboden liegen. Ich sage, dass die Zeitungen nach dem Datum sortiert waren.
Mark sagt, dass wir für mich eine neue Pinzette kaufen werden, man muss die Dinger sowieso zwischendurch auswechseln, denn sie verschmutzen und werden stumpf, und dann kommt es zu Entzündungen. Ich frage, ob er hier übernachten wird, und er sagt, dass er sich bereits ein Zimmer im Hotel reserviert hat. Er trinkt ein wenig Kaffee, pustet in die Tasse, stellt sie auf den Spültisch, blickt auf sein Handy, das zugleich Uhr und Radio und Kamera ist.
Gehen wir dann?
Ja, gehen wir. Ich wechsle nur meine Strumpfhose.
Ich muss die Strumpfhose wechseln, weil sie beim Waten durch die vollen Kartons ein Loch bekommen hat.
Ich trage ein weites schwarzes Strickkleid, das eigentlich in Ordnung ist, der Halsausschnitt ist zu eng, aber das Kleid sieht immer noch wie neu aus, obwohl es bereits vor dreißig Jahren angefertigt wurde.
Heute Abend kann man laut Radiomeldung eine vollständige Mondfinsternis bewundern, sofern es das Wetter erlaubt. Aus der Küche sieht man den Vollmond am besten. Man muss den Küchenhocker an die Wand stellen, mindestens auf die dritte Stufe steigen und das Vogelfernrohr aufs Gewürzregal legen. Je höher man hinaufzusteigen wagt, desto länger kann man den Mond betrachten.
Die Haare sind noch nicht trocken und ein bisschen wirr, aber ich bin angezogen: Kleid, Strumpfhose, Pumps. Kein Hut, und das wurmt mich.
Ich stoße die Schlafzimmertür auf. Mark dreht sich um, steckt dabei sein Handy in die Tasche.
Das willst du tragen?, fragt er.
Wieso, ist etwas falsch daran?
Na ja, es ist reichlich verschlissen. Hast du nichts Neueres? Ist das Kleid überhaupt sauber? Mir scheint, es riecht ein bisschen.
Ich habe nichts Neueres. Was heißt, es ist nicht sauber?
Ist es das alte von Ilse? Sieht ganz so aus. Warum trägst du Ilses alte Sachen?
Es ist aber sauber, ich habe es waschen lassen.
Dann nichts für ungut, es ist ganz okay. Doch, das ist es. Und Taschentücher? Hast du genug Taschentücher dabei?, fragt Mark.
Ja. Sitzen meine Haare?
Ja.
Gehen wir also.
Der Friedhof ist feucht vom vielen Regen. Hoch oben türmen sich die Wolken.
Am Tor bleibe ich stehen, mache eine kleine Pause.
Ich halte mich am grün gestrichenen Eisen fest und blicke zum Himmel, eine Krähe krächzt, eine, zwei, viele. Im Sommer wird es den Krähen hier zu heiß und sie ziehen in den Norden, vielleicht nach Russland, vielleicht nach Sibirien, eine ziemlich lange Strecke legen sie zurück, rasten sicherlich zwischendurch. Ich habe gelesen: Die Krähen werden mit drei Jahren monogam. Sie legen drei bis sieben Eier und brüten drei Wochen lang in der Zeit zwischen Mitte März und Ende April. Die Jungen verlassen im Alter von fünf, sechs Wochen das Nest, und im Alter von acht Monaten sehen sie bereits erwachsen aus.
Was schaust du? Stimmt etwas nicht?, fragt Mark.
Mir fehlt nichts.
Ist alles in Ordnung? Was gibt es dort zu sehen?
Mark spricht schnell und viel, hört nicht richtig zu.
Es wird nicht mehr regnen.
Stimmt.
Ein Glück, dass der tagelange Regen gerade heute aufgehört hat.
So ist es.
Bist du warm genug angezogen?
Ja.
Im Frühjahr und im Sommer sollte Schwarzes pechschwarz sein, sonst wirkt es hässlich und billiggrau.
Ilse und Bea warten schon vor der Kapelle. Ich habe sie gleich vom Parkplatz aus gesehen. Und Leo. Leo ist auch da und kommt in meine Richtung, er winkt mir leicht zu, Bea ebenfalls. Leo kommt mit Simon. Simon bleibt ein wenig hinter ihm. Leos Mantel steht offen und weht. Man kann sie alle an ihrem Wesen erkennen, ihr Wesen hat sich in all den Jahrzehnten überhaupt nicht verändert.
Wir haben einander lange nicht gesehen, ja, vielleicht ein ganzes Jahr nicht, und ich registriere einen kleinen Hüpfer in meiner Herzgegend, die Freude des Wiedererkennens. Ein Blick, und die Sache ist klar: Mark hatte recht, und Ilse trägt tatsächlich die gleichen Sachen wie ich, oder umgekehrt. Es kommt daher, dass ich Ilses altes Kleid und alten Mantel anhabe, doch mein Mantel ist nicht mehr so gut in Schuss, das Futter ist hier und da ausgebessert, ein Ärmel ist ausgefranst, aber man sieht es nicht, die kaputte Stelle ist innen, ich muss den Mantel mit der Futterseite zur Wand aufhängen. Und Bea? Wie schaut Bea aus? Ganz als wäre sie ein wenig gebeugt, als hielte sie sich nicht mehr so gerade, ihr Hals wirkt dicker als früher, der Kopf scheint zwischen den Schultern eingesunken, die jetzige Stimmung lässt auch einen stolzen Hals schrumpfen. Mark blickt mich an, als wollte er fragen: Kommst du klar? Ich sage, verzieh dich. Mark geht.
Es ist Kerstins Beerdigung. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn nicht, dass die Welt die Menschen verstößt.
Dem Alter nach waren wir Vater, Ilse, Bea, Leo, ich, Kerstin und Mark. Vater starb als Erster von uns, aber das ist lange her, und so dachte und sagte ich für gewöhnlich: Wir waren Ilse, Bea, Leo, ich, Kerstin und Mark. Und Simon? Er wurde schon ein Fremder, bevor er davonging.
Meine große Schwester Bea dreht sich um und lässt den Blick schweifen, entdeckt auch mich, winkt mir zu, ich gebe den Blick zurück, oder lächle sogar, aber das weiß Bea nicht, denn von da, wo sie steht, kann sie unmöglich meine Mimik erkennen. Bea übergibt Ilse an Mark, ist Ilse vielleicht ein Paket? Nein, Ilse ist meine Mutter. Beas, Leos, meine und Kerstins Mutter. In dieser Reihenfolge. Marks Aufgabe ist es heute, sich um Ilse zu kümmern, sie zu begleiten, zu heben und abzusetzen, alles zu tun, was Ilse wünscht, und alles andere zu unterlassen. Das war früher einmal meine Aufgabe, aber jetzt bin ich zu alt dafür. Überall habe ich Schmerzen, womöglich genau eine Folge dessen, dass ich einst Ilse betreute. Mark soll außerdem dafür sorgen, dass sämtliche Trauergäste nach der Feierstunde mit ihrem eigenen Auto oder einem Taxi den Weg von der Kapelle zu Ilses Wohnung finden und dass Ilse keinen Augenblick allein ist, aber das schafft Mark sicherlich.
Ich mache mich auf den Weg. Ich bewege mich vorwärts. Diese Schnecke hier bewegt sich vorwärts, gelangt dorthin, wo auch alle anderen sind. Wir begrüßen uns, nur Ilse schaut zu Boden, hat bisher zu keinem etwas gesagt, nicht mal zu Mark. Der Pastor kommt, gibt allen die Hand, sagt mein Beileid, nickt, blickt freundlich, auch andere Leute kommen und geben uns die Hand. Dann stehen wir dort beisammen. Der Pastor macht den Eindruck eines recht guten Pastors.
Allerdings: ein natürlicher Tod. Kerstins natürlicher Tod.
Der Kies knirscht unter den Schuhsohlen und Absätzen, als diese Menschentraube vorwärtsschreitet, das Geräusch erinnert an Essen, Zähne, Zwieback, ein ähnliches Malmen, der Hunger meldet sich, vielleicht haben wir alle schon ein wenig Hunger. Unsere Schritte vereinen sich zu einem einzigen Rhythmus, aus vielen Wesen ist dort, während wir uns versammelten, ein einziges geworden.
Wir betreten die Kapelle. Sie hat farbige Malereien an der Decke und wirkt wie die Miniaturausgabe der Kathedrale in der Innenstadt. Auch herrscht der gleiche Geruch. Alle Kirchen, jene Tempel des Heiligen Geistes, verbindet etwas: ein Kreuz und der gleiche Geruch. So riecht der Heilige Geist: nach Erde und Ton. Mir wird ein Sitzplatz zugewiesen, so wie allen anderen.
Ich meine natürlich nicht so etwas wie Mord. Ich spreche auch nicht von einem Behandlungsfehler. Auch ein völlig unpassender Ausdruck für das hier. Der Arzt hatte Kerstin regelmäßig und viele Male und immer wieder und jeden Freitag untersucht. Aber dass angeblich die Zeit gekommen war, Kerstins Zeit? Es hat nichts Natürliches, wenn ein Kind vor seiner Mutter stirbt, wenn jüngere Menschen vor den älteren sterben. Und Kerstin war doch trotzdem ein Kind. Ilses Kind, Beas, Leos und meine Schwester. Klein, mit runzeligem Nacken, und zugleich jünger als wir anderen Geschwister.
Ich bin also in allen Dingen grundsätzlich anderer Meinung als der Pastor. Vor allem darin, dass Kerstins Zeit gekommen war und dass man es als … welches Wort hatte er noch gleich benutzt … betrachten sollte. Es hängt zusammen mit diesem Satz: Eines Tages verwandelt Dankbarkeit die Erinnerung in stille Freude.
Ich drücke Marks Schulter. Er wirft mir einen Seitenblick zu, flüstert. Was ist?
Begreift er denn nicht? Ich flüstere ihm das Wort ins Ohr: Dankbarkeit.
Mark hört nicht, will nicht hören, schüttelt den Kopf, blickt wieder vor sich hin.
Hast du nicht gehört?
Und nein, Mark hört nichts. Sitzt einfach nur da. Ich versuche an etwas anderes zu denken, in die Runde zu blicken, mich in diesem kühlen Gebäude zu verhalten wie in jedem xbeliebigen anderen Gebäude. Ich habe schließlich auch bisher brav auf meinem Platz ausgeharrt.
Mark sitzt links neben Ilse, rechts neben ihr sitzen Leo und Bea, die gekrümmte Bea, deren Hals aus den Schultern herauslugt wie bei einer Schildkröte. Neben Bea sitzt Simon. Eigentlich wäre das mein Platz, aber jetzt ist dort Simon. Es spielt keine Rolle. Soll er da sitzen.
Simon ist wieder aufgetaucht. Sicherlich nicht meinetwegen. Etwa wegen Mark? Glaubt Simon, dass sein Sohn in dieser Situation die Unterstützung seines Vaters benötigt? Ich kann sagen: nein. Mark ist selbstständig, war es immer und ist es vor allem jetzt. Und Leo? Er sieht überraschend gut aus. Am besten und gesündesten und stärksten von uns allen. Ich weiß nicht, warum ich stets gedacht hatte, dass Leo von uns vieren vermutlich am kränklichsten wäre, verbraucht, verkümmert, so wie eine Bohne, die dringend Wasser braucht. Jedenfalls habe ich mich geirrt. Sehr sogar. Mein einziger Bruder Leo ist prall und knackig wie eine frische Tomate. Mein Lieblingsbruder Leo. Der jetzt die Hand hebt, um Mark hinter Ilses Rücken das Gesangbuch zu reichen.
Ilse ist wie ein alter Baum.
Der Trauerhut bedeckt ihren Kopf. Die Haare, die unter dem Hut hervorschauen, bedecken knapp den Nacken, reichen aber nicht bis auf die Schultern. Ilse hält mit ihren Händen den Mantel zusammen, obwohl es nicht so wirkt, als würde sie frieren, sie hat meines Wissens in ihrem ganzen Leben noch nie gefroren.
Leos Blick streift mich. Er wendet das Gesicht nicht ab. Leo. Leo lächelt leicht, grüßt mich auf diese Weise, erkennt mich, hebt das Kinn. Die Naht seines Mantels ist unter der Achsel eingerissen, es ist ein Mund, Leos zweiter Mund. Sagt sein Mantel mir etwas in seinem Namen, hat Leo ihn gebeten etwas zu sagen?
Je schöner die Erinnerung, desto schwerer der Abschied …, aber eines Tages … in stille Freude. So darf man hoffen …, in stille Freude.
Danach bin ich hauptsächlich abwesend und mehr auf das Reißen in der Schulter als auf irgendetwas anderes konzentriert. Allerdings merke ich, dass man mich in ein Auto packt und wir an Häusern, Geschäften, Parks und Kirchen vorbeifahren, durch die ganze Stadt, wobei wir erst nach links und wieder nach rechts abbiegen, viele Male vor Ampeln halten und dann unversehens stoppen und das Auto parken, um zweihundert Meter zu Fuß weiter zu laufen (wegen eines Autos, das zwischen den Schienen in eine Baugrube gerutscht war, hatte es schon morgens vor meinem Haus ein gewaltiges Verkehrschaos gegeben, und jetzt herrscht vor Ilses Haus ein ganz ähnliches Gedränge), und dass wir dann Türen öffnen und schließen, Treppen hochsteigen und entgegenkommende Hausbewohner grüßen, die Mäntel ausziehen und einer Menge Leute die Hände schütteln, und ich komme erst wieder richtig zur Besinnung, als ich Beas Worte höre: War es nicht trotzdem eine wirklich gute Beerdigung?
An der Wand der Kapelle hing das Bild eines Engels, eines barfüßigen Engels. Gerade diese Füße sind mir in Erinnerung geblieben. Meine eigenen Füße schmerzen. Die alten, aus dem Karton hervorgekramten Pumps sind zwar heil und gut eingefettet, aber hart und zu klein. Mit dem Alter wachsen die Füße, werden länger, breiter.
Ich kenne Ilses Küche wie meine eigene Westentasche. Sich darin zurechtzufinden ist nicht schwer, weil sie so klein ist, fast nur eine Nische. Sie hat helle Schränke und blaue Fliesen. Die Fliesen wurden an einem sonnigen Frühlingstag verlegt, als bereits Vögel aufs Fensterbrett kamen, um zu fragen, ob sie hier Futter kriegen oder sich anderswo welches suchen müssten. Die Küche riecht nach Zitrone und Putzmitteln. Und immer ist es dort leicht zugig, so war es all die Jahrzehnte hindurch. Die Luft wird ausgetauscht und die Wohnung gelüftet, hieß es an guten Tagen, an Lohntagen. Es zieht, hieß es an Tagen, an denen man gereizt und müde und der Kühlschrank leer war.
Das Wohnzimmer ist voll mit fremden Menschen, und ich bin hierher in die Küche gekommen, zu Bea. Sie ist nicht mehr so gebeugt wie noch vorhin auf dem Friedhof oder in der Kapelle zu Füßen des Engels. Sie hat jetzt wieder eine Aufgabe. Bea trägt eine schön fallende schwarze Tunika und lange Hosen, das schwarze dicke Haar ist zu einem Knoten zusammengerafft, ihre Füße stecken in derben Stiefeln, an den Fingernägeln hat sie dicken dunklen Lack. Als Kind wollte ich immer das Gleiche anziehen wie Bea, wollte sein wie sie. Es war nur ein Spiel, aber es begann sie zu ärgern. Du kichernde Meerkatze. Schließlich verbot sie mir die Nachmacherei. Du fauler Zwergaffe.
Im Wohnzimmer summt und klirrt es, die metallenen Löffel schlagen gegen die Tassen, die Essbestecke auf die Porzellanteller, die Geräusche sind trotz der Musik bis in die Küche zu hören, sie vermischen sich mit dem Gesang und der instrumentalen Begleitung.
Es gibt hier zwar eine Spülmaschine, aber Bea wäscht von Hand ab, sie hat mich unterbrochen, die ich da stehe und starre, mich an den Küchentisch oder die Wand lehne in einem Schwebezustand, die Gedanken bei den Zehen des Engels in der Kapelle und vor Augen das ganze Bild, eine Hand des Engels hing nach unten und die andere war zu einer Menschengestalt oder zu Gott ausgestreckt.
Wie viele Schmerztabletten waren es heute?
Vielleicht drei. Oder höchstens vier.
Beas Frage unterbricht mich beim Erkunden der Grenze von Schatten und Farbe. Eindeutig verläuft mitten auf dem Tisch eine Grenze.
Beas Worte, die Tatsache, dass sie zu mir spricht, ist wertvoll, was könnte ich sagen, ich phantasieloser Blutegel? Auf den Arbeitsflächen in der Küche stehen Teller, Tassen, Gläser, sie sind in den Händen und auf dem Schoß gehalten worden, man hat versucht, möglichst leise und mit geschlossenem Mund zu essen, um eine angemessene Trauerfeierstimmung zu wahren, was auch recht gut geklappt hat.
Ich helfe, sage ich dann.
Beas Hände und Unterarme stecken im Abwaschwasser, schwenken Tassen, Teller, Gläser, legen sie ins Spülbecken, stellen sie auf ein leinenes Geschirrtuch, es ist bald klatschnass, gibt es davon irgendwo mehr?, fragt Bea und wäscht ab. Weint nicht, sondern wäscht ab und wäscht und schwitzt und wäscht. Sie öffnet Schränke, rollt ihre Trauer nach allen Seiten aus dem Weg, und ich weiche aus, damit Bea in Bewegung bleiben kann, mit der Trauer auf den Fersen. Bea wächst, ich schrumpfe.
Lass mich helfen, sage ich. Ich beginne die Schränke zu untersuchen, in ihnen sind: Geschirr, Mehl, Flocken, Grütze, Müsli, Vollkornkekse, Tee und Kaffee, und ich möchte allen am liebsten sagen: Hört zu, die Türen dieser Schränke machen ein weiches Geräusch, wenn sie zugehen, Holz gegen Holz. Bea sagt, irgendwo hier waren welche, soweit ich mich erinnere, und sehnt sich jetzt, wie immer in ihrem Leben, nach weiteren zu erledigenden Aufgaben, alles, was sich irgendwie bietet, kommt infrage: Teller, die gereinigt, Nasen, die geputzt, Kinder, die gewaschen werden müssen, hungrige Bäuche, schmerzende Köpfe, zu vernähende Wunden, wehe Knochen, jedes beliebige Problem, bei dem man etwas tun kann, bei dem man Gutes tun kann. Bea läuft mit der Trauer auf den Fersen dem Guten entgegen. Bea vermag gut zu sein, wenn man im Leben nicht gut sein kann, was kann man dann tun? Vor dem Fernseher sitzen und zuschauen, wenn es knallt, ja? einfach alles laufen lassen? Nein, im Fernsehen kommt immer jemand um die Ecke, der irgendeine besondere Fähigkeit hat.
Wohin gehören diese Tassen, Bea? Sollen die Reste in den Müll oder sollen sie aufbewahrt werden? Und ich habe die Frage noch nicht zu Ende gesprochen, als mir eine Tasse aus der Hand fällt, zum Glück ist sie aus Plastik.
Geh nur, sagt Bea, das klappt hier schon.
Aber …?
Bea jedoch sieht mich an, geh, sei so lieb.
Zu Ostern wird Mastlamm gegessen, zu Weihnachten Geflügel, im Frühling Spargel, im Sommer frisches Gemüse, Beeren, Meerestiere, für jedes Tier ist die passende Jahreszeit bestimmt, in der es geopfert und gefeiert und genossen wird, die zähen Käse der Schweizer und die langen Baguettes der Franzosen.
Geh raus, sei so lieb, sagt Bea.
Ich bleibe stehen, sage: Ja, Bea. Eine wirklich gelungene Trauerfeier. Ich denke: Wäre warmes Essen vielleicht doch passender gewesen als kaltes, im Hinblick auf Kerstin? Und im Hinblick auf die Menschen, die zur Trauerfeier erschienen sind, das Leben geht weiter, all das war ohnehin schwer zu verdauen, die Gäste, es sind dreiunddreißig, auf dem Friedhof waren es noch neununddreißig, unterwegs hat es Schwund gegeben, hat man sie womöglich irgendwo vergessen? Der größte Teil der Trauergäste hat sich an die Bitte gehalten: keine Blumen. Die unersetzliche Arbeit des Hospizvereins war unserer Kerstin wichtig. Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Geldspende für den Bau des geplanten neuen Hauses. Eine angemessene Summe kann entweder auf das Konto: --- überwiesen oder nach dem Gottesdienst in die Sammelbüchse gegeben werden. Einige haben trotzdem Blumen mitgebracht und kommen jetzt in die Küche und fragen: Entschuldigen Sie die Störung, aber. Sie sprechen mit leiser, weicher Stimme, heute ist alles weich: die Stimmen, die Menschen, die Tassen, die Gläser und die Teller, die Dinge fließen, die Blicke und Gesten und Gedanken, die Erinnerungen und das Lächeln und die offenen, von Tränen gewaschenen Gesichter und Ohren und die Haut, alles ist weich und rein, hätten Sie irgendwo eine passende Vase und nein, die haben wir leider nicht mehr, es muss eine andere Lösung gefunden werden, aber was für schöne Blumen, Blütenblätter, Knospen, wer hat sie mitgebracht nackte Hälse und Handgelenke und Augen; die Blumen muss man zu den anderen dazustellen oder ein Wasserglas oder einen Eimer oder eine Kaffeekanne oder Flasche nehmen, und hier, Bea, ist ein sauberes und trockenes Geschirrtuch, hier, Bea, ich habe es gefunden, schau.
Fein, sagt Bea. Vielen Dank für die Hilfe.
Beas Nacken und Hals und Hände. Bea nimmt das Geschirrtuch. Dann setzt sie sich. Sie muss sich ein wenig hinsetzen, sagt sie. Dorothea, ich muss jetzt hier ein wenig sitzen. Sie schaut mich an und lächelt.
Sei so lieb und schließ die Tür hinter dir.
Bea will eine Weile allein sein.
Ich bin jetzt hier überflüssig. Ich verstehe das.
Im Wohnzimmer stehen und sitzen Menschen, oder sie gehen umher. Fast jeder hält eine Tasse und einen Teller in der Hand, hat etwas, an dem er sich festhalten kann, keiner ist hier mit leeren Händen unterwegs. Ich stehe vor dem Bücherregal, und da sind, in unveränderter ewiger Reihenfolge, die bekannten Bände. Ich nehme einen heraus, er beginnt: Dies ist – ich sage es ganz direkt und ohne Rücksicht darauf, dass man mich vielleicht verdächtigen wird, einer »Nostalgie-Welle« hinterherzuhecheln – dies ist ein trauriges Buch. Es schöpft aus dem Brunnen der Erinnerungen. Ich stelle das Buch zurück. Als Nächstes: Auf meinem Tisch stehen Blumen. Reizend. Dann: Wenn in dem Moment jemand behauptet hätte, er wäre verliebt, leidenschaftlich verliebt, hätte er verwundert gesagt, dass es nicht stimmt, wäre vielleicht sogar wütend geworden. Ich mustere die Bücher, eines nach dem anderen, sie stehen seit Beginn der Zeitrechnung auf demselben Platz, diese selben Bände, Nachschlagewerke, Wörterbücher, als Kind habe ich sie aufgeblättert, habe die Welt erkundet, die Dinge der Erwachsenen, Orte und Dinge, in die einzutreten ich eines Tages die Erlaubnis und die Fähigkeit haben würde. Ich habe Bea gefragt, die sowieso immer alles besser wusste: Weißt du, was der Name des Suez-Kanals tatsächlich bedeutet? Weißt du, dass Kenias Hauptstadt eigentlich Nairobi ist? Und: Magst du Arbusen? Und das hier: Als Epikuros seine Lebensarbeit, seine Weltanschauung, zu Papier brachte, hatte das Volk der Hellenen bereits fünfhundert Jahre literarischer Kulturgeschichte hinter sich.
Auf den Tischen und Borden und Fensterbrettern stehen Vasen und Gläser mit weißen Blumen, erstaunlich, wie viele verschiedene weiße Blumen es gibt, Nelken, Chrysanthemen, Rosen und Lilien. Mark steht hinter Ilse. Er hält sein Versprechen: Ich werde mich den ganzen Tag gut um Großmutter kümmern, ihr könnt ganz beruhigt sein, es wird keinerlei Probleme geben.
Ilse sitzt mitten im Zimmer auf ihrem Stuhl, hält Tasse und Teller im Schoß, und es sieht gefährlich danach aus, als könnte beides gleich herunterfallen. Ilses Lippen sind farblos und schmal. Das schwarze Stirnhaar ist so präzise geschnitten, wie es eigentlich nur mit einem Lineal gelingen kann. Ilse wirkt so reglos und ausdruckslos, dass man unwillkürlich an ein Denkmal oder ein uraltes Gebäude im Stadtzentrum denken muss, das von einer Blumenrabatte umgeben ist.
Wenn ich könnte, wäre ich gern siebenunddreißig Jahre jünger. Nicht weil ich mir wünschen würde, länger zu leben, oder weil ich das Gefühl habe, irgendetwas verpasst zu haben. Nein, ich habe Mark – über die bewusste Einladung müssen wir bei nächster Gelegenheit reden – und das genügt mir völlig. Aber ich wäre deshalb gern siebenunddreißig Jahre jünger, weil Kerstin dann zur Welt käme und ich froh wäre. Ich würde noch nicht begreifen, dass in dieser Truppe hier etwas faul ist. Ich wäre oft aber auch traurig, weil das wichtig ist. Selbst Schmerzen wären ein Grund zum Glücklichsein, da zum Leben einfach alles dazugehört. Einige Jahre lang kann man es sich leisten, manche Dinge zu verschmähen und zu verachten. Man wäre dann so wie Mark. Allerdings hat er diese Phase gerade überwunden, er ist ihr entwachsen. Man merkt es daran, wie er mit Ilse umgeht.
Der Pastor setzt sich neben Ilse. Er sagt etwas, Ilses Blick ist zu Boden gerichtet, Mark blickt abwechselnd auf den Pastor und auf sein Handy. Er hat irgendwann – ich habe nicht gemerkt, wann genau – begonnen, statt der Sweat-Shirts Hemden zu tragen, darunter hat er oft ein T-Shirt, dazu einen Gürtel, keine Rede davon, dass die Hose etwa baumelt, die lederne Geldbörse zeichnet sich prall in der Gesäßtasche ab. Und dann ist da das Handy. Immer das Handy. Ich mache ihm ein Zeichen: Weg jetzt mit dem Gerät.
Die Leute sind Ilse zugewandt. Sie halten den Kopf geneigt oder schauen einander beim Reden in die Augen, aber sie sind trotzdem Ilse zugewandt, sie zeigen auf diese Weise ihre Achtung vor der Mutter der Toten und deren Trauer. Ilse sitzt einfach da. Wenn die Leute zu ihr gehen und ihr die Hand auf die Schulter legen, nickt sie. Manchmal sagt sie: Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich bestimmt … Der Satz bricht stets ab. Manchmal kommen einzelne Worte wie »Salat«, »Ruhe«. Ilses Aufgabe heute ist: anwesend zu sein.
Mark steckt sein Handy in die Tasche. Er begreift, dass er heute echt gebraucht wird, und posiert nicht länger wie ein von seiner eigenen Wichtigkeit erfüllter Teenager. Als Kind war Mark ein schrecklicher Wildfang. Ich hatte Angst um ihn. Ich stritt täglich mit ihm und fürchtete mich wie eine Wahnsinnige, da er nicht bereit war, Simons Predigten zuzuhören oder sich ihren Inhalt zu merken, etwa, dass ein minderjähriger Junge nicht spät nachts allein in den Straßen einer großen Stadt unterwegs sein darf oder dass Ladendiebstahl kein spannendes Hobby, sondern eine ernste Sache mit weitreichenden Folgen ist. Wann ist ein Mensch erwachsen? Dann wohl, wenn er so weit zurechtkommt, dass er sich mit legalen Mitteln satt und warm halten kann und begreift, was Langeweile bedeutet. Oder nein. Erst, wenn er außerdem auch mit der Langeweile fertig wird. Sie nicht fürchtet, wie Mark es noch tut, das sieht man an all seinen Projekten, die meistens mit Verkaufen und Kaufen oder Bauen und mit Fahrten von einer Stadt zur anderen zu tun haben. Ganz zu schweigen von seinem ständigen Herumfingern an Apparaten – was wäre die Menschheit nur ohne Strom? Aber trotz alledem kann man sagen, dass er heute ein vernünftiger Mensch ist. Ein gewöhnlicher.
Das ist ein Wunder.
Die Tatsache, dass es einen gewöhnlichen Menschen gibt, ist das größte Wunder der Welt.
Ich habe Durst. Auf einmal bin ich schrecklich durstig geworden. Es kommt vom Schwitzen, von diesem kratzenden Wollkleid mit dem zu engen Halsausschnitt. Ich brauche schnell Wasser. Das steht ja in gläsernen Krügen auf dem Tisch bereit. Wasser und Zitronenscheiben und Gläser, alles ist reichlich und überreichlich vorhanden. Leo und Bea bringen Nachschub aus der Küche, sobald etwas fehlt, Mangel ist tatsächlich nie das eigentliche Problem gewesen.
Wenn ich fünfundzwanzig Jahre jünger wäre, würde ich noch lieben. Oder doch nicht. Ich würde nicht lieben, mir würde erstmals die Tatsache bewusst werden, dass ich nicht liebe, aber ich würde es nicht für einen Dauerzustand halten, sondern glauben und erwarten, dass die Dinge sich ändern, dass irgendeine neue Erfahrung kommen und für Spannung sorgen würde. Ich würde mich dafür interessieren, was die Zukunft bringt, weil sie auch bisher jeden Tag neue und spannende Informationen aus der Welt geliefert hatte, enthüllt hatte, wie die Dinge funktionierten. Wie etwa die Schwerkraft. Was für eine erstaunliche Sache. Und man redete von Computerterminals und Autotelefonen und Faxgeräten. Vater war Produktentwickler und oft auf Reisen, von denen er etwas mitbrachte, Ramsch und Spielsachen. Er sagte, dass seine Arbeit darin bestünde, mehr Licht in die Welt zu bringen, und das klang wichtig – wichtigtuerisch, laut Ilse –, ein bisschen unglaubhaft und übertrieben. Vater sprach pausenlos von neuen Fertigkeiten, von den Menschen, die Welt war seiner Ansicht nach voller neuer, spannender, fähiger Menschen. So konnten wir auch selbst werden, wenn wir nur wollten. Weil wir eine prächtige Sippe waren, gesund und wohlgeraten, und im Wohlstand lebten.
Vater sagte: Was kaufen wir?
Ilse sagte: dieses. Manchmal sagte sie auch: jenes.
Ich wäre noch ein ungeformter Klumpen, der Ilses Befehle aufnimmt und die Lücke füllt, die entsteht, wenn Ilse will und befiehlt, ihr Ziel aber aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Es muss verhindert werden, dass Ilse die Lücke sieht. Die Vorstellung, dass sie die Lücke nicht bemerken würde, ist falsch.
Ilse sitzt in ihrem Stuhl. Ihre Augen fallen zu, vielleicht ist sie eingenickt. Ihr Körper neigt sich nach vorn und Mark drückt sie wieder in den Sitz zurück. Mark passt auf und hilft. Er stellt ihr eine Frage. Ilse schüttelt den Kopf, sie gibt Mark das Geschirr, das sie im Schoß hielt.
Der Pastor räuspert sich und steht auf. Er wartet darauf, dass die Leute merken, dass er einige Worte sagen möchte. Jemand ist so aufmerksam, die Musik abzuschalten. Der Pastor blickt in die Runde, wendet sich dann an die Trauergäste. Dem Menschen fällt es nicht immer leicht zu glauben, beginnt er. Und fährt fort: Dass man aber in allen Lebenslagen auf den Schöpfer vertrauen könnte, auf die größte Liebe, die nie verurteilt, sondern immer trägt. Der Pastor spricht von der großen Liebe, der nie versiegenden, sagt mehrmals dasselbe auf unterschiedliche Weise. Dann spricht er von der Dankbarkeit, so wie schon in der Kapelle. Auch von der Trauer und Sehnsucht, die irgendwann, mit der Zeit, zu Akzeptanz und schließlich zu stillem Dank werden können, wenn wir es zulassen. Es hängt von uns selbst ab.
Ich trinke in großen Schlucken Wasser, es gleitet in Stücken hinunter und tut fast weh im Hals. Ich stelle das leere Glas auf den Schreibtisch. Dort liegt heute eine Decke, sodass man keine Angst haben muss, Ränder zu verursachen.
Es ist schwer, lange reglos zu stehen. Tante Jolesch, Jugend ohne Gott, Der Idiot, Philosophie der Freude. Die Bibel, sogar zwei Bibeln. Ich nehme die Bibel aus dem Regal, öffne sie. Zwischen den Seiten stecken Zeitungsausschnitte, zunächst Kerstins Todesanzeige, Kerstin Leeb, entschlafen am Sonntag, 27. 4. Dann folgt Vaters Todesanzeige. Und auch die einiger Onkel und Tanten, die ich nicht näher gekannt habe, nur vom Namen her, dazu gibt es Geschichten, etwa: Er fuhr mit dem Fahrrad herum, bis er einen Herzschlag bekam und starb. Und: Dort wurde der Rasen gemäht, als wäre man in England. Oder: Jeden Donnerstag gab es frischen Gugelhupf, man musste ihn nur holen. Oder: Irgendwann gingen sie heimlich, still und leise nach Amerika. So was eben.
Mein Nachbar blickt mich an. Ich flüstere ihm zu: Glauben Sie an Zufälle? Er hört nicht, gibt nur einen unbestimmten Laut von sich und schüttelt den Kopf. Ich gebe es auf.
Die Todesanzeigen sind glatt, zwischen den goldumrandeten Seiten der Bibel. Sie wurden dort geglättet. Ihre Falten und Schmerzen. Niemand von uns lebt für sich allein, und niemand stirbt für sich allein. Die Stelle, an der sie liegen, ist in den Büchern der Chronik. Gott sagte zu David: Du darfst mir keinen Tempel bauen, denn deine Hände sind blutig. Aber Salomo. Salomo darf. Der Tempel, den König Salomo für den Herrn baute, war sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. Es gab einen großen Vorsaal, nach innen geweitete Fensteröffnungen, einen Seitenflügel, den Tempelsaal, Nebenkammern und alles Mögliche.
Ich stelle die Bibel ins Regal zurück. Der Pastor gibt weitere Freundlichkeiten von sich. Er spricht von »jenen schweren Zeiten« und »schmerzlichen Momenten«.
Dann äußert er Tadel, sagt, dass der Mensch seine kostbare Zeit nicht verschwenden soll, um sich mit Überflüssigem zu befassen. Da schauen alle automatisch zu Boden.
Er könnte doch einfach auf den Schöpfer vertrauen, sagt der Pastor noch. Dann ist die Rede zu Ende.
Die Leute regen sich wieder. Man reicht dem Pastor eine Kaffeetasse, die er zwar entgegennimmt, aber mit der Hand bedeckt zum Zeichen, dass er keinen Kaffee mehr möchte und auch nicht wünscht, dass man ihn danach fragt. Man lässt ihn allein sitzen. Man achtet, aber meidet ihn. Man lässt ihn in Ruhe, darauf läuft es hinaus.
Ich gieße mir beim Tisch erneut Wasser ein und gehe mit dem Glas in der Hand zur anderen Seite des Raumes, wo auf dem Sofa inzwischen eine Lücke entstanden ist, in die genau ein Mensch hineinpasst. In diesem Zimmer gibt es nicht genug Stühle für alle dreiunddreißig Personen. Dreiunddreißig Sitzplätze in einer gewöhnlichen Wohnung, das ist ziemlich viel verlangt.
Auf dem Sofa sitzen. Das Glas auf den Tisch stellen. Kaffee trinken, der jetzt serviert wird, und sich bedanken. Es ist ein bisschen so, als wäre dies ein Café, denn sobald ich sitze, wird mir serviert, im Stehen nicht, wohl aber im Sitzen. Kaffee wird mir eingeschenkt, ich komme nur dazu, kurz aufzublicken, komme nicht dazu, Fragen zu beantworten, mir werden auch keine gestellt, und schon ist die Tasse wieder voll, und so schlürfe ich denn. Wasser und Kaffee. Ich bin hier Ehrengast. Nur einer von vieren zwar, aber immerhin. Ich mag es zu schlürfen. Ich möchte es am liebsten die ganze Zeit tun. So ein Ritual. Ich möchte überhaupt einmal im Leben sagen können: Wollen wir zusammen Kaffee trinken? Ich möchte einen Gast erwarten können, möchte den Kaffeetisch decken, die Tassen füllen, Zucker und Milch unterrühren und wissen und fühlen, dass es das jetzt ist: Kekse und das Leben.
Carlos kommt allerdings recht häufig. Er bringt Likör oder Kuchen mit. Hausmeister Carlos klingelt an der Tür und kommt einfach herein, zu jeder beliebigen Tageszeit. Mein Freund Carlos traut sich, er sagt jedes Mal: Passt hier noch einer rein? Wann räumst du ein bisschen auf?
Carlos spottet unnötig viel. Ebenso wie Mark. Sie begreifen es nicht, auch wenn ich es ihnen noch so oft sage und zeige.
Warum sieht es in deiner Wohnung aus, als wäre nichts fertig?, fragt Carlos.
Wozu all diese Kartons?, fragt Mark.
Ja, warum? Etwa, weil keiner da ist, der sich um die Dinge kümmert? Nein, daran liegt es nicht. Der Kümmerer ist nur langsamer als die Welt. Es ist schwer, mit der Entwicklung Schritt zu halten, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich daran zu halten. Das ist auch der Grund, warum ich mich so oft verspäte. Da versucht man, der Welt und den Dingen hinterherzulaufen, kommt aber immer zu spät. Man selbst ist eine Schildkröte, während man um sich herum lauter Hasen hat. Der Tag müsste fünfundzwanzig Stunden haben. Dreißig wären noch besser, dann könnte man es schaffen, außer dem Frühstück wenigstens noch zu Mittag zu essen und das Bett zu machen, bevor wieder Schlafenszeit ist.
Fünfundzwanzig Stunden am Tag wären gut, sage ich zu meinem Nachbarn. Ich sammle die herumstehenden Tassen und Teller ein, sie können dann hier abgeholt und in die Küche gebracht werden, sie sind alle benutzt. Man bräuchte ein Tablett oder einen Korb.
27. 4., Kerstin Leeb. Kerstins Todesanzeige und die Ziffern darauf, sie könnten alles mögliche bedeuten, einen Tag, eine Summe, die Qualität, den Preis, die Reihenfolge, Gramm, Liter, Quadratmeter, Höhe, Breite, Gewicht, Hämoglobin oder Blutdruck. Zwei und sieben und vier. Ich habe den Zeitungsausschnitt an mich genommen. So wie auch die übrigen Zeitungsausschnitte. Darunter befinden sich auch Ilses und Vaters Heiratsurkunde und Marks Taufanzeige. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Die Zettel, die in der Bibel gesteckt haben, sind so glatt, als wären sie gebügelt worden. Die Glätte lässt sie wertvoll, außergewöhnlich erscheinen. Die Glätte hat sie stärker, zäher gemacht. Warum werden alte Dokumente für die Nachkommen erst lebendig, wenn ihr Besitzer tot ist? Was steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Es ist nun mal so.
Bea kommt und kontrolliert, ob das Büfett in Ordnung ist. Ob nur ja nichts getropft oder gespritzt hat, kein Behälter leer ist oder leckt. Bea versteht es, sich zu kümmern. Hat es immer verstanden.
Obwohl Fisch und Fleisch in umgekehrter Reihenfolge stehen sollten.





























