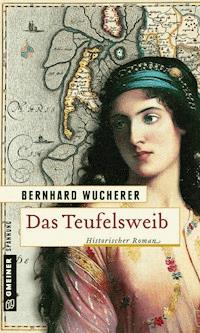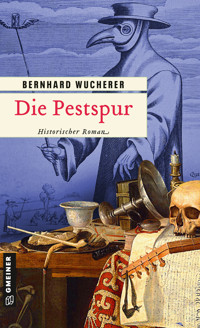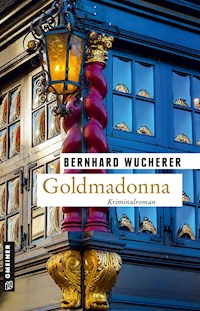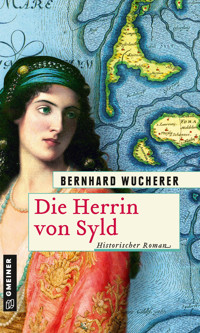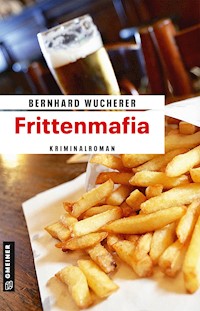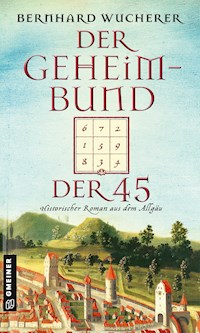Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trilogie um die Kastellansfamilie
- Sprache: Deutsch
Staufen im Jahr 1635. Inmitten des Dreißigjährigen Krieges bricht die Pest aus. Aber nicht nur der schwarze Tod fordert Opfer. Zwischen dem Totengräber und der Familie des Staufener Kastellans, Ulrich Dreyling von Wagrain, ist noch eine alte Rechnung offen und der missgünstige Dorfschuster setzt alles daran, die jüdische Familie Bomberg aus ihrem Haus zu vertreiben und zu vernichten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Wucherer
Der Peststurm
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013–Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Man on Horseback« von Gerard ter Borch; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_ter_Borch_-_Man_on_Horseback.jpg
Den 706 Pesttoten Staufens des Jahres 1635 gewidmet
Der Markt Staufen
Staufen: Legende
1: Staufenberg: Hier beginnt mit den Söhnen des »Kastellans« der Vorspann zur Geschichte.
2: »Galgenbihl«: Richtstätte der Herrschaft Staufen auf einer Kuppe am Fuß des Staufenberges.
3. Obergölchenwanger Grat: (Der heutige Hochgrat, verzerrt dargestellt.) Hauptberg der Nagelfluhkette. Nach rechts guter Blick in die Schweizer Berge.
4. Wirtshaus »Zur Krone«: Stammtaverne des Totengräbers und des Medicus. Provisorischer Gerichtssaal.
5. Anwesen der Familie Bomberg: Die jüdische Familie ist im Fokus des bösartigen Schuhmachers Hemmo Grob.
6. Seelesgraben: Lebensader des Dorfes. Der Bach fließt nach rechts durch den Unterflecken.
7. Marktplatz: Gesellschaftlicher Dreh- und Angelpunkt des Dorfes. Hier steht der Pranger.
8. Wirtshaus »Zum Löwen«: War in besseren Zeiten Sitz der Staufner Handwerkszünfte.
9: »Färberhaus und Pestfriedhof«: (beide nicht sichtbar) Zum Haus des Blaufärbers Hannß Opser führen 70 Schritte am »Löwen« vorbei. Zum Pestfriedhof geht es etwa 2 Meilen den Berg hinunter in das kleine Dorf Weißbach.
10: Propsteigebäude: Wohnung des Propstes Johannes Glatt und »Behandlungsraum« des Medicus.
11: Wirtshaus »Zur Alten Sonne«: Hier wohnt »Josen Bueb«, ortsbekannter Grantler und Gegner des Propstes.
12.: Alter Marstall: Nach Verwaisung der Residenzstadt vorübergehend als gräfliche Kanzlei genutzt.
13: Entenpfuhl: Liegt direkt hinter dem Marstallgebäude (verdeckt).
14: Schloss Staufen: Links das große Herrschaftsgebäude. Rechts das kleine Vogteigebäude, Arbeitsplatz des »Kastellans«.
15. Schlossbuckel: Einziger offizieller Weg zum Schloss und danach weiter auf den Kapfberg.
16. Fuß des Kapfberges: Eines der Forst- und Jagdreviere des Reichsgrafen Hugo zu Königsegg Rothenfels.
17: Alte Schießstätte: Liegt am Fuß des Kapfberges, errichtet durch Freiherr Georg von Königsegg.
18: Verbindungsweg zur »Salzstraße« (Die alte Reichsstraße): Dieser Weg führt zum Heustadel des Bauern Moosmann und zum Siechenhaus. Die alte Militär- und Handelsstraße geht von Hall in Tirol aus an Staufen vorbei nach Lindau am Bodensee.
Schloss Staufen 1
Schloss Staufen 2
Schloss Staufen: Legende
1. Herrschaftsgebäude (Palas): Im EG mehrere Repräsentationsräume. Darüber der »Rittersaal«. Im 3. und 4. Geschoss Wohnung der gräflichen Familie.
2. Gästehaus mit Schlosskapelle: Im 2. Geschoss Verbindung zur Kapelle, der Gottesmutter Maria – Hausheilige der gräflichen Familie – geweiht.
3. Nordturm (Dürnitz): Wachturm mit Blick auf das Dorf hinunter und zum Staufenberg hinüber. Die Wachstube im EG kann vom Gästehaus aus mit beheizt werden.
4. Südturm: Wachturm mit Blick nach Weißach, in die Berge und nach Vorarlberg. Im oberen Strock befindet sich die Verwahrzelle des Schlosses.
5. Stallungen und Wirtschaftsgebäude: Mehrere Kutschen- und Schlittenstellplätze mit Pferdestall (Marstall). Drei Nutzviehställe mit Reparaturwerkstatt und Schmiedewerkstatt.
6. Lagerhaus: Im Keller das Weinlager. Darüber liegt die Speisekammer. Im 2. Geschoss ein Heulager, unter dem Dach das Strohlager.
7. Vogteigebäude: Wohnung des »Kastellans«.
8. Nordwesttürmchen: In beiden Stockwerken gibt es Verbindungstüren zum Vogteigebäude. Darunter liegt die gut bestückte Waffen- und Rüstungskammer.
9. Gemüse- und Kräutergarten: Nach außen – besonders nach Süden hin – ungenügend gesichert. Dies ist das Reich der »Kastellanin«.
10. Schlossstraße: Einziger Weg vom Dorf zum Schloss. Von da aus weiter auf den Kapfberg. Der steile »Schlossbuckel« ist gerade im Winter schwer zu befahren.
1635von May bisSanct Nikolaustag
»Meine Feder ist zu schwach unnd die Trübsal dieses Jahrs zu groß, alls daß ich es den Nachkommen nicht genugsam beschreiben kann.
Es ist nicht zu glauben, was die verarmte Bürgerschafft ausgestanden hat. Wäre ein gantzes Buch zu schreiben.«
Kapitel 1
Die Hinrichtung desaus dem Herzogtum Schlesienins Allgäu geflohenen Arztes Heinrich Schwartz, der es Ende vergangenen Jahres mittels verteufelt gut dosierter Kräutergiftmischungen geschafft hatte, die einfachen Bauern- und Handwerkerfamilien des Tausend-Seelen-Dorfes Staufen glauben zu machen, dass ihre Verwandten und Freunde langsam an der Pestilenz erkrankt und schlussendlich daran gestorben waren, lag jetzt knapp zwei Wochen zurück. Deswegen vermochte es die Leiche des auf dem ›Galgenbihl‹ erhängten Giftmörders mittlerweile, noch erbärmlicher zum Himmel zu stinken als dessen von Gott verdammte Taten, die erst aufgrund ihrer Aufdeckung durch den Medizinstudiosus Eginhard, ältester Sohn des Staufner Schlossverwalters Hannß Ulrich Dreyling von Wagrain, ruchbar geworden waren.
Urheber dieser Giftmordserie war allerdings nicht der Medicus, sondern ein anderer: Der zwar ebenfalls, aber nicht aus Schlesien, sondern aus der Residenzstadt Immenstadt, geflohene Totengräber Ruland Berging hatte diese Schweinerei dereinst ausgeheckt und mit dem versoffenen, arg heruntergekommenen Medicus bis ins Detail geplant. Allerdings hatte er die Früchte seines mörderischen Plans nicht mehr ernten können. Da ihm nach der Ermordung zweier Knaben, die er aufgrund einer Namensverwechslung für unliebsame Zeugen gehalten hatte, der Boden zu heiß geworden und er einmal mehr bei Nacht und Nebel abgehauen war, hatte der Medicus die Sache allein durchgezogen und mit seiner Giftmordserie, der innerhalb weniger Monate 69 unschuldige Männer, Frauen und Greise, ja sogar Kinder zum Opfer gefallen waren, viel Geld verdient, letztendlich aber für seine schändlichen Taten gebüßt, noch bevor er, wie er es ursprünglich geplant hatte, mit Einsetzen der warmen Jahreszeit sein profitables Unwesen hatte weiter treiben können.
Dass der seinerzeit gerade noch rechtzeitig aus Staufen geflohene Totengräber ausgerechnet genau zu dem Zeitpunkt, an dem Heinrich Schwartz sein Leben am Strick aushauchte, zurückgekommen war, dürfte kein Zufall gewesen sein. Immerhin hatte ihn der Medicus ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verraten und somit nicht mehr mit der Giftmordserie, und auch nicht mehr mit den Kindermorden, in Verbindung bringen können, weswegen der Totengräber–kaum, dass sich der am Galgen zappelnde Medicus eingenässt hatte, ihm die Zunge aus dem Mund gequollen und das letzte Leben aus ihm gewichen war–vor den um den Galgen herum versammelten Staufnern verschwörerisch gemurmelt hatte, dass er ›im rechten Augenblick, nicht zu früh und nicht zu spät‹, zurückgekommen sei. Das ›nicht zu spät‹ würde jetzt und fürderhin eine unglaublich böse Rolle spielen, das ›nicht zu früh‹ hatte ihm vor knapp zwei Wochen im Angesicht seines erhängten Kumpans das eigene Weiterleben gesichert, um erneut anderen das Leben nehmen zu können, im Moment jedenfalls.
Zudem hatte Ruland Berging geahnt, dass die wahren Zeugen seines seinerzeitigen Gesprächs mit dem Medicus auf dem Kirchhof–Lodewig und Diederich, die zwei jüngeren der drei Söhne des Staufner Schlossverwalters–immer noch am Leben waren, und ihn immer noch verraten könnten, weswegen er sich eines Tages ebenfalls einnässen könnte, ohne dass seine Füße den Boden berührten. Wenn die wüssten, dass ich der Initiator dieser Mordserie gewesen bin und deswegen versehentlich die beiden Blaufärbersöhne, Otward und Didrik Opser, umgebracht habe, würden sie mich wahrscheinlich nicht nur hängen, sondern gleich aufs Rad flechten oder vierteilen, hatte er sich seinerzeit mit einem hämischen Grinsen auf den vernarbten Lippen gedacht.
*
Ließe das Gekrächze der schwarzen Vogelschar die Menschen nicht ständig zum Galgenbihl hochblicken, würde die Vollstreckung des Gerichtsurteils am verhassten Medicus wohl bald in Vergessenheit geraten. Dessen Taten aber würden die Staufner wohl niemals loslassen, obwohl sie jetzt anderes, ihr eigenes Überleben, im Kopf hatten. Denn der Krieg, den man jetzt den ›Großen Krieg‹ nannte, tobte immer noch durch Europa und verschonte auch das Allgäu nicht. Nachdem die Protestanten trotz der Beteiligung schwedischer Kontingente bei Nördlingen eine herbe Niederlage hatten erleiden müssen, waren auch kaiserliche Truppen bis in den letzten Zipfel des deutschen Südens vorgestoßen und wüteten seither auch dort wie die Berserker. Der malträtierten Bevölkerung allerdings war egal, ob es die lutherischen Fanatiker oder Truppen der Katholischen Liga waren, die marodierend über sie herfielen–der Gräuel, den beide Seiten anrichteten, war unbeschreiblich. Im Februar vergangenen Jahres hatten die Schweden von Leutkirch, Isny und Wangen aus Raubzüge in die Umgebung unternommen und dabei Ellhofen und Lindenberg niedergebrannt. Dabei waren sie Staufen bedenklich nah gekommen. Am Fasnachtsdienstag dieses Jahres war Scheidegg–ebenfalls ein Dorf nahe Staufen–dran gewesen. Am 19. März waren in Schwangau 400 Kroaten vom Kaiserlichen Regiment ›Isolani‹ eingefallen und hatten unter anderem 500 Pfund Brot für ihre Truppenverpflegung erzwungen–wie sie dies bewerkstelligt hatten, konnten nur diejenigen wissen, die den marodierenden Söldnern entkommen waren. Kurz darauf hatten die Schweden Kaufbeuren besetzt, und ihr Generalfeldmarschall Horn war nach Kempten vorgerückt, wo er bei Nacht die kaiserlichen Besatzer überrumpelt hatte. Während Memmingen beschossen worden war, hatten sich von Lindau aus 1800 kaiserliche Soldaten und bewaffnete Vorarlberger Bauern in Marsch gesetzt, um die verhassten Schweden aus Wangen zu vertreiben. So waren die Scharmützel immer näher gekommen und rund um das rothenfelsische Gebiet, zu dem Staufen gehörte, ausgetragen worden. Dennoch war der Krieg mit den Bewohnern des kleinen Dorfes zu Füßen des Staufenberges bisher eher gnädig umgegangen. Nur aus der Ferne waren die beängstigenden Kanonenschüsse zu hören. Wenn an einem Tag nichts davon, sondern nur das Zwitschern der aus dem Süden zurückgekehrten Vögel, zu hören war, hatten die Staufner das Gefühl, als wenn der Krieg seine Kraft verlieren und nicht alles stimmen würde, was ihnen durch fahrende Händler und Reisende zugetragen worden war. Aber das täuschte. Auch wenn man eigentlich hätte glauben sollen, dass die gegnerischen Truppen genug miteinander zu tun gehabt hatten, war dies eine Fehleinschätzung, denn um das hilflose Volk zu schinden, war für die längst verrohten Soldaten noch immer genug Zeit übrig gewesen.
Aber noch hatte sich der Gräuel den Weg bis nach Staufen hinein nur ein einziges Mal Bahn gebrochen, und so versuchte die Bevölkerung, aus ihrem mehr als bescheidenen Leben das Beste zu machen. Die warme Jahreszeit war angebrochen und ließ nach der letztjährigen Mordserie und dem darauf folgenden harten Winter das Dasein wenigstens etwas erträglicher werden. Außerdem fand wieder der Wochenmarkt, eine lebensnotwendige Veranstaltung, statt. Es war erst der dritte Markttag, der seit dem unaufgeklärten Tod eines gräflichen Wachsoldaten auf dem Staufner Marktplatz abgehalten werden durfte. Hugo Graf zu Königsegg-Rothenfels, Regent der Herrschaft Staufen, hatte das im vergangenen Herbst durch seinen Oberamtmann Conrad Speen ausgesprochene Marktverbot gnädigerweise aufgehoben und der Bevölkerung somit wieder die Gelegenheit gegeben, Handel zu treiben und dringend benötigte Lebensmittel einzukaufen–falls sie diese überhaupt bezahlen konnten. Bei seinen diesbezüglichen Überlegungen hatte er sich davon leiten lassen, den arbeitsfähigen Teil seiner Staufner Untertanen endlich wieder zu Kräften kommen zu lassen, um–wie es sich aus seiner Sicht für ordentliche Untertanen gehörte–den Zehnten entrichten zu können. Er war es leid, dass immer gerade dann, wenn es seinen Untertanen einigermaßen gut ging und sie korrekt Steuern zahlen konnten, aus was für Gründen auch immer Unbill über sein Herrschaftsgebiet zog oder gar schlechte Zeiten hereinbrachen. Aber was waren schon schlechte Zeiten? Die verarmte Bevölkerung des Rothenfelsischen Gebietes kannte nichts anderes – mit dem Unterschied, dass alles noch viel schlimmer kommen würde.
*
Obwohl es sich noch nicht überall herumgesprochen hatte, dass auf dem Staufner Marktplatz im Unterflecken endlich wieder etwas los war, hatte an diesem Mittwoch erstmalig eine beachtliche Händlerschar den Weg nach Staufen gefunden.
Aber nicht nur deswegen war es ein ganz besonderer Tag für die einheimische Bevölkerung. Der Staufner Schlossverwalter, den hier alle nur ›Ulrich‹ nannten oder als ›Kastellan‹ bezeichneten, wollte den Familien das Geld zurückzahlen, das der Medicus ihren Verwandten vor nicht allzu langer Zeit für seine ›Dienste‹ abgenommen hatte, bevor er sie vergiftete, und das Eginhard zusammen mit seinem Vater wiedergefunden hatte. Um dies möglichst reibungslos ablaufen zu lassen, hatte der zudem auch noch als interimistischer Ortsvorsteher fungierende gräfliche Beamte mitten auf den Markt ein Tischchen gestellt, auf dem jetzt eine Art Quittungsbuch bereitlag, in dem die Angehörigen der damaligen Opfer des Arztes nach dem Empfang des Geldes ihre Kreuzchen machen konnten. Jetzt musste der allseits geachtete, großgewachsene Mann nur noch darauf warten, dass die Leute kommen würden und er mit jedem Einzelnen würde abrechnen können.
Zu seiner Sicherheit und zur Sicherheit des Geldes hatte ihm Oberamtmann Speen zwei Wachsoldaten aus der Residenzstadt Immenstadt geschickt. Aufgrund der Erfahrungen, die einst zwei ihrer Kameraden auf dem hiesigen Markt hatten machen müssen, waren sie nicht gerne nach Staufen geritten. Aber Befehl war schließlich Befehl. Ihre Angst, Staufen, wie einst ein anderer Soldat, bäuchlings auf ihre Pferde gebunden, verlassen zu müssen, hatte wenigstens den Vorteil, dass sie ihre Aufgabe ernst nehmen und noch wachsamer sein würden, als dies ohnehin der Fall war.
Obwohl noch früh am Morgen, baute schon ein Händler nach dem anderen seinen Stand auf. Offensichtlich hatte es den erhofften Erfolg gezeitigt, dass die Staufner die Hinrichtung des Arztes dafür hatten nutzen können, um bei den auswärtigen Gaffern für ihren Wochenmarkt zu werben. Der Weißgerber und der Rotgerber hatten ihren Gemeinschaftsstand bereits komplett aufgebaut und ihre Waren verkaufsfördernd drapiert, ebenso der Nadler, der Drechsler und die beiden Kesselflicker, die sich misstrauisch beäugten. Die Bechtelerbäuerin schleppte gerade einen Haufen Schafspelze, etliche gestrickte Kittel und eine Vielzahl grau und braun gewirkter Strümpfe aller Größen herbei, um sie auf einem groben Holztisch auszubreiten. Obwohl die kräftige Frau mit dem wirren Haar wusste, dass sie jetzt im Frühjahr wesentlich schlechtere Geschäfte machen würde als im Herbst, war sie bestens bestückt und gut gelaunt. Da dem Kastellan über den Winter hinweg der Tabakvorrat knapp geworden war, hielt er Ausschau nach dem ›Rauchhändler‹, der stets auch Pfeifen und anderen Tand mit sich führte. Während der hohe gräfliche Beamte überlegte, ob er sich auch noch eine der modernen Meerschaumpfeifen, die der betagte Händler im letzten Jahr aus Flandern eingeführt hatte, leisten sollte, sah er die beiden Karren des bohnenlangen Gemüsebauern aus Lindau, gefolgt vom pausbäckigen Weinbauern aus Kressbronn und ein Stück dahinter das klapprige Gefährt des als listig bekannten jüdischen Öl- und Fetthändlers, der bis vom Oberschwäbischen angereist war, hintereinander in den Ort hereinholpern. Um sich eines eventuellen Hinterhaltes auf dem berüchtigten Hahnschenkel besser erwehren zu können, hatten sie es vorgezogen, im schützenden Tross zu reisen.
»Na endlich«, rief ihnen der interimsweise eingesetzte Ortsvorsteher, der sich schon Sorgen darum gemacht hatte, ob heute wohl einige Lebensmittelhändler kommen würden, winkend und lachend entgegen. So nach und nach füllte sich der Platz. Mittlerweile trafen die letzten Handwerker und Krämer, zu denen auch der ›Bunte Jakob‹ zählte, ein. Dessen Wagen war so vielfarbig, weil er mit allem schacherte, was sich zu Geld machen ließ. Dass es das allerorten bekannte Schlitzohr mit der Herkunft seiner Waren nicht immer genau nahm, kratzte nicht im Mindesten an seinem Ansehen. Er war ein Faktotum, das auf jeden Markt gehörte. So war es kein Wunder, dass ihm die Kinder des Dorfes freudestrahlend entgegenrannten.
Judith Bomberg, der Frau des einzigen Juden im Dorf, war es trotz aller Probleme über den Winter gelungen, aus ihren wenigen Hühnern und dem einzig verbliebenen Hahn eine beachtliche Zucht hervorzubringen. Die gut aussehende Frau mochte zwar noch nicht allzu viel davon entbehren, konnte aber immerhin schon neun Junghennen und etliche Dutzend Eier zum Kauf anbieten. Als die letzten Fieranten ihre Marktstände aufbauten, waren auch schon die ersten Marktbesucher unterwegs. Unter ihnen befand sich Konstanze Dreyling von Wagrain, die stolze und strenge Frau des Schlossverwalters. Dadurch, dass die großgewachsene, schlanke Kastellanin im Gegensatz zu den meist abgearbeiteten Frauen des Dorfes kerzengerade und zudem erhobenen Hauptes über den Markt schlenderte, wirkte sie eingebildet, ja sogar arrogant. Aber diese Einschätzung würde ihr nicht ganz gerecht werden. Sicher, sie wusste, dass sie sich in jeder Hinsicht von den anderen Frauen abhob. Darauf bildete sie sich aber nicht allzu viel ein. Sie liebte zwar die schönen Künste und schätzte es, sich in einer der seltenen Gesellschaften, die in besseren Zeiten im Immenstädter Schloss gegeben worden waren, bewegen zu dürfen–aber deswegen etwas Besseres sein? Nein! Nicht unbedingt. Allerdings erfüllte sie ein Attribut, das man Höhergestellten gerne zuordnete: Wenn ihr etwas nicht passte, konnte sie–im Gegensatz zu ihrem Mann–aufbrausen wie eine wildgewordene Furie. Dies bekamen dann meist ihr Gesinde, Lieferanten…oder ihre Familienmitglieder zu spüren. In der Öffentlichkeit zeigte sie sich stets zurückhaltend. Heute war sie mit ihren beiden jüngeren Söhnen Lodewig und Diederich vom Schloss heruntergekommen, um sich mit frischen Waren einzudecken. Obwohl sie zwar mit Entsetzen gehört hatte, Ruland Berging, der ehemalige Totengräber, sei wieder aufgetaucht, und sie den 18-jährigen Lodewig gebeten hatte, auf den um neun Jahre jüngeren Bruder Diederich ganz besonders zu achten und ihn nicht aus den Augen zu lassen, war sie in erträglicher Sorge. Von ihrem mittleren Sohn wusste sie, dass er selbst auf sich achten konnte und sowieso gleich zum Marktstand der Bombergs gehen würde, um dort seine geliebte Sarah, Judiths bildhübsche Tochter, zu treffen. Dennoch machte sie sich auch Gedanken über Lodewig. So, wie er versprechen musste, auf seinen jüngeren Bruder zu achten, musste dieser ihr hoch und heilig zusichern, nicht von ihrer Seite zu weichen, während Lodewig bei Sarah und die Mutter mit ihm allein sein würde. Obwohl Konstanze klar war, dass mit der Rückkehr des Marktes endlich wieder etwas im Dorf los war und sich alle darauf gefreut hatten, wäre es ihr aus der Sorge heraus, dass ihm etwas geschehen könnte, am liebsten gewesen, ihren Jüngsten zu Hause zu lassen.
Als sie Diederich einen diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet hatte, war der Bub tödlich beleidigt gewesen und hatte so gotterbärmlich geheult, dass sie ihren Vorschlag nur allzu gerne zurückgenommen hatte.
Jetzt standen sie vor Papas Tischchen und orientierten sich von dort aus.
»Hast du den Schuhflicker schon gesehen?«, fragte Konstanze ihren Mann, während ihr Blick neugierig über das beginnende hektische Treiben schweifte.
»Nein! Der scheint immer noch Angst vor einer tödlichen Mistgabel zu haben, wie sie der Wachmann beim letzten Markt in seinem Brustkorb gehabt hat. Er kommt wohl nicht!« Da ein gräflicher Soldat, den Oberamtmann Speen mit einem Kameraden zur Sicherheit des Markttreibens von Immenstadt nach Staufen entsandt hatte, mit diesem bäuerlichen Arbeitsgerät erstochen worden war und die Sache nicht hatte aufgeklärt werden können, ging bei den Händlern immer noch die Angst um, dass es ihnen genauso ergehen könnte.
»Oder er fürchtet sich vor der Pest«, ergänzte Konstanze, nachdem sie den Lederer nirgends entdecken konnte. Da sich noch nicht überall herumgesprochen hatte, dass es sich im vergangenen Herbst nicht um die Pestilenz, sondern ›nur‹ um eine raffinierte Mordserie gehandelt hatte, mieden immer noch viele auswärtige Händler den früher belebten Staufner Marktplatz, bei dem es in besseren Zeiten sogar einen Aufzug, ein Kindertheater und andere Kurzweil gegeben hatte.
»Ich bin dann weg«, informierte Lodewig seine Mutter und übergab ihr hastig Diederichs Hand, nachdem er den Stand von Judith Bomberg gesichtet hatte.
War ja klar, dachte sich Konstanze und schlenderte mit Diederich ebenfalls zu Judith, um ihr einen Korb voller Eier und zwei lebende Hühner abzukaufen. Um Sarah und Lodewig nicht zu brüskieren, ließ sie sich damit so viel Zeit, bis die jungen Leute händchenhaltend abgezogen waren.
Während sich die beiden Freundinnen nach einer herzlichen Begrüßung angeregt unterhielten, rief die Frau des Kastellans plötzlich: »Da ist er ja!«
»Wer?«, fragte die verdutzt um sich blickende Judith.
»Der Schuhflicker! Da! Direkt neben dem Verkaufswagen des Bunten Jakob!«
Die Jüdin war verwundert. »Na und? Das ist doch nichts Neues. Den kennen wir doch.«
»Aber Judith! Ich habe dir doch davon erzählt, dass Lodewig und Diederich im letzten September auf dem Kirchhof ein unheimliches Gespräch zwischen Ruland Berging und einem Unbekannten mitgehört haben und deswegen vor dem Totengräber geflohen sind. Lodewig hat dabei einen Schuh verloren, woraufhin ich das verbliebene Teil als Muster zum Schuhflicker gebracht und ihn gebeten habe, einen dazu passenden neuen zu machen. Jetzt bin ich gespannt, ob er ihn tatsächlich dabei hat…Aber ich lass ihn erst mal in Ruhe seinen Stand aufbauen.«
Während die beiden so vor sich hin plauderten, füllte sich der Marktplatz im unteren Flecken zunehmend mit Menschen, die nach und nach aus allen Richtungen herbeiströmten. Darunter befanden sich auch der Kronenwirt Mattheiß und Ruland Berging, der seine alte Arbeit wieder aufgenommen hatte weil er jetzt wieder zum Totengräber des Dorfes bestallt worden war und an dessen Anwesenheit und Anblick sich die Staufner zwar schon längst wieder gewöhnt hatten, aber immer noch zusammenzuckten und sich heimlich bekreuzigten, wenn sie ihm begegneten. Allerdings ging die Angst der Staufner nicht so weit zu riskieren, unwissend zu bleiben. Seit dem Tag, an dem der Totengräber wieder in Staufen war, musste er sich viele spekulative Fragen, die er mit den haarsträubendsten Lügen beantwortete, gefallen lassen. Seine mysteriöse Abwesenheit wegen des gemeinen Mordes an Otward Opser, dem älteren der beiden Blaufärbersöhne, von dem immer noch niemand wusste, wer ihn umgebracht hatte, begründete er stets mit der Genesung lebensgefährlicher Verletzungen am ganzen Körper. Außerdem hatte er sich eine glaubwürdige Ausrede für sein verletztes Auge einfallen lassen: Er behauptete, dass er sich diese Wunde in der gut einen halben Tagesritt enfernten Stiftsstadt Kempten eingehandelt habe, als er dort war, um sich beim städtischen Leichenbestatter über die verschiedenen Möglichkeiten der Beerdigungen zu informieren.
Dass er noch niemals in Kempten gewesen war und ihn moderne Bestattungsformen nicht interessierten, wenn es diese denn überhaupt geben sollte, konnte in Staufen ja niemand wissen, denn außer dem Kastellan und dem Propst war kein einziger Staufner jemals in der pulsierenden fürstäbtlichen Stadt an der Iller gewesen. Jedenfalls begründete er sein verbundenes Auge damit, dass er in Kempten einen kleinen Jungen–der wohl etwas getan hatte, was er nicht hätte tun dürfen–selbstlos vor dessen Verfolgern hatte schützen wollen und dafür derart verprügelt worden sei, dass er mit Blessuren am ganzen Körper in das dortige Heilige-Geist-Spital eingeliefert worden war. Die Geschichte mit dem kleinen Jungen war ihm spontan eingefallen, weil ihm seit seiner geheimen Besprechung mit dem Medicus auf dem Kirchhof Knaben nicht mehr aus dem Kopf gingen. Zu seinem Glück hatte er schon einige Tage nach seiner Rückkehr die willkommene Gelegenheit erhalten, im Einvernehmen mit dem Propst und der widerwillig gegebenen Zustimmung des Kastellans, seine Arbeit als Leichenbestatter erneut aufzunehmen. Und nur dies zählte, zumindest im Moment.
Da es der Propst und der Kastellan für ratsam gehalten hatten, Fabio, den ehemaligen Helfer des Totengräbers, noch eine Zeit lang im Schloss zu behalten, hätte für die Bestattung eines wenige Tage nach der Hinrichtung des verruchten Arztes Heinrich Schwartz an Wundbrand verstorbenen Knaben niemand zur Verfügung gestanden. So hatte ihm keiner die Wiederaufnahme seiner alten Arbeit streitig gemacht. Der Totengräber geriet lediglich in Form von Marktgeschwätz, offiziell aber nie, in den Verdacht, mit dem Medicus gemeinsame Sache gemacht zu haben, weswegen er diesbezüglich auch von niemandem belästigt wurde. Wenn er tatsächlich damit etwas zu tun gehabt haben sollte, ist es jetzt eh zu spät, ihm dies noch nachzuweisen, dachten selbst diejenigen, die ihm noch nie über den Weg getraut hatten. Nur der Kastellan und seine Frau waren seit dem Tod der Blaufärbersöhne nach wie vor misstrauisch.
Die letzten Reste des Einzigen, der etwas dazu hätte sagen können, zerlegten die Krähen in schnabelgerechte Einzelteile. Das wusste auch Ulrich Dreyling von Wagrain, der sich in seiner Eigenschaft als inzwischen von Amts wegen eingesetzter Ortsvorsteher jetzt wohl oder übel zähneknirschend mit dem Totengräber würde arrangieren müssen–auch wenn dies seiner Frau ganz und gar nicht passen mochte.
*
Bei strahlendem Wetter entwickelte sich schnell ein munteres Treiben–fast so wie in alten Zeiten. Es wurde gekauft, verkauft und an allen Ständen gefeilscht, was der Handschlag hergab, obwohl bei Weitem nicht so viel Münzen in Umlauf waren, wie es in früheren Zeiten der Fall gewesen war, weswegen viele Staufner erst zum Ortsvorsteher gingen, um sich das Geld ihrer ermordeten Verwandten zurückzahlen zu lassen. Kein Wunder also, dass sich vor dessen Tischchen eine lange Schlange gebildet hatte.
Aber nicht alle waren in der glücklichen Lage, einen warmen Regenguss in Form von mehr oder weniger Hellern, Kreuzern und Gulden oder Schmuck über sich rieseln zu lassen. Zu ihnen zählte auch der örtliche Dorfschuhmacher Hemmo Grob. »Na, schon einen Gewinn erzielt?«, wurde Judith Bomberg von dem unangenehmen Mann, den wegen seiner Geschwätzigkeit alle nur den ›Pater‹ nannten, süffisant gefragt. Der missgünstige Lederer konnte es einfach nicht lassen, die braven Leute zu piesacken, wo es nur ging. Sein Hass gegen die Juden im Allgemeinen und die in Staufen lebenden Bombergs im Besonderen war so groß, dass er es am liebsten gesehen hätte, wenn die ganze Mischpoke neben dem Medicus aufgehängt worden wäre. Es passte ihm nicht, dass in Staufen jetzt alles so friedlich und harmonisch zuging und sogar wieder ein Markt stattfand. Nicht einmal dieser Scheißkrieg kommt nach Staufen, dachte der Verblendete, in der Hoffnung, die damit verbundenen Wirren für seine Zwecke ausnutzen zu können. Es ärgerte ihn, dass er beim besten Willen keine Handhabe hatte, den Bombergs etwas nachzusagen, weswegen man sie hätte vor Gericht zerren können. Und im Augenblick war der ›Pater‹ ganz besonders stinkig, weil er mitbekommen hatte, dass die Menschen am Stand seines fahrenden Berufskollegen sogar anstanden, um dort ihre Schuhe reparieren zu lassen, Lederreste oder auch neue Schuhe zu kaufen, anstatt ihm diese Geschäfte zukommen zu lassen. Und dass sich darunter nicht nur Auswärtige, sondern auch etliche Staufner, wie der Blaufärber Hannß Opser, befanden, wurmte ihn ganz besonders.
»Keine Finger, um eine Faust machen zu können, aber Geld für neue Schuhe haben«, murmelte er in Anspielung darauf, dass dem Blaufärber und seiner Frau Gunda im vergangenen Winter ein paar Glieder abgefroren waren, als sie trotz Eiseskälte nach Dietmannsried kutschiert waren, um ihren vermissten Sohn Otward zu suchen. Als er auch noch sah, dass sich die Frau des Kastellans unter den Wartenden befand, hätte er Gift und Galle spucken können.
Nachdem Konstanze fast das Viertel einer Stunde gewartet hatte, kam sie endlich an die Reihe. »Habt Ihr den Schuh für meinen Sohn?«, fragte sie sofort in forderndem Ton.
Der Schuhflicker, der seit langer Zeit zum ersten Mal wieder aus dem im oberen Allgäu liegenden Weiler Kierwang nach Staufen gekommen war und die ansonsten freundliche, zumindest aber höfliche Frau kannte, wollte ihr dies zurückgeben, indem er den Kopf schüttelte und die Mundwinkel so nach unten zog, als wenn er von nichts wüsste.
»Aber Ihr habt doch im letzten Herbst einen Schuh als Muster entgegengenommen, damit Ihr für meinen Sohn Lodewig einen zweiten dazu machen könnt! Wisst Ihr das denn nicht mehr?«
Der kräftige Mann zauberte einen fragenden Ausdruck auf sein Gesicht, zwirbelte seinen gepflegten Schnauzbart und zuckte mit den Achseln, gab aber keine Antwort.
»Es war an jenem denkwürdigen Tag, als hier ein Soldat den Stichen einer Mistgabel erlegen ist! Das müsst Ihr doch noch wissen! Es war der letzte Markttag vor dem Marktverbot seiner Exzellenz, des Grafen zu Königsegg«, beschwor Konstanze den Schuhflicker, der sich nun seinen spitzen Kinnbart kraulte, während er wieder kopfschüttelnd die Mundwinkel nach unten zog, anstatt zu antworten.
Erst als die leicht erregbare Konstanze Dreyling von Wagrain so laut wurde, dass sogar andere Leute auf den einseitigen Disput aufmerksam wurden, erhob der Schuster den Zeigefinger und das Wort: »Bleibt gelassen, gute Frau! Vielleicht habe ich ja etwas anderes, das Euer Herz erfreuen könnte!«
»Ich möchte nichts anderes als meinen Schuh zurück, wenn Ihr schon nicht in der Lage gewesen seid, den dazu passenden zu nähen«, entgegnete sie jetzt in einem derart lauten Ton, dass nicht nur die herumstehenden, sondern sämtliche Marktbesucher und Händler, an deren Ständen sie gerade verweilten, plötzlich still waren und sich allesamt dem Stand des Schuhflickers zuwandten. Darunter befanden sich auch der ›Pater‹, der von dort aus einen guten Blick auf seine ungeliebte Konkurrenz hatte, und der Totengräber, der nach langer Zeit wieder versuchen wollte, mit dem Bunten Jakob irgendeinen lohnenden Handel einzugehen, und sei dies auch ein noch so schmutziges Geschäft.
Der Schuster kroch unter seinen Marktstand und schien nach etwas zu kramen. »Ah!…Da ist er ja«, rief er, während er–vor seinem Stand selbst noch unsichtbar–einen Schuh in die Höhe hielt.
»Na ja. Auch wenn ich keinen neuen Schuh bekommen habe, bin ich doch wieder im Besitz des einen. Dann werde ich einen dazu passenden doch woanders nähen lassen müssen oder ein neues Paar kaufen«, stellte Konstanze gleichsam zornig und enttäuscht fest.
Der ›Pater‹, der am Nebenstand lehnte und dies gehört hatte, rieb sich schon die Hände. Er glaubte, dass dieses Geschäft jetzt ihm zukommen würde. Immerhin war er der einzige Schuhmacher des Dorfes…und noch dazu ein Meister seines Faches, den man, trotz seiner menschenverachtenden Lebenseinstellung, sogar in die Zunft aufgenommen hatte. Aber er sollte enttäuscht und seine Wut auf die Frau des Kastellans noch größer werden.
Als Konstanze eine Hand nach ihrem Sohn ausstreckte und ihn mit seinem Namen rief, wurde nicht nur der Totengräber neugierig. Auch die anderen Umstehenden warteten ab, ob noch etwas käme.
»Gute Frau«, rief ihr der Schuhflicker nach, »kommt zurück! Ich habe nur Gleiches mit Gleichem vergolten und mir einen Scherz mit Euch erlaubt. Seht!« Dabei zeigte er zum Himmel. »Ihr habt endlich wieder Markttag in Staufen und dazu auch noch herrliches Krämerwetter.«
Als sich Konstanze umdrehte, sah sie, wie der Schuhflicker freudestrahlend den zweiten Schuh in die Höhe hielt. Dies bemerkte allerdings auch der Totengräber, der jetzt nur noch eins und eins zusammenzählen musste, um ganz sicher zu wissen, dass er ein Narr gewesen und dies der Schuh war, dessen Pendant er Lodewig vom Fuß gezogen hatte, als dieser mit seinem Bruder Diederich durch ein Loch in der Kirchhofmauer vor ihm und dem Medicus geflohen war. Er könnte sich für seine Dummheit selbst abwatschen. Schlagartig war ihm bewusst geworden, dass es der kleinere der beiden Knaben war, der vor ihm am Rockzipfel seiner Mutter hing und der ihn damals auf dem Kirchhof belauscht hatte, als er mit dem Medicus zusammen die Vorgehensweise für die ›Pestmorde‹ besprochen hatte.
»Und ich Narr habe wegen einer mistigen Namensverwechslung die beiden Söhne des Blaufärbers umgebracht. Es gibt in Staufen also doch noch einen Burschen, dessen Namen dem des jüngeren Blaufärbersohnes ähnelt…Der eine hat Didrik geheißen und dieser Arsch hier heißt Diederich! Ich habe es doch gewusst: Er war es, der den Medicus und mich belauscht hat«, hatte er, leise vor sich hinmurmelnd, festgestellt, bevor er laut fluchte und sich mit der linken Faust in die rechte Handfläche hieb, während er sich durch die Menschenmenge näher an den Stand des Schuhflickers durcharbeitete, um das frisch genähte Leder genauer betrachten zu können.
Wenn es sich dabei auch noch um einen rechten Schuh handelt, weiß ich ganz gewiss, dass ich anstatt dem älteren Blaufärbersohn dem größeren Sohn des Kastellans einen Schuh abgestreift habe, als die beiden durch ein Loch in der Kirchhofmauer geflohen sind. Dann hege ich nicht mehr den geringsten Zweifel daran, dass ich die falschen Knaben zum Schweigen gebracht habe, reimte er sich fahrig zusammen und fluchte wieder laut: »Verdammte Scheiße! So ein Mist aber auch!«
*
In seinem Zorn schlug der übel aussehende, der bärtige Geselle mit seiner Augenklappe, so fest an eine der Befestigungsstangen des ihm am nächsten stehenden Marktstandes, dass das lappige Standdach des Knopfmachers in Schieflage geriet. Als der greise Händler mit dem auffallend langen Schnurrbart, der ihm müde zu beiden Seiten des Mundes herunterhing, die hölzerne Stange packen wollte, um ein Zusammenkrachen seines Verkaufsstandes zu verhindern, fiel er damit ungebremst so fest in seine Ware, dass den vorbeilaufenden Marktbesuchern die Knöpfe um die Ohren flogen. Während einige erschrocken zur Seite sprangen, begannen die meisten Männer, lauthals zu lachen. Ihre raffgierigen Frauen nutzten derweil die Gelegenheit, um hastig die auf dem Boden verstreuten Hirschhornknöpfe einzusammeln. Dabei hatten sie das Glück, den völlig aufgelösten Händler so mit sich selbst beschäftigt zu sehen, dass dieser davon kaum etwas mitbekam. Ungeachtet dessen, sollte er noch ganz andere Probleme bekommen. Beim Fallen riss der zittrige Mann alles mit sich, was er vor gut einer Stunde mühsam allein aufgebaut hatte, während seine junge Frau das Geschäft auf ihre Art angekurbelt hatte. So zog er ungewollt auch den Stoffverschlag, den er extra hierzu hinter seinem Stand angebracht hatte, von den Haltestangen und sorgte somit dafür, dass nun der komplette Marktstand in sich zusammenbrach.
Die stehen gebliebenen Marktbesucher hatten sich jetzt allesamt vom Stand des Schuhflickers abgewandt und blickten gespannt auf den Stoffverhau, der sich wie durch Geisterhände zu bewegen schien. Sie wunderten sich über das wüste Weibergekeife, das darunter zu hören war und von einem lauten Männergefluche begleitet wurde. Ihnen war klar, dass sich in der Stoffplane jemand verheddert haben musste und sich daraus befreien wollte–aber wer?
Als darunter ein barbusiges, rothaariges, junges Weib hervorkroch, staunten sie nicht schlecht. Da die meisten Männer von ihren Frauen sofort vom Ort des Geschehens weggezerrt wurden und einer aufgrund seines lüsternen Grinsens sogar eine schallende Ohrfeige bekam, war es nur wenigen vergönnt, ihren Fantasien zumindest ein Stückchen freien Lauf zu lassen.
Anstatt sofort ihre beachtenswerte Blöße zu verdecken, zerrte die Frau, die offensichtlich soeben einem Mann ihre Gunst erwiesen hatte, wütend an den Zeltstoffen und gab dadurch den Blick auf den als Hurenbock bekannten örtlichen Fleischer frei. Da der alternde Weiberheld aufgrund seines, gerade in Notzeiten, interessanten Berufes als Einziger des Dorfes selbst so viel Speck hatte ansetzen können, dass er reif für seine eigene Schlachtbank war, bewegte er sich recht ungelenk. So bemühte sich der unansehnliche, aber erfolgreiche Meister seiner Zunft zunächst erfolglos, hastig die Beingewandung hochzuziehen, um seine–angesichts der überaus peinlichen Situation–schnell dahingeschwundene Männlichkeit zu verstecken, obwohl diese selbst in voller Pracht nicht über den feisten Wanst hinausgereicht haben dürfte. Dabei stolperte er über die eigenen Füße und fiel auf den Ehemann der jungen Frau, die offensichtlich eine billig zu bekommende ›Hellerhure‹ war und jetzt–ungeachtet dessen, dass ihre wackelnden Brüste immer noch jeglicher Verhüllung entbehrten–damit begann, ihre Gewandung ›unten herum‹ zurechtzuzupfen. Aufgrund der bewundernden Männerblicke hatte sie es nicht eilig damit, sich auch oben herum zu bedecken. Bestimmt würde sich der eine oder andere Ehemann jetzt Appetit holen und es dem kahlköpfigen Fleischer an einem der nächsten Markttage nachmachen.
Nach der ersten Fassungslosigkeit wussten jetzt alle, was sich die Männer schon seit geraumer Zeit an den Stammtischen zutuschelten: Das rassige Weib des alten Knopfhändlers hatte eine zusätzliche Einnahmequelle, indem sie an den Markttagen zahlungskräftiger Kundschaft für kleines Geld ihren strammen Körper anbot, während ihr verhutzelter Mann vorne Hornknöpfe verscherbelte.
»Du solltest dir das Gehörn auf den Kopf setzen, anstatt Knöpfe daraus zu machen«, rief einer der Umstehenden. Er löste dadurch ebenso allgemeines Gelächter aus wie eine Frau, die, mahnend auf den flüchtenden Fleischer zeigend, rief: »Seht doch! Dort rennt ein Mann, der nicht nur Sauen schlachtet, sondern auch noch aussieht wie ein Schwein und sogar selber eines ist!«
*
Von alledem bekam Konstanze nicht viel mit. Sie hörte zwar den Krach und das Gelächter, konzentrierte sich aber immer noch auf den Schuhflicker. Sie hatte das Muster direkt neben den neuen Schuh gestellt und begutachtete das Werk des Lederers nun schon ein ganzes Weilchen mit kritischem Blick, was den Meister in unruhiges Erstaunen versetzte.
»Habe ich keine ordentliche Arbeit abgeliefert?«, fragte er verunsichert.
Konstanze drehte das Teil nach allen Seiten und stellte es immer wieder neben das Muster, während sich ihre Miene zu verfinstern schien und sie zunehmend mit dem Kopf zu schütteln begann. »Nein, guter Mann. Dieser Schuh gefällt mir nicht. Das Leder ist nicht identisch und er ist etwas zu klein geraten. Ich nehme ihn nicht!« Mit einem wütenden Gesichtsausdruck knallte sie das kunstvoll zusammengenähte Lederteil auf den Tresen und wandte sich ab.
»Gottverdammtes Weib«, rutschte es dem Schuhflicker, ungeachtet der honorigen Kundschaft, ungewollt heraus. »Entschuldigt, edle Frau, aber ich habe mich redlich bemüht, einen Schuh herzustellen, der wie ein Ei dem anderen gleicht«, versuchte er, das zuvor Gesagte zu relativieren.
Als Konstanze keine Reaktion zeigte, wusste er nicht mehr, wie er sich verhalten sollte, zog es aber vor, sich nicht zu weit hinauszulehnen und stattdessen seine Kundin an deren Ehre zu packen: »Und Ihr haltet es für richtig, mich für meine hervorragende Arbeit zum Gespött der Leute zu machen, anstatt mich für den erteilten Auftrag ordentlich zu entlohnen?«
Konstanze blieb noch einige Augenblicke lang, dem Stand des Schuhflickers abgewandt, stehen, bevor sie hellauf zu lachen begann.
»Auge um Auge«, rief sie ihm zu, während sie wieder zu seinem Marktstand zurückging. »Ich verzeihe Euch Euren Scherz…und Eure anmaßende Art, Euch auszudrücken. Wenn auch Ihr mir meinen Scherz verzeiht, können wir ins Geschäft kommen!«
Der Schuhflicker schnaufte erleichtert aus, als ihm Konstanze lachend die Hand zum Frieden reichte. Während sie anstandslos den geforderten Preis bezahlte ohne zu feilschen, lobte sie den Meister für seine achtbare Arbeit, bevor er dies selber tun konnte. Sie bemerkte dabei, dass er nicht nur ein gewöhnlicher Lederer, sondern fürwahr ein Könner seines Fachs sei.
Diese Lobeshymnen bekam auch der ›Pater‹, der sich vom Tumult am Stand des Knopfmachers kaum hatte ablenken lassen, mit. Er hatte jetzt eine Mordswut im Bauch und begann laut zu fluchen. Da Konstanze damit beschäftigt war, ihren Geldbeutel hervorzukramen, bekam sie das nicht mit–hätte sie dies, wäre es ihr wohl egal gewesen. Als das Geschäft mit dem Schuhflicker abgewickelt war und sie sich wieder auf die Sorge um ihren Jüngsten besann, blickte sie sich ängstlich nach dem Totengräber um. Aufgrund der kleinen Witzelei mit dem Schuhflicker hatte sie für ein paar Augenblicke vergessen, dass Ruland Berging eigentlich nichts von den Schuhen mitbekommen sollte. Da er sich sofort verzogen hatte, als der Stand des Knopfmachers in sich zusammengebrochen war, konnte sie ihn jetzt nirgends mehr sehen. Und da Diederich die ganze Zeit über brav an ihrem Rockzipfel gehangen hatte, schlenderte sie jetzt–ihn fest an die Hand nehmend–von einem zum anderen Marktstand.
Es dauerte nicht lange und sie traf die mildtätige Schwester Bonifatia, die dem Franziskanerinnenorden angehörte und die sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Die Krankenschwester leitete das Siechenhaus nahe Genhofen und war an diesem sonnigen Tag nach Staufen gekommen, um den Mann zu suchen, den sie vor einiger Zeit gepflegt und dessen verloren gegangenes Pferd sie gefunden hatte. Außerdem hatte auch sie sehnsüchtig auf den Markttag gewartet, um endlich wieder einmal einkaufen zu können. Sie benötigte vom Leinenweber dringend etliche ungefähr zehn Fuß lange Leinenbahnen, aus denen sie für eine längere Zeit ausreichend Verbandsmaterial würde zurechtreißen können. Konstanze kannte die Franziskanerin eigentlich nur von früheren Marktbesuchen her und hatte–abgesehen von einigen Schwätzchen–bisher keinen engeren Kontakt zu ihr. Nachdem sich die beiden begrüßt hatten, unterhielten sie sich ein wenig.
»Was ist los mit Euch, ehrwürdige Schwester?«, fragte Konstanze, die schnell gemerkt hatte, dass ihre Gesprächspartnerin trotz des schönen Wetters und des fröhlichen Markttreibens heute nicht besonders gut aufgelegt zu sein schien. »Euch bedrückt doch etwas?«, ließ sie nicht locker und beharrte auf einer Antwort.
»Ach, werte Frau Dreyling von Wagrain. Die Schwester Oberin hat mich in unser Mutterhaus nach Dillingen zurückbeordert.«
»Heißt das, dass Ihr das Siechenhaus in Genhofen verlassen und in die Universitätsstadt an der Donau zurückkehren müsst?«
Die Schwester seufzte, während sie nickend eine knappe Antwort gab.
»Aber Ihr wollt lieber hier im Allgäu bleiben…, stimmt’s?«, hakte Konstanze nach.
Wieder kam nur ein knappes »Ja«, dem aber, nachdem die ebenfalls großgewachsene Ordensfrau das gesenkte Haupt erhoben und sich den Schleier zurechtgerückt hatte, eine Erklärung folgte: »Während der drei Jahre, die ich jetzt in Genhofen bin, habe ich mich an die ›sterrgrindigen‹ Allgäuer gewöhnt«, sagte sie und ließ jetzt sogar ein kurzes Lächeln zu, bevor sie zu schimpfen begann. »Außerdem braucht man mich hier…, obwohl ich es zunehmend mit Simulanten zu tun habe, die nur ins Siechenhaus kommen, um eine kostenlose Unterkunft und warme Mahlzeiten zu erhalten. Es scheint sich nicht nur allseits herumgesprochen zu haben, dass es bei mir stets für jeden–ob Schmarotzer oder nicht–etwas gibt. Leider hat die Schwester Oberin auch schon davon gehört und sieht deswegen keine weitere Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung des Siechenhauses. Wenn ich also im Allgäu bleiben und gleichzeitig meinem Orden treu bleiben möchte, muss ich hier eine neue Arbeit finden, die der Mutter Oberin…«, bevor sie den Satz zu Ende sprach, senkte sie demütig das Haupt, »und Gott gefällt.«
Die Schwester überlegte, ob sie der Frau des Kastellans erzählen sollte, dass sie ein Pferd mit sich führte, das Wegelagerer einem ihrer Patienten auf dem Hahnschenkel abgenommen hatten, als dieser auf dem Rückweg von Hopfen war, einem kleinen Weiler etwas abseits der Salzstraße, die, von Hall in Tirol kommend, an den Bodensee führte. Das Tier war dann wohl, einem inneren Instinkt folgend, geflüchtet und dem vermeintlichen Besitzer bis zum Siechenhaus gefolgt. Dass es sich dabei um den Schimmel des Totengräbers und bei ihrem Patienten um den zwischenzeitlich erhängten Staufner Medicus gehandelt hatte, wusste sie ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Medicus damals in Hopfen war, um bei Til, dem kauzigen Kräutermann, der dort eine fast unüberschaubare Kräuterplantage bewirtschaftete, die giftigen Blätter, Knollen und Stängel zu erwerben, mit deren Hilfe er fast halb Staufen ausgelöscht hatte. Aber die Schwester ließ dies und erzählte der Frau des Kastellans von ihrer Arbeit. Während sie sprach, überlegte Konstanze, wie sie ihr helfen könnte. Da sie von ihrem Mann wusste, dass der Propst dringend einen Spitalleiter bräuchte, aber offensichtlich keinen bekommen hatte, fragte sie die Schwester unumwunden, ob sie es sich vorstellen könne, dem Orden gegenüber ungehorsam zu werden und hier in Staufen die Leitung des Spitals zu übernehmen.
Die Augen der barmherzigen Schwester begannen zu leuchten. »Aber…?«
Konstanze hielt ihr mit dem Zeigefinger so sanft den Mund zu, als wenn sie schon viele Jahre bestens vertraut miteinander wären. »Sagt jetzt nichts! Ich habe nur meine Gedanken laut werden lassen und kann Euch noch nichts versprechen. Ich muss erst mit meinem Mann darüber reden, der wiederum mit Propst Glatt, unserem Euch bestens bekannten Pfarrherrn, über die Sache sprechen muss. Außerdem solltet Ihr erst klären, was Eure Mutter Oberin mit dem Siechenhaus zu tun gedenkt, nachdem sie Euch von dort abgezogen hat. Ich gehe davon aus, dass die Anstalt nicht geschlossen und dort weiterhin karitativ gearbeitet wird.«
Schwester Bonifatia zog die Mundwinkel nach unten, die Augenbrauen nach oben und zuckte mit den Schultern, was wohl so viel heißen sollte, dass sie keine Antwort darauf habe.
Konstanze erzählte der Schwester in groben Zügen, warum es in Staufen zurzeit keinen Medicus gab. So musste sie unweigerlich über die unrühmliche Geschichte des verbrecherischen Arztes Heinrich Schwartz, der am Galgen sein Ende gefunden hatte, berichten.
Da sich die Schwester bisher intensiv um die Kranken, Verletzten und Lahmen in Genhofen hatte kümmern müssen und das Siechenhaus nicht hatte verlassen können, hatte sie von den Ereignissen in Staufen nicht alles haarklein mitbekommen. Ihr war lediglich zugetragen worden, dass in Staufen ›jemand‹ hingerichtet worden sei. Um wen es sich dabei gehandelt hatte und weshalb er zum Tode verurteilt worden war, hatte sie zwar nicht in Erfahrung bringen können, aber dennoch für ihn gebetet.
Als sie Konstanze so sprechen hörte, wurde ihr klar, dass es sich nur um denjenigen Mann handeln konnte, den sie vor geraumer Zeit gesund gepflegt hatte, nachdem dieser von einem barmherzigen Fuhrmann schwerverletzt vor die Tür des Siechenhauses gelegt worden war. Um ganz sicher zu sein, bat sie die Frau des Kastellans, ihr doch den Unglückseligen näher zu beschreiben. Nach deren genauer Beschreibung wusste sie zweifelsfrei, dass es sich bei dem Gehenkten um einen ihrer ehemaligen Patienten handelte, der–obwohl er zu seinem eigenen Schutz kein Wort gesprochen hatte–ihr das Gefühl gegeben hatte, ein Apotheker oder ein Medicus, mindestens aber ein heilkundiger Bader zu sein. Dass er der Medicus von Staufen war, hatte er ihr wohlweislich verschwiegen.
Aus einem unguten Gefühl heraus riss sich die Schwester zusammen und bekreuzigte sich auch nicht, als ihr klar wurde, wer ihr Patient gewesen war, sondern versprach dem Herrgott im Stillen ein zusätzliches Gebet für den Hingerichteten. Sie beschloss, weiter für sich zu behalten, dass sie den Medicus persönlich gekannt und sein Pferd dabeihatte, um es ihm zurückzubringen. Sie war jetzt etwas verunsichert und wusste nicht, wie sie sich verhalten und was sie mit dem edlen Ross anfangen sollte. Da am Pferd überall Blut geklebt hatte, das Tier selbst aber unverletzt gewesen war, als sie es auf der Wiese bei der Siechenkapelle gefunden hatte, und da am Sattelzeug einige Kräutersäckchen gehangen hatten, war ihr bewusst geworden, dass es sich nur um das Pferd dieses Patienten handeln konnte. Was sollte sie jetzt also tun, da der Besitzer des schönen Schimmels tot war? Sollte sie ihn einfach behalten? Ein Blick zum Himmel gab ihr schnell die Antwort. Sie würde–weswegen sie das Pferd mitgebracht hatte–mit Propst Glatt darüber sprechen und ihn fragen, was damit geschehen sollte.
Nachdem Schwester Bonifatia ihre Einkäufe getätigt hatte, schleppte sie einen Leinenballen, einen Korb mit Gemüse und ein kleines Fässchen Schnaps, aus dem sie einen Arnikasud zur Behandlung von Wunden ansetzen wollte, in Richtung des Pferdes, das, ebenso wie das mitgebrachte Saumtier, geduldig auf sie gewartet hatte. Da sie die Verantwortung für dieses schöne Geschöpf Gottes übernommen hatte und sich zudem denken konnte, dass es sich um ein besonders wertvolles Pferd handelte, hatte sie es zusammen mit ihrem Lasttier hinter einem Stadel versteckt und angebunden, bevor sie auf den Markt gegangen war.
Jetzt belud sie es, zurrte alles gut fest und führte beide Tiere in Richtung Propstei, in der Hoffnung, dass Johannes Glatt, der eigensinnige Pfarrherr von St. Petrus und Paulus, ihr weiterhelfen würde.
Sie war noch nicht weit gekommen, als hinter ihr jemand aufgeregt schrie und sie zum Halten aufforderte. Nachdem sie sich umgedreht hatte, sah sie eine Gestalt in schwarzer Gewandung, die, offensichtlich erregt, auf sie zueilte.
»Wartet! Wartet, ehrwürdige Schwester«, rief der Totengräber, während er schnaufend näher kam.
»Was ist los?«, fragte sie erstaunt. »Gott zum Gruße erst einmal!«
»Ja, ja…« Da Ruland Berging Gott nicht gerne bemühte, räusperte er sich angesichts der Nonne fast etwas verlegen. »Seid gegrüßt«, beeilte er sich zu sagen, um sofort zum Thema zu kommen, »das ist mein Andalusier! Mein Pferd!…Endlich habe ich dich wieder.« Er konnte sein Glück kaum fassen.
Während er das unruhig schnaubende Tier aufgeregt tätschelte und das Sattelzeug auf Unversehrtheit untersuchte, fragte die Schwester irritiert, wer er denn sei und wie er darauf komme, dass es sich bei diesem Schimmel um sein Pferd handelte.
»Das kann ich Euch sagen…und zudem unschwer beweisen«, triumphierte der Totengräber, der es selbst kaum glauben konnte, dass er ›sein‹ Pferd, von ihm vor langer Zeit in Immenstadt einem venezianischen Kaufmann gestohlen, wiedergefunden hatte. Er zeigte auf die Mähne des edlen Tieres und sagte in wissendem Tonfall: »Darunter verbirgt sich etwas, das nur der Besitzer dieses schönen Tieres wissen kann! Glaubt Ihr mir, dass es meines ist, wenn sich hinter dieser dicken Mähne das zeigt, was ich Euch zuvor sagen werde?«
Die Schwester zuckte perplex mit den Schultern und nickte. »Ja! Aber nun macht schon und klärt mich auf.«
Bevor der Totengräber die Pferdemähne zur Seite strich, sagte er: »Es befindet sich ein dunkler Fleck darunter, der fast die Form eines auf den Kopf gestellten Kreuzes hat. Glaubt Ihr mir dann?«
Die Schwester nickte auffordernd und deutete ihm mit einer Handbewegung, den Beweis anzutreten.
Als klar war, dass der Totengräber dieses Pferd zumindest gut kannte, ließ sie sich noch haarklein erzählen, warum es dann dem Medicus abhandengekommen war, als dieser auf dem Hahnschenkel überfallen worden war. Da der Totengräber, ohne zu überlegen, das genaue Datum wusste, an dem er dem Medicus sein Pferd geliehen hatte, und gestenreich erklärte, dass er dem Bitten und Betteln des verzweifelten Arztes zu Gefallen des Schöpfers nachgegeben und ihm sein Pferd nur geborgt hatte, weil der Medicus dringend benötigte Heilkräuter besorgen wollte, glaubte ihm die Schwester–immerhin deckte sich seine Aussage mit dem Datum, an dem der Medicus vor ihrer Tür gelegen und was sie mit ihm selbst erlebt hatte. Warum auch sollte sie an seinen Worten zweifeln, da er doch auch noch kundtat, dass er in seiner Eigenschaft als Leichenbestatter in Diensten des Propstes, quasi also in Diensten der Mutter Kirche, stand?
So übergab sie ihm vertrauensvoll die Zügel. Sie streichelte das Pferd noch einmal, bevor sie sich mit ihrem Packesel in Richtung Siechenhaus zurück aufmachte.
Der Totengräber sprengte an ihr vorbei. Bevor man ihn wieder mit diesem edlen Ross sehen würde, wollte er es verstecken. Er preschte auf direktem Wege zum Moosmannbauern, in dessen Stall er sein Pferd sicher wähnte. Er hatte sich schon lange Gedanken darüber gemacht, wo er das stolze Ross unterstellen würde, falls er es wieder zurückbekommen sollte. Bei Babtist Vögel, dem derben Schmied, dessen Stallungen mitten im Dorf lagen, war es zu gefährlich; dort könnte der auffällige Schimmel entdeckt werden. Im Moosmann’schen Stall hingegen dürfte es vor neugierigen Augen sicher sein. Der Hof lag außerhalb des Dorfes, auf halbem Weg zur quer verlaufenden Salzstraße, von wo aus er–sollte dies nötig sein–Staufen jederzeit ungesehen verlassen konnte. Dorthin kamen nur selten Einheimische, und wenn doch, dann zogen sie nur vorbei oder wurden–falls sie zu neugierig waren–vom als gewalttätig bekannten Landwirt verjagt. Der Totengräber würde den Bauern gut dafür entlohnen, dass er das Pferd fütterte und pflegte…und so lange vor allzu interessierten Gaffern versteckt hielt, bis er es brauchen würde.
Kapitel 2
»Weshalb hast dumich zu dir bestellt?Und warum musste ich alles stehen und liegen lassen, um sofort kommen zu können? Waren wir nicht auf morgen verabredet, um darüber zu sprechen, wie es mit dem Spital weitergehen soll?«, fragte der Kastellan den Propst in mürrischem Ton. Er war aufgrund seiner vielen Arbeit im Wald nicht gerade begeistert über den kurzfristig anberaumten Gesprächstermin. Dass der Kirchenmann wissend lächelte, aber nicht gleich zur Sache kam, weil er es spannend machen wollte, trug nicht gerade zur Verbesserung seiner Laune bei. Er schaute den kirchlichen Würdenträger so lange scharf an, bis dieser eine wichtigtuerische Miene aufsetzte und endlich den Mund aufmachte. »Obwohl es von äußerster Dringlichkeit ist, geht es heute weder um das Spital noch um einen neuen Medicus.«
»Um was dann?«, knurrte Ulrich Dreyling von Wagrain.
Der Propst rieb sich nachdenklich das Kinn. »Erinnerst du dich noch daran, als du mit Eginhard die Räume des Arztes nach den todbringenden Kräutern und dem ergaunerten Geld durchsucht hast?«
»Natürlich! Aber was soll diese Frage?«
»Erinnerst du dich auch noch an die Durchsuchung des Schrankes in seiner Schlafkammer?«
Der Kastellan wurde jetzt unruhig. »Was meinst du? Was willst du von mir?«
»Erinnerst du dich daran oder nicht?«, wiederholte der Propst seine Frage.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!