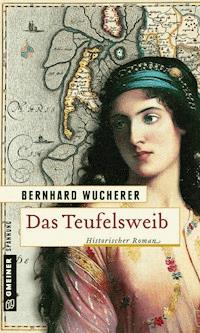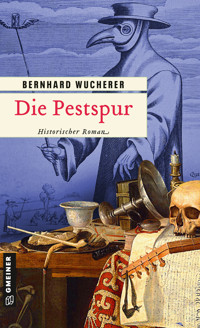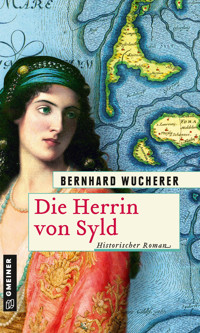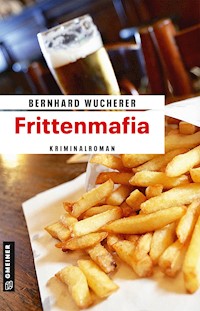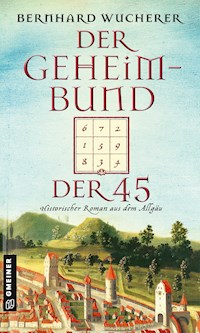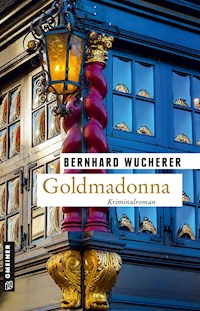
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Frederic Le Maire
- Sprache: Deutsch
Im niederländischen Ort Vaals verschwindet eine weibliche Leiche nach der Trauerfeier spurlos aus dem Sarg. Wenig später tauchen im ganzen Beneluxraum Frauenleichen auf, denen ein Fuß oder eine Hand abgetrennt wurde. Hauptkommissar Le Maire und sein Team ermitteln. Offenbar hat es der Täter auf Frauen abgesehen, die Verbindungen zum Rotlichtmilieu haben. Dann wird in Aachen eine ägyptische Studentin vermisst gemeldet, und als klar wird, dass alle Fälle zusammenhängen könnten, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Wucherer
Goldmadonna
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Christian Müller / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6748-6
0
»Weiß Gott, sie war eine schöne Frau!«
Die alte Dame nickte nur stumm. Dann bestätigte sie das, was sie soeben gehört hatte, und fügte hinzu: »Ja … wunderschön!«
Weil der Regen wie entfesselt auf die schützenden Schirme klatschte, die sich deswegen dicht an dicht drückten, machte sie sich erst gar nicht die Mühe nachzusehen, wer ihr diese wichtige Information über das Aussehen der Verblichenen hatte zukommen lassen. Erstens kannte sie die offensichtlich viel zu früh Verstorbene nicht und zweitens wollte sie nicht Gefahr laufen, die hervorragende Position ihres Schirmes zu gefährden. Denn es hatte sie nicht nur ein scheinheiliges Dauerlächeln, sondern auch große Anstrengung gekostet, ihn unauffällig in geschlossenem Zustand zwischen den anderen Schirmen hindurchzuschieben und ihn dann zu öffnen.
Dies war ihr nur gelungen, weil sie es über mehrere Jahrzehnte hinweg wohl an die hundert Mal geübt hatte. Sie war inzwischen eine wahre Meisterin, was Beerdigungen anging. Deswegen hatte es auch dieses Mal auf dem Friedhof im niederländischen Grenzort Vaals geklappt, ohne dass allgemeines Gezeter ausbrach.
Die alte Dame drückte ihre Augen unter dem gehäkelten Schleier vor dem Gesicht zusammen und nickte unmerklich lächelnd vor sich hin. Mit dem bisherigen Verlauf dieser Beerdigung war sie rundum zufrieden. Wenn dies hier alles vorüber war und sich die ineinander verhakten Schirme über ihrem eigenen Regenschutz voneinander gelöst hatten, würde sie den Ehemann der Verstorbenen ansprechen und ihm nach allen Regeln der Kunst kondolieren. Dass dies der große Mann mit den langen blonden Haaren war, der ihr auf der anderen Seite des Grabes gegenüberstand, hatte sie bereits recherchiert, als sich die engsten Verwandten in der Aussegnungshalle zusammengefunden hatten.
Ach, wie sie diese kleinen Unterredungen auf dem Friedhof liebte, die schon oft dazu geführt hatten, dass sie zum Leichenschmaus oder wenigstens zu Kaffee und Kuchen eingeladen worden war. Für sie gab es nichts Verbindenderes als den gemeinsamen Schmerz um Verstorbene. Da war es egal, ob sie diese gekannt hatte oder nicht. Und auch wenn bei Regenwetter getrauert wurde, war sie überglücklich.
Jetzt aber musste sich die Dame erst einmal auf das Hier und Jetzt konzentrieren, denn gleich würde der Herr Pastor Erde auf den Sarg werfen. Das Geräusch, das die Dreckklumpen verursachten, wenn sie auf das hohl klingende Sargholz knallten, liebte sie fast mehr, als sich eine Einladung zum Leichenschmaus zu erschleichen.
Doch dieses Mal sollte es ihr nicht gegönnt sein, sich auf das sehnlichst erwartete Geräusch zu konzentrieren, denn eine extrem raue Männerstimme riss sie aus ihren Gedanken: »Wie eine Madonna … Sie sah aus wie eine ›Schwarze Madonna‹!«
Die alte Dame stutzte und war drauf und dran, ihren Kopf mitsamt dem Gesichtsschleier zu heben. Das hatte nicht wie eine der üblichen Beerdigungsphrasen geklungen, wie sie begeisterte »Friedhofsgänger« auswendig konnten. Sie kannte den Unterschied. Immerhin ging sie seit ihrem Eintritt in die Frühpension jahrein, jahraus auf jede katholische oder evangelische Beerdigung im Umkreis von 20 Kilometern, falls es von Aachen aus eine Buslinie gab, die in die Nähe des jeweiligen Friedhofes führte. Und weil dieses zwar irgendwie merkwürdige, ja fast schon hämisch klingende »wie eine ›Schwarze Madonna‹« von einem Mann gekommen war, der offensichtlich nicht zur Verwandtschaft gehörte – er stand hier und nicht auf der anderen Seite des Aushubes –, war sie neugieriger geworden, als sie es ohnehin schon gewesen war. Der Ehemann der Frau, die soeben unter die Erde gebracht wurde, stand ihr ja direkt gegenüber. Oder hatte sie sich getäuscht und möglicherweise sogar schlampig recherchiert? Falls dem so wäre, würde sie es der Tatsache zuschreiben, dass der Bus erst angekommen war, als die Zeremonie in der Aussegnungshalle bereits begonnen hatte.
Schwarz, durchfuhr es sie wie einer der Blitze, die diese Beerdigung zu etwas ganz Besonderem für sie machten. Obwohl sie wegen der Schirme keinen einzigen sehen konnte, verliehen die grollenden Donnerschläge der Zeremonie eine außergewöhnliche Atmosphäre. Deswegen habe ich bei den Hinterbliebenen vorhin so viele asiatische Menschen mit dunkler Haut gesehen – ich hatte mich schon darüber gewundert. Die Verblichene war also eine Asiatin und hatte dunkle Haut …
Sie überlegte, was zu tun war. Auf alle Fälle musste sie ihre Contenance bewahren. Schließlich war sie trotz dieses Fauxpas Beerdigungsprofi und hatte bei solch willkommenen Anlässen schon ziemlich alles erlebt, was die Abgründe der menschlichen Seele und das Verhalten von Hinterbliebenen herzugeben vermochten. Sie wurde unruhig. »Verdammt!«, entfuhr es ihr so laut, dass es sogar der Herr Pastor hörte. So viel zur Contenance.
»Anindas Tod ist kein schmerzlicher Verlust und ihr Mann kann sich nun eine ehrenwerte Frau suchen«, flüsterte ihr die Dame zu, die schräg hinter ihr stand. Offenkundig war sie mit den Verhältnissen innerhalb der Familie vertraut. Hochinteressant! Eine Nachbarin vielleicht? Eine enge Verwandte war sie jedenfalls nicht, denn die standen ja alle um den Witwer herum. Aber das war im Moment nicht so wichtig, sie hatte zwei interessante Informationen erhalten, die ihren Zugang zum Leichenschmaus in greifbare Nähe gerückt hatten. Aninda war wohl ein Luder, zumindest aber keine gute Ehefrau gewesen, reimte sie sich hastig zusammen. Wenn sie noch den Namen des Ehemannes erfuhr, wäre das Festmahl gesichert. In gewohnt hinterhältiger Art fragte sie: »Äh … wie heißt er doch gleich wieder mit Vornamen?«
»Wer?«
»Anindas Mann.«
»Louis … Louis van Basten! Ein waschechter Vaalser und dazu ein gottesfürchtiger Mensch! Den kenne ich schon seit seiner Kindheit!«
Die durchtriebene Friedhoftouristin triumphierte innerlich, konnte ihre neuen Erkenntnisse aber nicht weiterverarbeiten, weil ausgerechnet in diesem Augenblick der Witwer ein Zitat aus dem Lukasevangelium loswerden musste. Bevor sich die Trauergäste – falls sie van Bastens Worte wegen des klatschenden Regens überhaupt verstanden hatten – darüber Gedanken machen konnten, knallte auch schon die Erde auf den Sarg, deren Geräusch die Dame so liebte.
Nun war alles wieder in bester Ordnung. Die strafenden Blicke der Trauergemeinde wegen ihres Fluches waren inzwischen an ihr abgeprallt wie der Regen, der die anderen Beerdigungsteilnehmer durchnässte. Dennoch war sie nicht ganz zufrieden. Sie überlegte, wie sie sich dem Mann gegenüber verhalten sollte, der von der »Schwarzen Madonna« gesprochen hatte und von dem sie nur die an den Knien zerrissenen Hosenbeine und die auffällig großen und beinahe leuchtenden Schlangenlederstiefel sah. Als sie sich dazu entschlossen hatte, die hart erkämpfte Position ihres Schirmes vorzeitig aufzugeben, um dem Unbekannten neben ihr ins Gesicht zu schauen, war es zu spät. Sie sah gerade noch, wie der Mann sich zwischen den anderen Beerdigungsbesuchern hindurchquetschte und verschwand. Dabei fielen ihr noch die weißen Streifen an seiner Jeans und ein rotes Emblem an der rechten Gesäßtasche auf. Zu ihrem Entsetzen zeigte es einen aufgerissenen Mund mit herausgestreckter Zunge. Und sein Ausspruch mit der »Schwarzen Madonna« blieb ihr im Ohr. Seine raue Stimme würde sie jederzeit wiedererkennen wie seine auffälligen Cowboystiefel.
Kapitel 1
Limburger nieuws vom 19. Oktober 2021 – Polizeibericht:
Vaals.In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde vor dem Restaurant »De Zwarte Madonna« auf dem Eschberg in Vaals eine Madonnenfigur entwendet. Dabei sind der oder die Täter mit großer Raffinesse vorgegangen. Anstatt die schwere Figur gewaltsam aus ihrer Bodenverankerung zu reißen, haben sie mühsam und zweitaufwendig das Sockelfundament ausgegraben und anschließend die Befestigungsschrauben gelöst. Das von einem belgischen Künstler erstellte, aus Blaustein gehauene, modern gestaltete Standbild ist 1,78 Meter hoch und weist erhebliche Zeichen der Verwitterung auf. Dass der oder die Täter nicht in das Restaurant oder in das gegenüberliegende Museum eingebrochen sind, wo über 200 Heiligenstatuen und andere religiöse Kunstgegenstände eine leichtere Beute gewesen wären, könnte ebenso darauf hinweisen, dass es sich nicht um Profis handelt, wie die Tatsache, dass sie eine relativ wertlose Staue gestohlen haben, verglichen mit den anderen Madonnenfiguren im Park, der zum Restaurant gehört. Möglicherweise sind der oder die Sakralschänder unter der Bevölkerung von Vaals und Umgebung zu suchen.
Sachdienliche Hinweise an die Politie Limburg Zuid …
»Oha!«, entfuhr es dem belgischen Kriminalhauptkommissar Frederic Le Maire, als er diese Zeilen las. Er saß gerade vor dem Café »d’r Koffereck« in Vaals und blätterte in der hiesigen Tageszeitung. Obwohl es herbstlich kühl war, hatte er es vorgezogen, draußen auf seine Lebenspartnerin Angelika zu warten, anstatt es sich in der warmen Gaststube des beliebten Lokals gemütlich zu machen.
Es war Dienstag, also Markttag. Und weil der weit über die Landesgrenzen hinweg bekannte Wochenmarkt auf dem nahe gelegenen Koningin Julianaplein beim Rathaus abgehalten wurde, musste er nicht allein der Frische des herbstlichen Vormittags trotzen. Denn während die Frauen eifrig das knackige Obst und Gemüse oder das frische Fleisch und das umfangreiche Fischangebot an den Marktständen prüften, um es nach Beendigung der Corona-Pandemie endlich wieder tütenweise davonschleppen zu können, gönnten sich einige ihrer Männer im »Koffereck« schon mal das erste Bierchen des Tages und andere – wie Le Maire vor dem Café – zusätzlich ein Zigarettchen.
»Fehlt nur ein Schild: ›Wir müssen draußen bleiben‹«, lästerte Peter Schreckmann, einer der Kettenraucher und dienstäglicher Stammgast im »Koffereck«. Wie viele andere kam er mit seiner Frau Lorette jede Woche aus dem wenige Autominuten entfernten ostbelgischen Grenzort Kelmis hierher, um es sich gut gehen zu lassen, während seine ständig vor sich hin schnatternde Gattin saisonale Köstlichkeiten besorgte.
Die anderen Raucher lachten über Schreckmanns mehr als abgedroschenen Witz und Frederic blätterte unbeeindruckt weiter in der Zeitung. Gerade hatte er den Polizeibericht über den Madonnendiebstahl fertig gelesen, als ihm Angelika zurief, er solle ihr beim Tragen der vielen Tüten ins gegenüberliegende Parkhaus helfen.
Weil Angelika eine extrem gut aussehende Frau mit einer Wahnsinnsfigur war, schaute nicht nur ihr Partner auf. Während Frederic Sekunden später über die Straße schlurfte, um ihr zu helfen, genoss er die bewundernden Blicke der anderen in seinem Rücken. Dabei hörte der Mordermittler, wie einer der Männer bemerkte: »Die gehört zu ihm? Unglaublich!«
Wenn man einen Menschen nur auf das Äußere reduzierte, mochte der Mann nicht einmal ganz falschliegen. Denn im Gegensatz zu seiner Angelika war Frederic optisch nicht gerade der Burner. Weil zu den größten Lastern des nur 1,65 Meter großen Mannes neben Selbstgedrehten auch original belgische Fritten und belgisches Bier gehörten, hatte er es im Laufe der Jahre zu einer bemerkenswerten Körperfülle gebracht. Und weil er zudem stets unrasiert war und im Gegensatz zu Angelika keinen allzu großen Wert auf ordentliche, geschweige denn auf modische Kleidung legte, mochten die beiden rein äußerlich überhaupt nicht zusammenpassen. Dennoch liebten sie sich und harmonierten in jeder Hinsicht bestens miteinander – es sei denn, Angelika mäkelte an seiner Kleidung herum und versuchte, ihm Designerklamotten aufzuschwatzen oder ihn in einen dieser schicken »Fresstempel« zu schleppen, die es im Dreiländereck zuhauf gab. Zu Frederics Leidwesen ging meist beides miteinander einher.
Ließ man dies beiseite, konnte man getrost sagen, dass die beiden auch über das Private hinaus ein nahezu perfektes Team waren. Deswegen hatten sie auch eine verzwickte Mordserie der niederländischen »Frittenmafia« gemeinsam lösen und »so ganz nebenbei« auch einen europaweit agierenden Menschenhändlerring ausheben können.
»Zwei Fliegen mit einer Klappe … Das machen wir zwei ab jetzt immer so!«, hatte Frederic Le Maire seinerzeit nach einer Belobigung im Brüsseler Rathaus zu der Aachener Rechtsmedizinerin gesagt.
Damals war er der leitende Kriminalhauptkommissar der Mordkommission Lüttich gewesen. Bei seinem nächsten Fall, bei dem es um raffinierte »Glühweinmorde im Hexenhof« gegangen war, die auf dem Aachener Weihnachtsmarkt ihren Anfang genommen hatten, hatte sich das geändert. Wegen seiner Liebe zu Angelika war er von seiner zentral gelegenen Lütticher Wohnung in der Rue de la Violette an den Ronheider Berg in Aachen gezogen. Seither war er der Leiter der Eupener Kriminalpolizei. Dort war alles etwas gemütlicher als in Lüttich und er hatte es in der »Hauptstadt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens« weniger mit Morden als mit mehr oder minder interessanten Delikten aller Art zu tun. Weil ihn dies bei Weitem nicht ausfüllte, dachte er sogar ernsthaft daran, sich ganz woandershin versetzen zu lassen. Und Le Maire wäre nicht Le Maire, wenn er nicht schon eine Idee im Kopf hätte.
Obwohl Lüttich von Aachen gute 50 Kilometer entfernt lag und eigentlich nicht mehr in seinen Zuständigkeitsbereich fiel, durfte er – wie es in einem gesonderten Schreiben hieß, das er vom Polizeipräsidenten aus Brüssel erhalten hatte – »bei zwingender Notwendigkeit« offiziell mit dem Segen von oben über die belgischen Grenzen hinweg auch in Nordrhein-Westfalen und – wenn es unumgänglich war – auch in anderen Teilen Deutschlands sowie in den Niederlanden und sogar in Luxemburg ermitteln. Allerdings musste er in diesem Fall mit den jeweils vor Ort zuständigen Behörden eng zusammenarbeiten und die dortigen Leitstellen informieren. Weil Le Maire ein absonderlicher Einzelgänger war, der sich am ehesten mit seinen eigenen Leuten, vor allen Dingen aber mit der Aachener Rechtsmedizinerin kompatibel zeigte, mochte ihm dieser Zusatz überhaupt nicht gefallen.
Den Grundstein für diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit hatte Le Maire selbst gelegt. Denn nachdem er und sein Team ihren ersten internationalen »Doppelfall« gemeinsam mit ihren deutschen, niederländischen und englischen Kolleginnen und Kollegen spektakulär gelöst hatten, waren die Polizeichefs der Beneluxländer und Nordrhein-Westfalens zusammengekommen und hatten ein Dekret zur Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg unterzeichnet. Nach dem letzten medienwirksamen Erfolg wollte keiner der Polizeichefs riskieren, bei weiteren spektakulären Siegen über das internationale Verbrechen durch Frederic Le Maire nicht mit von der Partie zu sein.
Letztlich aber war dies dem eigenwilligen Ermittler egal; er tat sowieso, was er für richtig hielt, ob dies auswärtigen Kollegen passte oder nicht. Sein eigenbrötlerisches Verhalten konnte er sich nur erlauben, weil seine Erfolgsquote bisher unschlagbar gewesen war und weil er stets mit der toughen Aachener Rechtsmedizinerin zusammengearbeitet hatte.
*
»Nein, nein!«, wehrte Angelika ab, als Frederic Anstalten machte, sich wieder auf seinen Terrassenplatz vor dem »Koffereck« zu setzen, um eine seiner geliebten Selbstgedrehten zu rauchen. »Mir ist es hier etwas zu kühl! Meine Finger sind vom Taschenschleppen klamm geworden. Ich habe mir jetzt ein Gläschen Prickelwasser in einer wohlig warmen Gaststube verdient.«
»Merde«, fluchte Frederic bewusst so leise, dass sie es nicht hören konnte.
Nachdem ihr die Bedienung den Sekt und ihm ein Affligem-Bier gebracht hatte, war für sie die Welt in Ordnung. Lediglich Frederic war wegen des Rauchverbots in geschlossenen Räumen etwas säuerlich, was Angelika amüsierte. Seit sie sich vor vier Jahren kennengelernt hatten, tat sie alles, um ihn vom Rauchen abzubringen. Dies war der eigentliche Grund, weswegen sie im Lokal und nicht auf der Terrasse saßen.
Nachdem sie den ersten Schluck genommen hatte, entfuhr Angelika ein zufriedener Seufzer. »Ist es nicht schön, dass wir beide zur selben Zeit eine Woche freinehmen konnten, um uns ein wenig in der Heimat zu entspannen? Zuerst in ›meinem‹ Nordrhein-Westfalen und dann in ›deinem‹ Belgien. Und jetzt sitzen wir hier im beschaulichen niederländischen Vaals.« Ohne seine Antwort abzuwarten, begann sie, die geplante Freizeitgestaltung an den freien Tagen vor ihm auszubreiten: »Weil du jetzt bei mir in Aachen wohnst, werden wir morgen von dort aus ein wenig durch die deutsche Eifel fahren. Vielleicht besuchen wir die Burg Satzvey und trinken dort …«
»… ein Gläschen Sekt«, ergänzte Frederic mit einem Lächeln. Er kannte seine Partnerin in- und auswendig. Er erinnerte Angelika daran, dass sie schon öfter die Burg besucht, aber er dort nie etwas Ordentliches zu trinken, geschweige denn zu essen bekommen hatte.
Angelika schürzte die Lippen und zuckte keck mit den Schultern. »Warum nicht? Wir können es ja noch einmal versuchen. Vielleicht hat sich das Angebot der Burggastronomie ja ein bisschen verändert, seit die junge Gräfin das Sagen hat.«
»Das glaubst du doch selber nicht«, konterte Frederic, weil er ahnte, dass es dort nach wie vor keine belgischen Fritten und kein belgisches Bier geben würde. Der einzige Maßstab, an dem sich gute Gastronomie in seinen Augen messen ließ.
»Dann fahren wir eben zum berühmten ›Krimihotel‹ nach Hillesheim. Dort gibt es ein Lokal, das dir gefallen wird. Wie das Hotel sind auch die Gasträume voll im ›crime style‹ eingerichtet. ›Themenkneipen‹ sind ja heutzutage voll im Trend!«, schlug Angelika vor.
Weil Frederic wusste, was es für ihn bedeutete, wenn sie beide nicht zur Arbeit mussten, seufzte er. »Hör mal! Als du vorhin auf dem Markt gewesen bist, habe ich mich ein wenig mit der hiesigen Zeitung beschäftigt. Da konnte ich lesen, dass irgendwelche Verrückten eine Madonna gestohlen haben und …«
»Eine Madonna?«, unterbrach ihn Angelika, weil sie glaubte, sich verhört zu haben.
»Ja!«, nickte Frederic. »Hier in Vaals! Es handelt sich um eine wettergegerbte Muttergottesfigur aus Blaustein, die vor dem Lokal ›De Zwarte Madonna‹ gestanden haben soll!«
»Vor der ›Schwarzen Madonna‹ in Vaals steht doch der ganze Park voller Heiligenfiguren. Und im Lokal hängen sie sogar an den Wänden. Da gibt es doch auch dieses ›Sakralmuseum‹«, entgegnete Angelika.
»Halleluja!«, entfuhr es Frederic lachend.
»Warum machst du dich darüber lustig? Ich dachte, dir gefallen themenbezogen eingerichtete Lokale. In diesem Lokal ist alles authentisch, das ganze Café ist christlich dekoriert und eingerichtet. Dort kannst du sogar beichten!«
»Nicht im Ernst, oder?«, wunderte sich Frederic, der im Gegensatz zu Angelika nie dort gewesen war.
»Natürlich nicht! Obwohl im Lokal ein Beichtstuhl steht. Aber sag mal, was kann man mit einer verwitterten Madonnenfigur anfangen? Gibt es in Antwerpen nicht auch ein Touristenlokal, das ebenfalls mit sakralen Statuen vollgestopft ist wie das Café hier in Vaals?«
Frederic nickte. »Ja! Das kenne sogar ich! Du meinst sicher das ›Elfde Gebod‹neben der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, oder?«
Angelika zuckte wieder mit den Schultern. »Ich glaube schon, dass ich es kenne. Wenn, dann ist es aber sehr lange her, dass ich dort war. Jedenfalls scheint dies wirklich ein Trend geworden zu sein«, fügte sie an und bemerkte, dass es auf der hiesigen ›Mergellandroute‹ etliche Lokale gab, in denen Heiligenfiguren herumstanden.
»Du meinst, dass sich dieser Trend auch bei uns fortsetzen und möglicherweise Erfolg haben wird?«
»Was heißt hier ›bei uns‹? Meinst du ›dein‹ ostbelgisches Eupen oder ›mein‹ nordrhein-westfälisches Aachen? Wenn schon, dann passt eine Kneipe mit Heiligenfiguren in die Kaiserstadt, dort gibt es schließlich einen weltberühmten Dom! Aber wieso interessiert dich das überhaupt? Witterst du schon wieder einen Mord?«, scherzte sie und war dabei stolz darauf, was »ihr« Aachen alles zu bieten hatte.
Frederic lächelte Angelika an und ließ sie weiterreden: »Na ja, meine Freundin Eleonore hat mir erzählt, dass in Aachen, direkt am Dom, ein altes Haus zu einem Speiselokal umgebaut wird, in dem es ›Messwein‹ geben soll.«
»Messwein? Du meinst so einen Wein, wie ihn die Priester während der Messe trinken?«
»Ja, geweihten Wein.« Angelika nickte. »Eleonore ist für die Raumgestaltung und das Interieur zuständig. Auf Wunsch des neuen Besitzers soll das Lokal durch und durch mit sakralen Gegenständen ausstaffiert werden. Dadurch möchte der Wirt, der extrem gläubig sein soll, neben gottesfürchtigen Einheimischen auch Pilger aus aller Herren Länder als Gäste anlocken, beispielsweise auch zur ›Aachener Heiligtumsfahrt‹. Aber erstens ist es nicht so weit, zweitens haben wir nichts damit zu tun und drittens hast du Urlaub. Uuuuurlaub! Verstehst du? Bestell mir lieber noch ein Gläschen Sekt!«
Die »Aachener Heiligtumsfahrt« fand doch alle sieben Jahre statt? Und da möchte der Wirt Umsatz machen?, dachte sich Frederic, während er die Bedienung herbeiwinkte.
*
Der Kriminalhauptkommissar saß knappe 70 Kilometer vom niederländischen Vaals entfernt in seinem Büro im ostbelgischen Provinzhauptstädtchen Eupen. Der Urlaub war – Gott sei’s gejubelt, getrommelt und gepfiffen – endlich vorüber. Voller Tatendrang hatte der Chefermittler sein dreiköpfiges Team mitsamt seiner Sekretärin gleich am Morgen seines ersten Arbeitstages zum Rapport zusammengerufen.
Während einer nach dem anderen in seinem Büro eintrudelte, überlegte der Leiter des Eupener Kriminalkommissariats, weshalb er schlecht gelaunt war. Eigentlich müsste er doch glücklich darüber sein, den gemeinsamen Urlaub mit Angelika einigermaßen unbeschadet hinter sich gebracht zu haben und wieder an seinem geliebten Schreibtisch sitzen zu dürfen. Weiß Gott, er liebte dieses intelligente Vollblutweib, das so viele Vorzüge vorweisen konnte, wie er Mankos und Marotten hatte. Aber musste sie ihn ständig von einem Herrenausstatter zum nächstbesten Schuhladen und von einem Sternelokal in die nächste Champagnerbar schleifen?
Lediglich der von Angelika vorgeschlagene Ausflug nach Hillesheim hatte ihm ohne Punktabzug gefallen; denn das »Krimihotel«, in dem sie übernachtet hatten, war bodenständig gewesen. Zudem hatte sich das angegliederte »Kriminalhaus« mit seinen vielen Ausstellungsstücken und der großen Krimi-Bibliothek als äußerst interessant erwiesen. Und im dazugehörenden »Café Sherlock« hatte es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch feine Bierspezialitäten gegeben, zwar keine belgischen, aber trotzdem gut trinkbare. Die drei Tage in der deutschen Eifel hatten ihm so gutgetan, dass Angelika ihn sogar dazu hatte überreden können, den »Eifelkrimi-Wanderweg« über die gesamte Strecke hinweg mitzugehen und sich am »Krimi-Suchspiel« zu beteiligen.
»Das nenne ich eine gelungene ›Themengastronomie‹«, hatte Le Maire den Inhaber des »Kriminalhauses« gelobt, nachdem er einen Gutschein über eine urige Eifelbrotzeit für zwei Personen in Empfang genommen hatte, weil er beim »Kriminalisieren« von immerhin 18 Teilnehmern der Beste gewesen war. Bescheiden wie er nun einmal war, hatte er sich trotz Angelikas Drängen nicht als »echter« Kriminalbeamter zu erkennen gegeben.
Aber dann war es umso dicker gekommen: Von wegen Ausflüge in seine belgische Heimat! Stattdessen sämtliche Juweliere in Aachen, Boss-Outlet in Köln und der extravagante Philipp-Plein-Shop an der Düsseldorfer »Kö«. Mit Angelikas schickem SLK waren sie sogar zum Nobelschuhgeschäft von John Lobb bis nach Frankfurt hinuntergerauscht. An die sündhaft teure Übernachtung in einem der dortigen Viersternehotels durfte er gar nicht denken. Ja, geht’s noch?, hatte er sich gefragt, Angelika zuliebe aber nichts laut dazu bemerkt. Die kostspieligen »Fresstempel«, in denen die Ober stets distinguiert dreingeschaut hatten, wenn er sich ein frisch gezapftes Bier anstelle des Rotweins zum Rumpsteak bestellt und sich vorsichtig nach Fritten erkundigt hatte? Nein, das war nicht das, was er unter Lifestyle und Dolce Vita verstand! Und es war noch schlimmer gekommen: Anlässlich seines Geburtstages hatte Angelika ihn nach Bochum zum »Starlight Express« gelockt. Allerdings hatte er sich schon während der Vorstellung eingestehen müssen, dass es sich um ein rasantes Musical handelte. Jedenfalls war er – anders, als es bei solchen oder ähnlichen Events bisher eigentlich immer der Fall gewesen war – nicht eingeschlafen. Dennoch mochte er sich »so etwas« nicht mehr antun.
Sehr zum Ärgernis seiner Sekretärin Fabienne Loquie kaute er in Gedanken daran genervt auf einem Bleistift herum. Weil die 29-jährige untersetzte Frau ihren Chef vergötterte, wies sie ihn nicht darauf hin, obwohl sie dafür zuständig war, dass im Eupener Kommissariat mit Bürobedarf sparsam und pfleglich umgegangen wurde.
»Was steht an, Locki?«, bellte der Chef seiner Sekretärin entgegen, deren Wangen sich schlagartig knallrot färbten und deren Augen einen gefährlich wässrigen Glanz bekamen.
»Also …« Nachdem Locki, wie die Sekretärin wegen ihres lockigen Kurzhaarschnittes allseits genannt wurde, abschweifend berichtet hatte, was während seiner Abwesenheit im Kommissariat los gewesen war, kam Le Maire zu dem Schluss, dass sich nichts Interessantes ereignet hatte.
Nach Lockis wenig ergiebigem Vortrag über allerlei Administratives, Telefon- und Posteingänge sowie über pikante Interna aus anderen Abteilungen erhoffte Le Maire sich von seiner Stellvertreterin Agnès Devaux interessantere und wichtigere Informationen. Aber die im Gegensatz zu ihrem Chef übergenaue Kriminaloberkommissarin konnte zu Le Maires Verwunderung auch nicht allzu viel berichten, schon gar nichts von einem aktuellen Mordfall.
»War’s das schon, Devaux?«, fragte er sie nach Beendigung ihres kurzen Vortrages. »Kein einziger Mord? Nicht mal ein kleiner Totschlag? Ihr habt euch nur mit Kinkerlitzchen aus anderen Abteilungen beschäftigt?«
Devaux zog zuerst die Mundwinkel nach unten und die Stirn nach oben, bevor sie abwehrend ihre Hände hochhielt.
»Pierre! Herbert! Habt wenigstens ihr etwas?«
Weil Kriminaloberkommissar Pierre Vonderbank und Polizeihauptmeister Herbert Demonty nur wortlos ihre Köpfe schüttelten, beschloss Le Maire, auf den Balkon zu gehen, um sich eine Zigarette zu drehen. »Und dann bringst du mir einen deiner köstlichen Kaffees, Locki!«
»Ach, Chef! Noch etwas: Sie müssen sich bei Docteur Baguette in Lüttich zurückmelden!«
»Ich weiß, Locki! Danke! Du kannst mich gleich mit ihm verbinden, ich muss ihn sowieso kurz sprechen!«
»Aber erst nach dem Kaffee, oder?«, fragte sie in verführerischem Tonfall, den sie mit einem Augenzwinkern garnierte.
Le Maire nickte zustimmend.
Eine Kaffee- und Zigarettenlänge später hatte Le Maire seinen direkten Vorgesetzten Docteur Etienne Baguette am Telefon. Der hochrangige Beamte war der Chef einer von insgesamt drei Generaldirektionen mit Sitz in Lüttich, also ein »hohes Tier«. Über ihm stand nur das Generalkommissariat in Brüssel. Seine – also auch Le Maires Dienststelle – war Teil der Police Fédérale, der landesweiten Polizei Belgiens, die ihre Fühler in alle Richtungen ausstreckte, wenn es um das Verhindern möglicher Verbrechen oder um die rasche Aufklärung derselben ging.
Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln drang aus dem Telefonhörer Papierrascheln. »Mein guter Le Maire, ich komme gleich zum Punkt: Ich lese hier, dass Sie zu viele Überstunden haben und schleunigst wenigstens einen Teil davon abbauen müssen!«
»Schon wieder Urlaub? Jetzt gleich?«, schoss es entrüstet aus dem besten Mordermittler Belgiens heraus.
»Ja! Jetzt gleich! Das Jahr geht dem Ende entgegen! Weil offensichtlich alle Mörder in Ihrem Zuständigkeitsbereich in die Herbstferien gegangen sind, ist hier seit Wochen tote Hose! Deswegen habe ich sogar unseren neuen Rechtsmediziner kurzfristig auf einen Fortbildungslehrgang nach Brüssel geschickt.« Offenbar um Le Maire dazu zu bewegen, wenigstens ein paar Überstunden abzubauen, schmückte er dieses Argument aus: »Sie haben ja selbst gemerkt, dass der junge Mediziner keine Erfahrung hat und dass derzeit nichts los ist!« Docteur Baguette legte eine kurze Pause ein, bevor er ergänzte: »Fragen Sie mich nicht, warum momentan niemand umgebracht wird. Wie gesagt …«
»Ich weiß, lausige Zeiten für Mordermittler«, murmelte Le Maire.
»Was? … Äh … Sind Sie verrückt geworden, Le Maire?«, rügte Docteur Baguette seinen Hauptkommissar, nachdem er realisiert hatte, was der soeben von sich gegeben hatte. Er räusperte sich fast etwas verlegen und fuhr in gemäßigtem Ton fort: »Jedenfalls ist das die Gelegenheit für Sie, in diesem Jahr ein paar Urlaubstage dranzuhängen. Ich weiß, dass ich anderen Kollegen nicht zumuten kann, im November Urlaub zu machen. Aber Sie fahren ja – wie ich weiß – sowieso nie ins Ausland in die Ferien.«
»Das stimmt nicht, Monsieur Docteur! Ich habe erst jetzt gerade ein paar Tage Urlaub in der Eifel gemacht!« Dass er gerne wieder einmal in sein geliebtes Katalonien oder ins schöne Allgäu fahren würde, verkniff er sich angesichts Baguettes drohendem Vorschlag.
»Jaja. Schon gut! Und jetzt genießen Sie zur Abwechslung einfach einmal unsere Heimat – Belgien ist wunderschön! Fahren Sie zur Küste hoch, oder …«
»Alles klar, Chef«, unterbrach Le Maire wieder. »Ich habe verstanden und beuge mich der Gewalt. Ich arbeite bis zum Wochenende einige Kleinigkeiten auf und lege dann ein paar Tage Urlaub drauf. Ist das für Sie in Ordnung?«
Le Maire bemerkte zwar Docteur Baguettes erleichtertes Ausatmen, der aber nicht Le Maires inneren Fluch.
»Ich wusste, dass Sie vernünftig sind!«, lobte Docteur Baguette, obwohl er sich denken konnte, dass in der Regel genau das Gegenteil der Fall war. Hauptsache, das Thema war für den Chef vom Tisch.
*
Endlich war die ungewöhnlich unaufgeregte Arbeitswoche ohne eine einzige Leiche zu Ende gegangen. Frederic wollte sich zuerst vom Büro zu seiner alten Wohnung in die Rue de la Violette begeben, die mitten im Zentrum von Lüttich lag. Dort würde er seinen Kulturbeutel und ein paar Klamotten in seinen 40 Jahre alten mintfarbigen Citroën packen und dann in die gemeinsame Wohnung nach Aachen zu seiner Angelika fahren. Dabei wusste er jetzt schon, dass er den neuen Designeranzug und die hippen Schuhe, die nach Angelikas Aussage »perfekt« zum Anzug passten, in seiner Lütticher Wohnung geflissentlich vergessen würde.
*
Am Nachmittag des folgenden Tages hatte der beurlaubte Kommissar eine Art Déjà-vu. Wie vor knapp zwei Wochen in Vaals machte Angelika Besorgungen, während er relaxt vor einem Lokal saß. Dieses Mal an einem Samstag und auf der Terrasse des Café-Restaurants »Elisenbrunnen« in seiner neuen Wahlheimat Aachen. Er hatte eine Zigarette im Mundwinkel und blätterte das »Aachener Tagblatt« durch. Dabei stolperte er über den Polizeibericht:
Aachener Tagblatt vom 30. Oktober 2021. – Polizeibericht:
Aus der Nachbarschaft. Wie die Aachener Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen erst heute mitteilt, ist es im niederländischen Grenzort Vaals zu einer Leichenfledderei gekommen. Als am frühen Morgen des 19. Oktobers einer der Friedhofswärter über den Friedhof zur Aussegnungshalle gehen wollte, entdeckte er einen Erdhügel, der dort nicht mehr sein sollte, weil mit dieser Erde tags zuvor ein frisch ausgehobenes Grab zugeschüttet worden war. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass das Grab der am Vortag darin beerdigten Frau wieder ausgehoben und der Inhalt des Sarges verschwunden war. Von Leiche und Leichendieb fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise …
Schon wieder Vaals? Dort geht es derzeit ja zu wie im Chicago der 1920er-Jahre! Ich glaube, ich lasse mich nach Holland versetzen, dachte Le Maire grinsend, schob den irrsinnigen Gedanken aber sofort wieder beiseite.
Weil die niederländische Provinz Limburg, zu der das ansonsten eher beschauliche Grenzstädtchen zählte, nicht zu seinem Revier gehörte, hatte er dort nichts zu melden. Allerdings scherte sich der belgische Kriminalbeamte normalerweise nie um Grenzen, an denen seine Kompetenzen als »ein im deutschsprachigen Gebiet Belgiens tätiger wallonischer Kriminalhauptkommissar« normalerweise endeten.
Die Sache mit dem Leichendiebstahl in Vaals interessierte ihn brennend. Aber: Es ging ihn wirklich nichts an.
Deswegen schlug er die Zeitung zu und zog nachdenklich ein paar Mal an seiner Zigarette. Schließlich war er für ermordete Menschen und nicht für verschwundene Friedhofsleichen aus dem Ausland zuständig – es sei denn, sie hatten etwas mit einem Mordfall zu tun, den er und sein Team bearbeiteten. Aber derzeit gab es eben nichts zu bearbeiten. »Keine Leiche, keine Arbeit! So einfach ist das«, seufzte er leise in sich hinein.
*
Frederics ganz persönliche »Urlaubswünsche« waren insofern in Erfüllung gegangen, dass Angelika nicht schon wieder freibekommen hatte und er seine Freizeit zumindest tagsüber weitgehend selbst im direkten Umfeld gestalten konnte. So hatte er es gemütlich angehen lassen und Angelika fast täglich zur Arbeit gefahren. Danach war er meist planlos durch Aachen geschlendert, ohne sich um das dortige Geschäftsleben zu kümmern. Manchmal hatte er sich in ein Café gesetzt, um ganz einfach Menschen zu beobachten.
Erst nach Angelikas Feierabend in der Aachener Rechtsmedizin war es für ihn das eine oder andere Mal etwas stressig geworden. Angelika hatte ihn dazu überredet, mit einem oder zwei befreundeten Pärchen ins »Aachener Brauhaus« oder in den »Domkeller« zu gehen, zwei der wenigen verbliebenen urigen Öcher Bierkneipen. Wie immer, wenn sie sich mit Freunden trafen, hatte Angelika sich die eine oder andere neckische Bemerkung wegen ihres Berufes anhören müssen wie beispielsweise: »Hast du dir auch schön die Hände gewaschen?« Weil die coole Leichenbeschauerin diese dummen Sprüche zur Genüge kannte, nahm sie das Ganze stets locker.
Frederic konnte nicht immer alles so leicht nehmen wie seine Partnerin. Denn während Angelikas beste Freundin, die 42-jährige Innenarchitektin Eleonore Olbrich, von ihrem aktuellen Projekt zwischen Münsterplatz und Fischmarkt erzählte und von der ersten Madonnenfigur schwärmte, die dort zur Dekoration eingetroffen war, nervte ihr Mann. Bert Olbrich war ein äußerst geschwätziger Psychologieprofessor der RWTH Aachen, der immer alles besser wusste – sogar besser als Frederic.
Während Frederics »Single-Urlaubs« hatte Angelika sich lediglich zweimal durchsetzen und ihn in die nordrhein-westfälische Spitzengastronomie schleppen können; einmal davon sogar in ein japanisches Edelrestaurant in Köln, in dem das Fleisch vor ihren Augen auf einem »Teppanyaki-Grill« zubereitet wurde.
»Jaja! Dann trinke ich in Gottes Namen eben ein japanisches Bier!«, hatte Frederic sehr zu Angelikas Missfallen geknurrt, nachdem ihn der freundliche Koch gefragt hatte, ob alles in Ordnung sei. »Asahi-Bier! Wenn ich das schon höre, Asahi! Da lobe ich mir mein belgisches Jupiler«, hatte er gemault und das Getränk mit einer todesverachtenden Mimik in sich hinein- und einen Shōchū hinterhergeschüttet.
Da hatte es auch nichts genützt, dass Angelika ihm erklärt hatte, dass er ein Sapporo- oder ein Yebisu-Bier hätte bestellen können. »Das Asahi …«, hatte sie mit erhobenem Zeigefinger geschulmeistert, »… ist das teuerste japanische Bier, das sie hier haben, also wird es wohl auch das Beste sein. Und jetzt hör endlich mit deiner Motzerei auf!« Sie hatte ihn sogar so laut gerügt, dass der Chefkoch erneut an den Tisch gekommen war, um nochmals nachzufragen, ob alles in Ordnung sei.
»Jaja … Ein Bier, bitte!«
Im »La Bécasse«, einem französischen Nobelrestaurant in Aachen, hatte er sich ein paar Tage später zwar schnell an die landestypische Zubereitung des Steaks mit der leckeren Soße gewöhnt. Allerdings gab es als Beilage keine Fritten, sondern nur Kroketten. Französische Kartoffelstäbchen hätte er – im Gegensatz zu deutschen Pommes frites – seinem Magen sogar angetan, obwohl er normalerweise nur belgische Fritten akzeptierte.
Was die Getränke betraf, so war er wenigstens diesbezüglich etwas zufriedener gewesen. Die Bierqualität war deutsch. Und damit konnte sich das japanische Gebräu trotz aller Bemühung nicht messen.
So waren die Tage vergangen, ohne dass Angelika die Zeit gehabt hatte, mit ihm ausschweifend shoppen zu gehen. Hier und da waren sie zwar in die von Frederic gerne gemiedene »Elisengalerie« oder in den von ihm gehassten Konsumtempel »Aquis Plaza« gehetzt, aber mehr hatte sie ihm nicht zugemutet. Weil Angelika bei den wenigen Einkaufsmöglichkeiten ganz auf sich selbst fixiert gewesen war, hatte sie ihn weitestgehend verschont. Die Camouflage-Jogginghose, die in einer Geschäftsauslage gelegen hatte, hatte sie ihm dann aber doch kaufen müssen.
Ich bin Polizeibeamter und kein Soldat. Nur gut, dass ich die ausschließlich zu Hause tragen muss und mich niemand damit sieht, hatte er sich gedacht, als er das Geschenk mit einem verzerrten Lächeln in Empfang genommen und ihr ein Küsschen gegeben hatte.
*
Zur Abwechslung war Frederics Lebensgefährtin übers Wochenende mit ihm nach Lüttich gefahren, wo sie sich erst einmal damit befassen musste, Frederics ehemaligen Erst- und heutigen »Ausweichwohnsitz« auf Vordermann zu bringen.
»Aha. Da also hast du deinen neuen Anzug und die Schuhe versteckt«, hatte Angelika in ruhigem Ton gesagt und die beiden hippen Teile demonstrativ auf dem Bett ausgebreitet. Das Schuhwerk hatte sie ebenfalls gut sichtbar direkt davor auf den Boden gestellt. Frederic war nichts anderes übrig geblieben, als den topaktuellen Anzug mit der, wie er fand, schrecklichen Jacquardmusterung zu loben. Um keinen Streit zu provozieren, hatte er sogar beschlossen, sich kampflos in sein unausweichliches Schicksal zu ergeben. Vielleicht wäre es doch besser, wenn ich Soldat geworden wäre, hatte er sich gedacht und sich gnädig gezeigt: »Weißt du was, Angelika? Zum Dank lade ich dich heute zum Essen ein!«, hatte er an diesem frühen Samstagabend verheißungsvoll getönt und – um seiner Geliebten zu gefallen – den Anzug angezogen, den er ansonsten niemals »freiwillig« tragen würde.
*
»Sag mal, spinnst du? Willst du mich natzen!«, schimpfte Angelika, die in ihrem engen Kostümchen eine ganz besonders gute Figur abgab, obwohl ihr die Zornesröte ins Gesicht geschossen war.
»Wieso?«, wunderte Frederic sich allen Ernstes, als sie durch die Tür der »Friterie du Perron« an der Ecke Rue de Rey nahe seiner alten Wohnung spazierten, wo Angelika ungläubig auf die frittierten Kartoffelstäbchen in der Auslage starrte, während er im Geiste bereits genüsslich damit begonnen hatte, sein Menü zusammenzustellen.
Fast angewidert wandte Angelika ihren Blick ab und schaute wehmütig zum Fenster hinaus. Anklagend zeigte sie über die Hauptstraße zum »Place du Marché« hinüber. »Hättest du mich nicht wenigstens ins ›Å Pilori‹ einladen können? Ist das nicht eines deiner beiden Stammlokale gewesen, als du noch in Lüttich gewohnt hast? Weshalb haben wir uns so rausgeputzt? Nur dass du mich in eine gewöhnliche Frittenbude schleppst?«
»Entschuldige, mein Schatz! Weil ich schon lange nicht mehr bei meinem alten Freund ›Fritten Ralf‹ war, dachte ich mir …«
»Was dachtest du dir?«, unterbrach Angelika schroff. »Nichts hast du dir dabei gedacht, als du mich ohne Vorwarnung hierhergebracht hast.« Während Angelika so richtig loslegte, brummte es in Frederics Hosentasche. Egal, wer dran ist, der Anruf kommt genau zur richtigen Zeit, dachte er sich und fischte sich zu Angelikas Erstaunen sein ausnahmsweise einmal betriebsbereites Mobiltelefon aus der Tasche. Dass der Akku seines Handys geladen war, lag nur daran, dass er sehnlichst darauf hoffte, endlich Arbeit zu bekommen, derentwegen er seinen Urlaub würde abbrechen müssen.
Als Angelika weiterschimpfen wollte, sagte er nur: »Entschuldige bitte.«
»Schon gut!«, schnaubte sie, aber ihr Unmut war noch lange nicht verraucht.
»Oh, Locki! Du bist es! Was gibt’s? … Aha! … Schon gut!« Gleich darauf schoss ein erschrocken wirkendes und irgendwie doch zufrieden klingendes »Was?« aus ihm heraus. Nachdem er einige Male still genickt hatte, fragte er seine Sekretärin: »Wo?« Gleich darauf sagte er in versehentlich gut gelaunt klingendem Tonfall: »Ich fahre sofort los. Ruf die uniformierten Kollegen in Clermont an, dass sie alles absperren und nichts berühren oder verändern sollen!«
Angelika hatte sich zwar vorgenommen, umgehend weiterzupoltern, sowie Frederic sein Telefonat beendet haben würde, ahnte aber, um was es darin gegangen war. »Wer war das?«, säuselte sie und spielte dabei die Uninteressierte.
»Das hast du doch gehört, Schatz! Es war Mademoiselle Loquie, meine Sekretärin!«
»Und? Was ist los? Nun sag schon!«
Frederic atmete tief durch, bevor er antwortete: »Es tut mir leid, aber ich muss weg! Wir haben eine Leiche!«
»Wo?«
»Keine 30 Kilometer von hier!«
»Wo?«, wiederholte sie genervt.
»In Clermont!«
»Meinst du Thimister-Clermont in der belgischen Wallonie? Das kenne ich! Ein süßes mittelalterliches Örtchen.«
»Entschuldige bitte, Angelika. Ja! Selbstverständlich meine ich dieses Clermont und nicht das Clermont in Frankreich oder gar in Florida!«
Während Frederic sich insgeheim darauf freute, endlich wieder einen Mordfall lösen zu dürfen, anstatt mit Angelika einen auf fein machen zu müssen, holte sie ihr nagelneues iPhone hervor und versuchte, damit ins Netz zu gelangen.
»Also … Äh … Ich muss jetzt fahren!« Wenn der Kriminalbeamte hoffte, sich so einfach loseisen zu können, irrte er sich gewaltig. Angelika fragte ihn, ob er sie nicht mitnehmen mochte.
Der Mordermittler überlegte einen Moment lang. Dann zuckte er mit den Schultern und sagte, dass er grundsätzlich nichts dagegen habe, es aber nicht ihr Fall sei, weil der Tote, »… wie wir nun ja festgestellt haben«, in der Provinz Lüttich aufgefunden worden sei. Damit – so glaubte er – sei die Sache vom Tisch.
»Da irrt sich der Herr Kriminalhauptkommissar aber gewaltig!«, entgegnete sie selbstbewusst.
»Wie … Wie meinst du das?«, wunderte sich Frederic.
»Sieh selbst!«, sagte sie und hielt ihm triumphierend ihr Smartphone entgegen.
»Ja und? Du hast einen Routenplaner aufgerufen. Was soll das?«
Angelika lachte siegessicher auf, bevor sie ihm erklärte, dass es von Lüttich nach Clermont genau 28,4 Kilometer, von Aachen aus aber nur 23,3 Kilometer waren. »Also liegt Aachen näher am Tatort als Lüttich, oder? Außerdem ist dies sowieso nicht dein Fall, weil du in Eupen und nicht mehr in Lüttich arbeitest! Hast du das vergessen?«
Nun triumphierte Frederic: »Dennoch wurde ich angerufen! Und von Eupen aus sind es nur gute 14 Kilometer!«
Er sah Angelikas fordernden Blick und fluchte still in sich hinein. Er wusste, dass er sagen konnte, was er wollte, er hatte schon verloren. Also gab er sich lieber gleich geschlagen, als sich auf eine lange Diskussion einzulassen, bei der er am Schluss sowieso den Kürzeren ziehen würde. »Von mir aus!«, knurrte er. »Möglicherweise hast du Glück.«
Angelikas Augen weiteten sich erwartungsvoll. »Weshalb?«
»Na ja, ich hatte dir doch davon erzählt, dass der junge Nachfolger von Docteur Brülèe zur Fortbildung in Brüssel ist. Somit ist die Gerichtsmedizin in Lüttich derzeit verwaist.«
Bevor es sich Frederic doch noch überlegte, fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn. »Danke, Lemmi!«
Nun stieg ihm die Zornesröte ins Gesicht. »Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du mich nicht so nennen sollst! Und nun lass mich in Ruhe mit meinem Chef telefonieren, damit er unserer neuerlichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zustimmen kann! Das klappt nur, wenn er seinen Segen gegeben hat. Und den bekommen wir nur, wenn es Docteur Baguette gelingt, Oberstaatsanwalt Delieux ebenfalls mit ins Boot zu nehmen.«
»Aber das war doch sicher nicht zufällig, dass sie in Eupen angerufen und dich zu dem Fall gerufen haben, oder?«, wunderte sich Angelika und setzte keck nach: »Dann gibt es sicher auch keine Probleme, wenn ich dich bei der Aufklärung dieses Falls unterstütze.«
Kapitel 2
Und ob der leitende Lütticher Staatsanwalt Martin Delieux zugestimmt hatte. Denn der Mann war wegen eines überaus günstigen Zufalls erst vor einem Jahr zum Oberstaatsanwalt avanciert und musste sich in seiner neuen Position beweisen. Und dies tat er am besten, indem er möglichst viele, vor allen Dingen schnelle Erfolge erzielte. Weil dies ohne Mordfälle aber schwierig war, hatte er Docteur Baguettes Vorschlag zugestimmt, keine Zeit zu verlieren und die deutsche Rechtsmedizinerin mit der Leichensektion zu betrauen. Weil das Dream-Team Le Maire/Dr. Laefers bei den »Frittenmorden« vor zwei Jahren und bei den »Glühweinmorden« im vergangenen Jahr bereits hinreichend bewiesen hatte, dass es gut und erfolgreich zusammenarbeitete, konnte dies einer raschen Aufklärung des aktuellen Falls nur dienlich sein und für Delieux schnelle Ergebnisse zeitigen, mit denen er sich würde schmücken können. Deswegen war der Oberstaatsanwalt über seinen eigenen Schatten gesprungen und hatte seine Ressentiments Le Maire gegenüber beiseitegeschoben – zumindest vorübergehend. Er hatte seinen Eupener Chefermittler sogar persönlich angerufen, um ihm die volle Unterstützung der Staatsanwaltschaft zuzusichern. Dazu war allerdings nötig gewesen, dem Interimsleiter seiner Lütticher Mordkommission klarzumachen, dass dies Le Maires Fall und somit ein Fall der Eupener Kollegen war, die es mit aller zur Verfügung stehenden Lütticher Manpower zu unterstützen galt.
Weil Patrick Miller, der eigentliche Chef der Lütticher Mordkommission, im Urlaub weilte, kam es Delieux entgegen, Le Maire für den Fall abzustellen.
*
»Bonjour, Locki! Was gibt’s?«
»Bonjour, Monsieur le Commissaire! Gut, dass Sie gleich rangehen!«
Le Maire seufzte. »Was gibt es denn Wichtiges?«
»Agnès Devaux ist bereits nach Clermont unterwegs! Den Kollegen Pierre Vonderbank konnte ich leider nicht erreichen. Und Herbert Demonty ist …«
»Na ja, wir haben Wochenende!«, unterbrach Le Maire seine aufgekratzte Sekretärin. Lassen wir es die beiden Kollegen genießen. Eine Unterstützung genügt mir fürs Erste! Ist sonst etwas?«
»Ja! Ich soll Ihnen ausrichten, dass sich Oberstaatsanwalt Delieux gleich morgen früh mit Aachen in Verbindung setzen wird, um die Angelegenheit in Bezug auf Ihre Kompetenz und die Sache mit Frau Dr. Laefers zu klären.«
Als er dies hörte, lachte Le Maire triumphierend auf. »Dass dies mein Fall ist, geht meinen Aachener Kollegen Peter Dohmen zwar nichts an, aber von mir aus. Danke, Locki! Ich bin in etwa 15 Minuten in Clermont und komme dann am Montag ins Büro. Du machst jetzt auch gleich wieder Feierabend, ich brauche dich heute nicht mehr, dafür am Montag umso mehr! Alles klar? Au revoir!«
Enttäuscht legte Fabienne Loquie auf. Weil ihr Freund Hennes auf beruflicher Bustour und sie deswegen allein war, wusste sie mit diesem verregneten Wochenende nichts Besseres anzufangen, als zu arbeiten und ihrem Chef zur Seite zu stehen. Bis vor etwa zwei Jahren hatte sie ihn sogar offen angehimmelt. Seit sie aber während einer Reise nach Brüssel den Aachener Busfahrer Hennes kennen- und lieben gelernt hatte, verehrte sie ihren Chef nur noch, dies aber mit einer fast schon selbstlosen Hingabe, die Le Maire hier und da lästig war.
*
Die auf der Straße herumstehenden Anwohner staunten nicht schlecht, als Angelikas SLK fast etwas zu flott in die kleine Gasse einbog, die Locki ihrem Chef beschrieben hatte. Mehr staunten die Kolleginnen und Kollegen der ebenfalls von Locki informierten Eupener Spurensicherung darüber, dass sie zum Einsatz kamen und dass Le Maire in einem todschicken Anzug vor ihnen stand. Vollends verwundert waren sie, als sie gewahr wurden, dass nicht der junge Rechtsmediziner aus Lüttich, sondern eine ihnen bestens bekannte Rechtsmedizinerin aus dem Ausland die Leichenbeschau vornehmen wollte. Zumindest machte sie den Eindruck, denn die aparte Frau war in einen weißen Schutzanzug geschlüpft, mit ihrem Arztkoffer direkt auf die Leiterin der Spurensicherung zugegangen und hatte selbstbewusst gefragt: »Was haben wir?«
Weil normalerweise der leitende Ermittler diese obligatorische Frage stellte, blieb Le Maire nur ein drängendes »Und?« übrig.
»Der Fundort ist nicht der Tatort!«, verkündete Therese Lambert, die 39-jährige Leiterin der Eupener Spurensicherung, bevor sie beiseiteging und die Rechtsmedizinerin ihre Arbeit tun ließ. Und die würde in dieser Nacht wohl nicht einfach werden.
Vor ihnen war eine Frau mit dunklem Teint so an der oberirdischen Grabkammer der Familie Tomson-Brandebourg hindrapiert worden, als wenn sie ihren Rausch ausschlafen würde. Sitzend lehnte sie mit dem Rücken an der Glastür, die in die Familiengruft führte. Ihr linker Arm war wie schützend auf ihre Scham gelegt worden, der andere fehlte. Sie trug aufreizende Kleidung. Und während stetig Blut vom Armstumpf heruntertropfte, waren ihre Augen starr in Richtung der gegenüberliegenden Kirche Saint Jaques le Majeur gerichtet. Der Mund der Toten war so weit geöffnet, dass es wirkte, als ob sie dem heiligen Jakobus ihren Schmerz entgegenschrie.
Dieses Bild störte die Wahrnehmung der wenigen Menschen am Tatort so stark, dass sie wie erstarrt dastanden, einen Moment lang unfähig, etwas zu tun. Lediglich Le Maire war dazu imstande, die Lage um die Tote herum sofort zu analysieren: »15 Meter …« Damit meinte er den Abstand zwischen der Leiche und dem Gotteshaus, auf das sie starrte und vor dem unzählige, teilweise jahrhundertealte Grabsteine standen oder einfach nur herumlagen. Ob ihm diese Einschätzung etwas nützen würde, wusste er nicht. Aber dies war im Moment nicht wichtig, jetzt ging es erst einmal darum, den Leichenfundort »sauber« zu halten, die Leiche zu identifizieren und die Umstände des Todes an Ort und Stelle wenigstens in etwa zu analysieren.
»Todesursache?«, bellte Le Maire ungeduldig, musste sich mit einer Antwort aber so lange gedulden, bis Dr. Laefers mit ihrer Arbeit so weit war.
Der Mordermittler nützte die Zeit, um mit den wenigen anwesenden Streifenbeamten zu sprechen und sie das Rundbogentor zum Friedhof absperren zu lassen. »… und leuchtet – verdammt noch mal – endlich das Areal aus!«
»Wir haben keine so großen Strahler zur Verfügung«, hielt einer der Beamten in eingeschüchtertem Tonfall entgegen.
»Dann holt ihr eben die Feuerwehr!«, gab Le Maire unwirsch zurück.
Nachdem dies geklärt war, blieb dem Mordermittler nichts anderes übrig, als sich »notgedrungen« eine Zigarette anzuzünden und das Tun seiner Partnerin im Dunkel der Nacht zu betrachten, das nur durch ein paar Taschenlampen erhellt wurde, weswegen die Szenerie umso schauriger wirkte. Davon unbeeindruckt, wartete er darauf, was sie zu berichten hatte. Und das traf ihn mit voller Wucht.
»Also, Herr Hauptkommissar!«, sagte sie, während sie aufstand. »Die Frau ist etwa 25 Jahre alt und keine zwei Stunden tot, weswegen das Blut dort …«
»… nicht ganz eingetrocknet ist«, kam Frederic seiner Partnerin zuvor.
»Die Schleifspuren hier sind frisch und kommen von dort!«, bestätigte Therese Lambert, während sie mit einer Hand zur entgegengesetzten Seite des Friedhofseingangs zeigte. Gleichzeitig drückte sie Le Maire ein Tütchen in die Hände.
»Was ist das? Sieht wie Schuppen eines Reptils aus, vielleicht einer Schlange«, stellte er fest, nachdem er den Inhalt des Tütchens näher betrachtet hatte. »Woher stammt das?«
»Von ihren Fingerspitzen! Diese Schuppen finden sich auch unter ein paar Fingernägeln«, kam es zur Antwort.
»Ist das alles, was ihr bisher gefunden habt?«, knurrte Le Maire.
»Sie sind gut! Bei den Lichtverhältnissen«, kam es ruppig zurück.
»Papiere?«
Die Chefin der Spurensicherer schüttelte wortlos den Kopf.
»Merde!« Weil es dem Ermittler im Moment nicht weiterhalf, gab er das Tütchen an die Spurensicherung zurück und wandte sich wieder Angelika zu. »Und?«
»Schwer zu sagen, mit wem wir es zu tun haben! Die Klamotten sind sehr aufreizend, vielleicht Verbindungen zum Rotlichtmilieu?«
»Und die Todesursache?«, fragte Le Maire noch einmal.
Angelika winkte Frederic näher zu sich, dann beugte sie den Oberkörper der Frau nach vorne. »Sie wurde von hinten erstochen! Alles Weitere …«
»Jaja. Schon gut. Ich weiß … morgen!«, grummelte der Ermittler, während er weiter suchend um sich blickte. »Na, endlich!« Le Maire war erleichtert, als der durch die Polizei angeforderte Gemeindeelektriker mit zwei Flutlichtern auf dem Ladewagen ankam und unverzüglich damit begann, die Beleuchtungskörper so aufzustellen, wie sie die Rechtsmedizinerin und die Spurensicherer haben wollten.
Während die ausfahrbaren Strahler hochgekurbelt und wackelnd in Position gebracht wurden, blitzte das Licht eines Strahlers für den Bruchteil einer Sekunde in Richtung des Kirchenendes, wohin der Ermittlungsleiter zufällig gerade schaute. Weil Le Maire glaubte, einen Kopf mit langen Haaren gesehen zu haben, der hinter der Mauerecke hervorgelugt hatte, eilte er links um die Kirche herum, um die Person zu erwischen. Aber er war zu langsam. Bei der davonrennenden Person konnte er gerade noch feststellen, dass es sich um einen großen Mann handelte, an dessen rechtem Handgelenk etwas zu blitzen schien, als für einen Moment das Licht einer Straßenlaterne darauf schien. Weil der Mann dann aber ganz im Dunkel verschwand, hatte er keine Chance mehr, ihn zu erwischen.
*
»Was tust du denn hier?«, knurrte der belgische Mordermittler, als er anderntags in der Aachener Rechtsmedizin auf seinen Kollegen Peter Dohmen stieß.
»Keine Sorge, Frederic, ich habe es schon gehört, es ist dein Fall! Und da mische ich mich selbstverständlich nicht ein! Allerdings helfe ich dir gerne, wenn …«
Frederic hob abwehrend die Hand. »Dieses Mal nicht, okay?«
»Weil dies hier …«, Peter Dohmen drehte sich mit weit aufgerissenen Armen um die eigene Achse, »… aber die rechtsmedizinische Abteilung ›meines‹ Kommissariats ist, darf ich doch sicher dabei sein, wenn dir Angelika sagt, was sie herausbekommen hat, oder etwa nicht?«
Da war es wieder, dieses ewige Platzhirschgehabe, das der deutsche und der belgische Chefermittler eigentlich nicht mehr an den Tag legen wollten, seit sie zusammen im allgäuischen Oberstaufen gewesen waren, um Gilbert Primat gemeinsam zu verhaften, den damals über sämtliche Landesgrenzen hinweg gesuchten »Glühweinerpresser«. Seither waren sie sogar mehr oder weniger zu Freunden geworden – irgendwie zumindest. Deswegen und weil ihm dieser Fall bereits zugeteilt worden war, zeigte sich der belgische Kommissar großmütig. Er gestattete dem Hausherrn, dabei zu sein, wenn Angelika über die Leiche dozieren würde.
»Jussuf …« Damit meinte sie ihren Assistenten Jussuf Abdalleyah, der sofort verstanden hatte, dass er das Tuch von der Toten nehmen und ihren Oberkörper hochheben sollte.
»Kommen wir also zuerst zur Todesursache: Wie ich bereits am Leichenfundort feststellen konnte, ist sie von hinten erstochen worden! Und zwar …«
»Um Gottes willen! Was ist das denn?«, unterbrach Peter Dohmen die Rechtsmedizinerin, hielt aber sofort inne, als er Frederics genervten Blick sah.
»Darf ich weitermachen?«, hakte sich Angelika gleich wieder ein, um eine unnütze Streiterei der beiden Alphatierchen im Keim zu ersticken. »Also: Die Stichwunde sieht deswegen so schlimm aus, weil der Mörder ein Messer benutzt hat, das einseitig normal geschärft ist und auf der anderen Seite grobe Sägezacken besitzt! Deswegen muss er es ihr mit aller Kraft in den Rücken gerammt haben. Zudem hat er es ein paar Mal in der Wunde gedreht. Die von der Schneideseite her spitz zulaufende Klinge ist am Schaft 40 Millimeter breit und genau 21,5 Zentimeter lang.«
»Gerade so kurz, dass sie vorne nicht herauskam«, resümierte Frederic.
»Kurz?«, entfuhr es Jussuf Abdalleyah verwundert.
Aber weder Frederic noch Angelika gingen darauf ein. Stattdessen gab sie Frederic recht und fuhr unbeirrt fort: »Ja. Der Stich ging von hinten genau in den linken Lungenflügel. Und zwar so, dass sie nicht gleich tot war.«
Frederic überlegte kurz, dann fragte er, wie groß die Frau gewesen sei.
»1,66 Meter!«
»Sie war also recht klein. Das heißt, dass der Mörder – wenn er größer ist – das Messer mit dem Daumen nach vorne – also eher von unten – hineingestoßen haben könnte. Der Stichkanal würde dafürsprechen, oder?« Weil ihm Angelika durch ein Kopfnicken beigepflichtet hatte, fasste Frederic seine Theorie zusammen: »Wenn er das Messer von oben benutzt hat, hätte er es zu hoch angesetzt. Wir können also davon ausgehen, dass der Mörder mindestens 1,80 Meter groß ist, oder?«
»Du fragst mich etwas?«, wunderte sich Peter Dohmen, nickte aber bestätigend.
Während die beiden erfahrenen Ermittler darüber sprachen, gebot die Rechtsmedizinerin ihrem Assistenten, die Tote wieder auf den Rücken zurückzulegen. Dann zeigte sie auf die Hämatome zwischen den Brüsten der Toten.
»Was haben die blauen Flecken zu bedeuten?«, mochte Frederic wissen.
»Ganz einfach!«, antwortete die Ärztin. »Siehst du nicht, dass das die Form eines Schuhabdrucks ist?« Sie zeichnete mit dem Zeigefinger die nicht besonders gut erkennbaren Konturen nach und erklärte den beiden, dass der Mörder mit dem spitz zulaufenden Schuh mit hohen Hacken – »vielleicht ein Stiefel« – mit seinem rechten Fuß auf der Brust der Toten gestanden hatte, als er dem bedauernswerten Opfer den rechten Arm absägte. »Eine saubere Arbeit!«, bescheinigte die Rechtsmedizinerin dem Mörder und bedeutete Jussuf, sich auf den Boden zu legen, um die Situation nachstellen zu können. »Übrigens: Schuhgröße 45!«
Angesichts dieses Schauspiels musste Frederic trotz der traurigen Sachlage und der bedauernswerten Toten für einen Moment belustigt schmunzeln, blieb aber professionell: »War sie da bereits tot?«
Angelika blähte ihre Wangen und stieß Luft aus, bevor sie antwortete. »Ich glaube nicht. Sie war aber sicherlich bewusstlos von den Folgen des Stiches in ihren Rücken, während ihr der Arm abgetrennt wurde. Ich kann auf jeden Fall schon einmal so viel sagen, dass der Arm mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit demselben Messer abgetrennt wurde, mit dem auch der Stich in die Lunge erfolgte. Haut und Fleisch wurden akkurat aufgeschnitten, bevor der Os humeri fachgerecht zersägt wurde.«
»Also nicht unbedingt post mortem?«, interessierte Frederic, der sich mit der menschlichen Anatomie bemerkenswert gut auskannte.
Angelika nickte bestätigend.