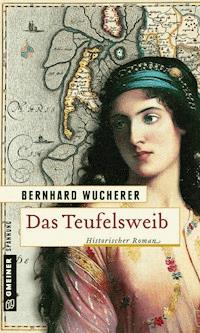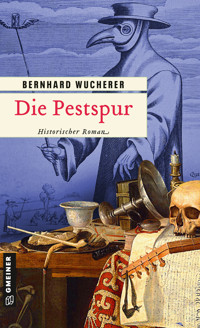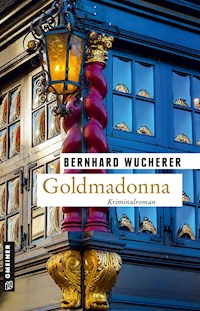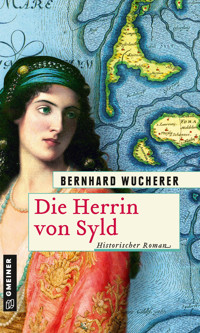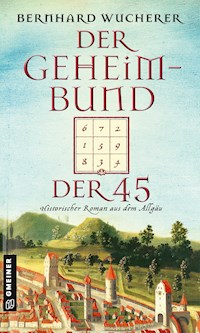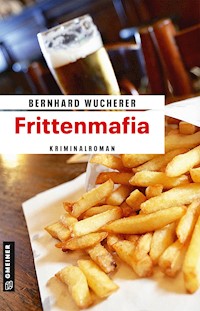
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Frederic Le Maire
- Sprache: Deutsch
Commissaire de la criminelle Frederic Le Maire ist Belgier aus Leidenschaft. Kein Wunder also, dass er belgische Fritten über alles liebt. Dass die holländische »Frittenmafia« versucht, Frittenfett schlechter Qualität in Belgien einzuführen und dabei über Leichen geht, passt dem verschrobenen Kauz überhaupt nicht. Als dann auch noch die Köpfe von Frittenbudeninhabern in Deutschland, Holland und Belgien im heißen Frittenfett stecken, beginnt der Kriminaler mit seiner Partnerin, der Aachener Pathologin Dr. Angelika Laefers, zu ermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Wucherer
Frittenmafia
KRIMINALROMAN
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Das Teufelsweib (2018), Die Säulen des Zorns (2014),
Lieblingsplätze: Tradition trifft Trend in Oberstaufen (2013),
Der Peststurm (2013), Die Pestspur (2012)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © CapturePB/shutterstock
ISBN 978-3-8392-5794-4
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Ein ganz spezielles, vorweggenommenes Glossar
(Die weitere Erläuterung der Begriffe, Namen und Zitate beginnt auf Seite 4601)
Fritten Belgische und niederländische Bezeichnung für »Pommes frites«.
Friterie Typisch ostbelgische, insbesondere im Bereich der deutschsprachigen Bevölkerung gebräuchliche Bezeichnung für einen Frittenladen oder für eine Frittenbude.
Friture (Ausgesprochen: Fritüür) Im wallonischen, also französischsprachigen Teil Belgiens gebräuchliche Bezeichnung für einen Frittenladen oder für eine Frittenbude.
Frituur Im flämischen, also niederländischsprachigen Teil Belgiens und in den Niederlanden gebräuchliche Bezeichnung für einen Frittenladen oder für eine Frittenbude. Die Flamen kennen auch die Bezeichnung »Frietkot«, die im Roman allerdings nicht vorkommt.
Aber Achtung: Wie im Roman selbst trügt auch bei der jeweiligen Schreibweise oft der Schein. Denn nicht jeder Inhaber oder Pächter eines »Frittenladens« oder einer »Frittenbude« hält sich an die jeweils landstrichübliche Schreibweise. So kann es auch sein, dass die ostbelgische und die wallonische Schreibweise mit Doppel-t geschrieben wird. Die wallonische Schreibweise hingegen liest man auch des Öfteren mit »ü«, anstatt mit »u«. In jedem Fall wird sie mit mit einem langgestreckten »ü« ausgesprochen (»Fritüür«). Den Belgiern ist es aber ziemlich egal, wie das Geschäft firmiert, aus dem sie ihr Lieblingsnahrungsmittel beziehen – Hauptsache, sie bekommen dort ihre gewohnt original belgische Frittenqualität.
Egal wie die jeweils übliche Schreibweise auch sein mag; sie spielt keine allzu große Rolle. Um der Authentizität wegen habe ich dennoch versucht, mir die korrekten Schreibweisen anzugewöhnen und reale Firmenbezeichnungen zu verwenden, … auch wenn deren Schreibweise das eine oder andere Mal auf den jeweiligen Standort bezogen atypisch sein sollte.
1Alle Seitenangaben in diesem Buch beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe.
… und eine kleine Hommage an die belgische Frittenkultur
Sie sehen, dass der Umgang mit der belgischen »Frittenphilosophie« gar nicht so einfach ist. Kein Wunder also, dass gerade in diesem wunderschönen Land über die Qualität guter oder minderwertiger Fritten trefflich gestritten werden kann und laut unseres Romanhelden, commissaire de criminelle Frederic Le Maire, aus dem Ausland kommende »Pommes« selbst mit den schlechtesten belgischen Fritten nur sehr schwer mithalten können. Wie sagt unser schrulliger aber gewiefter Kriminalhauptkommissar doch immer, wenn er anstatt belgischer Fritten ausländische Pommes vorgesetzt bekommt? »Merde!«
Fritten sind in allen Teilen Belgiens Kult, Lebensgefühl und Werbeträger zugleich. Sie werden hier nicht einfach nur mit Mayonnaise und Ketchup genossen, nein: die Belgier zelebrieren den Verzehr ihrer Fritten, wie die Bayern ihre Weißwurst mit einem speziellen Weißwurstsenf und einer Brezge oder die Berliner ihre Klopse mit scharfem Senf und einer Spreewaldgurke. Die Belgier lassen sich sogar Muscheln zu ihren Fritten servieren. »Moul frites« nennen sie diese Köstlichkeit. Und wie kann es anders sein; gibt es auch hierbei verschiedene Schreibweisen: »Moules frites« oder »Moules et frites« etwa, also Miesmuscheln (in Gemüsesud) mit frittierten Kartoffelstäbchen – glauben Sie mir, nicht nur ein Hochgenuss für Belgier. Im französisch sprechenden Teil Belgiens ist diese kulinarische Sensation sogar zu einer Art Nationalgericht erkoren worden.
»Fritten« sind in Belgien nicht nur das beliebteste Nahrungsmittel, ihr Genuss ist auch eine das ganze Land verbindende Philosophie. Auch wenn die Wallonen, Flamen und Deutschsprachler in Belgien in mancher Hinsicht mehr trennt, als sie verbindet, sind sie sich doch darin einig, dass ihr Nationalgericht zum Unesco-Weltkulturerbe werden sollte – wie die französische Haute Cuisine oder der Türkische Kaffee. Uneinig sind sie sich allerdings mit den Franzosen, die – »Merde!« – ebenfalls auf die Urheberschaft pochen. Aber dies lassen sich die Belgier nicht gefallen. Für sie ist die aus der Schweiz kommende Frage: »Wer hat’s erfunden?« mit einem glasklaren, besser gesagt; mit einem goldgelben »Wer wohl? Die Belgier!« schnell und eindeutig beantwortet. »Hätten Fritten ihren Ursprung in Frankreich, gäbe es wohl schon lange ein ›Frittenforschungsmuseum‹ in Paris« scherzt Bernard Lefèvre, Chef des belgischen Frittenherstellerverbandes Navefri-Unafri der Deutschen Presse-Agentur dpa gegenüber.
Warum sind Fritten für die Belgier so wichtig, obwohl sie mit ihren vielen Bier- und Schokoladesorten auch noch andere kulinarische Aushängeschilder haben? »Weil sie etwas ganz Besonderes sind!«, sagt Dominique Bonnier, der es mit seinen Fritten in der »Maison Antoine« in Brüssel zu einer internationalen Berühmtheit gebracht hat. Die heruntergekommen wirkende Hütte im Europaviertel gilt als eine der besten Frittenbuden Belgiens, ja sogar der Welt. Aber weshalb sind belgische Fritten etwas ganz Besonderes? Liegt es an der besonderen Qualität der Kartoffeln? Oder liegt der Grund darin, weil sie zweimal frittiert werden? – einmal zehn Minuten bei rund 130 Grad, um sie innen weich zu bekommen und dann kurz bei etwa 150 Grad frittiert, damit sie außen schön knusprig werden. Oder ist es das besondere Öl und das Rinderfett, in dem die Kartoffelstäbchen goldgelb werden? Dies zu klären liegt an unserem belgischen Ermittler Frederic Le Maire der alles daran setzen wird, diejenigen dingfest zu machen, die sich der belgischen Frittenkultur entgegenstellen und dabei nicht einmal vor Mord zurückschrecken. Hilfe bekommen der »Belgier aus Leidenschaft« und sein Team von seiner taffen Partnerin, der Aachener Gerichtsmedizinerin Dr. Angelika Laefers, … die allerdings keine Fritten mag. »Merde!«
Kapitel 1
»Merde!«, fluchte Monsieur Frederic Le Maire, der leitende commissaire de criminelle in Liège, nachdem er kurz vor Mitternacht den Telefonhörer abgehoben hatte.
Damit Fabienne Loquie möglichst wenig von der miesen Stimmungslage ihres Chefs mitbekam, hatte der schlaftrunkene belgische Kriminalhauptkommissar eine Hand fest auf die Muschel seines Telefonhörers gepresst. Er konnte es sich nicht verkneifen, nochmals seinen Lieblingsfluch auszustoßen: »Merde! … Muss mir das ausgerechnet jetzt noch passieren?« Leise grummelte er »Verfluchter Job« hinterher.
Aber es half alles nichts. Der normalerweise in der Wallonie tätige Kriminalbeamte kam nicht umhin, sich dem soeben Gehörten zu stellen und seiner Mitarbeiterin gegenüber trotz der unchristlichen Uhrzeit angemessen höflich zu antworten. Immerhin war er ihr Chef und musste als solcher zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sein, ob er wollte oder nicht. »In Ordnung, Locki, ich komme gleich! … Ja: Ich beeile mich! Verdammt!« In Momenten wie diesen fiel Le Maire gerne in seine deutsche Muttersprache zurück.
»Qu’est-ce que c’est? … Je ne compends pas?«, kam es deswegen etwas irritiert von der diensteifrigen jungen Frau am anderen Teil der Leitung zurück.
»Schon gut, Locki, ich weiß, dass du ebenfalls aus dem Bett geklingelt wurdest«, beschwichtigte der Hauptkommissar seine Mitarbeiterin, nachdem er sich wieder etwas beruhigt hatte. »Aber du kannst mir glauben, dass auch mir der Tote gerade jetzt sehr ungelegen kommt! … Salut!« Er hatte wieder seine ursprüngliche Haltung eingenommen und den Hörer unsanft auf die Gabel seines altmodischen Telefons zurückgeknallt.
Zur selben Zeit waren direkt unterhalb seines geöffneten Schlafzimmerfensters zwei Männer vorbeigetorkelt. »Der alte Monsieur commissaire hat wohl Probleme mit seinem ›Manneken Pis‹ und kann nicht mehr …«, hob einer der beiden amüsierten Zecher zu lästern an und blickte nach oben, bevor er sich an der Ecke des grau getünchten Hauses an die Wand lehnte, um sich zu übergeben.
Der völlig betrunkene Mann war mit seinem Kameraden von einer Kneipentour am Place du Marché in Richtung La Meuse unterwegs. Und ausgerechnet in dem Augenblick, als das resigniert klingende Geschimpfe Le Maires seinen Weg in die laue Sommernacht hinaus gefunden hatte, waren sie direkt unterhalb seiner Wohnung vorbeigetorkelt.
Dummerweise hatten die beiden das, was ihr Vereinskamerad Frederic soeben von sich gegeben hatte, total missverstanden. »Wahrscheinlich hat der alte Schwerenöter Ärger mit seiner Angelika, weil eine gewisse ›Locki‹ bei ihm ist«, wurde der eine von seinem Kameraden unterbrochen, während er selbst bemüht war, den durch das unheilvolle Gemisch aus zu viel Rotwein und Pastis verursachten Würgereiz loszuwerden. Dies wollte ihm allerdings nicht so schnell gelingen, wie er es gerne gehabt hätte. Dass Frederic sich lediglich telefonisch mit seiner Sekretärin unterhalten hatte und er sie wegen ihres lockigen Kurzhaarschnittes und in Anlehnung an ihren Nachnamen »Locki« nannte, konnten die beiden Saufkumpane nicht wissen.
Die zwei Männer kannten Frederic und auch seine Lebensgefährtin Dr. Angelika Laefers vom Verein der »Königstreuen« her. Wie die meisten anderen Vereinsmitglieder, nahmen sie das beruflich perfekt eingespielte Duo privat als absolut ungleiches Paar wahr. Dennoch brachten sie den beiden eine hohe Wertschätzung entgegen. Deswegen unterließen sie es trotz ihres beachtlichen Alkoholpegels, sich weiter über den meist ungepflegt wirkenden Monsieur commissaire de criminelle lustig zu machen und zogen stattdessen hämisch lachend weiter. Zudem wollten sich die Trunkenbolde nicht unnötig mit der Polizei anlegen. »Man weiß ja nie, oder?«, meinte der eine zum anderen, während er mühsam versuchte, seinen Hosenschlitz zu öffnen, um sich ungeniert an der nächsten Hauswand erleichtern zu können.
Währenddessen schimpfte der 46-jährige Kriminaler immer noch vor sich hin und drehte sich erst einmal eine Zigarette, bevor er sich das bisschen Schlaf, den er hinter sich hatte, aus dem Gesicht wusch. Mit der Selbstgedrehten zwischen den Lippen suchte er die im ganzen Zimmer herumliegenden Klamotten zusammen. Im Gegensatz zur perfekt durchgestylten und äußerst gepflegten Penthousewohnung seiner Geliebten in einer der feinsten Gegenden Aachens herrschte hier das reinste Chaos: in der Küche stapelte sich fortwährend frisch gespültes, aber noch nicht eingeräumtes Geschirr. Überall stand oder lag etwas herum, von dem der manchmal konfus wirkende Staatsbeamte nicht immer wusste, was er damit hatte tun wollen. Und in einem großen Weidekorb neben dem Bügelbrett vor dem Fernsehgerät im Wohnzimmer lag stets frisch gewaschene Wäsche, die geduldig aufs Bügeln, oder besser gesagt, auf Angelika wartete. Zu Le Maires Ehrenrettung muss allerdings gesagt werden, dass er zwar mit dem Aufräumen auf Kriegsfuß stand, seine Wohnung aber immer sauber geputzt war. Und genau so, wie er mit seiner Wohnung umging, behandelte der Gesetzesdiener auch sich selbst. Dies zeigte sich in erster Linie darin, dass er zwar meistens schäbig aussehende Klamotten trug, dafür aber einen fast schon überspitzten Wert auf Hygiene und Körperpflege legte. Und ein Dreitagesbart war ja schließlich modern – in seinen Augen der einzige Tribut, den er der Mode zollte. Auch mental war dieser Mann ein einziger Widerspruch in sich, was sein Umfeld gelegentlich irritierte. Gerade seine knubbelige Sekretärin Fabienne Loquie hatte es nicht immer leicht mit dem von ihr vergötterten Chef.
*
»Merde!«, drang es eine knappe Stunde später gute 40 Kilometer entfernt durch das Lüftungsrohr einer Fritüre heraus. Ansonsten war es im ostbelgischen Grenzort La Calamine ziemlich still. Selbst in der um diese Uhrzeit ansonsten nicht immer ruhigen Rue Albert hörte man außer Le Maires kurzem Standardfluch, der immer herhalten musste, wenn ihm etwas nicht passte, keinen Ton. Wären da nicht die beiden Polizeifahrzeuge mit ihren nervtötenden Blaulichtern und der Notarztwagen, dessen Fahrer so vernünftig gewesen war, das schlafraubende Warnsignal auszuschalten, könnte man sagen, dass es totenstill war. Denn ein weiteres Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen fiel da schon weniger auf als die drei Dienstfahrzeuge. Nur der alte mintfarbene Citroën des aus Liège herbeigerufenen Ermittlers zog die Blicke der »Fensterkucker« magisch auf sich. Im Moment aber spielte sich nichts auf der Straße, sondern nur innerhalb der kleinen Fritüre und an den Fenstern der umliegenden Häuser ab. Lediglich ein paar zur Tatortsicherung abgestellte Dorfpolizisten ließen ein spekulierendes Murmeln und Zigarettenrauch zu den neugierig vor und hinter den Gardinen liegenden Anwohnern hoch.
»Merde!«, entfuhr es commissaire Le Maire erneut, dieses Mal allerdings wesentlich gedämpfter und aus einem anderen Grund als zuvor. Es war kurz vor ein Uhr. Eigentlich hätte er an diesem Freitag – missmutig schaute er auf die Uhr – seit genau 51 Minuten Urlaub. Er wollte mit dem von ihm gegründeten Verein »Die Königstreuen« übers Wochenende einen Kurztrip nach Brüssel unternehmen. Da er aber kurz vor Mitternacht, also gestern noch zu diesem Einsatz gerufen worden war, musste er sich nun auch um diesen ganz besonders scheußlichen Fall kümmern, mit dem er es jetzt zu tun bekommen würde. Dementsprechend hatte der sonderbare Ermittler eine Stinkwut im Bauch, der auch reichlich Platz dafür bot. Denn hätte ihn der Anruf erst nach Mitternacht erreicht, wäre er urlaubsbedingt nicht ans Telefon gegangen. Er wäre am Vormittag frohgelaunt in den Bus Richtung Antwerpen – der ersten Rast auf dem Weg quer durch sein geliebtes Belgien – gestiegen und hätte sicherlich drei informative und fröhliche Tage mit seinen Vereinskameraden erlebt, die mit einem von ihm organisierten kleinen Empfang im Königspalast in Brüssel gekrönt worden wären. Aber er, der königstreue Vereinspräsident, konnte nun wegen eines Mordes nicht dabei sein. »Merde!«
Stattdessen wusste der bekennende Hedonist, der für original belgische Fritten selbst töten könnte und auch die belgischen Biere über alles liebte, dass sein freies Wochenende gestrichen war und er somit seine Beteiligung am Vereinsausflug canceln musste, was er gleich in der Früh mit einem Telefonat beim Schriftführer seiner »Königstreuen« tun würde.
Mit seinem letzten Fluch hatte er nicht nur das bevorstehende, voraussichtlich arbeitsreiche Wochenende, und das selbst für einen abgebrühten Kriminalbeamten Unfassbare gemeint, weswegen man ihn gerufen hatte und was er gerade vor sich sah. Vielmehr war es das Frittenfett vor ihm, das ihn fast aus der Fassung gebracht hätte. Denn dem leidenschaftlichen Fan der bereits 1781 auf dem Gebiet des heutigen Belgiens erfundenen goldgelb frittierten Kartoffelstäbchen tat es leid, dass der Kopf eines Mannes ausgerechnet in einer Friteuse stecken musste, weswegen es ihm künftig den Appetit auf Fritten verderben könnte. Aber Le Maire arbeitete bereits mental daran, nicht ständig an diesen Anblick denken zu müssen, wenn er Lust auf Fritten haben würde.
»Bonjour, Monsieur commissaire!«, rief ihm ein Inspecteur de police, also ein uniformierter Kollege der hiesigen Polizeizone Weser-Göhl, eifrig auf Französisch entgegen, obwohl hier vorwiegend Deutsch gesprochen wurde. Er grüßte zackig mit der Hand an der Dienstmütze und setzte gleich an, den griesgrämig dreinschauenden Kriminalbeamten über den Stand der Dinge aufzuklären.
Aber Le Maire – immer noch geschockt über den schändlichen Umgang mit einer der für die perfekte Frittenzubereitung wichtigsten Ingredienzen und dabei in Gedanken an seine nächste Frittenmahlzeit – gebot dem eifrigen Beamten mit einer Handbewegung, zu schweigen. Damit wollte er zu keiner Gedenkminute für das bedauernswerte »Frittenopfer«, als was er den zweifellos Ermordeten für sich bezeichnete, ansetzen, sondern sich zunächst in aller Ruhe selbst ein Bild der irgendwie skurrilen Situation machen. Während sich der uniformierte Beamte eingeschüchtert zurückzog und wie auf Befehl auch die anderen Polizisten und sogar sein Assistent Pat Miller einen Schritt zurücktraten, drehte sich Le Maire gemütlich eine Zigarette, unterließ dabei allerdings das mürrische Knurren, nach dem ihm zumute war.
*
Der bodenständige, aber verschrobene Kriminalbeamte hasste nichts mehr, als zu seiner normalen Arbeit im wallonischen Teil Belgiens hin auch noch hier, im Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, aushelfen zu müssen, obwohl – oder gerade weil er von hier, genau gesagt aus Eupen, stammte. Und dies auch noch zu nachtschlafender Zeit. Seit sich aber der Chefermittler der eigentlich zuständigen Kriminaldienststelle in Eupen wegen privater Gründe für drei Monate hatte freistellen lassen und ausgerechnet zu dieser Zeit auch noch der dortige leitende Polizeidirektor nach einer Herzoperation für etliche Wochen zur REHA an die Küste hochgemusst hatte, war es Le Maires zusätzliche Aufgabe geworden, sich auch noch mit den normalerweise zur Eupener Dienststelle gehörenden Mordfällen zu beschäftigen.
»Es ist ja nur für eine kurze Zeit, dann kehrt wieder Ruhe ein! Die gewöhnlichen Fälle werden nach wie vor von den Eupener Kollegen selbst bearbeitet. Damit haben Sie nichts zu tun!«, hatte ihn sein Chef Docteur Baguette mehr oder weniger erfolgreich zu beruhigen versucht, als er ihm die neue Dienstanweisung serviert hatte.
Da der Chefermittler der Mordkommission in Liège zuvor schon kaum etwas mit »gewöhnlichen« Kriminalfällen zu tun gehabt hatte, sah er in den gebetsmühlenartigen Beschwichtigungen seines Chefs nicht den geringsten Vorteil für sich. Er wusste nur, dass er sich seither in einer verdrehten Welt befand: Er, der aus der ostbelgischen »Hauptstadt« der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens stammende Ermittler, verrichtete seinen Dienst seit nunmehr fast 20 Jahren Jahren für die Förderale Polizei im wallonischen Liège und musste nun auch noch die Mordfälle im Bereich der lokalen Polizeizone Weser-Göhl bearbeiten. Deswegen war es nicht das erste Mal, dass er von Liège aus dorthin fahren und auch dort mit seinem jungen Assistenten Pat Miller zusammenarbeiten musste, was sich trotz ihrer Verbundenheit nicht immer einfach gestaltete. Denn Miller war einer jener typischen Engländer, die alles an sich hatten, was Le Maire nicht auszeichnete. Der 26-jährige Kriminalkommissar stammte zwar aus London, lebte und arbeitete aber ebenfalls schon viele Jahre in Liège. Da war es nur gut, dass sich die beiden seit ihrem ersten Zusammentreffen vor gut einem Jahr auf Anhieb privat gut verstanden hatten und seither kollegial bestens harmonierten – sofern dies mit dem eigensinnigen und manchmal sogar eigenbrötlerischen Le Maire überhaupt möglich war.
*
»Stört es jemanden, wenn ich dem Gestank hier etwas entgegensetze?«, fragte der passionierte Kettenraucher mehr rhetorisch als ernst gemeint und offenbarte damit einmal mehr seine dritte Obsession, die ihm seine Lebensgefährtin Angelika, promovierte Leiterin der Gerichtsmedizin Aachen, ständig abzugewöhnen versuchte.
Da selbst der Notarzt, der sich zusammen mit den beiden Sanitätern um eine abwesend wirkende Frau Mitte 30 kümmerte, schwieg, zündete Le Maire sich die Zigarette an, nahm einen kräftigen Zug, zeigte zur Friteuse und fragte ins Rund, wer »den hier« so gefunden habe.
Nun kam die große Stunde des schleimigen Streifenbeamten, der dienstbeflissen einen kleinen Notizblock aus der Brusttasche seiner Uniformjacke herausfischte und betonte, dass er als Erster an Ort und Stelle gewesen sei, bevor er Le Maire eifrig fast alles berichtete, was er bis zu dessen Eintreffen in Erfahrung gebracht hatte.
»Du warst also schon fünf Minuten nach der Alarmierung durch die Frau des Toten hier?«
Der Polizist wunderte sich zwar über die vertraute Anrede, nickte aber eifrig und brüllte Le Maire ein zackiges »Oui, Monsieur!« entgegen.
»Respekt!« Le Maire wartete mit zusammengekniffenen Augen auf eine Reaktion des offensichtlich nicht besonders intelligenten Beamten. Und die kam unverzüglich in der Form, dass er sich so kerzengerade direkt vor dem Kriminaler aufbaute, als wenn ihm dieser einen Orden anstecken wollte. Immerhin würde der verhältnismäßig kleine Hauptkommissar auf Augenhöhe mit der Brusttasche des verhältnismäßig großen Streifenbeamten sein, was ein Anstecken erleichtern würde. So ein Quatsch, dachte Le Maire, dem es lieber war, etwas kleiner als so profilneurotisch wie dieser Dorfgendarm zu sein. Er räusperte sich, dann sagte er mit einem unverhohlenen Grinsen auf den Stockzähnen: »Dann warst du zwar schnell, aber nicht der Erste am Tatort.«
»Nicht?«, wunderte sich der Streifenpolizist.
»Nein! Aber immerhin warst du der Zweite. … Gratuliere!«
Da der niederrangige Beamte zunächst geglaubt hatte, ein ernst gemeintes Lob des höher dekorierten Kriminalbeamten eingefahren zu haben, sich jetzt aber nicht mehr sicher war, senkte er verunsichert seinen Blick und sagte vorsichtshalber nichts mehr.
Trotz seiner miesen Laune musste Le Maire schmunzeln, kam aber gleich zur Sache: »Der Tote ist also bekannt? – Gut! Das ist doch schon mal etwas, … oder?«
»Ja!«, beeilte sich der Polizist, dem auffallend leger gekleideten Kriminaler recht zu geben, weil er nicht checkte, dass das letzte Wortanhängsel eine nicht ernst gemeinte Frage des manchmal etwas zynisch klingenden Ermittlers aus Liège war. »Es ist Monsieur Ottens, der Besitzer dieser Pommesbude«, ergänzte der Uniformierte noch rasch, weil er es zu Beginn seines Berichts für besonders klug gehalten hatte, die momentan wichtigste Erkenntnis bis zum Schluss aufzusparen.
Nachdem er dies gesagt hatte, sprach niemand mehr ein Wort und alle Köpfe drehten sich ihm zu. An die zehn Augenpaare schauten den Polizisten gleichsam verständnislos wie strafend an.
»Was ist?«, wollte der nun völlig verunsicherte Beamte wissen, nachdem er dies bemerkt hatte. »Ach so«, wehrte er lachend ab und gab sich selbst die falsche Antwort: »Hier in dieser Ecke Belgiens ist ja Deutsch die Amtssprache – Pardon!«. Er räusperte sich etwas verlegen und wollte sich hastig korrigieren: »Entschuldigung: Das hier ist …« Er zeigte zur mittleren der drei Friteusen und betonte: »… Herr Ottens, der Besitzer dieser Pommesbude!«
Aber damit schien er die Kuh noch nicht vom Eis gebracht zu haben, – im Gegenteil! Denn nun ruhten erst recht sämtliche Blicke auf ihm.
»Bist du ein stolzer Belgier?«, wurde er von Le Maire zwischen einem Zigarettenzug und einem für starke Raucher typischen Hüsteln unterbrochen.
Von dieser Frage schon wieder verwirrt und eingeschüchtert, antwortete der Mann, dass er »eigentlich« Niederländer, aber schon über 18 Jahre in La Calamine stationiert sei und …
Nachdem er dies gehört hatte, war Le Maire wieder eingefallen, dass er es vor über einem Jahr schon einmal mit diesem einfältigen »Aushilfspolizisten« zu tun gehabt und keine besonders gute Erinnerung an ihn hatte. Deswegen hatte er mit gesenktem Kopf eine Hand gehoben und ihn abermals unterbrochen: »Stopp! Das genügt! Dann ist ja alles klar.«
Nun völlig verunsichert blickte der Streifenpolizist um sich: »Was, … was …«
Wieder unterbrach ihn Le Maire, dieses Mal allerdings in strengem Ton: »Du hattest mir doch vor über einem Jahr bei einem Einsatz auf der Eyneburg in Hergenrath stolz gesagt, dass du Ostbelgier bist! Erinnerst du dich? Warum also sprichst du so despektierlich von einer Fritüre?«
Da der in diesem Teil Belgiens eingebürgerte Niederländer nicht wusste, was der arrogant auf ihn wirkende Kriminalhauptkommissar aus Liège von ihm wollte, zog er es vor, wieder zu schweigen und abzuwarten, was da noch auf ihn zukommen mochte.
»Bezeichne eine ostbelgische Fritüre nie, nie mehr abschätzig als ›Pommesbude‹! Solche Etablissements mag es in anderen Ländern geben, aber nicht hier bei uns in Belgien! Von mir aus kannst du die in anderen Gebieten Belgiens gebräuchliche französische Bezeichnung ›Friture‹ oder die niederländische Bezeichnung ›Frituur‹ benutzen. Aber niemals den Terminus ›Pommesbude‹ in den Mund nehmen! Niemals! Hörst du? Denn die schlechtesten belgischen Fritten sind immer noch besser als die besten Pommes frites anderer Länder!« Erst jetzt hob Le Maire seinen Kopf und schaute dem Polizisten scharf in die Augen. »Ist das klar?«
»Ja! … Kein Termin, äh, Pommes-Terminus und …«
Le Maire senkte wieder den Kopf und rieb sich die Stirn, bevor er laut sagte: »Silence! Halt einfach deinen Mund und beherzige das, was ich dir soeben gesagt habe! – Klar?«
Beschämt hielt nun der Streifenpolizist den Kopf gesenkt und zeigte durch ein stummes Nicken, dass er seinen indirekten Vorgesetzten verstanden hatte. Weil er einer anderen Dienststelle angehörte, hätte ihm der Monsieur le commissaire aus Liège eigentlich überhaupt nichts zu sagen gehabt, – glaubte er jedenfalls zu wissen. Da Le Maire im Rang eines Hauptkommissars allerdings wesentlich höher stand und sich zudem der Tatort hier in La Calamine befand, das der Eupener Dienststelle zugehörig war, musste sich der Mann mit der perfekt sitzenden Uniform aber wohl oder übel den Anordnungen des auf ihn schlampig wirkenden Beamten in Zivil unterordnen.
»Gut, dann machen wir hier weiter und tun unsere Arbeit«, ordnete Le Maire nun in unerwartet pragmatisch klingendem Ton an.
Um von seinem in Belgien schier unverzeihlichen Fauxpass abzulenken, gab der offensichtlich erst halbwegs eingebürgerte Niederländer hastig die persönlichen Daten des augenscheinlich Ermordeten preis und bot an, die Ehefrau des Toten weiter zu verhören. Dabei fuchtelte er unruhig mit einem Zeigefinger in Richtung des kleinen Tisches, an dem die Frau saß.
»Erstens wird hier niemand ›verhört‹, sondern lediglich befragt! Und zweitens ist dies mit Verlaub Sache der Kriminalpolizei!«, funkte aber Le Maires Assistent, der sich bisher im Hintergrund gehalten hatte, in nicht ganz perfektem Deutsch dazwischen und zog sich schnell einen Stuhl an den Tisch, an dem die kurioserweise irgendwie zufrieden wirkende Frau des Opfers mit dem Notarzt und den Sanitätern saß. Damit wollte er verhindern, dass ein örtlicher Kollege seine Arbeit übernahm. Im Gegensatz zu seinem Chef, der als gebürtiger Eupener nahezu akzentfrei Deutsch und überdies perfekt niederländisch sprach, konnte Pat Miller eine starke französische, mit englischem Slang unterlegte Klangfärbung nicht verstecken. Aber egal: Da er betont langsam sprach, konnte man ihn gut verstehen. Deswegen sollte einer sanften Befragung der Frau auf Deutsch nichts im Wege stehen, obwohl diese Belgierin war, also zum Deutsch hin auch perfekt Französisch sprach. Aber: Man befand sich schließlich auf dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft dieses nonkonformistischen Königreiches, weswegen hier in Gottes Namen Deutsch gesprochen werden musste. In dieser Gegend Belgiens war einfach nichts einfach.
Während Le Maires eifriger Adlatus sich um die Witwe des Mordopfers kümmerte, besah sich der Chef ganz genau die Haltung des Toten, wobei ihm sofort die Hämatome auffielen. Sie befanden sich knapp über der Stelle am hinteren Teil des Halses, der nicht im inzwischen ziemlich abgekühlten Frittenfett steckte.
Es war ein schrecklicher Anblick – zumal sich auch bereits einige kohlrabenschwarze Fritten mit dem verbrühten Schädel zu verkleben begannen. Da der Körper des Toten aufgrund allgemeiner Erschütterungen etwas nach unten gesackt und somit der Kopf ein Stück aus dem Frittenschwenker herausgerutscht war, konnte Le Maire die bis ins Schwarze verbrannte »Halskrause« genau betrachten. Er mochte sich nicht ausmalen, wie es wohl im Frittenschwenker selbst aussah.
»Wo bleibt die SpuSi?«, rief er leicht ungehalten und erreichte damit, dass der schweigsam hinter ihm stehende Streifenpolizist endlich aktiv werden konnte. Obwohl es eigentlich Millers Aufgabe gewesen wäre, kümmerte er sich sofort darum und verständigte die Kollegen der Spurensicherung.
Le Maire war auch ohne die Aussage der Spurensicherer oder eines Gerichtsmediziners klar geworden, dass man den Mann entweder ge- oder sogar ganz erwürgt hatte, bevor der Mörder dessen Kopf in die Friteuse gesteckt hatte. Oder wurde er bei lebendigemLeibe in das Edelstahlgitter gedrückt?
Da um und um alles voller Fettlachen und -spritzer war, könnte sich das Opfer gewehrt haben, weswegen auf den ersten Blick die zweite Version plausibel schien. Allerdings musste sich der Mörder in diesem Fall die Finger selbst gewaltig verbrannt haben.
Auch wenn die genaue Todesursache im Moment Rätsel aufgab, weil die Gerichtsmedizin noch nicht vor Ort war, hatte Le Maire wenigstens schnell erfahren, um wen es sich bei dem bemitleidenswerten Opfer handelte und dass der Fritürenbesitzer ein Alemanne war, der mit seiner belgischen Frau Simone in der deutschen Kaiserstadt Aachen lebte. Diese Erkenntnis zauberte ein leises Lächeln auf das Gesicht des Ermittlers. Denn darauf hatte Le Maire nur gewartet. Nun konnte er getrost die Gerichtsmedizinerin aus dem wenige Kilometer entfernten Aachen, anstatt deren knorrigen Kollegen Docteur Brülée aus Liège anfordern.
»Solange die Frau Doktor und die SpuSi nicht hier sind, fasst keiner etwas an!« Der notorische Zuspätkommer freute sich, ausnahmsweise einmal vor der Spurensicherung an einem Tatort zu sein. Und dies auch noch um eine aus seiner Sicht unchristlichen Uhrzeit. Der unverhohlene Stolz auf sich selbst ließ ihn für einen Moment sogar den entgangenen Vereinsausflug vergessen.
Kapitel 2
In der Zwischenzeit war die Neugierde etlicher Anwohner so groß geworden, dass sie sich aus ihren Wohnungen gewagt hatten. Zudem waren die letzten Gäste vom schräg gegenüber der Fritüre liegenden Lokal »D’r Lange Ruwe« ebenfalls aufmerksam geworden, weswegen sich die Sache via Telefon und SMS wie ein Lauffeuer in La Calamine herumgesprochen hatte. Kein Wunder also, dass sich trotz der nächtlichen Stunde doch noch eine beachtliche Menschentraube in der Rue Albert zusammengefunden hatte, um tuschelnd darüber zu spekulieren, was in der erst vor Kurzem hypermodern umgestalteten Fritüre vorgefallen sein könnte. Da die neugierig gewordenen Leute mitbekommen hatten, dass es in dem Laden einen Toten gab, wollten sie natürlich ganz genau wissen, was geschehen war. Schließlich kannten sich bis auf die in der sogenannten »Edelweißsiedlung« lebenden Deutschen und die vielen hier angesiedelten meist schwarzen Muslime in der knapp 11.000 Einwohner zählenden Grenzgemeinde fast alle Bewohner.
»Sicher wieder so ein heimtückischer Terrorakt des ES! … Diese Bombenleger sind doch überall und geben sich nicht mit ein paar Anschlägen in Deutschland, in Frankreich und in Spanien oder hier bei uns in Belgien zufrieden! Mich wundert es eh, dass noch keine Fritüre Ziel dieser Terroristen geworden ist. Immerhin würden sie dort das Herz Belgiens am schlimmsten treffen«, zischte ein betagter Kriegsveteran und kam sich dabei nicht nur mutig, sondern auch noch besonders klug vor. Aber anstatt allseitiger Zustimmung erntete er nur Gelächter und von einem der anderen Klugscheißer eine Korrektur dessen, was er von sich gegeben hatte: »IS! Es heißt IS und steht für Islamischer Staat!«
»Oder es hängt mit dem sicher sündhaft teuren Umbau dieser Fritüre zusammen. Der Ottens hat doch gar kein Geld für den Umbau gehabt, der hat ja alles verzockt. Wahrscheinlich hat da die Glücksspielmafia ihre Finger mit drin«, orakelte ein ortsbekanntes Waschweib, das sich nur schnell einen Bademantel übergestreift hatte, um ja nichts zu verpassen.
Ansonsten rührte sich außerhalb und innerhalb der Absperrung vor der Fritüre nichts. Niemand kam heraus und niemand ging hinein. Das Einzige, was dann eine gute halbe Stunde später kam, war ein todschickes anthrazitfarbenes Cabrio, das in solchem Tempo anbrauste, dass dem gerade mit einem Absperrband hantierenden Polizisten das Kinn nach unten klappte. »Sind Sie verrückt?«, blaffte er die Frau an, nachdem diese ausgestiegen war und ihr knallrotes Röckchen, das beim Aussteigen nach oben verrutscht war, zurechtzupfte, bevor sie ihren Arbeitskoffer und ihren Schutzanzug vom Beifahrersitz holte. Als der Beamte zunächst die schlanken Beine mit der umwerfenden Strumpfnaht und den knackigen Hintern, dann auch noch das für diese Uhrzeit – inzwischen war es genau 03.24 Uhr geworden – ungewöhnlich perfekt geschminkte Gesicht mit dem wallenden schwarzen Haar der Frau sah, blieb ihm der Mund weiter offen stehen. Dennoch rief er ein zitternd klingendes »Halt!«, war damit aber zu spät dran. Denn noch bevor ihr der verdutzte Polizist den Durchgang verwehren konnte, hatte sich die aus Aachen angeforderte Todesermittlerin Dr. med. Angelika Laefers legitimiert, die Erlaubnis des Beamten aber gar nicht abgewartet. Wieselflink war sie unter dem Absperrband hindurchgehuscht.
»Und das soll eine ›Pathologin‹ sein?«, wunderte sich der einfach gestrickte Beamte einem Passanten gegenüber, der beim Anblick der aparten Frau bewundernd durch die Zähne gepfiffen hatte. Diesen Begriff kannte der Klugscheißer vom Fernsehen her, wo fälschlicherweise meist Pathologen, anstatt Rechtsmediziner zu Mordfällen an Tatorte gerufen wurden.
*
»Na endlich! Wo bleiben Sie denn? – Die SpuSi ist bereits da!«, wurde die sehnlichst erwartete Medizinerin anstatt mit den in Belgien üblichen drei oder wenigstens mit einem Küsschen harsch von ihrem Liebhaber Frederic begrüßt, der sie gleich beiseitezog. »Da Aachen viel näher liegt als Liège, kann ich meinem Chef gegenüber argumentieren, dich zu dem Fall gerufen zu haben und nicht deinen lieben Kollegen Docteur Brülée aus Liège, in dessen Zuständigkeitsbereich diese Angelegenheit eigentlich fallen würde!«, sagte er leise zu ihr.
»Ach, Lemmi! Ich weiß doch längst, dass der Tote ein Deutscher ist und dass du deshalb diese Angelegenheit getrost in meine Hände legen konntest! Also mach hier keinen auf Gönnerhaft und sag mir stattdessen, um was es geht – okay? … Ich streife mir inzwischen meinen todchicken Kombi über und steck mir die Haare hoch! Es ist doch schön, dass wir wieder mal einen gemeinsamen Fall in Kelmis haben«, bemerkte sie mit einem entwaffnenden Lächeln auf ihren knallroten Lippen. Wie die meisten »Öcher«, als was sich eingefleischte Aachener selbst bezeichneten, verwendete sie für den direkt an Aachener Gebiet grenzenden belgischen Ort die deutsche Bezeichnung.
»Verdammt noch mal! Wenn wir beruflich miteinander zu tun haben und du vor den Kollegen laut mit mir sprichst, sind wir per Sie! Hast du das vergessen?«, wurde sie vom Einsatzleiter angeraunzt.
»Ja, Lemmi! … Aber das ist doch langsam albern. Meinst du nicht auch? Außerdem duzt du doch sonst auch alle, mit denen du zu tun hast.«
*
Le Maire hatte die taffe Ärztin vor einem guten Jahr kennenglernt, als sie von Aachen aus zu einem Einsatz auf die Eyneburg nach Hergenrath, einem Ortsteil von Kelmis, respektive von La Calamine, gerufen wurde, wo er die Leitung gehabt hatte. Seinerzeit waren zwei Männer – wie sich später herausgestellt hatte, die Gebrüder Eric und Philipp, Söhne des schwerreichen Knut Siprath – in ein Loch unter der bröckelnden Burgkapelle gestürzt. Während die Rechtsmedizinerin beim älteren Bruder nur noch »Tod durch Ertrinken« hatte feststellen können, hatte der Jüngere die beiden physisch und psychisch unglaublich harten Wochen »Am Abgrund zur Hölle« wie durch ein Wunder überlebt. Dass dies nur durch den Verzehr des Fleisches seines toten Bruders hatte geschehen können, war wegen der Hundertschaft Ratten, die sich über den fleischlichen Rest des Leichnams hergemacht hatten, nie aufgedeckt worden. Noch am Tag dieses grenzüberschreitenden Einsatzes hatten sich Angelika und Frederic auf eine irgendwie merkwürdige Weise ineinander verliebt. Die absolut ungleichen Berufskollegen hatten ihre Beziehung immer dann ausgebaut und gefestigt, wenn Frederic nach Aachen gekommen war, um sich über den Stand der Dinge zu dem Unfall der beiden Siprath-Brüder zu erkundigen. Denn damals hatte sich schnell herausgestellt, dass dahinter gleich mehrere erfolgreich ausgeführte perfide Mordpläne gesteckt hatten, wegen derer Astrid und Jutta, die beiden Frauen der Brüder Siprath, für viele Jahre hinter Gitter gemusst hatten. Nachdem sich die damalige Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden als schwierig erwiesen hatte, war vom eigenwilligen belgischen Ermittler ein Vorschlag in Bezug auf eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemacht worden. Zu seiner Überraschung hatte schon bald darauf eine Art Gipfeltreffen der grenznahen deutschen, niederländischen und luxemburgischen Polizeichefs zusammen mit einer großen belgischen Delegation stattgefunden, die Le Maires Antrag diskutiert, einstimmig bewilligt und an die zuständigen Politiker mit der Bitte um rasche Genehmigung weitergeleitet hatten. Seither galt Le Maire in diesem Dreiländereck als allseits respektierter »Superbulle«, weswegen er sich seine eigenwilligen Ermittlungsmethoden und seine im Dienst nach außen hin ruppige Art erlauben konnte.
Angelika lebte trotz ihrer Liaison mit Frederic berufsbedingt immer noch in der Penthauswohnung ihres schmucken Hauses in der Ronheider Gegend am Rande von Aachen, während er aus demselben Grund in Liège wohnen blieb. Seither pendelten sie – meist an den Wochenenden – abwechselnd hin und her. Allerdings ließ Angelika nicht locker, ihren Frederic zu bedrängen, sich um einen Job bei der Eupener Kripo zu bewerben. »… dann hättest du nicht weit zu deiner Dienststelle und wir könnten in meiner Öcher Wohnung zusammenwohnen, oder?«
*
»So, Lemmi! Ich bin bereit!«, meldete sich die Rechtsmedizinerin, die auch im weißen Schutzanzug und mit hochgestecktem Haar eine gute Figur abgab, in vertrauter Form beim Einsatzleiter, der die Mittvierzigerin wieder schroff beiseitezog und anzischte: »Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du mich in der Öffentlichkeit nicht so nennen sollst! Und außerdem …«
»… siezen wir uns im Dienst, Lemmi! Ich weiß«, lächelte Angelika entwaffnend zurück und nahm ihm die Zigarette aus dem Mundwinkel, um mit dem Zeigefinger der anderen Hand ein Küsschen auf seinen Lippen andeuten zu können. »Den richtigen Kuss bekommst du, wenn du nicht nach Zigaretten stinkst! Oder soll ich jetzt …?«, kokettierte sie frech.
»Untersteh dich!«, raunzte Frederic leise, während er sich unauffällig umsah, ob jemand etwas mitbekommen hatte. Um dieses süße Spiel gleich wieder zu beenden, begann er, den bisherigen Sachstand zu erläutern, woraufhin die Ärztin das Diktiergerät einschaltete und ihre Arbeit aufnahm.
»Kommen Sie bitte her, Monsieur Le Maire!«, gebot sie dem Hauptkommissar provokativ, aber dienstbeflissen, voll konzentriert und so laut, dass es ja jeder hören konnte.
Indessen waren auch die Spurensicherer eingetroffen. »Habt ihr etwas angefasst oder verändert?«, wurden die bereits Anwesenden von deren Chefin gefragt, weswegen sie sich den Zorn des Einsatzleiters zuzog.
»Sag mal, spinnst du? Wir sind Profis!«, raunzte Le Maire die Deutsche an.
»Ach!«, mischte sich Dr. Laefers in den sich anbahnenden Disput ein. »Ihr kennt euch ja noch nicht! Dies ist Margot Wintgens, die Leiterin unserer SpuSi. Und dies ist commissaire Le Maire, der Einsatzleiter aus … Lüttich!«
»Trotzdem …«, knurrte die offensichtlich strenge Spurensicherin und wandte sich ohne ein weiteres Wort ab, um ihren Leuten Anweisungen zu geben.
Sofort sicherten die in weißen Schutzanzügen steckenden Beamten den Tatort ab, um ungestört Fotos machen, Fingerabdrücke nehmen sowie Beweismittel nummerieren und eintüten zu können. Erst nach etwa einer halben Stunde durfte die Gerichtsmedizinerin den Kopf des Toten aus dem immer noch heißen Frittenfett ziehen und den Toten von den inzwischen eingetroffenen Mitarbeitern des Beerdigungsinstitutes »Öcher Friede« auf eine Plane legen – Zeit genug für Le Maire, um eine Zigarette zu rauchen, bevor er sich das Mordopfer genauer besehen würde. »Um Gottes willen …«, entfuhr es dem ansonsten abgebrühten und an vieles gewöhnte Kriminaler entsetzt, als er das Desaster sah. Aber er hatte keine Zeit, sich zu grausen. Denn Dr. Laefers begann sofort damit, ihm mitzuteilen, was er hören wollte und sehen musste, ob er mochte oder nicht. Denn der Kopf des Toten war teilweise bis auf die Knochen durchgebraten und gänzlich verkohlt. Offensichtlich hatten die ursprünglichen 180 Grad des Frittenfettes genügend Zeit gehabt, um ihre ganze Kraft entfalten zu können.
Der Kopf des Toten sah so schrecklich aus, dass Le Maire unweigerlich an einen dieser tumben Zombiefilme denken musste. Sowohl die Haare als auch die Haut waren verbrannt. Der weit aufgerissene Mund legte die noch verbliebenen Zähne bis auf die Wurzeln frei und schien einen letzten anklagenden Schmerzensschrei von sich geben zu wollen. Der Kopf wirkte zum Rest des Körpers klein und ähnelte fast einem dieser »Schrumpfköpfe«, wie sie bis in das 19. Jahrhundert hinein von einigen indigenen Völkern Südamerikas zu kultischen Zwecken verwendet wurden.
»Der war wohl länger da drin, als normalerweise die Fritten«, mutmaßte Le Maire zynisch, was die Rechtsmedizinerin nach einem genaueren Blick auf die Leiche bestätigte: »Um die drei Stunden hat er sicherlich in der ›Brühe‹ gesteckt.«
Als er diese abschätzige Bezeichnung für Frittenfett hörte, wollte der patriotische belgische Beamte die ignorante deutsche Ärztin zurechtweisen, besann sich aber angesichts der anderen dann doch lieber auf die eigentliche Arbeit: »Wie wurde der Kopf in die Friteuse gesteckt?«
Da die zwar junge, aber hochintelligente und aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Arbeit recht erfahrene Todesermittlerin sofort wusste, auf was er hinauswollte, sagte sie ohne zu zögern, dass der Kopf bei lebendigem Leibe so lange »dort hinein« gedrückt worden war, bis sich das Opfer nicht mehr hatte wehren können. Dabei zeigte sie an den Hals. »Diese Hämatome stammen von sehr kräftigen Männerhänden, die dicke Handschuhe angehabt haben mussten. Möglicherweise solche Lederhandschuhe, wie sie Waldarbeiter oder Bauhofmitarbeiter tragen.«
»Oder Asbesthandschuhe einer Feuerwehr?«, spann Le Maire den Faden weiter.
»Möglich! … Ja! Wahrscheinlich sogar!«, bestätigte Dr. Laefers, während sie sich das massiv geschädigte Körpergewebe am Hals näher besah und ihre Aussage konkretisierte: »Ich bin sicher, dass der Mörder extrem dicke Handschuhe getragen hat. Aber Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich ihn auf meinem Tisch habe – Faserspuren und so …«
Wie oft Le Maire diesen abgedroschenen und nervtötenden Spruch während seines Berufslebens schon hatte hören müssen, wusste er zwar nicht mehr genau, ärgerte sich aber immer wieder aufs Neue darüber.
»Na toll, dann haben wir keine Fingerabdrücke«, bemerkte er enttäuscht.
Da drehte sich einer der Spurensicherer um und verkündete, dass hier wohl »an die tausend« Fingerabdrücke zu finden seien.
»Klar; das ist schließlich ein öffentlicher Raum. Aber sicher nicht vom Täter«, knurrte der Ermittler leise und wandte sich wieder der erfahrenen Todesermittlerin zu: »Und wie lange zieht sich ›so etwas‹ hin?«, fragte er schroff und meinte damit die Dauer des Sterbens.
Nun überlegte die Medizinerin einen Moment, bevor sie die Antwort gab. »Der Tod ist sicher nicht sofort eingetreten. Aber ich schätze, dass die Besinnungslosigkeit so rasch über ihn gekommen ist, dass er zwar einen grausam und schmerzvollen, aber keinen allzu langen Tod gehabt haben dürfte … Das Ganze hat etwa 20 bis 30 Sekunden gedauert!«
»Lange genug«, bemerkte Frederic fast ein wenig mitleidig, bevor er wieder sachlich wurde: »Hat er sich noch gewehrt?«
»Ja, was glaubst du denn, Lemmi?«, kam es in bewusst vertrautem Ton zurück. Dabei zeigte sie auf das Umfeld der Friteuse, an die Wand und auf den Boden. »Man sieht hier überall, dass er wie ein Verrückter gestrampelt hat! Außerdem sehe ich bis auf die auffallend breiten Druckstellen am Hals weder am Hinterkopf noch an anderen Stellen des Körpers Hinweise auf Gewalt! Aber wie gesagt, …«
»… alles Weitere nach der Obduktion. Ich weiß!«
Nun konnte Le Maire sicher davon ausgehen, dass es sich um keine versehentliche Selbsttötung handelte und das Mordopfer bei vollem Bewusstsein in die Friteuse gedrückt worden war. Obwohl ein Suizid mehr als unwahrscheinlich gewesen wäre, hatte er auch dies in Betracht ziehen müssen. Schließlich war er es gewohnt, grundsätzlich in alle Richtungen zu ermitteln. Dies teilte er sogleich seinem Assistenten mit, der zwischenzeitlich mit seiner Befragung fertig geworden war und sich zu ihm gesellt hatte: »Der Täter hat ihn nicht niedergeschlagen, bevor er …?«
Miller war über den Anblick des »Schrumpfkopfes« zwar entsetzt, blieb aber cool. »Wahrscheinlich ist er unmittelbar vor seiner Friteuse gestanden und wurde vom Täter von hinten gewürgt und dabei brutal mit dem Kopf nach vorne ins siedend heiße Frittenfett gedrückt«, kombinierte der junge Kriminalassistent, der die Vermutung seines Chefs in Bezug auf hitzeschützende Handschuhe mit einem Ohr mitgehört hatte.
»Aber warum hat er seinen Mörder so nah an sich herangelassen?«, überlegte der Chefermittler laut.
»Vielleicht hat er ihn nicht bemerkt, weil der sich von hinten an ihn herngeschlichen … oder ihn gekannt hat?«
»Und sonst war die ganze Zeit über niemand in der Fritüre? Kein einziger Kunde um diese Uhrzeit? Keine Seele soll bemerkt haben, dass Monsieur Ottens drei Stunden lang in der Friteuse hing? – Merkwürdig!«
»Vielleicht war der Mann nicht beliebt, weswegen er wenig Kunden hatte?«
»Oder er hatte eine schlechte Frittenqualität?«, bemerkte der Experte und ergänzte »Ich meine, für belgische Verhältnisse!«
Da mischte sich der Notarzt ein und sagte mit erhobenem Zeigefinger, dass es bei Monsieur Ottens nur allerbeste Qualitätsfritten gab, bzw. gegeben hatte.
Miller, der mit Fritten nicht allzu viel anzufangen wusste, verdrehte die Augen und zog wortlos die Schultern nach oben.
»Hm«, entfuhr es Le Maire nachdenklich, bevor er das Thema wechselte. »Was ist mit seiner Witwe? Die scheint mir nicht sonderlich traurig zu sein!«
Miller zückte stolz sein brandneues 128 GB starkes iPad Pro, wischte lässig mit dem Zeigefinger über das Screen und berichtete Le Maire von seiner Befragung der Frau: »Laut ihrer Aussage war gestern nicht viel los, weil hier die Kirmes begonnen hat.«
»Die haben die hier sicher das ganze Jahr über«, lästerte sein Chef ungewohnt unsachlich.
»Darf ich?«, ergriff Miller sofort wieder das Wort und schüttelte über den unprofessionellen Ausrutscher seines Chefs leicht den Kopf.
Le Maire nickte.
»Gut! … Deswegen – ich meine wegen der geschäftslähmenden Kirmes –, hatte Madame Ottens sich um ziemlich genau 19.30 Uhr freigenommen und war hier in La Calamine zu einer Freundin gegangen, um mit vier weiteren Damen Rommé zu spielen.«
Le Maire kniff konzentriert die Augen zusammen. »Das war also ungefähr zwei bis drei Stunden vor seinem Tod, der laut Dr. Laefers um circa 22 Uhr eingetreten sein soll. Das könnte bedeuten, dass der oder die Täter draußen – möglicherweise in einem Auto – so lange darauf gewartet haben, bis das Opfer allein in der Fritüre war. Dies könnte auf einen Auftragsmord hindeuten, oder?« Le Maire wartete die Antwort seines jungen Kollegen nicht ab und schickte stattdessen noch eine Bemerkung hinterher: »Mich wundert allerdings, dass Fritten im Schwenker waren. Man gibt doch Fritten nur in den Korb einer Friteuse, wenn jemand welche bestellt hat. So wie es den Anschein hat, war aber niemand da, für den Monsieur Ottens hätte Fritten zubereiten müssen.«
»Möglicherweise wollte er für sich selbst eine Portion machen«, warf Miller in den Raum.
»Das ist gut möglich! – Der Mörder wird sich ja wohl keine Fritten bestellt haben, bevor er …« Nun kam Le Maire ins Grübeln. »Oder etwa doch?«
Einer der Spurensicherer ging auf den Chefermittler zu und hielt ihm ein eingetüteltes Schild mit der Aufschrift »GESLOTEN – FERMÉ« entgegen.
»GESCHLOSSEN! Und dies auf Französisch und auf Niederländisch anstatt auf Deutsch?«, wunderte er sich über das, was er auf dem ovalen Emailleschild las, und schüttelte ungläubig den Kopf. »Warum steht das Flämische vor dem Französischen und nicht umgekehrt? Und dies in einem Bereich Belgiens, in dem vorwiegend Deutsch gesprochen wird?«
Aber Miller runzelte nur die Stirn, anstatt eine Antwort darauf zu wissen.
»Wo befand sich das Schild?«, wollte Le Maire vom Spurensicherer wissen, bekam nun aber von Miller, der sich zuvor mit der Frau des Opfers unterhalten hatte, die Antwort: »Als Madame Ottens zurückkam, hing es ihrer Aussage nach außen am Türgriff. Weil sie das Schild nicht kannte und sich darüber wunderte, hat sie es abgenommen, noch bevor sie den Raum betrat. Sie wollte ihren Mann fragen …«
»Nun haben wir die Antwort darauf, warum die Fritüre mindestens drei Stunden lang von niemandem betreten wurde«, unterbrach Le Maire seinen Assistenten.
»Außer vom Mörder!«, ließ Miller sich nicht lange das Wort nehmen und fuhr gleich fort: »Gut möglich, dass es ein Racheakt oder etwas in der Art war. Ein Raubüberfall scheidet laut Madame Ottens jedenfalls aus«, bestätigte er die erste Mutmaßung seines Chefs und ergänzte noch: »Sie sagt, dass das gesamte Geld noch in der Kasse war, als sie gegen 22.15 Uhr zurückgekommen ist. Auch sonst würde augenscheinlich nichts fehlen!«
»Was? – Die hatte nichts anderes zu tun, als einen Blick in die Kasse zu werfen, nachdem sie ihren Mann so aufgefunden hat? Was ist das denn für eine Frau?«
Miller zuckte wieder ratlos mit den Schultern.
»Was ist nun mit ihr?«, störte der Notarzt die Unterhaltung und meinte damit jene Frau, der Geld wichtiger zu sein schien als das Leben ihres Mannes. »Obwohl sie bemerkenswert gefasst ist, habe ich ihr eine Beruhigungsspritze gegeben.«
»Gut! Dann kann sie von den Sanitätern nach Hause gebracht werden … Oder haben wir eine Beamtin hier?« Nachdem der Streifenpolizist von vorhin dies verneinte, sagte Le Maire zu den Sanitätern: »Sie gehört euch!« Simone Ottens wies er an, dass sie sich bis Mittag ausruhen und dann für eine Vernehmung bereithalten solle. Dann stellte er sicher, dass sein Assistent alle Daten von ihr bekommen hatte.
»So, das wäre das!«, entfuhr es Le Maire fast so erleichtert, als wenn der Fall bereits gelöst wäre und er wie geplant seinen Ausflug nach Brüssel antreten könnte. Dabei freute er sich einfach nur, mit seiner Angelika endlich ein wenig reden zu können.
»Während die Frau Doktor und ich hier so lange warten, bis der Leichnam abtransportiert wurde und wir unsere bisherigen Erkenntnisse vertiefen, sorgst du dafür, dass der Tatort von außen verschlossen wird und ein Beamter den Rest der Nacht über Wache hält, denn ich traue der Frau des Opfers nicht ganz über den Weg«, gebot der Chef seinem Mitarbeiter und zeigte auf denjenigen Polizisten, mit dem er beinahe aneinandergeraten wäre.
Le Maire sah schmunzelnd zu, wie sich der betreffende Beamte gegen diesen aus seiner Sicht entwürdigenden Job zu wehren versuchte. »Das hast du nun davon! … Pommesbude«, grummelte er schadenfroh vor sich hin, ohne auch nur einen Funken Mitleid für diesen ehedem holländischen Ignoranten aufzubringen.
»Wird erledigt!«, rief Miller seinem Chef zu, der sich von Madame Ottens gerade den Türschlüssel aushändigen ließ.
Sicher ist sicher, dachte Le Maire sich im Stillen. Da er aber weder ein Indiz, geschweige denn einen Beweis für ihre Schuld, ja, nicht einmal einen Anhaltspunkt hatte, musste er die Frau wohl oder übel gehen lassen. »Gleich morgen früh fahren wir nach Aix-la-Chapelle, um sie nochmals zu befragen und ihre Wohnung zu durchsuchen.«
»Ohne Durchsuchungsbeschluss?« Da Miller seinen Chef kannte, erwartete er keine Antwort.
*
Nachdem die Sanitäter zusammen mit Madame Ottens, dann der Notarzt und auch Miller die Fritüre verlassen hatten, schnaufte Le Maire erleichtert durch: »Endlich! Nun kann ich uns einen Kaffee machen.« Da inzwischen nur die Friteuse abgeschaltet war, die anderen Gerätschaften aber immer noch unter Strom standen, war die Kaffeemaschine betriebsbereit geblieben. Also versuchte Frederic, sich und Angelika einen Schwarzen aufzubrühen. Und er schaffte es tatsächlich. Genüsslich nahm er einen Schluck, drehte sich eine Zigarette und erklärte ihr aus heiterem Himmel, dass er sie lieben würde.
»Gut!«, gab sie knapp zur Antwort und schaute ihm fragend in die Augen. »Da ich weiß, dass du im Grunde genommen jeden – ungeachtet seiner Person und seines Ranges – duzt, bestehe ich nun darauf, dass wir dies ab sofort auch im Dienst tun! In deiner Lütticher Generaldirektion weiß doch sowieso schon jeder, dass wir zusammen sind. Und im Aachener Kommissariat ist es ebenfalls hinreichend bekannt. Was soll also dieser Blödsinn?«
Während Frederic die Tabakkrümel vom Tisch zusammen- und in das dafür vorgesehene Behältnis zurück strich, überlegte er, was er zu diesem Vorschlag sagen sollte. Da er ebenfalls wusste, dass ihre ungewöhnliche Beziehung in ihren beiden Dienststellen längst kein Geheimnis mehr war, nickte er nur, zog an seiner Zigarette und strich ihr sanft über die Wange.
»Und ich bin bei der kompletten Aufklärung dieses Falls dabei!«, forderte sie noch forsch.
Frederic grinste. Er liebte dieses Wahnsinnsweib, das er nach eigener Einschätzung eigentlich gar nicht verdient hatte. Und da er ihr sowieso keinen Wunsch abschlagen konnte, nickte er, bevor er zum Fenster zeigte: »Ah, die Totengräber sind fertig!« Da er wusste, in dieser Nacht nicht mehr nach Liège zurückzumüssen, weil er bei seiner Geliebten nächtigen würde, lächelte er Angelika verschwörerisch an. Zuvor aber musste er seinem Assistenten den Autoschlüssel der »Göttin«, wie sein Citroën DS von Kennern dieses Liebhaberstücks genannt wurde, anvertrauen und ihm die Macken des 39 Jahre alten Oldtimers erklären. »Miller!«, rief er laut nach draußen, während er aufstand, um den Autoschlüssel aus den Tiefen seiner ausgebeulten Hosentasche zu fischen. »Kommst du mal?«
»Ja, Chef! Ich muss den Bestattern nur noch schnell sagen, wohin sie die Leiche bringen sollen!«
»Lassen Sie mal. Das mache ich.«, bot Dr. Laefers an, damit Miller zu seinem Chef konnte.
Während kurz darauf die beiden schwarz gekleideten Männer von der Pathologin einige Anweisungen entgegennahmen und die letzten Vorbereitungen trafen, um den Toten transportfertig machen zu können, erklärte Le Maire seinem Assistenten, dass er bei Docteur Baguette, dem Chef der Kriminal-Generaldirektion in Liège ausführlich Bericht erstatten musste und morgen Vormittag wieder in La Calamine zurück sein würde. Dabei sah er sich nach allen Seiten um, bevor er den Treffpunkt festlegte. Er zeigte zur anderen Straßenseite hinüber und sagte: »Wir treffen uns dann dort drüben …« Da er den Schriftzug auf dem Firmenschild des von ihm gemeinten Lokals wegen der geschätzten 50 Meter Entfernung nicht lesen konnte, schickte er Miller dorthin, um dies zu tun.
»Das Lokal heißt ›D’r Lange Ruwe‹ und hat erst ab 11 Uhr geöffnet!«, verkündete Miller schon von der gegenüberliegenden Straßenseite aus und handelte sich wegen dieser Lärmbelästigung einen Rüffel seines Chefs ein. Denn es ärgerte ihn ein wenig, dass durch Millers vorheriges Geschrei der Streifenbeamte mitbekommen hatte, wegen wem er den Rest der Nacht als Wache vor der Friterie eingeteilt worden war.
»Das ist das hiesige Platt und heißt so viel wie ›Der lange Rote‹«, erklärte Le Maire seinem stirnrunzelnden Assistenten und ergänzte: »Vermutlich ist der Wirt ein groß gewachsener Mann mit rotem Haar! … Wahrscheinlich ein Ire.«
»Oder ein Irrer!«, witzelte Miller leicht genervt in den dunklen Nachthimmel hinein. Denn ihn interessierte dies nun wirklich nicht mehr, er wollte nur noch nach Hause zu seiner Verlobten Chloé. »Na dann: Bis morgen um elf! … Gute Nacht, Chef! – Gute Nacht Madame Docteur!«
»Aber vorher befragst du noch kurz die Gäste dieser Kneipe und nimmst deren Daten auf! … Und geh sorgsam mit meinem Auto um, hörst du?«
»Muss das wirklich jetzt noch sein?«, blaffte Angelika ihn an, weil sie Verständnis für den jungen Mann hatte.
»Das sind doch nur ein paar Zecher und mein nobler Adlatus muss ihnen für den Moment ja nur eine einzige Frage stellen, dann kann er sofort nach Hause fahren – ein Fünfminutenjob!« Da sich Le Maire darüber freute, den Rest der Nacht bei Angelika verbringen und den nächsten Tag gemütlich angehen zu können, winkte er seinem Assistenten trotz des versauten Ausflugswochenendes gut gelaunt nach, bekam diese Geste aber nicht erwidert.
»Gut, dass dich um diese Uhrzeit niemand mit deinen schäbigen Klamotten in meinem schönen SLK sieht«, lästerte Angelika, bevor sie mit quietschenden Reifen zur Rue de Liège hinunter in Richtung Aachen losbrauste.
Kapitel 3
»Haben Sie schlecht geschlafen?«, wollte der gut erholte Miller mit einem unverhohlenen Grinsen auf den Lippen von seinem an diesem Samstagvormittag ganz besonders zerknautscht aussehenden Chef wissen. Dabei zupfte er seine auffällige blau-weiß schräg gestreifte Fliege so zurecht, als wenn er damit zeigen wollte, wie ein belgischer Kriminalbeamter auch an einem Samstag auszusehen hatte. Wie vereinbart, stand er seit halb zwölf vor dem »Lange Ruwe«, wo er über eine Stunde auf seinen Chef gewartet hatte.
Der aus gutem Grund übernächtig wirkende Mann allerdings antwortete nicht darauf und fragte stattdessen schroff: »Was ist? Warum gehst du nicht hinein?«
»Weil es dort kein Frühstück gibt«, kam es knapp als Erklärung zurück.
»Konntest du das nicht vergangene Nacht abklären?«, beschied Le Maire sich wenig mit dieser alles andere als zufriedenstellenden Antwort.
»Nein! Es war schon geschlossen, als ich mich nach den Öffnungszeiten erkundigen wollte.«
»Dann konntest du die Gäste auch nicht mehr befragen?«
»Tut mir leid! Der Wirt hat dies offensichtlich geahnt und seinen Laden wegen der überzogenen Sperrstunde ganz schnell verriegelt. Aber das hole ich heute nach. Oder glauben Sie etwa, dass ich nicht herausbekomme, wer dort in der vergangenen Nacht noch zu Gast gewesen war?« Es klang fast ein wenig beleidigt.
»Schon gut, Miller. Und sonst?«
»Von einem Passanten konnte ich vorhin in Erfahrung bringen, dass es in der unweit von hier gelegenen Rue de I’Église unten das ›Bistro de la Place‹ gibt, wo Frühstück angeboten wird und …«
»Auf was warten wir dann noch?«, unterbrach Le Maire seinen Assistenten und zog ihn am Ärmel von der Tür weg. »Wir können ja später noch auf ein Bierchen zum ›Lange Ruwe‹ gehen, um dort gemeinsam zu recherchieren. Immerhin liegt diese Kneipe direkt schräg gegenüber des Tatortes. Vielleicht hat der Wirt oder einer seiner Gäste etwas mitbekommen?«
Traut er mir das allein nicht zu, dachte sich Miller und wollte schon wieder beleidigt dreinschauen, unterließ dies dann aber doch.
Kurz darauf saßen sie – von den anderen, meist älteren Gästen kritisch beäugt – im »Bistro de la Place«, wo sich die Bestellung für Miller anfangs etwas schwierig gestaltete, weil hier für Uneingeweihte ein kaum verständliches Kelmiser Platt gesprochen wurde.
»Dr’ Lange Ruwe! wie klingt das denn?« Sogar Le Maire schüttelte den Kopf über den hiesigen Dialekt, obwohl er selbst mit dem ähnlich klingenden Eupener Platt aufgewachsen war. Da er jetzt aber nahezu perfekt Hochdeutsch sprach, hatte der sowieso schon schlecht gelaunte Wirt geglaubt, zwei Allemand vor sich zu haben, weswegen er seine Gäste umso genauer musterte. Denn wegen Le Maires schlampiger Kleidung befürchtete er, sein Geld womöglich nicht zu bekommen. Deswegen hatte er sich gleich an Miller gewandt, der immerhin eine Fliege zum schicken blauen Sakko trug, frisch rasiert war und sogar so ein neumodisches Tablet vor sich liegen hatte. Also musste wenigstens dieser Mann seriös sein. Vielleicht ein Bewährungshelfer mit einem frisch entlassenen Sträfling? Oder er ist vom Sozialamt und lädt einen seiner Pflegebefohlenen zum Frühstücken ein. Ja, das wird es sein, war sich der Wirt sicher, was sich an seinem plötzlich zufrieden wirkenden Lächeln ausmachen ließ. Dennoch hatte er ein ungutes Gefühl im Bauch, was ihn trotz des aufgesetzten Lächelns auch nur leidlich freundlich sein ließ. Sicherheitshalber bemühte er sich zu Le Maires Belustigung beim Aufnehmen seiner Bestellung ebenfalls um ein verständliches Hochdeutsch. Da Le Maire dieses kleine Verwirrspiel Freude bereitete, wollte er sich weiter daran beteiligen und sagte zu seinem Gegenüber etwas auf Französisch, das Miller – dem die Unsicherheit des Wirtes in Bezug auf ihre Herkunft ebenfalls nicht entgangen war – spaßeshalber in reinstem Oxford-English beantwortete. Dies wiederum wurde vom vermeintlichen Ex-Knacki oder Sozialfall auf Flämisch quittiert, was den Wirt noch mehr durcheinanderbrachte und die anderen Gäste endgültig verstummen ließ. Erst als die zwei Männer am Tisch herzhaft zu lachen begannen, war dem Wirt klar geworden, dass sie ihn auf die Schippe genommen hatten und wohl Landsleute von ihm waren. Also hatte der Kommissar seine geliebte Tasse schwarzen Kaffee und einen »Croque Monsieur« doch noch bekommen. Sein Assistent hatte eine heiße Schokolade mit köstlich belegtem Baguette in Angriff genommen und wollte sich – wie an allen Samstagen und Sonntagen – zudem ein weiches Ei gönnen, was seinem Chef nach dieser Nacht sicher auch gutgetan hätte.
»Was hat Docteur Baguette gesagt?«, wollte Le Maire als Erstes von Miller wissen und bekam zur Antwort, dass alles in Ordnung sei und es richtig gewesen war, die deutsche Pathologin zu diesem speziellen Fall hinzuzuziehen. »Durch das neue ›internationale‹ Abkommen haben wir alle Freiheiten, sollen unseren obersten Boss lediglich ständig auf dem laufenden Stand der Ermittlungen halten. Er lässt sich die Entscheidung zu dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von oben absegnen. Und Sie …«
»Was ist mit mir?«, fuhr Le Maire rüde dazwischen.
Da Miller nicht wusste, wie er es seinem Chef sagen sollte, druckste er herum. »Na ja: Sie … Sie sollen sich zusammenreißen und … und den ausländischen Kollegen gegenüber nicht den ›Superbullen‹ spielen.«
»War’s das?«
»Nein! Sie sollen bei allem, was Sie sagen oder tun, nicht vergessen, dass wir den belgischen Staat repräsentieren.« Nachdem er dies losgeworden war, zeigte sich Miller sichtlich erleichtert. Er hob das Messer, um sein Ei mit einem zielsicheren Hieb zu köpfen.
»War’s das jetzt?«
»Das war’s! … Merde! Jetzt habe ich mich bekleckert!«, verwendete zur Abwechslung einmal der Assistent den Lieblingsfluch seines Chefs, der ihn auch gerne benutzte, ohne fluchen zu wollen.
»Gut«, grinste Le Maire und war in diesem Moment froh, sich selbst kein Ei bestellt zu haben, obwohl er es in Erwägung gezogen hatte.
Während die beiden immer wieder einen Schluck oder einen Bissen zu sich nahmen, ließen sie die bisherigen Erkenntnisse Revue passieren und besprachen die weitere Vorgehensweise. Dabei wurde rasch klar, dass das zunächst noch aufgeschobene Gespräch und die Inaugenscheinnahme von Madame Ottens’ Wohnung äußerste Priorität haben musste. Während die beiden Kriminaler sich leise unterhielten, bemerkten sie, dass die anderen Gäste eifrig und sogar tischübergreifend über sie tuschelten.
Dies veranlasste Le Maire dazu – selbstverständlich erst, nachdem er in aller Ruhe fertig gefrühstückt hatte –, aufzustehen und eine Frage ins Rund zu werfen: »Mesdames, Messieurs! Darf ich kurz um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Ich bin Frederic Le Maire, ein commissaire de criminelle aus Liège und leite die Ermittlungen in einem Fall, der La Calamine betrifft. Und dies hier«, er legte eine Hand auf die Schulter seines Assistenten, »… ist Kriminalkommissar Pat Miller, mein bester Mitarbeiter!« Allein dadurch hatte er Unruhe unter die biederen Rentner gebracht, die sich allmorgendlich in diesem Bistro zu einem gemütlichen Vormittagsplausch trafen und die Sache überaus spannend fanden, weswegen sie nun aufgeregt durcheinanderschnatterten. »Kriminalpolizei? Hier in La Calamine? Wahnsinn!«
»Ich bitte um Ruhe! … Danke.« Der Chefermittler musste die Stimme erheben, um auch bei den schwerhörigen unter den älteren Gästen Gehör zu finden.
Nachdem die neun Frauen und sechs Männer endlich still waren und sich der Wirt erwartungsvoll mit seinen Ellbogen auf die Theke gestützt hatte, wartete Le Maire nur noch darauf, mit dem, was er zu sagen gedachte, fortfahren zu können, was allerdings bedingte, dass die Kellnerin aufhörte, mit Mineralwasserkisten herumzuhantieren. »Sicher haben die Herrschaften zwischenzeitlich mitbekommen, dass in der vergangenen Nacht ein Verbrechen begangen wurde und Monsieur Ottens, der Besitzer der Fritüre in der Rue Albert, einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.«
An der Reaktion der Gäste merkte Le Maire, dass sich schon am frühen Vormittag die Neuigkeit des sogenannten »Frittenmordes« in La Calamine verbreitet haben musste. Deswegen kam er – ohne Internas auszuplaudern – gleich zur Sache und berichtete darüber. Danach begann er, Fragen zu stellen: »Hat jemand von Ihnen in der vergangenen Nacht etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen? Oder kann mir jemand etwas über Steffen Ottens, seine Frau und …«
Da Le Maire der Name entfallen war, schaute er seinen Assistenten an, der ihm – nachdem er auf sein Tablet gelinst hatte – aus der Patsche half: »Simone! Die Frau des Fritürebesitzers heißt Simone Ottens!«
»Ja, ja, schon gut«, zischte Le Maire seinen »besten Mitarbeiter« leise an, bevor er nach einem verlegenen Räuspern fortfuhr: »Also: Kann mir jemand etwas über Steffen und Simone Ottens sagen? Haben sie Kinder? Uns interessiert auch deren Umfeld und selbstverständlich alles über die Fritüre!« Weil er auf seine Frage nur betretene Stille erntete, hakte er nach: »Jede Kleinigkeit kann wichtig sein!« Da sich die Gäste immer noch in Schweigen hüllten, bedankte er sich höflich und wies darauf hin, dass er ein paar Visitenkarten auf die Theke legen würde, damit man ihn jederzeit anrufen konnte. »Jederzeit! Hören Sie?«
Wieder am Tisch sitzend, bemerkte er Miller gegenüber, dass dies keinen Sinn machte und sie anders vorgehen müssten. »Du bleibst noch ein wenig hier sitzen. Vielleicht fällt ja doch noch jemandem etwas ein, wenn ich weg bin.« Als er dies sagte, blinzelte er Miller verschwörerisch an. »Du verstehst …?«
»Na klar, Chef!«
»Gut! Danach gehst du erst einmal zum ›Lange Ruwe‹ und durchs Dorf, um so viele Leute wie möglich über die Familie Ottens und … Ach, du weißt schon selbst, nach was du fragen sollst. Währenddessen besuche ich die Rommétante, bei der Madame Ottens gestern Abend gewesen sein will. Dies dauert sicher nicht lange und ich bin gleich wieder zurück. – Wir treffen uns dann in der Fritüre, um den Tatort nochmals zu besichtigen und den Mord nachzustellen. Inzwischen habe ich von Frau Doktor …« Le Maire hüstelte verlegen und korrigierte sich seinem vertrauten Kollegen gegenüber selbst: »… von Angelika die ersten Ergebnisse der Obduktion bekommen.«