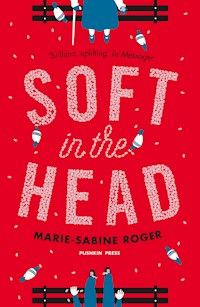9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gérards ganze Liebe gilt der Poesie. Doch leider kann er seine Leidenschaft mit niemandem teilen, da er aufgrund einer Behinderung weder schreiben noch richtig sprechen kann. Nur die Herumtreiberin Alexandra versteht ihn und nimmt ihn ernst. Und da Gérard auch sonst wenig vom Leben hat, schmiedet Alexandra einen abenteuerlichen Plan. Alexandra lebt aus dem Rucksack, jobbt auf einer Hühnerfarm und hat am Bruder ihres Vermieters einen Narren gefressen: Gérard leidet am Down-Syndrom und stellt jede Menge Unfug an, aber er trägt das Herz am rechten Fleck. Und Alexandra traut ihren Ohren nicht, als er eines Tages beginnt, ihr selbstkomponierte Gedichte vorzutragen ... Bei ihren Spaziergängen am Fluss lernen die beiden ein anderes Außenseiterpaar kennen: zwei junge Männer, die dort jeden Tag herumhängen und Bier trinken. Das Unmögliche geschieht: Die vier freunden sich an, und plötzlich bietet sich ihnen die Möglichkeit, gemeinsam zu einer Freundin von Alexandra zu reisen - zu viert auf einem alten Motorrad mit Sidecar ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Die OriginalausgabeVivement l’avenir erschien 2010 bei Éditions du Rouergue 1. Auflage 2011 Copyright © 2011 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburgwww.hoca.de Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-455-81025-7
Der Poet der kleinen Dinge
Inhalt
Richtung Hühnerfarm
Richtung Kanal
Zurück auf die Hühnerfarm
Stimmen am Ufer
Bierdosenweitflug
Federngeraschel
Schnabelhiebe
Wie ein Küken im Ei
Alle Eier in einem Korb
Richtung Hühnerfarm
Wie das Gespräch darauf gekommen ist, weiß ich nicht mehr genau.
Es passierte einfach.
Vielleicht hatte es mit den Kötern zu tun. Damit, dass sie im Fernsehen erzählt haben, wie viele von ihnen zum Ferienanfang im Tierheim landen. All diese braven Wauwaus mit ihrer feuchten Schnauze und den treuherzigen braunen Augen.
»Den eigenen Hund einfach aussetzen … Was für ein Jammer!«, hat Marlène da gesagt und ihren Tobby gestreichelt. »Diese verdammten Schweine! Die Todesstrafe müssten sie kriegen!«
»Na, hör mal. Ein bisschen Knast vielleicht, okay, da hätte ich auch nichts gegen«, hat Bertrand mit seiner ewig ruhigen Stimme geantwortet.
Wütend habe ich den noch nie erlebt.
Marlène hat den Kopf geschüttelt. Wenn sie von etwas überzeugt ist, lässt sie nicht locker. »Die Todesstrafe. Und basta. Nicht wahr, Tobby, mein Liebling, mein Dickerchen? Am besten mit der Guillotine, hm? Und nicht einfach zack, runter das Hackebeil, nee, nee, wenn schon, denn schon. In kleinen Schritten, ratsch, ratsch, ratsch.«
»Klar, die Guillotine«, hat Bertrand gemeint.
Roswell hat sich kaputtgelacht. Er lacht sich ständig kaputt.
Ich saß in meiner Ecke und las, ohne etwas zu sagen. Ich rede selten.
Wozu sollte das gut sein?
Ausschlaggebend war aber vermutlich die Nummer, die Roswell etwas später am Abend abzog. Weil er sich Popcorn machen wollte, ohne jemanden zu fragen.
Er könnte sich nur von Popcorn, Pommes und Cola ernähren. Er ist verrückt danach.
Er hat also das Gas angezündet, ganz allein, die Pfanne aufs Feuer gestellt, einen kräftigen Schuss Öl reingekippt, die Maiskörner dazu, alles so, wie es sich gehört. Und dann hat er die Pfanne vergessen.
Roswell hat zwar manchmal Ideen, aber mit der Umsetzung hapert es immer ein wenig. Vielleicht ist Ideen auch zu viel gesagt.
Wohl eher Einfälle.
Und als Marlène dann in die Küche gekommen ist, um Wasser für die Nudeln aufzusetzen, war überall dichter, beißender Rauch, der mörderisch in den Augen brannte.
Sie hat geschrien: »Das darf doch wohl nicht wahr sein! Was für ein verdammter Saustall!«
Dann hat sie hektisch das Fenster aufgerissen und alles runtergefegt, was davorstand: Abtropfsieb, Weinkrug, Salzstreuer und Salatbesteck. Sie hat die Pfanne in die Spüle gepfeffert, den Wasserhahn voll aufgedreht, es hat gezischt und gedampft. Nur der Geruch ist geblieben.
Als sie ins Esszimmer zurückkam, brüllte Marlène, dass es reicht, wirklich reicht, ein für alle Mal! Das wäre einfach der Gipfel! Jetzt hätte er fast schon wieder die ganze Bude abgefackelt, dieser Trottel, dieser Vollidiot! Eines Tages würde das Haus nur noch ein Haufen Asche sein, und wegen wem?
Roswell hat gelacht, aber es wirkte ziemlich unentspannt.
Ich kenne ihn besser als alle anderen, schließlich bin ich die Einzige, der etwas an ihm liegt, und ich habe genau gesehen, dass er Muffensausen hatte, schon an der Art, wie er jede Bewegung von Marlène verfolgte, wie er sie nicht aus den Augen ließ. Bloß nicht, man weiß ja nie.
Marlène rutscht nämlich manchmal die Hand aus. Und ihre Ohrfeigen sind nicht von schlechten Eltern.
Aber sie hat sich nur zu mir umgedreht und geseufzt: »Schaff ihn mir aus den Augen! Ich ertrage das alles nicht mehr, er macht mich fertig!«
»Hat er was gegessen?«, fragte Bertrand.
»Er hat keinen Hunger!«
Ich habe Roswell aus dem Sessel geholfen. Wir sind die Treppe hinaufgestiegen, er voran, ich hinterher, für alle Fälle. Nach einem Zwischenstopp auf dem Klo habe ich ihn in sein Zimmer gebracht. Ich habe ihm geholfen, sich auszuziehen, in seinen Schlafanzug zu schlüpfen und die Windel für die Nacht anzulegen. Ich habe ihm die Decke bis unter sein stoppeliges Kinn gezogen, die Brille abgenommen und ihm ein Glas Wasser gereicht.
Er hat geflüstert: »Dubisssnett-nich?«
Ich habe gesagt: »Na klar! Klar bin ich nett! Das weißt du doch, oder?«
»Mja. Dubisssnett, du.«
»Ja, das bin ich. Und du, du solltest das mit dem Popcornmachen lieber lassen!«
Er hat gelacht.
Dann habe ich auf die Nachttischlampe gezeigt und den Kopf geschüttelt.
»Nei-nei-nein, nei-nei-nein«, hat er gesagt.
Ich weiß, dass er Angst hat: im Dunkeln, vor Spinnen, vor Wespen, vor Gewitter.
Und auch vor Marlène.
Vor allem vor Marlène.
Ich habe mit dem Zeigefinger an meinen unsichtbaren Mützenschirm getippt, okay, Chef, alles klar, Chef, ich lass dein Licht an. Er hat so breit gegrinst, dass man seine vielen schiefen Zähne sehen konnte und das Zahnfleisch, wie bei einem Maulesel. Er hat meinen Gruß nachgemacht und sich mit der Hand schräg an die Wange getippt.
»Okeh-Scheff!«
Ich habe ihm zugezwinkert und die Tür leise hinter mir geschlossen. Da hatte er schon den Zipfel seines Betttuchs im Mund und nuckelte daran. Er zwinkerte zurück, mit beiden Augen gleichzeitig. Mit einem allein schafft er es nicht.
Und ich habe wie jeden Abend gedacht: Du bist mir einer, Roswell! Leider hast du es übel erwischt, als du aus dem Bauch deiner Mutter gekrochen bist.
Als ich die Treppe zehn Minuten später wieder runterging, kreiste das Gespräch immer noch um Roswell.
Marlène saß Bertrand gegenüber rittlings auf einem Stuhl, die Arme auf der Rückenlehne verschränkt, das Kinn daraufgestützt und den Rock bis über die Oberschenkel hochgeschoben. Sie zog an ihrer Zigarette, die Lippen zusammengekniffen, ein Mundwinkel schräg nach unten, die Augen wegen des Rauchs halb geschlossen. Sie wirft sich gern in solche Westernposen. Das ist ihre »Catamini-Jane«-Seite, wie sie sagt. Ihr Zorn war noch lange nicht verflogen, sie redete sehr laut.
Es stank wie im Pumakäfig – der Geruch des verbrannten Popcorns mischte sich mit dem des Raumsprays. Davon musste Marlène mindestens die halbe Dose in die Luft gepumpt haben.
Sie hatten mich nicht gehört. Ich blieb auf halber Treppe im Dunkeln stehen und lauschte gespannt. In meinen schwarzen Klamotten konnten sie mich auf keinen Fall sehen.
Es war wie im Theater: Die beiden Hinterwäldler mitten auf der Bühne, im grellen Licht der nackten Glühbirne, das sich mit dem des ständig laufenden Fernsehers mischte, der in einer Ecke blau vor sich hin flimmerte.
Bertrand saß mit hängenden Schultern da, so lebendig und fröhlich wie ein Gespenst, und starrte auf seinen Käse. Marlène ließ sich über Gérard aus, diesen Hemmschuh, diesen Klotz am Bein. Sie sagte, sie hätte nachgedacht. Und da wäre ihr auf einmal ein Licht aufgegangen, eine Erleuchtung, eine innere Stimme, die sagte …
»Na los, rück schon raus mit der Sprache …«, seufzte Bertrand.
Marlène erklärte ihren Plan. Er war einfach und klar.
Die Idee des Tages bestand darin, Roswell auszusetzen.
Bertrand hat einen Engel oder zwei durchs Zimmer gehen lassen und in der Zeit ein paar Würfel aus Brotkrumen geknetet. Dann hat er den Kopf gehoben.
»Sag mal, spinnst du?«, fragte er.
Schweigen.
Dann weiter: »Ihn aussetzen? Du schimpfst über die Leute, die sich ihren Hund vom Hals schaffen, und willst Gérard aussetzen? Ich sag dir was: Du hast ’nen Schuss.«
»Ich wüsste nicht, warum! Nenn mir einen Grund, warum wir ihn behalten sollten, einen einzigen!«
»Er ist mein Bruder«, antwortete Bertrand.
»Einen guten Grund, meine ich.«
Bertrand hat halblaut wiederholt: »Gérard aussetzen … Verdammt noch mal, du bist ja total durchgeknallt.«
Er grübelte vor sich hin, während er seinen Käse aufaß. Marlène stocherte in ihrem Teller rum und machte ein schiefes Gesicht. Bertrand sagte ein letztes Mal: »Ihn aussetzen … Ich fasse es nicht.«
Er wirkte schockiert. Da er aber grundsätzlich eher von der langsamen Sorte ist, wartete ich darauf, dass er aufwachte, dass sich etwas in ihm rührte. Ich glaube, ich hoffte endlich mal auf einen Zyklon.
Roswell aussetzen wie einen räudigen Köter?! Das würde ihn doch wohl aus seiner Gemütsruhe reißen, den guten Bertrand! Er würde sich echauffieren, er würde mit der Faust auf das Wachstischtuch hauen, seine Frau als arme Irre, als ausgefransten alten Strohbesen beschimpfen. Marlène würde endgültig ausrasten. Sie würde ihren roten Mund und ihre mit schwarzem Kajal umrandeten Augen weit aufreißen. Sie würde einen heiseren Schrei ausstoßen, ein Todesröcheln, und ein Patschhändchen aufs Herz pressen oder vielmehr auf eines ihrer 100-G-Körbchen, deren Größe ich kenne, weil ich ihre BHs oft auf der Leine hängen sehe.
Ja, Bertrand würde ordentlich auf den Tisch oder gegen die Wand hauen, und alles wäre anders.
Er würde reagieren.
Ich habe die Luft angehalten.
Da hat er gesagt: »Und wie stellst du dir das vor?«
Das war der Moment, in dem Roswells Schicksal entschieden wurde. An einem unschuldigen Tag im April, um 20 Uhr 23.
Und das alles wegen einer auf dem Herd vergessenen Pfanne und wegen der miesen Schufte, die sich ihre Hunde vom Hals schaffen. Wobei die natürlich das komplette Gegenteil von Marlène sind, denn sie selbst, sie könnte niemals ein Tier aussetzen.
Einen Schwachsinnigen vielleicht. Aber einen Hund niemals!
Marlène hatte sofort wieder Oberwasser. Sie hat ihre BH-Träger zurechtgezupft, sich die Locken im Nacken getätschelt und ihren Plan erklärt.
Wenn man ihr dabei richtig zuhörte, spürte man genau, dass diese Idee nicht erst von gestern war. Dass sie Zeit gehabt hatte, an ihrem Ast zu reifen, bevor sie auf das Wachstuch klatschte.
»Also, hör zu: Dein Bruder geht nie aus dem Haus, niemand weiß, dass er überhaupt hier ist, stimmt’s?«
Bertrand hat genickt und schnell mit der Hand gewedelt, was so viel heißen sollte wie: Weiter, weiter, worauf willst du hinaus?
»Das heißt – fast niemand, meine ich«, fuhr Marlène fort, mit einer Frische in der Stimme, die an eine kühle Nachmittagsbrise am Meer erinnerte.
Das »fast«, das war ich.
»Aber sie hat ja nur einen Zeitvertrag, und da sie in der Fabrik gerade entlassen, besteht keine Gefahr, dass sie den verlängern. Durch die Krise können wir unbesorgt sein! Und wenn sie dann weg ist, vermieten wir nicht gleich wieder. Sondern wir nutzen das aus, um … Na, du weißt schon!«
Sie hat eine kleine Pause gemacht. Dann ging es weiter: »Und wenn ich mich nicht irre, weiß dein Bruder noch nicht mal, wie er mit Nachnamen heißt. Stimmt’s, oder hab ich recht?«
»Hmfff«, hat Bertrand gemeint.
Marlène hat tief Luft geholt, den Rücken durchgedrückt, an ihrer Zigarette gezogen und den Rauch ganz langsam durch die Nase wieder ausgeblasen.
Es war wie in einem Psychothriller, gleich würde die Musik einsetzen, eine schrille, nervenaufreibende Melodie: Dring! Driing! Driiing! Driiiing!
Sie sagte: »Außerdem kapiert ja eh keiner was, wenn er redet! Deshalb wüsste ich nicht, wie er uns bei der Polizei anzeigen sollte, wenn wir ihn verlieren. Oder?«
Und sie kicherte vor sich hin.
In dem Moment bin ich die restlichen Stufen heruntergerannt und ins Wohnzimmer geplatzt. Ich habe getan, als wenn nichts wäre, und mich an den Tisch gesetzt. Marlène hat mir mechanisch den Topf rübergeschoben.
Ich habe meine Nudeln mit geriebenem Käse bestreut.
»Du hast aber ganz schön lange gebraucht«, hat sie gemeint und mich mit ihren vorstehenden blassblauen Augen angestarrt.
»Ich habe ihm eine Geschichte vorgelesen.«
»Eine Geschichte. Schau mal einer an. Jetzt soll man ihm auch noch Geschichten vorlesen, das fehlte noch!«
Marlène hat ihren Mann mit Verschwörermiene fixiert.
»Er ist mein Bruder«, hat Bertrand gesagt, als würde das irgendetwas ändern.
»Das ist kein Grund zum Angeben«, hat Marlène gemeint und einen schönen, kreisrunden Rauchkringel in die Luft geblasen.
Da hat es angefangen zu regnen, aber ohne jeden Zusammenhang.
Ich bin seit viereinhalb Monaten hier.
Die Anzeige habe ich im kostenlosen Lokalblättchen gefunden: Ruhige Lage, helles Zimmer mit Bad, Toilette, Kochmöglichkeit, Garten.
Ich habe angerufen. Marlène war sofort dran.
»Worum geht es?«, hat sie gefragt.
Als ich geantwortet habe, es sei wegen der Anzeige, wurde sie plötzlich zuckersüß und faselte irgendetwas von Ruhe, guter Luft und familiärer Atmosphäre.
Ich dachte mir gleich, dass da was faul war: Gute Luft in dieser Gegend? Wohl kaum – direkt hinter der Hühnerfarm und auf der ungünstigen Windseite!
Aber gut, bei der Miete.
Ich hatte Arbeit gefunden, das war die Hauptsache. Und zwar genau in dieser Hühnerfarm, erst mal für acht Monate, aber mit der Aussicht auf eine Festanstellung, an die ich zwar nicht glaubte, aber das war egal.
Man hatte mich dem Eierwenden und dem Schlüpfen zugeteilt. Ich hatte weder Ahnung von Federn noch von Schalen, aber mein Lebenslauf hatte bei der Einstellung keine Rolle gespielt. Wie für die meisten Jobs – jedenfalls für die, die ich so mache – braucht man da keine besonderen Vorkenntnisse, man muss sie einfach nur machen. Ich bin sorgfältig, befolge die Anweisungen und komme nicht zu spät. Das reicht.
Tag für Tag wende ich die Eier jeweils morgens und abends um eine Vierteldrehung und lasse sie dann eine Viertelstunde abkühlen. Nach zehn Tagen im Brüter halte ich sie gegen das Licht und entsorge die, die nicht befruchtet sind. Nach einundzwanzig Tagen werden sie nicht mehr bewegt. Dann wartet man auf das Schlüpfen, und wenn das zu lange dauert, muss man den Küken aus der Schale helfen. Danach lege ich sie auf ein Gitter, und wenn sie ganz trocken sind, kommen sie unter die Wärmelampe, die ich regle, indem ich sie jeden Tag ein bisschen weiter von den gelben oder schwarzen kleinen Calimeros wegrücke, bis sie einen Monat alt sind.
Ich kümmere mich auch um die Einstreu. Das ist nicht schwierig. Es ist nur immer das Gleiche, es stinkt und ist nach einer Stunde nicht mehr besonders interessant. Da der Betrieb nicht sehr groß ist und sie zur Zeit mehr Leute entlassen als einstellen, kommt es vor, dass ich meinen Dienst in zwei Schichten mache, was mehr oder weniger auf Zwölfstundentage hinausläuft. Aber das bin ich gewohnt. Ich habe auch im Gastgewerbe gearbeitet, im Service und in der Küche, das ist so ziemlich das Beste, was es in Sachen moderne Sklaverei gibt. Keinerlei Privatleben, beschissene Arbeitszeiten, garantierte Fußschmerzen.
Als ich Marlène von meinem Zeitvertrag in der Geflügelfarm erzählt habe, hat sie verzückt und mit einem Hauch Besitzerstolz ausgerufen: »Na, das trifft sich ja wunderbar, mein Mann arbeitet auch da drüben! Er kümmert sich um das Entkrallen der Enten, das Schnabelkürzen bei den Hühnern, das Impfen und das Kapaunisieren. Seit dreiundzwanzig Jahren ist er dort. Deshalb haben wir hier das Haus gekauft, das ist sehr praktisch, so kann er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Vorher war er Kükensexer, ausschließlich. Das war gut bezahlt. Er hat es mit der Federmessmethode gemacht. Jetzt ist das vorbei, in dem Job gibt es nur noch Japaner, die machen das per Fingerdruck auf die Kloake. Das geht angeblich schneller. Mein Mann meint, es wäre unsicherer als vorher, die Methode hätte eine hohe Fehlerquote. Na ja, wie auch immer, die Zeiten ändern sich. Aber jetzt komm lieber mit und schau dir dein Zimmer an. Wirst sehen, es wird dir gefallen. Ich sage du, wenn es dich nicht stört, weil mit dem Sie und dem ganzen Schnickschnack haben wir es hier nicht so. Bei uns geht es unkompliziert zu, wirst schon sehen.«
Das Zimmer war oben, neben Roswells, der wohl gerade schlief, denn ich habe ihn nicht gesehen. Das Bad war in einen früheren Wandschrank eingebaut, mit einer Schiebetür. Ich würde problemlos beim Zähneputzen pinkeln können. Aber gut, es war annehmbar, hässlich und sauber, mit Blick auf die Hühnerfarm und das Autobahnkreuz.
Ich habe gesagt, ich würde drüber nachdenken, und noch am selben Abend angerufen und zugesagt.
Als ich am nächsten Abend zu ihnen kam, war Bertrand gerade beim Essen. Marlène hat mich vorgestellt: »Alex wohnt jetzt bei uns.« Er hat mir unbeholfen die Hand gedrückt, so fest, dass er mir fast die Finger zerquetschte.
Dann hat er sich geräuspert. »Hast du schon gegessen?«
»Ja, danke.«
»Aber du trinkst doch noch ein Gläschen Wein?«
»Lieber ein Bier, wenn’s geht.«
Während ich mein Export trank, musterte er mich wortlos, mit einer leichten Verunsicherung im Blick. Marlène auch, das konnte ich sehen. Und ich ahnte, warum.
Mein Vorname sagt nichts über mich aus und mein Körper noch weniger. Ich bin lang und spindeldürr, eine richtige Bohnenstange, groß für ein Mädchen, kleiner Busen, die Haare im Nacken hochrasiert und darüber ein kurzer Igelschnitt. Ich trage enge Jeans und ein weites Kapuzensweatshirt. Ich habe Piercings in den Augenbrauen, ein hageres Gesicht und eine heisere Raucherstimme.
Ich sehe aus wie ein Junge. Es ist nicht so, dass ich gern einer wäre. Aber ich tue auch nichts, um das Gegenteil zu beweisen. Ich gehe gern nachts spazieren. Ich bin gern allein und gehe überallhin, wo es mir gefällt. Aber wenn man als Mädchen abends auf einsamen Straßen unterwegs ist, dann fahren die Autos plötzlich langsamer, ohne dass man sie darum gebeten hätte. Die Fensterscheiben gehen runter, und besoffene Stimmen grölen: »He! Mademoiselle! Haben Sie’s noch weit? Sollen wir Sie ein Stückchen mitnehmen?«
Manchmal folgen einem Autos im Schritttempo, wie große treue Hunde, bis man um die nächste Ecke biegt oder so tut, als würde man in einem Hauseingang verschwinden, oder bis sie es satthaben und mit quietschenden Reifen davonbrausen.
Als ich jung war, habe ich ein paarmal Angst gehabt. Nur Angst, weiter nichts. Aber das hat mir gereicht. Deshalb verkleide ich mich jetzt. Ich ziehe mich an wie ein Kerl, frisiere mich so und habe mir einen lässigen Gang zugelegt. Das macht mich unsichtbar, ich bin keine Beute mehr, kein Freiwild. Nur ein Jugendlicher von hinten, der sich durch die Nacht bewegt.
Ein junger Mann. Weiter nichts.
Selbst bei Tageslicht kann ich die Welt um mich herum für eine Weile täuschen.
Vielleicht wegen meines Blicks. Ich lächle nicht, ich mache nicht auf Barbiepuppe. Wenn ich Gefühle habe, zeige ich sie nicht. Außer vor Roswell, weil der das nicht sieht.
Als ich klein war, sagte mein Vater immer, wenn ich weinen musste: »Du hast wirklich keine Eier in der Hose!«
Und meine Brüder haben sich kaputtgelacht.
Deswegen beäugten mich Bertrand und Marlène an unserem ersten Abend so unauffällig wie möglich, aber voller Zweifel.
Sie trauten sich nicht, mich zu fragen. Stattdessen strichen sie um den heißen Brei, in der Hoffnung, ich würde sie auf die richtige Spur bringen. Was war ich, wer war ich? Ein etwas tuntiger Typ, eine Lesbe oder was? Bertrand schien die Sache am wenigsten geheuer zu sein.
»Marlène hat gesagt, du arbeitest in der Fabrik?«
»Ja.«
»Bist du aus der Gegend?«, hat sie gleich weitergefragt.
»Nein.«
»Ist das alles, was du an Sachen dabeihast? Nur diesen Rucksack?«
»Ja.«
Das kam ihnen natürlich spanisch vor. Marlène hat ihr Verhör dann plötzlich in einem leicht besorgten Ton fortgesetzt, fast mütterlich: »Du bist doch nicht aus einem Heim abgehauen oder so was?«
»Nein.«
»Und du bist volljährig, oder? Wir wollen nämlich keinen Ärger.«
Ich habe seufzend meinen Personalausweis aus der Tasche gezogen. Sie hat ihn sich sofort gekrallt, ihn studiert und mich mit dem Foto verglichen, als wäre sie von der Polizei. Dann hat sie auf einmal die Augenbrauen hochgezogen, gelacht und gemeint: »Dein Alter sieht man dir wirklich nicht an.« Sie hat sich zu Bertrand umgedreht. »Hättest du gedacht, dass sie schon dreißig ist?«
Bertrand hat erleichtert gelächelt. Ich war volljährig und eine Frau. Zwei gute Nachrichten auf einen Schlag. Männer sind schlampig, sie lüften nie, verbreiten überall Turnschuhmief, werfen ihre dreckigen Unterhosen einfach auf den Boden und hinterlassen immer einen Saustall. Manchmal ist es so schlimm, dass man alles neu streichen muss, wenn sie wieder weg sind. Eine Frau, ja, das war gut.
»Ich sag dir was, das sieht man dir kein bisschen an«, hat Bertrand gemeint. »Und du hast die Landwirtschaftsschule abgeschlossen?«
»Mmh.«
Das musste genügen.
Kein Abschluss, egal.
Ich bin freilaufend aufgezogen worden.
Es war nie mein Traum, Hühnereier mit Formaldehyd zu begasen, um Bakterien abzutöten. Auch nicht, um fünf Uhr morgens aufzustehen und an der Landstraße entlang zur Arbeit zu gehen, inmitten von Abgasen und Nebelschwaden. Und auch nicht, mich hier einzumieten, bei Marlène und Bertrand am Arsch der Welt, mit Blick auf das Industriegebiet.
Kennen Sie irgendjemanden, dessen Traum das wäre? Sein Leben mit beiden Füßen in der Scheiße zu verbringen, im Höllengestank einer Hühnerfarm?
Ich glaube, in den Geburtskliniken liegen ausschließlich Prinzessinnen und Märchenprinzen in den kleinen Plastikbetten. Kein einziges Neugeborenes, das entmutigt, enttäuscht, traurig oder blasiert wäre. Kein einziges kommt auf die Welt und sagt sich: Später gehe ich mal für einen Hungerlohn in der Fabrik malochen. Ich werde ein Scheißleben haben, und das wird super-duper. Juhu.
Warum ich hier bin, jetzt, in diesem Moment, ist sogar mir selbst ein Rätsel.
Aber da ich an Schicksal glaube, sage ich mir, dass es irgendwo einen großen Plan geben muss, hoch über meinem Kopf. Dass es für das alles einen Grund gibt.
Die Welt ist nicht für Menschen wie Roswell gemacht.
Sein Körper ist in sich zusammengefallen, er sieht aus, als würde er seiner Zeit als Fötus hinterhertrauern. Er ist mager, verkrümmt.
Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich sofort an diesen Außerirdischen aus der Roswell-Affäre erinnert, dessen fliegende Untertasse Ende der vierziger Jahre in den USA abgestürzt sein soll.
Ich hätte ihn E. T. nennen können, das würde auch hervorragend passen.
Aber Roswell ist cooler.
Roswell ist zweiunddreißig Jahre alt, und er lacht fast immer.
Er schläft auch ziemlich viel, dank Marlène. Bestimmt zehnmal am Tag fragt sie ihn: »Hast du nicht Durst, Trottel?« Oder: Dödel, Strohkopf, Dummerjan. Mondkalb oder Dusselchen an freundlicheren Tagen.
Roswell lacht sich jedes Mal schlapp, zeigt auf sein Glas, nickt und nuschelt: »Mjaaa, Durssst!«
Dann schenkt Marlène ihm ein, sich selbst auch. Nach einem oder zwei Gläschen schläft er tief und fest auf seinem Stuhl. Und Marlène legt CDs auf und weint ein bisschen.
Sie ist nämlich sensibel.
Es hat Zeiten des Glücks gegeben in ihrem Leben, Zeiten, denen sie nachtrauert. Sie war einmal Miss, mit zwanzig. Um nicht zu vergessen, wie schön sie war, hat sie ihr Foto gleich im Hauseingang an die Wand gehängt: Im Bikini steht sie auf dem Siegerpodest, mit Diadem und einer Schärpe mit der Aufschrift »Miss Weinlese 90«.
Man erkennt sie kaum, nicht nur weil sie damals rank und schlank war, sondern auch wegen ihres Gesichtsausdrucks: ein schönes, strahlendes Lächeln und leuchtende Augen voller Zukunft.
Daneben, in einem goldverzierten Rahmen, drei vergilbte Zeitungsausschnitte: aus dem Regionalblatt, dem Provinzboten und dem Gemeinde-Echo. »Ein guter Jahrgang für die Miss Weinlese!« – »90, Marlène Spitzenauslese« – »Marlène Dachignies, vollmundig, kräftig und samtweich!«
Marlène sagt, es wäre hart, in Vergessenheit zu geraten, wenn man dem Ruhm einmal so nahe war.
Auf die Kommode darunter hat sie eine Vase mit künstlichen Blumen gestellt. Es sieht aus wie ein kleiner Altar oder wie ein kleiner Friedhof. Nur die Kerzen fehlen.
Wenn sie von der Wahl erzählt, sagt sie, es wäre der schönste Tag ihres Lebens gewesen. Und wenn Bertrand ihr nicht Steine in den Weg gelegt hätte mit seiner Eifersucht, seinem Besitzanspruch, dann hätte sie weitergemacht.
Und sie hätte gewonnen, das ist sicher, denn sie hatte den Ehrgeiz, die Einstellung und den richtigen Körper.
Aber nein, er hat gesagt: »Entweder die Wettbewerbe oder ich.«
Sie war jung und hat geantwortet: »Du.«
»Dabei hätte ich es weit bringen können, das kannst du mir glauben! Ich hätte es bis in die Regionalauswahl geschafft, vielleicht sogar noch weiter. Aber nichts da, ich habe den Anschluss verpasst, die Karriere im Keim erstickt. Aus Liebe macht man die dümmsten Fehler, glaub mir!«
Wenn Marlène trinkt, zieht sie Bilanz.
Seit ich da bin, durfte ich mir ihr Leben schon mehrfach in voller Länge und Breite anhören. Ich weiß zwar genau, dass ich nur deshalb die Auserwählte bin, weil sonst niemand da ist, aber an manchen Abenden höre ich trotzdem zu. Und nach einer Weile sehe ich unter der dicken Make-up-Schicht und den platinblonden Strähnchen mit den mausbraunen Wurzeln nur noch ein altgewordenes Mädchen, das am Bahnsteig ankommt, als der letzte Zug gerade abgefahren ist. Sie ist ranzig wie ein altes Stück Speck. Für ihre vierzig Jahre sieht sie schon verdammt ramponiert und traurig aus.
Sie kann stundenlang vor sich hin reden, ohne müde zu werden, und im Schlamm rumwühlen, bis alles in ihrem Leben trüb und hässlich ist. Sie hat Ausdauer.
Manchmal unterbricht sie sich mitten im Satz, glotzt mich an wie ein toter Fisch und sagt: »Du bist auch eine Frau, du kannst mich verstehen, nicht wahr?«
Eines Tages hat sie mich gefragt: »Hast du Kinder?« Dann hat sie sofort mit den Achseln gezuckt und gemeint: »Ach, Quatsch, du bist ja noch viel zu jung, bin ich blöd!«
Nein, nein, ich könnte schon Kinder haben. Mehrere sogar. Sie vergisst nur immer, dass ich dreißig bin. Ich habe etwas Unfertiges, etwas Unreifes an mir.
Ich bin wie ein Entwurf meiner selbst.
Keine Kinder zu haben ist Marlènes großes Unglück. Ihr Drama, ihr Schmerz, der Stachel in ihrem Herzen.
»Ich habe alles versucht, alles! Medikamente, Kräuter, Diäten! Ich bin sogar zu einem Wunderheiler gegangen, stell dir vor. Einem Alten in der Stadt, der mit Fotos und Handauflegen arbeitet. Ich habe alle Untersuchungen gemacht, die es auf dieser Welt gibt. Die haben mich von oben bis unten durchgecheckt, das kannst du mir glauben. Und am Ende haben sie rausgefunden, dass es an Bertrand lag!«
Bei diesem Kapitel angekommen, seufzt sie in der Regel, tupft sich die Augen mit einem Stück Küchenpapier ab, möglichst ohne ihre Wimperntusche zu verschmieren, und fügt hinzu: »Den Schlag kann er nicht wegstecken. Das nagt an seinem Stolz. Kein Wunder: Ein Mann, der zehn Jahre lang Kükensexer war, produziert nur Windeier! Seitdem redet er fast gar nicht mehr, dabei war er vorher schon nicht gerade gesprächig. Und im Bett, na ja, du weißt schon … Von Frau zu Frau: Es ist so, als wäre ich unsichtbar geworden, als wäre rein gar nichts mehr an mir begehrenswert. Unglaublich, findest du nicht?«
Ich muss darauf nicht antworten. Ein Kopfschütteln, ein Nicken, das reicht. Marlène will nicht meine Meinung, sie will meine Ohren.
»Dabei hat uns der Günikiloge gesagt, dass es Möglichkeiten gibt! Und damals waren wir noch jung. Doch Bertrand wollte nichts davon wissen, er hat sich einfach geweigert. Aber ich, ich wäre zu allem bereit gewesen. Sogar eine künstliche Inzineration hätte ich mitgemacht.«
»Eine Insemination.«
»Da wäre ich auch nicht gegen gewesen.«
Sie echauffiert sich, bekommt rosige Wangen. »Ich hätte sogar adoptiert, verstehst du! Wenn der Kinderwunsch dich packt, dann könntest du in der nächsten Klinik eins stehlen gehen. Es gibt Frauen, die das machen, stimmt’s? Das hört man immer wieder in den Nachrichten. Es sollen die Hormone sein: Diese Leere füllt dich vollkommen aus, du denkst an nichts anderes mehr. Aber Adoptieren, das ist so eine Sache … Pfff! Man weiß nie, wo die herkommen. Und wenn man uns ein schwachsinniges Gör angedreht hätte? Was hätten wir damit gemacht? Das wäre dann zu dem da noch hinzugekommen. Und mit dem bin ich bedient, das kannst du mir glauben!«
Es endet fast immer mit dem armen Roswell, der im Schlaf lächelnd vor sich hin sabbert.
Marlène schenkt sich ein letztes Gläschen ein, zum Trost, dann setzt sie sich im Wohnzimmer vor die Glotze, bis der Schlaf sie einholt und im Traum auf weitere Siegerpodeste hebt.
Ich räume dann den Tisch ab, spüle mein Geschirr und gehe ein bisschen an die Luft – oder zur Arbeit.
Roswell hat keinen Gesamtblick auf die Dinge, es fehlen ihm ein paar Schaltstellen.
Bertrand sagt, da könnte man nichts machen, bei seiner Geburt hätten sie wohl Mist gebaut. Ein Riesenkuddelmuddel. Und weil sie es verpfuscht haben, ist er jetzt verkorkst.
Das war’s.
Er tickt nicht wie wir oder wie sonst irgendetwas.
Ich weiß nicht, was er versteht, nicht einmal, was er tatsächlich sieht. Es heißt, Katzen können kein Rot erkennen und Hunde sehen sechsmal schlechter als wir. Aber Roswell? Er lebt in einer anderen Welt, einer Parallelwelt. Ich weiß, dass er gern fernsieht und gern isst. Das vor allem. Auch wenn er nicht einmal Couscous von Cassoulet unterscheiden kann.
Das ist eins von Marlènes Lieblingsspielchen.
»Willst du den Bürzel, Dusselchen?«
»Au-mja!«
»Haha! Du willst den Bürzel? Aber das ist Kaninchen, du Rindvieh!«
Bertrand seufzt: »Das ist nicht witzig, Lénou. Lass das, hast du mich verstanden?«
»Jetzt darf man schon nicht mal mehr lachen! Hm, mein Dusselchen?«
Und Roswell wiederholt: »IsssTaniinchen! IsssTaniinchen!«, und lacht sich dabei kaputt. Und Marlène freut sich.
Sie streichelt Tobby und meint, zum Glück gibt es hier auch welche, die Humor haben!