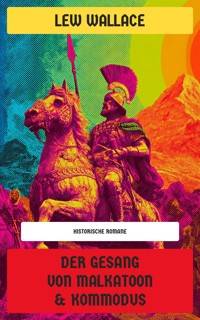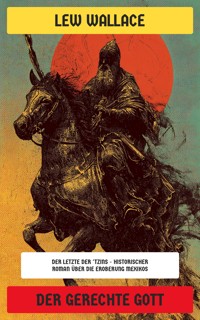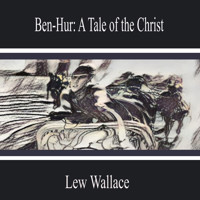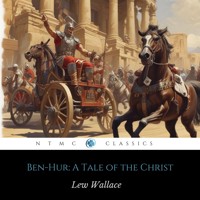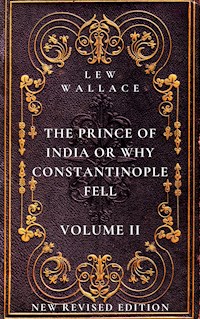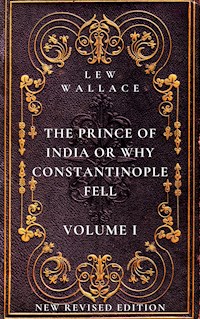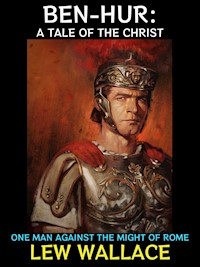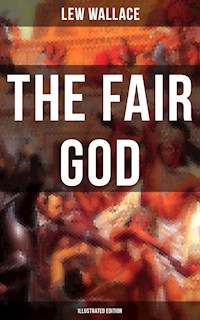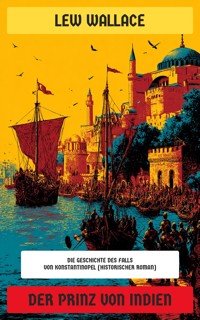
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lew Wallaces Roman "Der Prinz von Indien" entführt die Leser auf eine faszinierende und abenteuerliche Reise in die Zeit des 15. Jahrhunderts, als das byzantinische Konstantinopel seinem Untergang entgegenblickt. Im Mittelpunkt der packenden Erzählung steht der geheimnisvolle Protagonist, bekannt als der Prinz von Indien, dessen wahre Identität und Herkunft im Verborgenen liegen. Getrieben von einer jahrhundertealten Mission, bewegt sich dieser charismatische Fremde geschickt zwischen den politischen und religiösen Mächten seiner Zeit. Sein Weg führt ihn an die prachtvollen Höfe und in die dunklen Gassen der Metropole am Bosporus. Mit ihm verknüpft sind weitere bedeutende Figuren wie der junge, tapfere Grieche Konstantin, der inmitten von Intrigen und Verrat nach seinem Platz im Weltgeschehen sucht, sowie die schöne und kluge Prinzessin Irene, deren Loyalität und Mut auf eine harte Probe gestellt werden. Die Wege dieser Charaktere kreuzen sich vor dem Hintergrund einer Stadt, die von äußeren Feinden – insbesondere durch die Armeen Mehmeds II. – und inneren Spannungen bedroht wird. Wallace versteht es meisterhaft, die dramatische Atmosphäre der letzten Tage Konstantinopels einzufangen und die Leser in eine Welt voller Gefahr, Geheimnisse und politischer Ränkespiele zu entführen. Abenteuerliche Reisen, unerwartete Allianzen und tiefgründige Dialoge prägen den Verlauf der Handlung. Die Geschichte verwebt historische Fakten mit fesselnden fiktionalen Elementen und macht so den Untergang einer Weltmacht ebenso spürbar wie die unvergängliche Sehnsucht nach Liebe, Gerechtigkeit und Vergeltung. "Der Prinz von Indien" ist somit nicht nur ein packender historischer Roman, sondern auch ein faszinierendes Porträt einer vergangenen Epoche. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Prinz von Indien
Inhaltsverzeichnis
Erhebt euch auch, ihr Gestalten und Schatten der Vergangenheit Erhebt euch endlich aus euren längst vergessenen Gräbern Lasst uns eure Gesichter sehen, lasst uns hören Die Worte, die ihr in jenen Tagen der Angst gesprochen habt Kehrt wieder an eure vertrauten Orte zurück Die Schauplätze des Triumphs und die Schauplätze des Schmerzes Und hinterlasst die Fußspuren eurer blutenden Füße
An meinen Vater, David Wallace
Er liebte Literatur wegen der Freude, die sie ihm bereitete; hätte ich bei der Arbeit an diesem Werk seinen Rat einholen können, wären die Kritiker jetzt, da es kurz vor der Veröffentlichung steht, nicht so hart zu mir.
– Der Autor, Crawfordsville, Indiana.20. Mai 1893
Buch I. Die Erde und das Meer geben immer ihre Geheimnisse preis
Kapitel I. Die namenlose Bucht
An einem Mittag im September des Jahres 1395 lag ein Handelsschiff schläfrig auf den sanften Wellen des warmen Wassers, das an die syrische Küste floss. Ein moderner Seefahrer, der vom Deck eines der Messagerie-Dampfer aus, die heute auf derselben Handelsroute verkehren, auf das Schiff blickte, würde es neugierig betrachten und dankbar für die Ruhe sein, die es ihm während seines Staunens gewährte, aber noch dankbarer, dass er nicht an Bord war.
Es konnte nicht mehr als hundert Tonnen Ladung haben. An Bug und Heck war es mit einem Deck versehen, das ziemlich hochgezogen war. In der Mitte war es niedrig und offen und mit zwanzig Rudern versehen, zehn auf jeder Seite, die alle träge aus den schmalen Öffnungen schwankten, in denen sie aufgehängt waren. Manchmal schlugen sie gegeneinander. Ein Segel, quadratisch und schmutzig weiß, hing schlaff von einem breiten Rah, der selbst schräg stand und ab und zu klagend gegen den gelben Mast knarrte, ohne Rücksicht auf die einfache Vorrichtung, die es in Position halten sollte. Ein Wächter kauerte im spärlichen Schatten einer fächerartigen Konstruktion, die über das Bugdeck ragte. Das Dach und der Boden waren dort, wo sie frei lagen, sauber und sogar hell; an allen anderen Stellen, die dem Wetter und den Wellen ausgesetzt waren, war nur die Schwärze des Pechstrichs zu sehen. Der Steuermann saß auf einer Bank am Heck. Aus Gewohnheit legte er gelegentlich eine Hand auf das Ruder, um sicherzugehen, dass es noch in Reichweite war. Mit Ausnahme der beiden, des Ausguckes und des Steuermanns, schliefen alle an Bord, Offiziere, Ruderer und Matrosen – eine solche Zuversicht konnte die mediterrane Ruhe in denen wecken, die an das Leben auf dem schönen Meer gewöhnt waren. Als ob Neptun dort nie zornig wurde und mit seiner Muschel blies und mit seinem Dreizack schlug und den Himmel mit Wellen spritzte! Im Jahr 1395 war Neptun jedoch verschwunden; wie der große Gott Pan war er tot.
Das nächste Bemerkenswerte an dem Schiff war das Fehlen der üblichen Zeichen für Handelsschiffe. Es waren keine Fässer, Kisten, Ballen oder Pakete zu sehen. Nichts deutete auf eine Ladung hin. Selbst bei den stärksten Wellen war die Wasserlinie kein einziges Mal untergetaucht. Die Lederschilde der Ruderöffnungen waren hoch und trocken. Möglicherweise hatte das Schiff Passagiere an Bord. Ah, ja! Dort unter dem Sonnensegel, das sich über die Hälfte des Decks erstreckte, das vom Steuermann beherrscht wurde, befand sich eine Gruppe von Personen, die alle nicht wie Seeleute aussahen. Wenn wir innehalten, um sie zu betrachten, finden wir vielleicht den Grund für die Reise.
Die Gruppe bestand aus vier Männern. Einer lag auf einer Pritsche, schlief, war aber unruhig. Eine schwarze Samtmütze war ihm vom Kopf gerutscht und gab den Blick frei auf dichtes schwarzes, weiß meliertes Haar. Von den Schläfen aus fiel ein Bart, der kaum graue Strähnen aufwies, in dunklen Wellen über Hals und Kehle und bedeckte sogar das Kissen. Zwischen Haar und Bart war ein schmaler Streifen blasser Haut zu sehen, auf der die Gesichtszüge von Falten überlagert waren. Sein Körper war in einen lockeren, bräunlich-schwarzen Wollmantel gehüllt. Eine Hand, die nur noch aus Knochen zu bestehen schien, lag auf seiner Brust und umklammerte eine Falte des Gewandes. Die Füße zuckten nervös in den lockeren Riemen altmodischer Sandalen. Ein Blick auf die anderen in der Gruppe zeigte, dass dieser Schläfer der Herr war und sie seine Sklaven. Zwei von ihnen lagen ausgestreckt auf den blanken Brettern am unteren Ende der Pritsche, und sie waren weiß. Der dritte war ein Sohn Äthiopiens von reinem Blut und gigantischer Statur. Er saß links von der Liege, die Beine gekreuzt, und döste wie die anderen. Ab und zu hob er den Kopf und schüttelte, ohne die Augen ganz zu öffnen, einen Fächer aus Pfauenfedern über die liegende Gestalt. Die beiden Weißen trugen grobe Leinengewänder, die mit einem Gürtel um die Hüften gebunden waren, während der Neger bis auf einen Lendenschurz nackt war.
Oft kann man aus den Sachen, die ein Mann von zu Hause mitbringt, viel über ihn erfahren. Hier lag neben der Schlafstätte ein ungewöhnlich langer Spazierstock, der etwas oberhalb der Mitte stark abgenutzt war. Im Notfall hätte man ihn als Waffe benutzen können. Drei lose gewickelte Bündel waren gegen ein Holzstück des Schiffes geworfen worden; vermutlich enthielten sie die Beute der Sklaven, die auf das für die Reise erforderliche Minimum reduziert worden war. Am auffälligsten war jedoch eine Lederrolle von sehr altem Aussehen, die von mehreren breiten Riemen gehalten und mit Schnallen aus schwarzem Metall, das wie vernachlässigtes Silber aussah, befestigt war.
Die Aufmerksamkeit eines aufmerksamen Beobachters wäre nicht so sehr durch das antike Aussehen dieses Pakets geweckt worden, sondern vielmehr durch die Festigkeit, mit der sein Besitzer es mit der rechten Hand umklammerte. Selbst im Schlaf hielt er es wie etwas von unschätzbarem Wert. Es konnte keine Münzen oder andere sperrige Gegenstände enthalten. Möglicherweise war der Mann mit einer besonderen Mission unterwegs und hatte seine Beglaubigungspapiere in der alten Rolle. Ja, wer war er?
So hätte der Beobachter begonnen, sich zu bücken, um das Gesicht zu studieren, und sofort hätte ihm etwas gesagt, dass der Fremde zwar aus dieser Zeit stammte, aber nicht zu ihr gehörte. So waren die Zauberer des geschichtenliebenden Al-Raschid. Oder er war von der rabbinischen Sorte, die mit Kaiphas über den sanften Nazarener gerichtet hatte. Nur die Jahrhunderte konnten eine solche Erscheinung hervorgebracht haben. Wer war er?
Im Laufe einer halben Stunde regte sich der Mann, hob den Kopf, blickte hastig zu seinen Begleitern, dann zu den sichtbaren Teilen des Schiffes, dann zu dem noch am Ruder dösernden Steuermann; dann setzte er sich auf und nahm die Rolle auf seinen Schoß, worauf sich sein strenger Gesichtsausdruck entspannte. Das Paket war in Sicherheit! Und die Umstände waren so, wie sie sein sollten!
Dann machte er sich daran, die Schnallen seines Schatzes zu öffnen. Seine langen Finger waren geübt, aber gerade als die Rolle zum Öffnen bereit war, hob er den Kopf, starrte auf den blauen Streifen außerhalb des Zeltdachs und versank in Gedanken. Und sofort stand fest, dass er kein Diplomat, kein Staatsmann und auch kein Geschäftsmann war. Die Gedanken, die ihn beschäftigten, hatten nichts mit Intrigen oder Staatskunst zu tun; sie kamen aus seinem Herzen, wie sein Blick verriet. So blickt ein Vater in zärtlicher Stimmung auf sein Kind, ein Ehemann auf seine geliebte Frau, ruhig und liebevoll.
Und in diesem Moment hätte der Beobachter, der seine Beobachtung fortsetzte, das Paket, die weißen Sklaven, den riesigen Neger, das eigenwillige Haar und den stolzen Bart vergessen – allein das Gesicht hätte ihn gefesselt. Das Gesicht der Sphinx hat jetzt keine Schönheit mehr, und wenn wir davor stehen, verspüren wir keine Bewunderung, die immer ein Zeichen dafür ist, dass das, was wir betrachten, über das Gewöhnliche hinausgeht; dennoch fühlen wir uns unwiderstehlich davon angezogen, und zwar durch einen vagen, törichten Wunsch – so töricht, dass wir lange zögern würden, ihn unserem besten Freund gegenüber in Worte zu fassen –, dass das Ungeheuer uns alles über sich erzählen möge. Das Gefühl, das das Gesicht des Reisenden in ihm weckte, war ähnlich, denn es war eindeutig israelitisch, mit übertriebenen Augen, die tief in höhlenartigen Vertiefungen lagen – eine bewegliche Maske, die ein Leben verbarg, das irgendwie anders war als andere Leben. Anders? Das war genau das Faszinierende daran. Wenn der Mann nur sprechen würde, welche Geschichte könnte er erzählen!
Aber er sprach nicht. Tatsächlich schien er das Wort als eine Schwäche zu betrachten, gegen die man sich wappnen musste. Er schob den angenehmen Gedanken beiseitesprechen, öffnete die Rolle und holte mit überaus zärtlicher Berührung ein Blatt Pergament hervor, das brüchig trocken und gelb wie ein verblasstes Ahornblatt war. Darauf waren Linien wie eine geometrische Zeichnung und eine Inschrift in seltsamen Zeichen. Er beugte sich eifrig über die Karte, wenn man sie so nennen konnte, und las sie durch; dann faltete er sie mit zufriedener Miene wieder zusammen, schnallte die Riemen fest und legte das Päckchen unter sein Kopfkissen. Offensichtlich verlief das Geschäft, das ihn hierher geführt hatte, so, wie er es sich vorgestellt hatte. Als Nächstes weckte er den Neger mit einer Berührung. Der Schwarze verbeugte sich, beugte seinen Körper nach vorne und hob die Hände mit den Handflächen nach oben, die Daumen an die Stirn. Eine seltsam intensive Aufmerksamkeit lag auf seinem Gesicht; er schien mit seiner ganzen Seele zu lauschen. Es war Zeit für Worte, doch der Herr zeigte nur auf einen der Schlafenden. Der wachsame Neger verstand, ging zu dem Mann, weckte ihn und nahm dann seinen Platz und seine Haltung neben der Pritsche wieder ein. Die Bewegung zeigte seine Proportionen. Er sah aus, als könnte er die Tore von Gaza hochheben und mühelos wegtragen; zu seiner Kraft kamen noch die Anmut, Geschmeidigkeit und Sanftheit der Bewegungen einer Katze hinzu. Man konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass dieser Sklave alle Voraussetzungen mitbringen könnte, um sowohl auf dem Feld der Schlechtigkeit als auch auf dem Feld der Tugend ein hervorragender Akteur zu sein.
Der zweite Sklave stand auf und wartete respektvoll. Es war schwer, seine Nationalität zu bestimmen. Er hatte das schmale Gesicht, die hohe Nase, die fahle Hautfarbe und die kleine Statur eines Armeniers. Sein Gesichtsausdruck war freundlich und intelligent. Der Herr gab ihm mit Händen und Fingern Zeichen, die offenbar ausreichten, denn der Diener ging schnell davon, als hätte er eine Aufgabe zu erledigen. Kurz darauf kam er mit einem Begleiter zurück, der wie ein Seemann aussah, mit rotem Gesicht, kräftig gebaut, dumm und mit einem Gang, der nicht gerade auf gute Manieren hindeutete. Der Seemann stellte sich mit weit auseinander stehenden Füßen vor den Mann in der schwarzen Robe und sagte:
„Du hast nach mir geschickt?“
Die Frage war in byzantinischem Griechisch formuliert.
„Ja“, antwortete der Passagier in derselben Sprache, wenn auch mit besserem Akzent. „Wo sind wir?“
„Ohne diese Flaute wären wir schon in Sidon. Der Ausguck meldet, dass die Berge in Sicht sind.“
Der Passagier hielt einen Moment inne und fragte dann: „Wenn wir zu den Rudern greifen, wann können wir die Stadt erreichen?“
„Bis Mitternacht.“
„Sehr gut. Hör jetzt zu.“
Der Sprecher änderte seine Haltung, fixierte den Seemann mit seinen großen Augen und fuhr fort:
„Ein paar Stadien nördlich von Sidon gibt es so etwas wie eine Bucht. Sie ist etwa vier Meilen breit. Zwei kleine Flüsse münden dort, einer auf jeder Seite. In der Mitte der Biegung der Küste gibt es eine Quelle mit Süßwasser, die genug Wasser liefert, um ein paar Dorfbewohner und ihre Kamele zu versorgen. Kennst du die Bucht?“
Der Skipper war damit vertraut.
„Du kennst diese Küste gut“, sagte er.
„Kennst du eine solche Bucht?“, wiederholte der Passagier.
„Ich habe davon gehört.“
„Könntest du sie nachts finden?“
„Ich glaube schon.“
„Das reicht. Bring mich in die Bucht und lass mich um Mitternacht an Land gehen. Ich werde nicht in die Stadt gehen. Hol alle Ruder raus. Zur richtigen Zeit werde ich dir sagen, was ich weiter will. Denk daran, ich soll um Mitternacht an einem Ort an Land gebracht werden, den ich dir zeigen werde.“
Die Anweisungen waren zwar knapp, aber klar. Nachdem er sie gegeben hatte, bedeutete der Passagier dem Neger, ihn zu fächeln, streckte sich auf der Pritsche aus, und von da an gab es keinen Zweifel mehr, wer das Sagen hatte. Umso interessanter wurde es jedoch, das Ziel der Landung um Mitternacht an der Küste einer einsamen, namenlosen Bucht zu erfahren.
Kapitel II. Die Mitternachtslandung
Der Skipper sagte es voraus wie ein Prophet. Das Schiff war in der Bucht, und es war Mitternacht oder fast Mitternacht; denn bestimmte Sterne waren an bestimmten Stellen des Himmels aufgegangen und schlugen auf ihre Weise die Stunde.
Der Passagier war zufrieden.
„Du hast das gut gemacht“, sagte er zum Seemann. „Sei jetzt still und fahr näher an die Küste heran. Es gibt keine Brecher. Halte das kleine Boot bereit und lass die Anker nicht fallen.“
Die Ruhe herrschte noch immer, und die Wellen des Meeres waren kaum zu spüren. Unter dem sanften Antrieb der Ruder trieb das kleine Schiff seitlich dahin, bis der Kiel den Sand berührte. Im selben Augenblick tauchte das kleine Boot auf. Der Skipper meldete sich beim Passagier. Dieser ging zu den Sklaven und bedeutete ihnen, abzusteigen. Die Neger schwangen sich wie Affen hinunter und nahmen das Gepäck entgegen, das außer den bereits erwähnten Bündeln aus einigen Werkzeugen bestand, darunter eine Spitzhacke, eine Schaufel und eine stabile Brechstange. Auch ein leerer Wasserschlauch wurde hinuntergereicht, gefolgt von einem Korb, der auf Lebensmittel schließen ließ. Dann gab der Passagier, einen Fuß über der Schiffsseite, seine letzten Anweisungen.
„Fahrt jetzt“, sagte er zum Skipper, der zu seiner Ehre bisher keine Fragen gestellt hatte, „fahrt hinunter in die Stadt und bleibt dort bis morgen und morgen Nacht. Macht so wenig wie möglich auf euch aufmerksam. Es ist nicht notwendig, das Tor zu passieren. Legt rechtzeitig ab, damit ihr bei Sonnenaufgang hier seid. Ich werde auf euch warten. Übermorgen bei Sonnenaufgang – denkt daran.“
„Aber wenn du nicht hier bist?“, fragte der Seemann, der an alle möglichen Eventualitäten dachte.
„Dann wartet auf mich“, war die Antwort.
Der Passagier stieg seinerseits in das Boot, wurde von dem Schwarzen in die Arme genommen und vorsichtig hingesetzt, als wäre er ein Kind. In kurzer Zeit war die Gruppe an Land, und das Boot kehrte zum Schiff zurück; wenig später entfernte sich das Schiff dorthin, wo die Nacht die Tiefe wirksam verhüllte.
Der Aufenthalt an Land reichte aus, um das Gepäck unter den Sklaven zu verteilen. Dann ging der Kapitän voran. Sie überquerten die Straße, die von Sidon entlang der Küste ins Landesinnere führte, und gelangten zu den Ausläufern des Berges, die völlig unbewohnt waren.
Später stießen sie auf Spuren eines einst prächtigen Lebens – zerbrochene Säulen und hier und da korinthische Kapitelle aus Marmor, die verfärbt und tief in den Sand geformt waren. Die weißen Flecken darauf schimmerten gespenstisch im Sternenlicht. Sie näherten sich der Stelle einer alten Stadt, wahrscheinlich einem Vorort von Paläa-Tyros, als diese noch eine der Sehenswürdigkeiten der Welt war und am Meer lag, um weit und breit herrschend zu regieren.
Weiter vorne hatte ein kleiner Bach, einer von denen, die in die Bucht mündeten, eine Schlucht in den Weg gegraben, den die Gruppe verfolgte. Sie stiegen zum Wasser hinab, machten Halt, um zu trinken und die Wasserschläuche zu füllen, die der Neger auf seine Schulter nahm.
Weiter vorne gab es eine weitere alte Stätte, die mit Fragmenten übersät war, die auf einen Friedhof hindeuteten. Es lagen viele behauene Steine herum, dazwischen vereinzelt Entablaturen und Vasen, deren feine Schnitzereien noch nicht ganz vom Zahn der Zeit zerfressen waren. Schließlich versperrte ein riesiger, unbedeckter Sarkophag den Weg. Der Meister blieb davor stehen, um den Himmel zu studieren; als er den Nordstern gefunden hatte, gab er seinen Begleitern ein Zeichen und machte sich auf den Weg unter dem Lichtstrahl des unveränderlichen Leuchtfeuers.
Sie kamen zu einer Anhöhe, die deutlicher durch aus dem Fels gehauene Sarkophage gekennzeichnet war, die mit so schweren und massiven Deckeln verschlossen waren, dass einige von ihnen nie geöffnet worden waren. Zweifellos lagen die Toten darin so, wie sie zurückgelassen worden waren – aber wann und von wem? Welche Enthüllungen würde es geben, wenn endlich das Ende verkündet würde!
Weiter, aber immer noch in Verbindung mit der einst prächtigen Begräbnisstätte, stießen sie auf eine viele Fuß dicke Mauer, und kurz dahinter, an der Bergseite, befanden sich zwei Bögen einer Brücke, von der alles andere eingestürzt war; und diese beiden hatten nie etwas Substanzielleres als die Luft überspannt. Ein seltsames Bauwerk für einen solchen Ort! Offensichtlich begann die Straße, die einst darüber führte, in der Stadt, um eine bessere Verbindung zum Friedhof herzustellen, den die Gruppe gerade passiert hatte. So viel war leicht zu verstehen, aber wo war das andere Ende? Beim Anblick der Bögen atmete der Meister erleichtert auf. Es waren die Freunde, nach denen er gesucht hatte.
Dennoch führte er sie, ohne anzuhalten, hinunter in eine von allen Seiten abgeschirmte Mulde, wo sie ausluden. Die Werkzeuge und Bündel wurden neben einen Felsen geworfen, und man bereitete sich auf die Nacht vor. Die Pritsche wurde für den Meister ausgebreitet. Der Korb wurde geleert, und die Gruppe stärkte sich und schlief den Schlaf der Müden.
Am nächsten Tag blieben sie in ihrem abgelegenen Biwak. Nur der Meister ging am Nachmittag hinaus. Er stieg den Berg hinauf und fand die Linie, in der die Brücke weiterführte; eine Aufgabe, die durch die beiden Bögen, die als Fundament dienten, vergleichsweise leicht war. Er stand dann auf einer mit Steinen übersäten Bank oder Terrasse, die so breit war, dass nur wenige zufällige Betrachter sie für künstlich gehalten hätten. Er wandte sich von den Pfeilern ab, ging vorwärts und folgte der Terrasse, die an einigen Stellen aus der Linie geraten war und auf der rechten Seite mit Geröll bedeckt war, das vom Berg heruntergestürzt war. Nach wenigen Minuten bog dieser stille Führer in einer leichten Kurve ab und verschwand in etwas, das noch kaum als ein mit enormer Mühe aus einem niedrigen Felsen aus festem braunem Kalkstein herausgerissener Bereich zu erkennen war.
Der Besucher schaute sich wieder und wieder um; dann sagte er laut:
„Seitdem war niemand mehr hier“ –
Der Satz blieb unvollendet.
Dass er den Ort so genau identifizieren und mit solcher Gewissheit auf eine frühere Zeit schließen konnte, bewies, dass er schon einmal hier gewesen war.
Felsen, Erde und Büsche füllten den Raum. Er bahnte sich einen Weg und untersuchte die Felswand, die nun vor ihm lag, wobei er am längsten bei dem Haufen von Bruchstücken verweilte, der sich an der Verbindungslinie zwischen Fläche und Hügel zu einem Wall auftürmte.
„Ja“, wiederholte er, diesmal mit unverhohlener Zufriedenheit, „seitdem war niemand mehr hier“ –
Wieder blieb der Satz unvollendet.
Dann stieg er auf den Wall und entfernte einige Steine an der Spitze. Eine flach reliefierte Linie an der Felswand kam zum Vorschein; als er sie sah, lächelte er, legte die Steine zurück, stieg hinab, kehrte zur Terrasse zurück und ging von dort zu den Sklaven im Biwak.
Aus einem der Bündel holte er zwei eiserne Lampen im alten römischen Stil hervor, versah sie mit Öl und Dochten und legte sich dann, als sei alles für sein Vorhaben vorbereitet, auf die Pritsche. Während seiner Abwesenheit waren einige Ziegen an den Ort gekommen, aber sonst war keine lebende Seele zu sehen.
Nach Einbruch der Dunkelheit weckte der Herr die Sklaven und traf die letzten Vorbereitungen für das Unternehmen, zu dem er gekommen war. Er gab einem Mann die Werkzeuge, einem anderen die Lampen und dem Neger den Wasserschlauch. Dann führte er sie aus der Mulde hinaus und den Berg hinauf zu der Terrasse, die sie am Nachmittag besucht hatten; auch an der Stelle, die als abruptes Ende der Straße über den Skelettpfeilern bezeichnet worden war, hielt er nicht an. Er kletterte die Steinebank am Fuße der Klippe hinauf bis zu der Stelle, an der seine Erkundung geendet hatte.
Die Sklaven begannen sofort, den Wall oben abzutragen, was keine schwere Arbeit war, da sie die losen Steine nur einen bequemen Abhang hinunterrollen mussten. Sie arbeiteten fleißig. Nach einer halben Stunde entdeckten sie eine Öffnung in der Felswand. Der Hohlraum, der zunächst klein war, vergrößerte sich rasch, bis er eine Türöffnung von gewaltigen Ausmaßen erkennen ließ. Als die Öffnung groß genug war, dass er hindurchgehen konnte, ließ der Meister die Arbeit einstellen und ging hinein. Die Sklaven folgten ihm. Der Abstieg im Inneren verlief in einem ähnlichen Gefälle wie die Böschung draußen – es handelte sich tatsächlich um eine weitere Böschung aus dem gleichen Material, die jedoch aufgrund der Dunkelheit schwieriger zu passieren war.
Mit dem Fuß tastete sich der Anführer der Abenteurer den Weg zu einem Boden hinunter; und als seine Helfer zu ihm kamen, holte er aus einer Tasche seines Gewandes einen kleinen Kasten mit einem chemischen Pulver, das er zu seinen Füßen ausstreute; dann holte er einen Feuerstein und Stahl hervor und schlug sie aneinander. Einige Funken fielen auf das Pulver. Sofort stieg eine Flamme auf und erfüllte den Raum mit einem rötlichen Licht. Die Gruppe zündete die Lampen mit der Flamme an und sah sich um, die Sklaven mit schlichtem Staunen.
Sie befanden sich in einer Gruft – einer sehr alten Grabstätte. Entweder handelte es sich um eine Nachahmung ähnlicher Kammern in Ägypten, oder diese waren Nachahmungen davon. Die Ausgrabung war mit Meißeln vorgenommen worden. Die Wände waren mit Nischen versehen, die ihnen das Aussehen von Vertäfelungen gaben, und über jeder Nische befand sich eine Inschrift in erhabenen Buchstaben, die jetzt größtenteils unleserlich waren. Der Boden war ein Durcheinander von Fragmenten, die aus Sarkophagen herausgeschlagen worden waren, die, so massiv sie auch waren, gekippt, umgestürzt, aufgedeckt, verstümmelt und ausgeraubt worden waren. Es war sinnlos, nach den Urhebern dieser Verwüstung zu fragen. Es könnten die Chaldäer aus der Zeit Almanezors gewesen sein, oder die Griechen, die mit Alexander marschierten, oder die Ägypter, die den Toten der von ihnen besiegten Völker ebenso wenig Respekt entgegenbrachten wie ihren eigenen, oder die Sarazenen, die dreimal die syrische Küste erobert hatten, oder die Christen. Nur wenige Kreuzritter waren wie der heilige Ludwig.
Aber all das nahm der Meister nicht wahr. Für ihn war es richtig, dass die Gruft so aussah, wie sie aussah. Unbeeindruckt von Inschriften und gleichgültig gegenüber Schnitzereien, wanderte sein Blick schnell entlang der Nordwand, bis er auf einen Sarkophag aus grünem Marmor fiel. Dorthin ging er. Er legte seine Hand auf den halb geöffneten Deckel und stellte fest, dass die Rückseite des großen Kastens – wenn man ihn so nennen konnte – an der Wand stand, und sagte wieder:
„Seitdem war niemand mehr hier“ –
Und wieder blieb der Satz unvollendet.
Sofort wurde er ganz energisch. Der Neger holte die Brechstange und setzte sie auf Anweisung unter die Kante des Sarkophags, den er hochhielt, während der Meister ihn unten mit einem Steinsplitter blockierte. Ein weiterer Biss, und ein größerer Splitter wurde eingesetzt. Nachdem so ein guter Halt gefunden war, wurde eine Vase als Drehpunkt eingesetzt; danach schwang der schwere Sarg bei jedem Druck nach unten ein wenig nach links. Langsam und mühsam wurde die Bewegung fortgesetzt, bis der Raum dahinter freigelegt war.
Inzwischen waren die Lampen zur Lichtquelle geworden. Mit seiner Lampe in der Hand bückte sich der Meister und untersuchte die freigelegte Wand. Unwillkürlich beugten sich die Sklaven vor und schauten, sahen aber nichts, was sich von der allgemeinen Oberfläche in diesem Bereich unterschied. Der Meister winkte den Neger herbei, berührte einen Stein, der nicht breiter als seine drei Finger war, aber rötlich gefärbt aussah und wie ein zufälliger Splitter in einer Spalte steckte, und bedeutete ihm, mit dem Ende der Stange darauf zu schlagen. Einmal, zweimal – der Stein rührte sich nicht; beim dritten Schlag wurde er unsichtbar hineingetrieben und fiel, als man kräftig nachhämmerte, auf der anderen Seite zu Boden. Darauf brach die Wand bis zur Höhe des Sarkophags und bis zur Breite einer breiten Tür ein und schien einzustürzen.
Als sich der Staub gelegt hatte, kam eine zuvor unsichtbare Spalte zum Vorschein, die breit genug war, um eine Hand hineinzustecken. Der Leser muss bedenken, dass es in alten Zeiten Maurer gab, die sich damit vergnügten, ihre mathematischen Kenntnisse auf solche Rätsel anzuwenden. Hier war offensichtlich beabsichtigt gewesen, den Eingang zu einer angrenzenden Kammer zu verbergen, und der Schlüssel zu dieser Konstruktion war der zuerst entfernte Splitter aus rotem Granit gewesen.
Mit etwas Geduld und Hilfe von Stangen gelang es dem Handwerker, den ersten großen Block der Kombination herauszunehmen. Den nummerierte der Meister mit Kreide und legte ihn sorgfältig beiseitesprechen. Ein zweiter Block wurde herausgenommen, nummeriert und beiseitesprechen; schließlich war die Wand eingerissen und der Weg stand offen.
Kapitel III. Der verborgene Schatz
Die Sklaven schauten skeptisch auf die staubige Öffnung, die für sie nicht einladend aussah; der Herr jedoch zog seinen Mantel enger um sich und ging mit einer Lampe in der Hand voran. Sie folgten ihm.
Ein aufsteigender Gang, niedrig, aber breit, empfing sie. Auch dieser war aus dem festen Fels gehauen worden. Die Radspuren der bei den Arbeiten verwendeten Wagen waren noch auf dem Boden zu sehen. Die Wände waren kahl, aber glatt bearbeitet. Das Interessante hier war die Vorfreude auf das, was kommen würde, und vielleicht war es das, was den Gesichtsausdruck des Herrn so ernst und versunken machte. Er lauschte jedenfalls nicht den disharmonischen Echos, die beim Voranschreiten widerhallten.
Der Aufstieg war leicht. Fünfundzwanzig oder dreißig Stufen führten sie zum Ende des Ganges.
Dann betraten sie einen geräumigen, runden Raum mit einer Kuppel. Das Licht der Lampen reichte nicht aus, um die Decke aus der Dunkelheit zu holen, doch der Meister führte ohne zu zögern zu einem Sarkophag, der in der Mitte der Kuppel stand, und als er dort angekommen war, vergaß er alles andere.
Das so entdeckte Grabmal war aus dem Fels gehauen und hatte ungewöhnliche Ausmaße. Es stand quer zur Tür, war etwa so hoch wie ein normaler Mann und doppelt so lang wie hoch. Die Außenseite war so glatt poliert, wie es das Material zuließ, ansonsten war es völlig schlicht und sah aus wie eine dunkelbraune Kiste. Der Deckel war eine Platte aus feinstem weißem Marmor, die zu einem perfekten Modell des Salomonischen Tempels geschnitzt war. Als der Meister den Deckel betrachtete, war er sichtlich bewegt. Er hielt die Lampe langsam darüber und ließ das Licht in die Höfe des berühmten Gebäudes fallen; auf die gleiche Weise beleuchtete er die Korridore und das Tabernakel; dabei zitterten seine Gesichtszüge und seine Augen füllten sich mit Tränen. Er ging mehrmals um die exquisite Nachbildung herum und hielt ab und zu inne, um den Staub wegzupusten, der sich an einigen Stellen darauf angesammelt hatte. Er bemerkte die Wirkung des transparenten Weiß in der Kammer; so hatte das Original damals die umgebende Welt erleuchtet. Zweifellos hatte das Modell eine besondere Wirkung auf ihn.
Aber er schüttelte die Schwäche ab und machte sich nach einer Weile an die Arbeit. Er ließ den Neger die Kante der Stange unter den Deckel schieben und ihn vorsichtig anheben. Da er in der Vorkammer vorsorglich Steine für diesen Zweck bereitgelegt hatte, legte er einen davon so, dass er den gewonnenen Vorteil halten konnte. Langsam, indem er abwechselnd an den Enden arbeitete, drehte er die riesige Platte um ihre Mitte; langsam wurde die Höhle des Sarges von Licht überflutet; langsam und scheinbar widerwillig gab sie ihre Geheimnisse preis.
Im starken Kontrast zur Schlichtheit des Äußeren war das Innere des Sarkophags mit Goldplatten und -tafeln ausgekleidet, auf denen vertriebene und getriebene Kartons zu sehen waren, die Schiffe, hohe Bäume, zweifellos Zedern aus dem Libanon, arbeitende Steinmetze und zwei bewaffnete Männer in königlichen Gewändern darstellten, die sich mit gefalteten Händen begrüßten; und so schön waren die Kartons, dass der exzentrische Medailleur Cellini, sie lange, wenn nicht sogar neidisch studiert hätte. Doch derjenige, der nun in den Behälter blickte, warf kaum einen Blick darauf.
Auf einem Steinstuhl saß die Mumie eines Mannes mit einer Krone auf dem Kopf, und über seinem Körper, der größtenteils von Leinentüchern bedeckt war, lag ein weit ausgebreitetes Gewand aus Goldfäden. Die Hände ruhten auf dem Schoß; in der einen hielt er ein Zepter, in der anderen eine beschriftete silberne Tafel. An den Fingern und Daumen waren einfache Ringe und Ringe mit Edelsteinen zu sehen; die Ohren, Knöchel und sogar die großen Zehen waren auf ähnliche Weise verziert. Zu seinen Füßen lag ein Schwert in der Form eines Krummsäbels. Die Klinge steckte in einer Scheide, die aus einer Ansammlung von Juwelen bestand, und der Griff war ein flammender Rubin. Der Gürtel war mit Perlen und glitzernden Brillanten verziert. Unter dem Schwert lagen die Instrumente, die damals und seitdem den Meister-Maurern heilig waren – ein Winkelmaß, ein Hammer, ein Senklot und ein Zirkel.
Der Mann war ein König gewesen – das sagte schon der erste Blick. Wie bei seinen königlichen Brüdern aus den Gräbern entlang des Nils hatte der Tod triumphierend über den Einbalsamierer gesiegt. Die Wangen waren verschrumpelt und schimmlig, die Haut auf der Stirn war straff gezogen, die Schläfen waren hohl und von den Stirnknochen scharf umrandet, die Augenhöhlen waren teilweise mit getrockneter, bituminöser Salbe gefüllt. Der Monarch hatte sein Leben in voller Reife aufgegeben, denn das weiße Haar und der Bart hingen noch in steifen Zöpfen an Schädel, Wangen und Kinn. Nur die Nase war natürlich; sie ragte dünn und hakenförmig empor wie der Schnabel eines Adlers.
Beim Anblick der so herausgeputzten Gestalt, die in einer Haltung ruhiger Gelassenheit auf ihrem Sitz verharrte, wichen die Sklaven erschrocken zurück. Der Neger ließ seine Eisenstange fallen, die mit einem dissonanten Klirren durch die Kammer hallte.
Um die Mumie herum standen sorgfältig angeordnet Gefäße, die mit Münzen, Perlen und Edelsteinen gefüllt waren, die bereits für den Goldschmied geschnitten und vorbereitet waren. Tatsächlich war der gesamte Innenraum des Sarkophags mit Schalen und Urnen gefüllt, von denen jede für sich ein Kunstwerk war; und wenn man nach dem zu urteilen konnte, was über sie hinausquoll, enthielten sie alle Edelsteine aller Art. Die Ecken waren mit goldenen Tüchern und mit Perlen bestickten Tüchern drapiert, von denen einige nun unter ihrem eigenen Gewicht auseinanderfielen.
Wir wissen, dass Könige und Königinnen nur Männer und Frauen sind, die denselben Leidenschaften unterworfen sind wie das einfache Volk; dass sie je nach ihrer Natur großzügig oder geizig sind; dass es unter ihnen Geizhälse gegeben hat; aber dieser hier – glaubte er etwa, er könne seine Reichtümer mit sich aus der Welt nehmen? Hatte er die Edelsteine in seinem Leben so sehr geliebt, dass er davon träumte, sein Grab mit ihnen zu erleuchten? Wenn ja, oh königlicher Narr!
Als eine Öffnung breit genug war, indem er den Deckel auf die Kante des Sarkophags drehte, zog der Meister seine Sandalen aus, reichte einem seiner Sklaven einen Fuß und schwang sich ins Innere. Dann wurde ihm die Lampe gereicht, und er betrachtete den Reichtum und die Pracht, wie der König es vielleicht nie wieder tun würde. Und wie der König in seiner Zeit triumphierend gesagt hatte: „Siehe, es gehört alles mir!“, so beanspruchte nun der Eindringling das Recht darauf.
Da er, selbst wenn er gewollt hätte, nicht die ganze Sammlung mitnehmen konnte, schaute er sich um und überlegte, wo er anfangen sollte. Da er wusste, dass er nichts zu befürchten hatte, schon gar nicht von dem Besitzer auf dem Stuhl, ging er langsam und bedächtig vor. Aus seinem Gewand zog er mehrere Säcke aus grobem Hanfstoff und eine breite weiße Serviette hervor. Letztere breitete er auf dem Boden aus, nachdem er einige der Urnen beiseite gestellt hatte, um Platz zu schaffen; dann leerte er eines der Gefäße darauf aus und begann, aus dem funkelnden und bunten Haufen vor sich eine Auswahl zu treffen.
Sein Urteilsvermögen war ausgezeichnet, sicher und schnell. Nicht selten legte er die großen Steine beiseite und bevorzugte Farbe und Glanz. Die ausgewählten Steine ließ er in einen Beutel fallen. Als er alle Steine durchgesehen hatte, legte er die abgelehnten zurück in den Behälter und platzierte sie genau an ihrem Platz. Dann wandte er sich einem anderen Behälter zu, dann einem weiteren, bis er im Laufe von ein paar Stunden eine Auswahl aus der Sammlung getroffen hatte, neun Beutel gefüllt und diese sicher verschlossen hatte.
Sehr erleichtert stand er auf, rieb sich eine Weile die tauben Glieder und reichte die Pakete an die Sklaven weiter. Die Arbeit war anstrengend und ermüdend gewesen, aber sie war getan, und er konnte sich nun zurückziehen. Er verweilte noch, um einen letzten Blick ins Innere zu werfen, murmelte wieder den Satz und ließ ihn wie zuvor unvollendet:
„Seitdem war niemand mehr hier“ –
Sein Blick fiel auf die silberne Tafel in der kraftlosen Hand. Er trat näher, hielt die Lampe in eine günstige Position, kniete nieder und las die Inschrift.
I
„Es gibt nur einen Gott, und er war von Anfang an und wird ohne Ende sein.
II
„Zu Lebzeiten habe ich diese Gruft und dieses Grabmal vorbereitet, um meinen Körper aufzunehmen und ihn sicher zu bewahren; doch es darf besucht werden, denn die Erde und das Meer geben immer ihre Geheimnisse preis.
III
Deshalb, Fremder, der du mich als Erster gefunden hast, sollst du wissen:
„Dass ich mein ganzes Leben lang mit Salomo, dem König der Juden, dem weisesten aller Menschen und dem reichsten und größten, in Verbindung stand. Wie bekannt ist, begann er, ein Haus für seinen Herrn Gott zu bauen, entschlossen, dass es nichts Vergleichbares auf der Welt geben sollte, nichts so Geräumiges, so Reichhaltiges, so Vollkommenes in seinen Proportionen, so in allem der Herrlichkeit seines Gottes angemessen. Aus Sympathie für ihn gab ich ihm die Fertigkeiten meines Volkes, das in golden glänzendem Messing, Silber und Gold arbeitete und die Produkte der Steinbrüche herstellte; und meine Seeleute brachten ihm in ihren Schiffen die Erträge der Minen von den Enden der Erde. Endlich war das Haus fertig; da sandte er mir den Entwurf des Hauses und die Münzen und die Stoffe aus Gold und Perlen und die Edelsteine und die Gefäße, in denen sie aufbewahrt wurden, und die anderen wertvollen Dinge, die hier zu finden waren. Und wenn du, Fremder, dich über die Größe des Geschenks wunderst, so wisse, dass es nur ein kleiner Teil dessen war, was ihm noch davon übrig geblieben war, denn er war Herr über die Erde und über alles, was dazu gehört und ihm von Nutzen sein könnte, sogar über die Elemente und ihre Feinheiten.
IV
„Glaub nicht, Fremder, dass ich den Reichtum mit ins Grab genommen habe, weil ich denke, er könnte mir im nächsten Leben zur Seite stehen. Ich bewahre ihn hier auf, weil ich den liebe, der ihn mir gegeben hat, und weil ich eifersüchtig auf seine Liebe bin; das ist alles.
V
„So sollst du den Reichtum auf eine Weise verwenden, die dem Herrn, dem Gott Salomos, meinem königlichen Freund, gefällt, nimm ihn in Empfang. Es gibt keinen Gott außer seinem Gott!
So sage ich –Hiram, König von Tyrus.“
„Ruhe in Frieden, du weisester aller heidnischen Könige“, sagte der Meister und stand auf. „Da ich dich als Erster hier gefunden habe und mein Recht auf deinen Reichtum auf diesen Umstand stütze, werde ich ihn auf eine Weise verwenden, die dem Herrn, dem Gott Salomos, gefällt. Wahrlich, wahrlich, es gibt keinen Gott außer seinem Gott!“
Das war also die Angelegenheit, die den Mann zum Grab des Königs geführt hatte, dessen Ruhm darin bestand, ein Freund Salomos gewesen zu sein. Wenn wir darüber nachdenken, wird uns klar, wie groß der Ruhm des Letzteren war, und es ist nicht mehr verwunderlich, dass seine Zeitgenossen, selbst die königlichen, neidisch auf seine Liebe waren.
Wir kennen nicht nur die Angelegenheit des Mannes, sondern auch ihr Ausgang, und nach der Zufriedenheit zu urteilen, die sich auf seinem Gesicht abzeichnete, als er die Lampe hob und sich zum Gehen wandte, muss das Ergebnis seinen besten Hoffnungen entsprochen haben. Er zog sein Gewand aus und warf es seinen Sklaven zu; dann legte er eine Hand auf den Rand des Sarkophags, um herauszuklettern. In diesem Moment, als er einen letzten Blick um sich warf, fiel sein Blick auf einen glatt geschliffenen Smaragd, der größer war als eine ausgewachsene Granatapfel und lose auf dem Boden lag. Er drehte sich um, hob ihn auf und untersuchte ihn sorgfältig; dabei fiel sein Blick auf das Schwert, das fast zu seinen Füßen lag. Das Funkeln der Brillanten und das Feuer des großen Rubins im Griff zogen ihn unwiderstehlich an, und er blieb stehen und überlegte.
Dann sagte er leise:
„Seitdem war niemand mehr hier“ –
Er zögerte, blickte sich hastig um, um sich wieder zu vergewissern, dass ihn niemand hören konnte, und beendete dann den Satz:
„Niemand war hier, seit ich vor tausend Jahren hierherkam.“
Bei diesen Worten, die so seltsam waren und sich mit keiner Naturtheorie und keiner allgemeinen Erfahrung erklären ließen, zitterte die Lampe in seiner Hand. Unwillkürlich schreckte er vor diesem Eingeständnis zurück, wenn auch nur vor sich selbst. Aber dann fasste er sich wieder und wiederholte:
„Seit ich vor tausend Jahren hierherkam.“
Dann fügte er entschlossener hinzu:
„Aber die Erde und das Meer geben immer ihre Geheimnisse preis. So sagt der gute König Hiram; und da ich ein Zeuge bin, der die Weisheit dieser Worte beweist, muss ich ihm zumindest glauben. Deshalb muss ich mich so verhalten, als würde mir bald ein anderer folgen. Das Wort des Königs ist eine Anweisung.“
Damit drehte er das glänzende Schwert bewundernd hin und her. Da er es nur ungern hergeben wollte, zog er die Klinge teilweise aus der Scheide, und ihre Klarheit hatte die Tiefe, die dem Himmel zwischen den Sternen in der Nacht eigen ist.
„Gibt es irgendetwas, das man dafür nicht kaufen kann?“, fuhr er nachdenklich fort. „Welcher König könnte ein Schwert ablehnen, das einst Salomo gehörte? Ich werde es nehmen.“
Daraufhin reichte er den Sklaven sowohl den Smaragd als auch das Schwert und schloss sich ihnen an.
Die Überzeugung, die er noch einen Moment zuvor geäußert hatte, dass ihm ein anderer zum Grab des verehrten Tyrianers folgen würde, war nicht stark genug, um den Meister davon abzuhalten, alle Spuren zu verwischen, die zu seiner Entdeckung führen könnten. Der Neger setzte auf seine Anweisung den Deckel wieder genau an seinen früheren Platz auf dem Sarkophag, den Smaragd und das Schwert wickelte er in sein Gewand, die Säcke und Werkzeuge wurden gezählt und zur leichteren Beförderung unter den Sklaven verteilt. Mit der Lampe in der Hand ging er noch einmal umher, um sich zu vergewissern, dass nichts zurückblieb. Nebenbei musterte er sogar die braunen Wände und die dunkle Kuppel über ihm. Als er sich vergewissert hatte, dass alles in seinem früheren Zustand war, winkte er mit der Hand und warf einen letzten langen Blick zurück auf das Modell, das in seiner strahlend weißen Transparenz gespenstisch schön war. Dann ging er voraus zum Eingang und ließ den König in seiner Einsamkeit und seinem würdevollen Schlaf zurück, ohne sich der Störung und der Plünderung bewusst zu sein.
Draußen im großen Empfangsraum hielt er wieder inne, um die Wand wiederherzustellen. Beginnend mit dem unbedeutenden Schlüssel, wurden nacheinander die Steine, von denen er, wie wir gesehen haben, jeweils die Nummern notiert hatte, angehoben und wieder eingesetzt. Dann wurden Handvoll Staub gesammelt und in die kleinen Spalten geblasen, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Der letzte Schritt war die Wiederherstellung des Sarkophags; damit war die Galerie, die zum eigentlichen Grabgewölbe des Königs führte, wieder wirksam verborgen.
„Wer ihm folgt, egal ob früh oder spät, muss mehr als scharfe Augen haben, wenn er eine Audienz bei Hiram, meinem königlichen Freund aus Tyrus, erhalten will“, sagte der Abenteurer nachdenklich, während er gleichzeitig in den Falten seines Gewandes nach der Karte suchte, die auf dem Schiff Gegenstand seiner Sorge gewesen war. Die Schriftrolle, der Smaragd und das Schwert waren ebenfalls in Sicherheit. Er gab den Sklaven ein Zeichen, zu bleiben, wo sie waren, ging langsam durch den Raum und untersuchte mit Hilfe seiner Lampe eine Öffnung, die so breit und hoch war, dass sie eher an ein Tor als an eine Tür erinnerte.
„Es ist gut“, sagte er lächelnd. „Der Beutejäger wird auch in Zukunft diesen Weg nehmen statt den anderen.“
Die Bemerkung war schlau. Wahrscheinlich hatte nichts so sehr zur langen Verborgenheit des Ganges beigetragen, der gerade zum zweiten Mal in tausend Jahren wieder verschlossen worden war, wie die hohe Türöffnung, die zu den dahinter liegenden Räumen einlud, die nun alle in ikonoklastischer Unordnung waren.
Er kehrte zu seinen Arbeitern zurück, nahm einem von ihnen ein Messer vom Gürtel und schnitt einen Schlitz in die Öffnung, der groß genug war, um die Säcke mit den Edelsteinen hindurchzustecken. Die Haut war geräumig und nahm sie auf, wenn auch unter Verlust eines Großteils des Wassers. Nachdem er diesen Teil der Beute so verstaut hatte, dass er sich sowohl gut transportieren als auch verstecken ließ, half er dem Neger, ihn sicher auf die Schulter zu schwingen, und führte ihn ohne weitere Verzögerung aus der Kammer ins Freie, wo die Lampen gelöscht waren.
Die reine, süße Luft war, wie man sich vorstellen kann, für alle eine Wohltat. Während die Sklaven an den Tribünen standen und die gesunde Luft einatmeten, studierte der Herr die Sterne und sah, dass die Nacht noch nicht so weit fortgeschritten war, dass sie es mit etwas Eile noch rechtzeitig zum Schiff schaffen konnten.
Immer noch darauf bedacht, den Weg zum Grab so gut wie möglich zu verbergen, wartete er, während die Männer den Eingang wie zuvor mit Steinen aus dem Ufer bedeckten. Ein letzter Blick auf die Felswand, so genau, wie es das Sternenlicht zuließ, versicherte ihn, dass der Schatz, was den Rest der Welt betraf, noch weitere tausend Jahre, wenn nicht sogar für immer, ungestört bei seinem alten Besitzer bleiben könnte. Danach stieg er in feierlicher Stimmung den Berghang hinab zum Biwakplatz und gelangte von dort rechtzeitig und ohne Zwischenfälle zum Landeplatz am Meer. Dort watete der Neger weit hinaus und warf die Werkzeuge ins Wasser.
Zur vereinbarten Zeit kam die Galeere aus der Stadt und verschwand mit der Mannschaft unter dem Antrieb der Ruder die Küste hinauf in Richtung Norden.
Der Neger rollte die Matratze auf dem Deck aus und brachte etwas Brot, Smyrna-Feigen und Wein aus Prinkipo, und die vier aßen und tranken ausgiebig.
Dann wurde der Schiffsführer gerufen.
„Du hast das gut gemacht, mein Freund“, sagte der Kapitän. „Spar jetzt weder Segel noch Ruder, sondern fahr nach Byzanz, ohne in irgendeinen Hafen einzulaufen. Ich werde deinen Lohn entsprechend der Zeit, die du sparst, erhöhen. Kümmere dich darum – los – und beeile dich.“
Danach hielten die Sklaven abwechselnd Wache, während er schlief. Und obwohl die Seeleute häufig kamen und gingen, bemerkte keiner von ihnen den ölverschmierten Wasserschlauch, der achtlos neben dem Kopfkissen des Kapitäns lag, oder den zotteligen Halbumhang des Negers, der als Hülle für die Rolle, den Smaragd und das Schwert Salomos diente.
Die Fahrt der Galeere aus der namenlosen Bucht bei Sidon verlief ohne Unterbrechung und ohne nennenswerten Gegenwind. Über dem Deck war immer blauer Himmel, und unter ihnen lag das blaue Meer. Tagsüber hielt der Kapitän gelegentlich auf seinem Gang entlang der weißen Planken inne, stützte sich mit der Hand auf die Reling und blickte auf einige der Landmarken, die das alte Kykladenmeer säumten, hier eine Insel, dort ein hoher Landvorsprung des Festlandes, vielleicht eine olympische Höhe, die in der Ferne grau schimmerte. Sein Verhalten in solchen Momenten deutete nicht auf einen Reisenden hin, der neu auf dieser Strecke war. Ein Blick auf die Punkte, wie ihn Geschäftsleute werfen, die unter Zeitdruck stehen, um die Minuten auf der Uhr zu bestimmen, und schon setzte er seinen Spaziergang fort. Nachts schlief er tief und fest.
Von den Dardanellen in den Hellespont, dann in den Marmarameer. Der Kapitän hätte die Küste entlangfahren wollen, aber der Passagier bat ihn, auf offener See zu bleiben. „Das Wetter ist nicht zu befürchten“, sagte er, „aber wir können Zeit sparen.“
An einem Nachmittag sichteten sie die großen Felsen Oxia und Plati; der erste war kahl wie ein graues Ei und kegelförmig wie eine unregelmäßige Pyramide, der andere war oben flach und mit Grün und vereinzelten Bäumen bewachsen. Ein Blick auf die Karte zeigte ihnen, dass es sich um die westlichste Gruppe der Prinzeninseln handelte.
Nun ist die Natur manchmal dumm, manchmal launisch und tut unerklärliche Dinge. Wer von einem sanft schaukelnden Kajak aus ein Stück weit draußen auf dem Meer die anderen Inseln der Gruppe betrachtet, ahnt sofort, dass sie als Sommerquartiere gedacht waren, aber diese beiden, Oxia und Plati, die abseits liegen, im Winter kahl und in den heißen Monaten scheinbar immer bereit zur Selbstentzündung – wozu waren sie gedacht? Egal – man hat eine Verwendung für sie gefunden – eine passende Verwendung. Einsiedler auf der Suche nach den härtesten und trostlosesten Orten wählten Oxia aus, pickten Löcher und Höhlen in seine Flanken und teilten sich die mühsam gewonnenen Behausungen mit Kormoranen, den gefräßigsten Vögeln. Mit der Zeit wurde in der Nähe des Gipfels ein einfaches Kloster gebaut. Auf der anderen Seite wurde Plati in eine Hölle für Verbrecher verwandelt, und in den dortigen Fässern und Verliesen verbrachten die Menschen ihr Leben damit, um ihre Freiheit zu weinen. Auf dieser Insel Tränen und Flüche, auf jener Tränen und Gebete.
Bei Sonnenuntergang ruderte die Galeere zwischen Oxia und der europäischen Küste, etwa dort, wo heute St. Stephano liegt. Die Kuppel der Hagia Sophia war zu sehen; dahinter, in einer Linie nach Nordwesten, ragte der Turm von Galata empor. „Heim bei Lampenlicht – Gesegnet sei die Jungfrau!“, sagten die Seeleute fromm zueinander. Aber nein! Der Passagier mit dem höchsten Ansehen ließ den Kapitän rufen.
„Ich möchte nicht vor dem Morgen in den Hafen einlaufen. Die Nacht ist herrlich, und ich werde es mit dem kleinen Boot versuchen. Ich war einst Ruderer und habe noch immer Lust zu rudern. Leg hier in der Nähe ab und an. Bring zwei Lampen am Mastkopf an, damit ich dein Schiff erkennen kann, wenn ich zurückkehren möchte. Nun hol das Boot heraus.“
Der Kapitän fand den Geschmack seines Passagiers seltsam, tat aber, wie ihm geheißen. Nach kurzer Zeit legte das Boot – wenn man dieses vertraute Wort verzeihen mag – mit dem Neger und seinem Herrn, der ruderte, ab.
Zur Vorbereitung der Fahrt wurden der halb mit Wasser gefüllte Krug und der Schafsfellmantel des Schwarzen in das kleine Boot hinabgelassen. Das Boot entfernte sich in Richtung Prinkipo, der Mutterinsel der Gruppe, und als die Nacht hereinbrach, verschwand es aus dem Blickfeld.
Als sie vom Deck der Galeere nicht mehr zu sehen waren, übergab der Kapitän das Ruder dem Neger, setzte sich ans Ruder und änderte den Kurs nach Südosten. Danach fuhr er weiter, bis Plati direkt vor ihnen lag.
Die südliche Spitze von Plati bildet eine ziemlich steile Klippe. Vor langer Zeit war dort ein Steinturm gebaut worden, der den Wachen als Aussichtspunkt und Unterschlupf diente. Da es für Gefangene keine Möglichkeit gab, zu entkommen, so sicher waren sie eingemauert, musste die Aufgabe darin bestanden haben, Räuber vom Festland im Osten und Piraten im Allgemeinen abzuwehren. Unter dem Turm befand sich ein Aufstieg, der für die meisten Menschen selbst bei Tageslicht schwierig war, und angesichts der Manöver des Bootes war dieser Aufstieg offensichtlich das Ziel des Kapitäns. Schließlich fand er ihn und stieg auf einen abfallenden Felsen. Der Gurglet und der Mantel wurden ihm gereicht, und bald tasteten er und sein Begleiter sich nach oben.
Auf dem Gipfel ging der Häuptling einmal um den Turm herum, der jetzt nur noch eine Ruine war, ein formloses Gerüst, an einigen Stellen mit kranken Reben bewachsen. Er kehrte zu seinem Begleiter zurück, blieb einen Moment stehen, um den Krug gründlich auszutrinken, und kroch dann auf Händen und Knien in einen Durchgang, der stark mit Trümmern verstopft war. Der Neger wartete draußen.
Der Meister machte zwei Gänge; beim ersten nahm er die Wasserflasche mit, beim zweiten den Mantel, in den das Schwert gewickelt war. Am Ende rieb er sich selbstzufrieden die Hände.
„Sie sind in Sicherheit – die Edelsteine Hirams und das Schwert Salomos! Ich habe noch drei weitere Lagerstätten wie diese – in Indien, in Ägypten, in Jerusalem – und dann ist da noch das Grab bei Sidon. Oh, mir wird es nie an etwas mangeln!“, und er lachte zufrieden.
Der Abstieg zum kleinen Boot verlief ohne Zwischenfälle.
Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang gingen die Passagiere in Port St. Peter an der Südseite des Goldenen Horns an Land. Wenig später ruhte sich der Kapitän zu Hause in Byzanz aus.
Innerhalb von drei Tagen hatte der geheimnisvolle Mann, den wir, da wir seinen richtigen Namen und Titel nicht kannten, den Kapitän nannten, sein Haus und seinen Hausrat verkauft. In der Nacht des siebten Tages ging er mit seinen Dienern, die alle taubstumm waren, an Bord eines Schiffes und verschwand auf dem Marmora, ohne dass jemand außer ihm selbst wusste, wohin er fuhr.
Der Besuch am Grab des königlichen Freundes Salomos hatte offensichtlich dazu gedient, die Reise vorzubereiten, und dass er Edelsteine Gold und Silber vorzog, bedeutete, dass die Reise zeitlich und örtlich unbestimmt war.
Buch II. Der Prinz von Indien
Kapitel I. Ein Bote aus Cipango
Genau dreiundfünfzig Jahre nach der Reise zum Grab des syrischen Königs – genauer gesagt am fünfzehnten Tag des Monats Mai im Jahr vierzehnhundertachtundvierzig – betrat ein Mann einen der Stände auf einem Markt in Konstantinopel – heute würde man diesen Markt als Basar bezeichnen – und überreichte dem Besitzer einen Brief.
Der so geehrte Israelit zögerte, den Leinenumschlag zu öffnen, während er den Boten musterte. Diese Freiheit war, wie man anmerken muss, in der großen Stadt, deren Kosmopolitismus seit langem etabliert war, nicht üblich; das heißt, ein Gesicht, eine Figur oder eine Art, die einen zweiten Blick von einem ihrer Bewohner auf sich zog, musste damals wie heute äußerst fremdartig sein. In diesem Fall starrte der Besitzer des Standes den Boten regelrecht an. Er hatte, wie er meinte, Vertreter aller bekannten Nationalitäten gesehen, aber noch nie einen wie den jetzigen Besucher – noch nie einen mit so rosiger Hautfarbe und so schrägen Augen – noch nie einen, der sich so vollständig in einen einzigen Schal hüllte, dass dieser alle anderen für Männer üblichen Kleidungsstücke ersetzte. Letzteres fiel umso mehr auf, als ein brauner Seidensack lose über seiner Schulter hing, der vorne und an den Rändern mit auffälligen Stickereien aus Blättern und Blumen verziert war. Und dann waren die Pantoffeln aus ebenso reich bestickter Seide, während er über seinem bloßen Kopf einen bunt bemalten Sonnenschirm aus Bambus und Papier trug.
Zu gut erzogen, um ihn weiter anzustarren oder seine Neugier mit einer direkten Frage zu befriedigen, öffnete der Besitzer den Brief und begann ihn zu lesen. Seine Nachbarn, die weniger rücksichtsvoll waren, rannten herbei und bildeten eine Menschenmenge um den Fremden, der jedoch die Neugierde gelassen hinnahm und sich offenbar keiner Bewusstheit dessen bewusst war, was ihn so zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit machte.
Das Papier, das der Standbesitzer beim Öffnen des Umschlags in die Hand bekam, machte ihn noch neugieriger. Die zarte Beschaffenheit, die Weichheit beim Anfassen und die Halbtransparenz waren ihm völlig unbekannt; es war nicht nur fremd, sondern sehr fremd.
Die Schrift war jedoch eindeutig griechisch. Zuerst fiel ihm das Datum auf; dann wurde seine Neugierde unkontrollierbar, und da der Brief nur aus einem Blatt bestand, fiel sein Blick auf die Stelle der Unterschrift. Dort stand kein Name – nur ein Siegel – ein Abdruck auf gelbem Wachs, der die gebeugte Gestalt eines an ein Kreuz gebundenen Mannes zeigte.
Als er das Siegel sah, weiteten sich seine Augen. Er holte tief Luft, um ein aufkommendes Gefühl zu unterdrücken, das halb Erstaunen, halb Ehrfurcht war. Er zog sich auf eine Bank in der Nähe zurück, setzte sich und vergaß den Boten, die Menge, ja alles außer dem Brief und dem, worum es darin ging.
Die Forderung des Lesers, das Papier zu sehen, das eine solche Wirkung auf einen gewöhnlichen Händler auf einem orientalischen Markt hatte, dürfte inzwischen dringlich geworden sein; daher wird es hier in freier Übersetzung wiedergegeben. Nur das Datum wurde modernisiert.
„INSEL IN DER ÜBERSEE. FERNER OSTEN. , 15. Mai 1447 n. Chr.
„Uel, Sohn des Jahdai.
„Friede sei mit dir und allen deinen!
Wenn du die Erbstücke deiner Vorfahren treu bewahrt hast, findest du irgendwo in deinem Haus ein Duplikat des Siegels, das du hier beigefügt findest; nur dass dieses in Gold ausgeführt ist. Der Verweis soll dir eine Sache beweisen, die ich dir gerne bestätige, da ich weiß, dass sie dich zumindest neugierig machen wird – ich kannte deinen Vater, deinen Großvater und dessen Vater und andere aus deiner Familie, die weiter zurückreichen, als es mir ratsam erscheint, zu erwähnen; und ich habe sie geliebt, denn sie waren ein tugendhaftes und gutes Geschlecht, das eifrig bemüht war, den Willen des Herrn, des Gottes Israels, zu tun, und keinen anderen anerkannte; darin zeigte sich die höchste menschliche Tugend. Da dies dich persönlich betrifft, möchte ich hinzufügen, dass Eigenschaften von Menschen, wie Eigenschaften von Pflanzen, vererbbar sind und, wenn sie über viele Generationen unvermischt weitergegeben werden, eine Art bilden. Deshalb kenne ich dich, obwohl ich dich noch nie gesehen, deine Hand noch nie berührt und deine Stimme noch nie gehört habe, und schenke dir mein Vertrauen. Der Sohn deines Vaters kann der Welt nicht sagen, was er von mir hier hat, oder dass es ein Wesen wie mich gibt, oder dass er auch nur im Geringsten mit mir zu tun hat; und so wie der Vater meine Bitten, auch die, die ich dir jetzt offenbare, gerne erfüllen würde, wird sein Sohn sie nicht weniger bereitwillig erfüllen. Eine Weigerung wäre der erste Schritt zum Verrat.
„Mit dieser Vorrede, oh Sohn Jahdai, schreibe ich ohne Furcht und frei und teile dir zunächst mit, dass es nun fünfzig Jahre her ist, seit ich den Fuß auf diese Insel gesetzt habe, die ich mangels eines dir bekannten Namens als “In der Übersee. Ferner Osten” bezeichnet habe.
„Die Menschen dort sind von Natur aus freundlich zu Fremden und leben einfach und liebevoll. Obwohl sie noch nie von dem Nazarener gehört haben, den die Welt beharrlich Christus nennt, kann man mit Fug und Recht sagen, dass sie seine Lehren besser verkörpern, insbesondere im Umgang miteinander, als die sogenannten Christen, unter denen du dein Los gefunden hast. Dennoch bin ich müde geworden, wobei die Schuld eher bei mir selbst als bei ihnen liegt. Der Wunsch nach Veränderung ist das universelle Gesetz. Nur Gott ist gestern, heute und morgen ewig derselbe. Deshalb habe ich mich entschlossen, noch einmal das Land unserer Väter und Jerusalem zu suchen, um das ich noch immer weine. In ihrer Vollkommenheit war sie mehr als schön, in ihrer Zerstörung ist sie mehr als heilig.
„Damit du weißt, wie ich vorhabe, schicke ich dir meinen Diener Syama, der dir diesen Brief übergeben soll. Wenn du ihn bekommst, merk dir den Tag und schau, ob es nicht genau ein Jahr nach dem 15. Mai ist, dem Tag, den ich ihm für die Reise gegeben habe, die mehr über das Meer als über Land führt. Dann wirst du wissen, dass ich ihm folge, wenn auch mit Unterbrechungen von unbestimmter Dauer, da ich von Indien nach Mekka reisen muss, von dort nach Kash-Cush und den Nil hinunter nach Kairo. Dennoch hoffe ich, dich innerhalb von sechs Monaten, nachdem Syama dir diesen Bericht überbracht hat, persönlich begrüßen zu können.
Dass ich einen Boten so früh schicke, hat einen Grund, den ich dir unbedingt mitteilen muss.
Ich habe vor, meinen Wohnsitz wieder in Konstantinopel zu nehmen; dafür brauche ich ein Haus. Syama hat unter anderem die Aufgabe, eines zu kaufen, einzurichten und für meine Ankunft vorzubereiten. Es ist schon lange her, dass ein Khan für mich attraktiv war. Viel angenehmer ist es, daran zu denken, dass sich meine eigene Tür sofort öffnet, wenn ich klopfe. In dieser Angelegenheit kannst du mir einen Dienst erweisen, der dir in Erinnerung bleiben und dankbar vergolten werden wird. Er hat keine Erfahrung mit Immobilien in deiner Stadt, du aber schon. Daher ist es nur natürlich, dass ich dich bitte, ihm bei der Auswahl, der Klärung der Eigentumsverhältnisse und allem anderen, was für dieses Vorhaben erforderlich ist, behilflich zu sein. Achte dabei nur darauf, dass das Haus schlicht und komfortabel ist, nicht aber luxuriös, denn leider ist die Zeit noch nicht gekommen, in der die Kinder Israels vor den Augen der christlichen Welt auffällig leben können.
Du wirst Syama als klug und urteilsfähig erleben, älter, als er aussieht, und schnell bereit, mir um meinetwillen Loyalität zu erweisen. Sei auch darauf hingewiesen, dass er taubstumm ist; wenn du ihm jedoch beim Sprechen dein Gesicht zuwendest und griechisch sprichst, wird er dich an deinen Lippenbewegungen verstehen und dir mit Zeichen antworten.
„Schließlich, fürchte dich nicht, diesen Auftrag wegen der finanziellen Beteiligung anzunehmen. Syama hat die Mittel, sich alles Geld zu beschaffen, das er benötigt, sogar bis zur Verschwendung; gleichzeitig ist es ihm verboten, Schulden zu machen, außer dir für deine Freundlichkeit, die er mir melden wird, damit ich sie angemessen begleichen kann.
„In allen wichtigen Dingen hat Syama genaue Anweisungen erhalten; außerdem ist er mit meinen Gewohnheiten und Vorlieben vertraut; daher schließe ich dieses Schreiben mit dem Wunsch, dass du ihm die angegebene Hilfe leistest und dass du mir, wenn ich komme, erlaubst, mich dir als Vater zu einem Sohn zu verhalten, in allen Dingen eine Hilfe, in nichts eine Last.
Wieder, o Sohn Jahdais, dir und den Deinen – Friede!“
(Siegel.)
Der Sohn Jahdais ließ nach Beendigung der Lektüre seine Hände schwer in den Schoß sinken und vertiefte sich in ein Studium, von dem der Bote mit seiner fremdländischen Ausstrahlung ihn nicht ablenken konnte.
Große Entfernung ist eine der erhabensten Kräfte, die die Vorstellungskraft am stärksten anregen. Der Brief kam von einer Insel, deren Namen er noch nie gehört hatte. Eine Insel in der Übersee, die zweifellos das östliche Ende der Erde umspülte, wo auch immer das sein mochte. Und der Verfasser! Wie war er dorthin gekommen? Und was hatte ihn dazu getrieben?
Ein Schauer durchzuckte den Denker. Plötzlich fiel ihm ein, dass es in seinem Haus einen Wandschrank gab, in dem zwei Regale für die Aufbewahrung von Erbstücken standen; auf dem oberen Regal lag die Thora, die seit undenklichen Zeiten in seiner Familie verwendet wurde; das zweite enthielt Becher aus Horn und Metall, alte Phylakterien, Amulette und Kunstgegenstände im Allgemeinen, die im Laufe der Jahrhunderte so zahlreich geworden waren, dass er selbst keine Liste davon erstellen konnte; Tatsächlich erinnerte er sich jetzt, da seine Aufmerksamkeit geweckt war, an eine Ansammlung farbloser und formloser Gegenstände, die keine Geschichte und keinen Wert mehr hatten. Unter ihnen fiel ihm jedoch ein Siegel in Form eines goldenen Medaillons ein; aber ob der Abdruck darauf erhaben oder vertieft war, konnte er nicht mit Sicherheit sagen; ebenso wenig konnte er sagen, was das Motiv darstellte. Sein Vater und sein Großvater hatten es sehr geschätzt, und die Geschichte, die sie ihm darüber erzählt hatten, als er noch ein Kind war und auf ihren Knien saß, konnte er ziemlich genau wiedergeben.
Ein Mann hatte Jesus , den angeblichen Christus, beleidigt , der