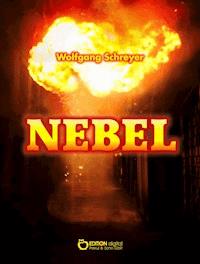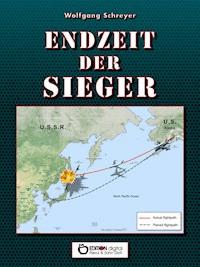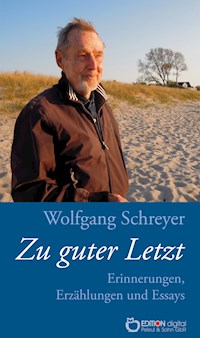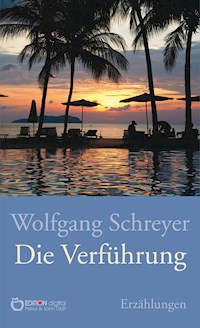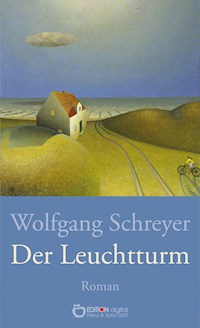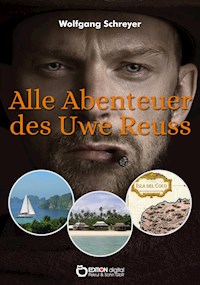8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dominikanische Tragödie
- Sprache: Deutsch
Santo Domingo, April 1965: Drückende Stille über der Insel. Noch vor John F. Kennedys Ermordung ist hier sein demokratischer Versuch gescheitert. Ein Militärputsch hat das „Schaufenster" zerstört. Als hätte es weder Trujillos 30-jährige Schreckensherrschaft noch die sieben Monate des Sozialreformers Juan Bosch gegeben, herrscht die alte Oberschicht — gedeckt von konservativen US-Beamten und Wirtschaftsmächten... Da erhebt sich mit der Garnison plötzlich das Volk in der Hauptstadt. Bürgerkrieg! Und niemand — kein Diplomat, kein Geheimdienstler, kein Reporter — hat das kommen sehen. Der Aufstand greift auf das Hinterland über. Präsident Johnson will ihn unter dem Vorwand, eigene Bürger zu retten, mit zwei Divisionen schlagartig ersticken. „Was richten wir denn in Vietnam aus", fragt er seinen Krisenstab, „wenn wir nicht mal klar Schiff machen können in der Dominikanischen Republik?" So entbrennt, in der ältesten Stadt Amerikas, die Schlacht um den Weg einer formell freien Nation — vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Denn in vier Monaten Bürgerkrieg wird dies immer mehr ein Kampf der Meinungen und der Berichte, geführt von den Massenmedien vieler Länder, die ihre Vertreter entsenden. Dies ist die Geschichte eines nordamerikanischen Auslandskorrespondenten. Mit all seinen Lebensproblemen — und der karrierelüsternen Gefährtin — findet er sich jäh im Hexenkessel wieder, an der Nachrichtenfront des Kriegsschauplatzes Nummer eins. Dort trifft er Menschen aller Schichten und politischen Schattierungen, um aus ihren Worten und Taten ein Mosaik der Wahrheit zu gewinnen... Menschen, die der Belastung gewachsen sind, und solche, die daran zugrunde gehen, körperlich und seelisch. Und auch er selber, nicht sehr gesund, scheint mehr als einmal zu erliegen: dem Zwang zum Erfolg, dem Tempodruck, den Versuchungen und schließlich Drohungen beruflicher, ja physischer Vernichtung. Hier, vor dem Hintergrund eines gut dokumentierten Vorgangs von weltpolitischem Rang, wirft Wolfgang Schreyer Fragen journalistischer Arbeitsweise wieder auf, die schon im Zentrum seines Romans „Tempel des Satans" standen. Wie weit reichen Mut, Ehrlichkeit und Zivilcourage des Einzelnen? Kann er sich gegen die Mächtigen behaupten? Es ist zugleich Schreyers Thema: das der Verantwortung des Schriftstellers. Gestützt auf Memoirenwerke, Augenzeugenberichte und eigene Interviews schrieb er dieses Buch vor allem aus innerer Erfahrung. Teil 3 der Dominikanischen Tragödie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Reporter
Die dominikanische Tragödie, 3. Band
ISBN 978-3-86394-106-2 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1980 beim Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erstes Kapitel
1
David Varela lag noch im Bett, als der Anruf kam. In letzter Zeit raffte er sich nur schwer dazu auf, pünktlich anzufangen. Auch war es ein Sonnabend, er hatte nicht viel vor – Pause zwischen zwei Einsätzen, wie Norton forsch zu sagen pflegte. Er wollte nur eben an seinem Buch weiter schreiben, üblicher Freizeitjob eines Washingtoner Korrespondenten, das gab einem immerhin das Gefühl, tätig zu sein; später mit Penny hinaus ins Grüne. Sie machte sich zwar nichts daraus, doch er brauchte einfach ein bisschen Bewegung.
Dieser Tag, er sah es schon, brachte Unannehmlichkeiten. Ein zerrissener Himmel, aus dem es abwechselnd strahlte und troff – Pennys Verbündeter in ihrem Drang, irgendwelche Leute zu besuchen, anstatt am Flussufer zu wandern. Und nun noch dieser Anruf, Nortons Stimme, kaum zu verstehen, wo war der eigentlich, in London oder in Saigon? Aber nein, er sprach aus New York. "Hören Sie keine Nachrichten?", fragte der Chef durch das Rauschen in der Leitung. "Putsch in Santo Domingo... Prüfen Sie das nach, David, werden Sie mal aktiv."
Varela stand auf. Irgendwo musste er anrufen, am besten im State Department, dabei ödete es ihn von vornherein an. Solche Dinge hatten ihm nie etwas bedeutet. Revolte da unten auf dem Subkontinent, Gott, das gab es, die Versuche mitgezählt, monatlich zweimal. Aber leider war er, hauptsächlich dank seines Namens, Nortons Fachmann für diese Sphäre. Letztes Jahr hatte er in Rio das Glück gehabt, zufällig da zu sein, als das Militär sein Ding abzog; und diesen Februar hatte er in Portugal nach dem verschwundenen General Delgado geforscht. Spezialist für Affären im spanisch-portugiesischen Sprachraum, obwohl er keine der beiden Sprachen völlig beherrschte, bis auf die tausend Worte, die man brauchte, um zu reisen und im Hotel zu leben.
Die Telefonzentrale des Außenministeriums schien unterbesetzt. Während er auf die Verbindung wartete, fiel sein Blick auf das Datum: 24. April 1965. Er hatte vorhin ausgerechnet, dass für ihn selber der 12. September war, nach den Regeln dieses Spiels. Es wurde zwar oft behauptet, man könne das Leben nicht in Phasen einteilen, Varela aber fand es nützlich. Er befasste sich gern mit Vergangenem, nichts fesselte so wie der Ablauf des eigenen Lebens; je älter man wurde, desto lohnender der Rückblick. Er hob auch die Dokumente auf, Schulzeugnisse, Fotos, Artikel und Briefe, Andenken jeder Art, doch das hielt er verschlossen, sah es niemals durch – aus Furcht wohl, wovor? Furcht, Zeit zu verlieren, depressiv zu werden, sich selbst zu erkennen? Nun, über sich wusste er Bescheid, viel war nie mit ihm los gewesen, ein höchst durchschnittliches Leben. Wenn er es also in Abschnitte von je sechs Jahren teilte und so weit ging, anzunehmen, dass er zweiundsiebzig werden würde, dann ließ sich das Leben leicht auf ein Jahr projizieren, geboren am 1. Januar, sechs Jahre immer ein Monat, Silvester der Schluss – er war fünfzig, das entsprach dem 12. September.
Die Telefonistin fragte, ob er die Presseabteilung wolle, der dominicanische Schreibtisch sei nicht erreichbar. Varela sagte ja, er hasste es, in solcher Stimmung zu telefonieren, er erreichte dann nie, was er wollte. Ließ man übrigens das Leben auf einen Tag zusammenschrumpfen, war's bei ihm fünf Uhr nachmittags, da kamen noch ganz schöne Stunden. (Für Penny allerdings – erst Anfang Mai oder acht Uhr morgens.) Das setzte natürlich voraus, dass er tatsächlich zweiundsiebzig wurde, nicht etwa bloß sechzig; in dem Fall wäre es schon Anfang November, kein sympathischer Befund. All dies wurde nur dadurch erträglich, dass er nicht wusste, ob es erst September oder schon November war.
"Ja, es riecht nach Putschversuch", hörte er nun den Pressesprecher sagen. "Meuterei in zwei Kasernen, kommt eben über eine private Radiostation dort unten. Sie hat auch den Sturz der Regierung verkündet, aber die sitzt fest im Sattel, stellt den Rebellen im Staatsrundfunk ein Ultimatum, es läuft um fünf Uhr nachmittags ab. Danach wissen wir mehr; vermutlich ist dies schon das Ende."
"Was sagt unsere Botschaft?"
"Wenig. Ein Routinefall. Unbedeutende Sache... Wenn Sie mich fragen, David, es lohnt sich für keinen Reporter, das Wochenende dranzugeben für einen Trip nach Santo Domingo."
"Ist der Flugplatz denn offen?"
"Selbstverständlich..."
Das war's also; Varela legte auf. Blinder Alarm, Gott sei Dank. Er nahm das Manuskript heraus, seine Recherchen, die Suche nach dem Phänomen Delgado – das, was er nicht hatte loswerden können, weil es der Presse zu ausführlich war. Und daraus nun ein Buch, das kein Verleger nahm, Aufstieg und Fall des Humberto Delgado, wer kaufte so was schon, wen interessierte das – im Augenblick nicht mal ihn selber. Er hätte den Text eben liefern müssen, bevor der Name aus den Schlagzeilen war, aber wer schaffte das heute noch? Anatomie eines Verbrechens, als Untertitel auch nicht gerade neu. "Zwei Irrtümer begründeten seinen Wahlerfolg: die Annahme, dass Delgado als aktiver und jüngster General über Rückhalt in der Armee verfügte, und die Vermutung, er sei ein Favorit Washingtons, weil er hier Militärattaché gewesen war."
Der nächsten Nachrichten wegen schaltete Varela das Fernsehen ein. Er musste sich warm lesen, um schreiben zu können, doch, wie so oft in letzter Zeit, erwärmte ihn sein Text nicht. Auf der letzten Seite stand: "Obwohl nach offiziellen (unüberprüfbaren) Angaben nur 25 Prozent der Stimmen auf ihn entfielen, wurde Delgado für Salazar gefährlich. Totalitäre Regierungen sind nicht elastisch genug, sich eine kontrollierte Opposition zu leisten, sie kennen letztlich nur ein Machtmittel, die Gewalt. Delgado wurde aus der Luftfahrtdirektion entlassen, vom Militärdienst suspendiert und seines Generalsrangs entkleidet. Von Spitzeln umringt, die sich ihm bald offen zeigten und den impulsiven Mann provozierten..."
Varela verlor den Faden, seine Gedanken schweiften zu Penny. Wie immer fragte er sich, wo sie gerade sein mochte, was sie dort tat und mit wem. Ja, er fing an, unter Zwangsvorstellungen zu leiden. Weshalb wohl weigerte sie sich, zu ihm zu ziehen? Ihre Unabhängigkeit, das verstand er, obschon hier Platz genug war für zwei; aber ein Drittel ihres Gehalts ging für die kleine Wohnung drauf, und was hatte sie davon? In gewisser Weise machte sie ihn krank. Tatsächlich, er fühlte sich kaum noch durch andere Frauen versucht, seine Phantasie beschäftigte sich einzig mit ihr. Er konnte sie wirklich nur vergessen, wenn sie bei ihm war, sich nur beruhigen, indem er sie berührte; und das hatte es noch nie gegeben. Ein weiteres schlechtes Zeichen: die Arbeit reizte ihn nicht mehr. Die Welt sah trübe aus. Nein, es gab nicht mehr viel zu erhoffen.
Außerdem goss es, Wasser schlug an die Scheiben, stürzte durchs Regenrohr. Kampfflugzeuge vom Typ "Thunderchief", so wurde gemeldet, hätten die Ham-Rong-Brücke bombardiert, hundert Kilometer südlich von Hanoi, sowie die Radarstation Vinh Linh zerstört. Auf Hawaii habe Verteidigungsminister McNamara die Beratung mit dem Saigon-Botschafter General Taylor und dem Oberbefehlshaber Pazifik Admiral Grant Sharp beendet. In Santo Domingo stehe ein Putschversuch rechtsgerichteter Militärs vermutlich vor dem Zusammenbruch. Bei Bajadoz, nahe der Grenze zu Portugal, seien heute nach Angaben der spanischen Polizei die Leichen von Humberto Delgado und dessen brasilianischer Sekretärin von zwei Kindern entdeckt worden... Das hätte Varela elektrisieren müssen, er begriff, es bestätigte seine Entführungsthese, wertete das Manuskript erheblich auf, zwang zum Weiterschreiben. Doch eben dieser Zwang war ihm jetzt nur lästig.
Delgado verscharrt, der Biograph hockt träge da... Nun, er kannte seine Schwierigkeiten, oder doch eine davon, ganz gut. Von ihm wurde erwartet, dass er in jedem Sachverhalt die Story sah, den menschlichen Aspekt. Es musste immer um Menschen gehen, um Männer meistens, denn die machten Geschichte. Das aber hieß, Entwicklungen als Schicksale zu schildern, den Niedergang des US-Freunds Salazar etwa als Ministeraffären mit Minderjährigen ("Rosa Ballett") oder als Tragödie eines Don Quichote wie Delgado. Die Story sollte verblüffen, als serviere man dem Leser in Madeirasoße einen Schuh. Nortons Rezept! Das hatte den groß gemacht, zum Enthüllungsjournalisten Nummer eins, zum Korruptionsschnüffler mit tiefem Einblick in Vorgänge der hohen Politik; an die tausend Zeitungen druckten sein Zeug nach, Radio- und Fernsehstationen kauften es auf. Am Anfang seiner Karriere war der Chef sich nicht zu schade gewesen, Edgar Hoovers Mülltonne eigenhändig zu durchwühlen, bis er Tabletten gegen Blähungen fand: das Land habe ein Recht, zu erfahren, dass der FBI-Direktor an Verdauungsstörungen leide, was natürlich die Amtsführung vergiften könne... Und heute gefürchteter Kolumnist, Chef eines zwanzigköpfigen Enthüllungsteams – und er, Varela, im Hinblick aufs Ausland die rechte Hand.
Als er Penny anrief, merkte er, dass sie alles gehört und auch schon gegessen hatte. Nein, sie wolle nicht mit ihm nach Triangle fahren, in den nassen Wald am Potomac, sie erwarte ihn lieber vorm Außenministerium: könnten sie es sich leisten, dreißig Meilen vor der Stadt etwas zu verpassen, das dem Büro wichtig war? Das Ding sei doch tot, sagte er, aber sie hatte schon aufgelegt. Varela grinste ein bisschen. Unmerklich nahm sie die Gewohnheit an, für ihn zu denken; es machte ihm nichts aus, er war schlau genug, es zu übersehen. Anfangs hatte er geglaubt, dass es eine rein körperliche Bindung sei, die er jederzeit beenden könne. Zwei gescheiterte Ehen hatten ihn gelehrt, wie wichtig es war, innerlich unbeteiligt zu bleiben. Es gab nur ein Problem: Penny führte das Leben einer unabhängigen Frau zwischen Arbeit, Einsamkeit und undurchschaubaren Kontakten zu wechselnden Männern – jüngeren als er; und natürlich endete es damit, dass er sich ärgerte und immer heftiger engagierte.
Sie stand vor der hellen, sechsstöckigen Riesenfront voll im Licht, ein Punkt von kühler Frische, funkelnde Tropfen auf dem Regenhut. Nach ein paar Sonnentagen sah sie blendend aus, unschuldig und lieb, verletzlich und resolut. Sachlichkeit war keine zweite Haut, die sie überstreifte, sondern ihre Natur. Und diese seltsame Waffe hatte sie dazu benutzt, Varela (an der Presseabteilung vorbei) ein Gespräch mit dem Sachbearbeiter für Santo Domingo zu verschaffen, einem netten Burschen namens Bernon Holland. Der Apparat, sagte sie, laufe nur mit halber Kraft, Mr. Holland aber erwarte ihn.
"Wozu?", fragte er. "Die Sache stirbt doch schon."
"Holland ist anderer Meinung."
"Vielleicht langweilt er sich bloß da drin."
"Er hat mal die politische Abteilung unserer Botschaft dort geleitet, unter Botschafter Mitchell."
Sie fuhren hinauf in den dritten Stock, wo die Landesschreibtischmänner oder deren Vertreter Stallwache schoben für die abwesenden großen Tiere der oberen Etagen. Bernon Holland stellte klar, es sei, obwohl hier Militär gegen Zivilisten stehe, kein Rechtsputsch, sondern offenbar der Versuch, den vor anderthalb Jahren gestürzten Juan Bosch wieder ans Ruder zu bringen, der schließlich ein frei gewählter Präsident gewesen sei. Geschehen sei noch nichts, außer dass zwei Einheiten der Regierung Fonseca den Gehorsam aufgekündigt und irgendeinen General als Geisel genommen hätten. Die Rebellen ständen noch in der Kaserne, das Ultimatum der Regierung laufe in drei Stunden ab.
"In den Kasernen?", rief Penny. "Aber so putscht man doch nicht!"
"Dort möglicherweise schon." Auf Hollands sanftem Gesicht erschien das duldsame Lächeln des Eingeweihten. "Die Rundfunkmeldung vom Sturz der Regierung..."
"War absolut falsch."
"... ist nur die Eröffnung gewesen, der Fehdehandschuh. Menschen mit Phantasie versichern gern etwas, bevor es passiert ist – als Einladung an alle, es nun auch zu tun."
Wie vormittags am Telefon fragte Varela: "Was meint denn die Botschaft?"
"Die spielt das ein bisschen herunter; übrigens ist sie wohl ziemlich verwaist. Das Spitzenpersonal scheint auf einer Konferenz in Panama zu sein. Der Botschafter selber ist auch nicht da; wir erwarten ihn übermorgen hier."
"Und wo steckt er jetzt?"
"In Georgia. Er besucht seine Mutter."
"Das heißt, die Botschaft wurde überrascht?"
Um Hollands Mund lag wieder das Kennerlächeln. "Sie hat die allgemeine Unzufriedenheit sicher unterschätzt – wenn Sie so wollen, das revolutionäre Potential. Ein Großteil der Bevölkerung dürfte ja mit den Rebellen sympathisieren. Das Regime ist nicht populär, und zu allem übrigen leidet Santo Domingo seit Wochen unter Wassermangel; ein recht ernster Punkt."
Varela bedankte sich. "Ein kleiner Wichtigtuer", sagte er im Abwärtslift.
"Die Schlagzeile heißt: Botschaft vom Putsch überrumpelt."
"Wieso Schlagzeile?"
"Dave, wir haben dort unten Militärattachés, Militärberater und einen Haufen Geheimdienstler – keiner hat was gemerkt, und das in einem Land, wo grundsätzlich alles durchsickert, weil keiner den Mund zu halten versteht."
Am Steuer fragte er: "Du glaubst doch nicht etwa, ich mache mich reisefertig?"
"Es sind nur vier Flugstunden mit der Abendmaschine", antwortete sie. "Weißt du, ich habe so ein Gefühl, da unten bahnt sich was an, eine Art Bürgerkrieg."
"Du darfst eine ganze Menge, aber mich in den Krieg schicken darfst du nicht." Irgendwo musste er die Grenze ziehen. Oder wünschte sie ihn ernsthaft weg? In ihm regte sich ein Verdacht. Letzten Samstag hatten sie gestritten, sie wollte ihn mit auf eine Party zerren, er aber war bei seinem Manuskript geblieben – hatte sie dort vielleicht jemanden kennen gelernt? Und neulich abends, als er unangemeldet zu ihr ging, kam da aus der Etage nicht ein Mann, flott in Schale? Dem war er doch schon mal begegnet... Natürlich, wenn es ein Mieter war.
Auf alle Fälle wollte er den kleinen Koffer packen. Auch buchte er für morgen einen Flug (via San Juan, Puerto Rico, eine Direktverbindung gab es sonntags nicht) und zahlte mit Scheck. Im Ausland brauchte er Bargeld, musste noch etwas auftreiben, schwierig am Wochenende. Was ihn nervös machte, war, dass er anfing, derart auf sie zu hören. Ja, es stimmte, ihre Meinung war ihm wichtig, sie wurde mehr und mehr zur Stimme seines Gewissens. Dabei war sie weder sehr begabt noch hatte sie eine bessere Schulbildung. Sie sprach allerdings nur aus ihrer Erfahrung oder aus weiblichem Instinkt, wovon sie nichts verstand, dazu sagte sie auch nichts; recht wohltuend.
Als sie über die Brücke zurückfuhren, erinnerte Penny ihn daran, dass im Büro ein versiegeltes Kuvert bereitlag, mit tausend Dollar, für Notfälle wie diesen. Er wunderte sich, dass sie dies wusste. Bei Norton Press behandelte man sie kühl, als Außenseiter, ohne dass sie was dagegen tat. Der Chef hatte sie im Spätherbst mitgebracht und kommentarlos ins Archiv gesteckt. In New York war sie unter anderem Bildreporterin gewesen, ohne Chance gegen die männliche Konkurrenz. Im Allgemeinen hielten Frauen sich nur auf gewissen Innenseiten, in Rubriken wie Mode, Klatsch, Das Schöne Heim, Gesundheit, Lokalglossen; bei den Gerichten, der Polizei oder im Rathaus traf man sie kaum. Penny entdeckte ja manches, aber ihr Stil war arm. Dennoch wollte sie heraus aus dem Archiv, versuchte es sogar im District Building, doch die Veteranen von Times, Post, Star und Herald ließen sie nicht zum Zuge kommen. Es war ihr, wie sie zugab, letztlich dort nur gelungen, die Damentoilette zu finden. Was also tat sie außerhalb des Archivs? Ihre Funktion im Haus schien nicht klar definiert. Für die alten Hasen war sie ein Fremdkörper, der beim ersten Fehler gefeuert werden würde. In keiner Weise passte sie sich an. Wo alles jagte, herzlich tat und hinterrücks tuschelte, blieb sie gelassen, folgte wie im Traum der eigenen Melodie, ein freier Mensch, der im Unterschied zum Rest der Welt niemandes Wohlwollen braucht.
Es musste dieser unwirkliche Hauch gewesen sein, der Varelas Neugier geweckt hatte. Sie war ihm um Weihnachten durch ein tröstendes Lächeln aufgefallen, das ihm besonders gegen den Strich ging. Damit beschenkte sie ihn, als Norton ihm wieder einmal Ungenauigkeit vorwarf, schlampiges Recherchieren völlig nebensächlicher, blödsinniger Details. "Ihre Einbildungskraft in Ehren, aber hier zählen Tatsachen... Sie sind Südländer, Dave, nicht wahr?", hatte der Chef gefragt, um seinen Tadel zu verschärfen. – "Mein Vater war Brasilianer; ich hab ihn nur nicht gekannt." – "Ich wusste, dass es einen Grund hat." Da hatte sie ihm komplizenhaft zugenickt, weil Kritik ihn so wenig traf wie sie; aber er konnte es sich leisten, auf ihn verzichtete man in diesem Hause nicht.
"Bist du fertig?", rief sie jetzt aus dem Archivraum, während er noch am Zahlenschloss des kleinen Safes fingerte. "Ja, mit dir, wenn du so weitermachst", knurrte er. Tatsächlich, sie war dabei, ihn zu tyrannisieren; sie vergötterte ihn als Auslandsreporter und errichtete gleichzeitig eine terroristische Herrschaft! Je länger er nachdachte über die Rätsel ihrer Psyche, desto mehr witterte er da ein Geheimnis, Lücken im Lebenslauf, etwas verbarg sie, bloß wozu? Er akzeptierte doch, dass sie kein unbeschriebenes Blatt mehr war. Ein Mädchen, das sich in dem Job behauptet, ohne viel Talent und ohne Protektion, war ein Sonderfall, das stand außer Frage... Eben das musste es sein, was ihn anzog: unter der Nonchalance die Mischung aus Ehrgeiz und Naivität.
In seinem Appartement nahm Penny einen Hefter aus der Umhängetasche, eine Faktensammlung, wie er sah, über die Insel, über diese verdammte Dominicanische Republik! Das war penetrant, es brachte ihn so auf, dass er sie fast verprügelt hätte. In seiner Wut warf er sie aufs Bett, ohne sich wie sonst erst in der Küche für den Angriff zu stärken, und fiel über sie her. Sie wehrte sich gar nicht und – das überraschte ihn noch mehr – war auch diesmal darauf aus, wirklich gut und abwechslungsreich zu sein. Es war schon außerordentlich, er fühlte sich jung dabei, mit ihr sank es nie zur Routine ab, ihr wahres Talent lag ganz bestimmt hier, und demzufolge war es eine rein körperliche Bindung, soviel er sich auch mühte, anderes hineinzulegen. Lieber Gott, kein Mann wollte es mit einer kleinen Hure treiben, nicht auf die Dauer jedenfalls, es musste, aus Gründen der Selbstachtung, da eben ein Geheimnis geben, die schlichte Wahrheit genügte nicht.
Eng aneinandergeschmiegt wachten sie auf. Ihre Kleidung lag noch verstreut am Boden, als Penny mit einem raschen Blick zur Uhr das Radio anknipste. In jenem Dämmerzustand, in den Varela danach meist versank, hörte er sagen, das Ultimatum der Regierung an die Rebellen sei abgelaufen, ohne Ergebnis, und auf morgen früh fünf Uhr verlängert worden. Also noch kein Ende in Sicht! Das hinderte ihn daran, den Flug zu annullieren, wie er es ursprünglich gewollt hatte. Penny half ihm beim Packen – er bedauerte, sie dort unten nicht dabeizuhaben. Seine Erfahrung und ihre Energie... Aber es stand ihm keine Assistentin zu. Hätte sie wenigstens Spanisch gekonnt. Korruptionsschnüffler Norton verlangte von seiner Crew dieselbe Sparsamkeit und Effektivität wie von einer Behörde.
Auf Puerto Rico ließ sich alles scheußlich an. Als Varela am folgenden Mittag, das Ticket in der Hand, die Bordkarte für Santo Domingo erbat, hieß es, der Flug falle aus. Am Schalter der Pan American World Airways hörte er, Punta Caucedo, der internationale Flughafen der Nachbarinsel, sei der Unruhen wegen vor drei Stunden geschlossen worden. Bei Caribair, einer kleinen regionalen Fluggesellschaft, dieselbe Auskunft. Der Stand der dominicanischen Luftlinie war vollends leer, an dem Glas hing ein bleistiftgeschriebener Zettel: Alle Flüge nach Santo Domingo sind bis auf weiteres gestrichen.
Aus. Dicht vorm Ziel saß er fest. Von den Wänden rieselte Musik, Evergreens, die den Fluggast besänftigen sollten und ihn, Varela, gerade deshalb reizten. Gewohnheitsmäßig, ohne viel Hoffnung, lief er zum Schalter der Lufttaxis und stieß dort auf Leute wie Dan Kurzman von der Washington Post und Georgie Anne Geyer (Chicago Daily News, eine der wenigen Damen im Auslandsgeschäft); sie hatten dieselbe Idee gehabt und saßen gleich ihm in der Falle. Denn das Mädchen hinter dem Tisch schüttelte den Kopf – das Risiko, auf einem gesperrten Flugplatz zu landen, werde von der Versicherung nicht gedeckt. Man fliege auch keinen anderen Punkt des Nachbarlandes an, es sei jetzt alles zu... Hätte er doch auf Penny gehört, auf die weibliche Intuition. Fünfzig Flugminuten von seiner Story hockte er da wie die anderen, die er sonst geschlagen hätte.
Mit ihnen brach er auf in die Stadt, die Sonne stand steil über San Juan, im Taxi, das er mit Tad Szulc teilte, klebte ihm das Hemd am Rücken fest. Szulc war gebürtiger Pole, ein Mann von der New York Times, dessen Laufbahn vor zehn Jahren damit begonnen hatte, dass er Perons Sturz prophezeite und den Hintergrund aufdeckte. Später hatte er in Venezuela, Columbien, Paraguay und Cuba recherchiert und bereits drei Bücher geschrieben; ein viel jüngerer und fähigerer Mann. Varela war reif genug, das zuzugeben, doch munterte es ihn natürlich nicht auf. Überdies erwähnte Szulc, er kenne Santo Domingo von früher und sei dort sogar einmal, 1959, unter Trujillo in Abwesenheit zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nein, keinesfalls werde er wie Cullen, der sein Auto in einer Zwei-Stunden-Parkzone Washingtons gelassen habe, mit der nächsten Maschine heimkehren; immerhin könne man von hier aus ja Freunde in Santo Domingo anrufen, das Telefon funktioniere, und Augenzeugenberichte sammeln... Varela, der weder diese Stadt noch irgendwen dort kannte, nickte düster.
Sie stiegen, wie die übrigen, vorm Caribe Hilton aus; nur ein Fernsehteam von CBS fuhr ins La Rada, wegen der französischen Küche. San Juan war sündhaft teuer, Varela kein Feinschmecker, er baute mit gesparten Spesen gern seine Münzensammlung aus, ihm hätte ein schlichtes Hotel genügt, er scheute nur das Alleinsein. Zwar bedeuteten ihm diese Menschen nicht viel, immer derselbe Kreis, der sich zwangsläufig traf, wenn es hier unten brenzlig roch. Aber es waren doch vertraute Gesichter, zerfurcht von ähnlichen Sorgen, wie jetzt dem Transportproblem. Immer noch tröstlicher, unter ihnen als in einem der 300 Zimmer zu sein (vollklimatisiert, mit Balkonblick auf den Ozean oder die Lagune), total isoliert, bloß das Transistorradio am Ohr.
Während der Nacht schien folgendes passiert zu sein: Militärs beider Seiten, also Rebellen wie Regierungstreue, hatten sich, anstatt einander zu beschießen, auf den Rücktritt des Präsidenten zugunsten einer Junta geeinigt. Um zehn Uhr früh hatte Fonseca sein Amt kampflos niedergelegt; nur der eigenen Sicherheit halber hielt er sich noch im Palast auf. Im Zivilberuf sei er Autoimporteur, sagte Kurzman über seinem Roastbeef, kaum anzunehmen, dass er versuche, den Helden zu spielen. Er werde wieder Fords verkaufen, basta... Inzwischen änderte sich die Lage erneut. Die jungen Offiziere, die alles angezettelt hatten, nahmen den staatlichen Rundfunk und erklärten jetzt über diesen Sender, sie lehnten es ab, mit Trujillo-Generalen eine Junta zu bilden. Vielmehr verlangten sie die Rückkehr zu Gesetz und Recht, zur Verfassungsmäßigkeit; sie wollten den vor neunzehn Monaten feige gestürzten frei gewählten Präsidenten Juan Bosch wiederhaben. Bis zu dessen Eintreffen sei laut Artikel 131 der Verfassung von 1963 der damalige Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Molina Ureña, Provisorischer Präsident.
Die Reporter ließen den Nachtisch stehen. Es stellte sich nämlich heraus, dass Dr. Bosch in der Stadt war, er lebte hier, und zwar – laut Tad Szulc, der ihn persönlich kannte – in der 6. Straße des Rio-Piedras-Viertels, unweit der Universität, wo er etwas wie Literatur oder Politische Wissenschaften lehrte. Varela schloss sich dem Spähtrupp an, all diese Auskünfte verdankte er den anderen, ihm fiel es ja schon schwer, durch das atmosphärische Rauschen dem hastigen Spanisch der Nachrichtensprecher zu folgen. Unterwegs erzählte ihm John T. Skelly von der Latin American Times, Bosch habe neben Kurzgeschichten auch einen Roman über den biblischen König David geschrieben – leider nicht auf Englisch erschienen –, der ein tragisches Selbstporträt darstelle... Varela sagte das nichts, er hatte von beiden, David wie Bosch, nur flüchtig gehört.
Juan Bosch bewohnte mit seinen Angehörigen ein bescheidenes Appartement im zweiten Stock eines Reihenhauses. Wer zur Familie zählte, wurde nicht klar, die Wohnung war voller Freunde und Anhänger, wohl Mitglieder seiner Revolutionären Partei im Exil. Ein fröhlicher Tumult, alle gratulierten ihm zu dem Sieg, als sei der schon Tatsache; er selber blieb gelassen. Obwohl nicht größer als die meisten der Anwesenden, schien er sie dank seiner aufrechten Haltung zu überragen. Schon seine ersten Antworten verrieten, dass Bosch, in dessen Namen da rebelliert wurde, von dem Putsch überrascht worden war. Er gab ohne weiteres zu, gestern ein ruhiges Wochenende am Strand von Luquillo verbracht zu haben, bis die erste Meldung ihn dort zufällig erreichte... Zwar ließ sich das als kluge Zurückhaltung, als staatsmännisches Gehabe deuten: man war kein Verschwörer, drängte nicht zurück an die Macht, sondern hielt sich still bereit, bis das Volk einen rief. Aber Luquillo Beach lag weit im Osten der Insel, hinter verträumten Badebuchten und schimmernden Kokosnuss-Hainen, gut eine Autostunde von San Juan; Varela erinnerte sich an feinen weißen Sand, grünes Wasser und matten Wellenschlag. Kein Mann ging in ein Touristenparadies, so weit weg vom Schauplatz jeder möglichen Handlung, wenn er hoffte, dass seine Stunde schlug.
Bosch gab sich als großer alter Mann der dominicanischen Politik. Er hatte dichtes weißes Haar, merkwürdig blaue Augen und ein schweres Kinn. Er meinte, der Aufstand sei unvermeidlich gewesen. Sicher werde er morgen in sein Land zurückkehren, vielleicht schon diese Nacht. Sein Vize, Molina Ureña, habe ihm eben telephonisch versichert, ein Militärflugzeug werde ihn heimholen; es könne übrigens jeden Augenblick landen. Gewiss, ein Dutzend Journalisten ließen sich darin noch unterbringen, sein eigener Stab sei ja recht klein... Den Beifall nutzend, zog er sich mit Tad Szulc in sein Schlafzimmer zurück. Durch die offene Tür sah man ihn, im Schaukelstuhl sitzend wie John F. Kennedy, ein Exklusivinterview geben, auf das andere natürlich keinen Anspruch hatten. Was hätte Varela auch fragen sollen, inmitten der hektischen Atmosphäre von Erwartung und Triumph? An Humberto Delgado, den toten General, hätte er hundert Fragen zu richten gewusst; aber hier stand er unter dem Eindruck, gar nicht zu begreifen, was eigentlich vorging. Das Gepäck staute sich bis hinaus auf den Flur. Boschs Ehefrau Carmen und seine Nichte Milagro Ortiz boten Erfrischungen an und quälten sich dann wieder damit ab, Dinge in Koffer und Taschen zu stopfen, die sich nicht mehr schließen ließen. Jemand, der mit Santo Domingo sprach, rief erregt, die Generale würden den Nationalpalast aus der Luft beschießen; doch es ging im allgemeinen Wirrwarr unter.
Verschwitzt kam Varela ins Hotel zurück. Keine Nachricht für ihn – es war seine Sache, Nachrichten zu liefern, nicht wahr, aber der Versuch, Washington zu erreichen, misslang. Kein Mensch dort im Büro, und wo zum Teufel steckte Penny? Ihn überfiel der übliche Verdacht, ganz deutlich sah er ihr kleines festes Hinterteil in den Händen eines anderen, etwa des Kerls, dem er wiederholt auf der Etage begegnet war. Undenkbar aber, dass sie ihn so hinterging, es konnte nicht sein! Es wär zu schändlich, wäre unverzeihlich gewesen...
Er duschte, fuhr in das Schwimmbad hinab, das sich schon leerte, kauerte auf dem Beckenrand und fing an, sich wie ein herrenloser Hund zu fühlen. Die Mehrzahl seiner Mitbürger, das war ihm klar, neideten ihm solch einen Aufenthalt, früher hatte er das kostenlose Wohnen in Häusern wie diesem selber genossen; doch die Zeit hatte ihn gelehrt, sie zu meiden und zu verachten. Ganz allmählich waren es für ihn Orte der Einsamkeit, des Hohns auf menschliche Begegnungen geworden. Im Ausland war er stets allein, auf sich gestellt und hatte es satt. Der Lärm, all die Gesichter, das Gewäsch an den Bars, die käufliche Höflichkeit des Personals – unerträglich, doch er nahm es hin, um zu den Storys zu kommen, für die man ihn seinerseits bezahlte wie einen Händler für frisches Obst oder einen Zuhälter für knackiges Fleisch. Im Moment freilich war er weit weg von seiner Ware.
Gechlortes Wasser netzte seine Füße, und der Schatten des Nachbarhotels rückte näher, wie um ihm zu zeigen, dass nichts stillstand, nichts von Dauer war auf der Welt. Er atmete tief, ließ sich hineingleiten und durchtauchte langsam die ganze Länge des Beckens – es klappte noch, wenn er ausgeruht war und genug Sauerstoff im Blut hatte. Der Bademeister, dieser Faulpelz, stand auf und starrte nervös, wie immer; sie wollten ja keine Leiche im Swimmingpool. Eben diese Art Hilfsbereitschaft war es, die er so überhatte. Er stieg heraus, warf das Handtuch über und nahm an der Bar des Schwimmbads ein Bier; es war so unterkühlt, dass es kaum aus der Flasche floss. Ringsum flammten Lämpchen auf, später würde eine Band loslegen und die Gäste, die aufs Bad blickten, also auch ihn, um den ersten Schlaf bringen. Sollte er ins Restaurant gehen, an einen der Tische, wo Auslandskorrespondenten Geschichten zum Besten gaben, die sie schon veröffentlicht hatten? Wie Frau Geyer vorhin die Story des guatemaltekischen Präsidenten, der ihr enthüllt habe, wie ihn CIA-Leute gedrängt hätten, die drei Millionen, die seine Installierung gekostet habe, aus der Staatskasse zurückzuzahlen... Fades Zeug, nicht wert, dass man sich dafür erhob und in Bewegung setzte.
Ein dünner Mann gesellte sich zu ihm und erzählte über dem halbgefrorenen Bier, er sei gestern Nacht mit der letzten Maschine aus Santo Domingo gekommen. Varela horchte auf, doch der Mann hatte nichts bemerkt, er kümmerte sich nur um Sehenswürdigkeiten, und zwar so professionell, dass die Frage nahe lag, ob er an einem Reiseführer schreibe. Nein, war die Antwort, er fotografiere für eine irische Postkartenfirma auf der ganzen Welt "typische Motive"; sie legten neue Serien auf, um die Japaner abzuschmettern, die jetzt mit dreidimensionalen Bildern vorstießen. Hier in San Juan sei er fertig, Kathedrale, Plaza de Colón, Casa de España, die Festung und das Capitol habe er im Kasten; morgen gehe es nach Rio Grande, Luquillo Beach und in den Nationalpark – zwanzig Orchideenarten und die berühmten Riesenfarne, wahrhaft Bäume. Das Capitol nannte er "ein Vier-Millionen-Dollar-Ding aus Georgia-Marmor". Unter dem Vorwand, ihm würde es kühl, zog Varela sich zurück.
Im Lift traf er Skelly, der etwas über Kampfhandlungen wusste; auf der Nachbarinsel floss nun offensichtlich Blut. Carmen Boschs Reaktion beschrieb er als leicht überspannt, sie habe gesagt: "Das beste, was passieren kann. Sie müssen dort lernen, dass Demokratie ihren Preis hat."
"Und was ist mit Boschs Flugzeug?"
"Darauf kann er lange warten. Die Luftwaffe ist gegen ihn."
Oben dann noch immer kein Kontakt mit Washington. Wo trieb Penny sich herum? Wenn er an ihre Leichtfertigkeit dachte – es kam ihr zum Beispiel nicht darauf an, jemanden zu küssen, an dem ihr gar nicht so viel lag. Es genügte, wenn der Betreffende schüchtern war, schöne Hände oder traurige Augen hatte. Sie hasste nur selbstsichere, überhebliche Naturen; immerhin etwas, das bei ihr nicht verfing. Aber eine Stimme, eine Stimmung reichten hin. Soviel Unbekannte, deren Vorhandensein Varela quälte, auch wenn er es bloß ahnte; es hatte sie ja gegeben oder gab sie noch. Dieser New Yorker etwa, der sie dem Chef vorgestellt hatte, so ein windiger Gerichtsreporter – der einzige Vorgänger, den sie zugab. Der Rest war dick übertüncht, doch die Vergangenheit schimmerte durch, in manchem unbedachten Satz, in der erotischen Erfahrung. Der Kerl am Lift etwa gab ihm sehr zu denken. Und dumpfes Brüten bewirkte die Vorstellung, sie sei auch Nortons Liebste gewesen, was sie entrüstet geleugnet hatte, das kleine Luder; den kürzesten Rock auf der Silvesterparty... Aber was war denn los mit ihm, wo blieb seine Toleranz, ging es, was sie betraf, nicht ohne die Normen der fünfziger Jahre? Nein, es war einfach bloß scheußlich, war kränkend, ständig die Eifersucht niederzukämpfen; denn in seinem Alter konnte man sie nicht mehr zeigen, ohne lächerlich zu sein. Zu allem übrigen noch lächerlich, das wär zuviel gewesen, erniedrigend! Doch ernsthaft, was bedeutete er ihr? Was er ihr gestern Nachmittag geboten hatte, konnte man kaum Liebe nennen; eher war es das Gegenteil gewesen.
Endlich das Läuten, er hob ab und hatte sie in der Leitung, über zweitausend Meilen hinweg unverkennbar Penny. Wo sie gesteckt habe? Im Kino. Was für ein Film, fragte er wie ein Polizist. Sie ging nicht darauf ein. Ihre Stimme klang würdig, brav und lieb. Zwar besagte das nichts, aber sie sprach wirklich besorgt, ganz teilnahmsvoll. Norton wisse, dass er festsitze, und wünsche, er möge ein Sportflugzeug oder ein Motorboot chartern, um schleunigst "vor Ort" zu kommen – sie hingegen rate ihm ab, das Meer sei dort ja voller Haie, und heimliches Betreten eines Landes, in dem totales Chaos herrsche, könne mit Festnahme, Spionageverdacht, standrechtlicher Erschießung enden. "Du kommst sowieso nicht durch zu Ramirez und Caamaño", sagte sie.
"Wer soll das sein?"
"Na, die Führer der Revolte. Hast du das Material gelesen? Ein paar Namen müssten drinstehen."
Sie vereinbarten noch feste Gesprächszeiten. Ihren Hefter hatte er im Flugzeug durchblättert, nahm ihn nach dem Anruf wieder vor. Sie wusste ja mehr als er, so ging es nicht weiter, er musste sich mal am Riemen reißen. Nicht mehr bloß nach den Krumen schnappen, die vom Tisch der anderen abfielen, sondern selbst an die Arbeit gehen! Die Akte war dünn, das meiste stammte wohl von Robert Tucker, seinem Vorgänger, der letztes Jahr einen Herzinfarkt erlitten und sich zur Ruhe gesetzt hatte. Tucker war mehrmals in Santo Domingo gewesen, das verriet die Adressenliste hier – sie war zu verschiedenen Zeiten handschriftlich ergänzt und überarbeitet worden, man hatte Namen, Telefonnummern und Charakteristiken wichtiger Leute gestrichen oder verbessert. Ganz oben gleich stieß Varela beschämt auf den Namen Dr. Bosch, Ex-Präsident, z. Z. San Juan, 6. Straße, die exakte Anschrift, er hätte als erster dort sein können, denn gestern im State Department war der Name ja gefallen; dieser Mr. Holland hatte ganz richtig vermutet, die Rebellion ziele auf Wiedereinsetzung des Juan Bosch.
Bisher war der Trip eine Pannentour gewesen, nun, das würde sich ändern. Schluss mit der Lethargie... Obwohl er jähen Klimawechsel schlecht vertrug und ihm nach all dem Ärger die Müdigkeit in jeder Faser saß, wurde sein Kopf hellwach, er ging das Material rasch durch. Er war ja nicht hilflos, nicht ohne Trümpfe, da drin in seinem Kopf steckten schließlich gewisse Reserven an Erfahrung und Gespür, er musste sie nur mobilisieren, und nach kurzer Anlaufzeit war ihm das noch stets geglückt. Man war nicht Reporter seit dem französischen Indochinakrieg, ohne dass sich neben Misstrauen und Widerwillen gegen derlei Aktionen ein Gefühl dafür entwickelte, wie solche Krisen ausgelöst und gehandhabt wurden, wer dahinter stand und wer bloß im Vordergrund agierte. Der Name Ramirez, vielleicht nur eine Vordergrundfigur, fehlte in Tuckers Zusammenfassung, die recht kompakt war, arm an Verben; sie las sich wie ein Memo aus dem Pentagon. Caamaño kam aber vor: Lieutenant Colonel Francisco A. Caamaño Deñó, Sohn des Trujillo-Intimus General Fausto Caamaño und Vertrauter Tony Imberts, unter diesem und dem Triumvirat Instrukteur der Bereitschaftspolizei.
Die Fülle der Fakten drohte Varela zu erschlagen; so erging es ihm immer zu Anfang. Er musste sich auf die Hauptakteure und auf mögliche Helfer beschränken, die Tucker mit Sternchen versehen hatte, in dankenswert pedantischer Manier. Der vorletzte Name (die Liste folgte dem Alphabet, sie schloss mit Vasallo, Admiral) war unterstrichen: César Eduardo Tirado, Herausgeber der Caribe, führender Zeitungsmann, kooperativ. Der Empfehlung war handschriftlich hinzugefügt: Nur abends von neun bis elf, Privatnummer.
Es ging auf zehn. Kooperativ, Varela wollte das probieren. Er meldete ein Ferngespräch nach Santo Domingo an, das angesichts dessen, dass die Leitung glühen musste, verblüffend schnell kam. Die Drähte der Telephongesellschaft ITT, an denen die ganze Karibik hing, schienen intakt und stark genug, einen Aufstand zu verkraften. "David Varela, Norton Press", meldete er sich. "Señor Tirado, ich darf Sie sehr herzlich von Mr. Norton grüßen. Er schickt mich zu Ihnen, aber ich hänge auf Puerto Rico fest, genau wie die anderen Reporter. Würde es Sie sehr belasten, mir kurz zu sagen, was sich jetzt bei Ihnen tut?"
"Was sich tut?" Die Stimme schnarrte, es klang äußerst ungehalten. "Die Hölle ist los, aber was schert das Sie? Mir ist nicht nach einem Interview, mein Gott, ich erwarte dringende Anrufe... Gehen Sie gefälligst aus der Leitung!"
Das hörte sich ungut an, aber Varela hatte so oft mit Menschen gesprochen, die unter Druck standen, dass er genug Geduld aufbrachte, nervöse Partner zu beruhigen. "Wer zum Teufel sind Sie überhaupt?", hörte er den Mann schreien. Er stellte sich noch einmal vor, doch der andere blieb abweisend, wollte das Gespräch beenden, bis es Varela einfiel, zu sagen, er sei der Nachfolger von Robert Tucker.
Sogleich änderte sich der Ton, wurde hilfreich, fast herzlich. Tirado gab einen Lagebericht, obschon sehr gedrängt und gehetzt: Aufruhr in der Alt- und Innenstadt, meuterndes Militär verteile seit dem Nachmittag im Colón-Park (den gab es überall) wahllos Waffen an jedermann, zumal an jugendliche Banden und "pro-Castro-Guerrilleros", die inzwischen auch die Vorstädte verunsicherten, den Nationalpalast, Radio Santo Domingo sowie weitere Gebäude besetzt und teilweise geplündert hätten, darunter den Sitz seiner Zeitung.
"Hat es Luftangriffe gegeben, Señor?"
"Ja, vereinzelt, auf den Palast und die Duarte-Brücke, die von den Meuterern gehalten wird."
"Gegen wen?"
"Gegen die Ordnungskräfte unter General Wessín. Die haben versucht, die Stadt von Osten her zu nehmen, liegen aber hinter dem Ozama fest."
Der Ozama schien ein Fluss zu sein, mit der Linken entfaltete Varela den Plan von Santo Domingo, der dem Material beilag. "Was tut Ihre Bereitschaftspolizei?"
"Sie meinen die Cascos blancos? Die sind hier, aber weg von der Straße, es sind ja nur sechshundert Mann, sie halten am Hafen die Ozama-Festung und wagen sich nicht heraus, bis..."
So überraschend, wie der Kontakt zustande gekommen war, riss er auch ab; die Leitung war tot. Doch ein Hauch der Ereignisse hatte Varela gestreift, er fragte sich, ob jenes Knattern, das Tirados Sätze zerhackt hatte, Gewehrfeuer gewesen sei oder simples Störgeräusch. Seine Phantasie erhielt einen Anstoß, er dachte an eine bewaffnete Menge, die Polizisten jagte und lynchte, vielleicht sah es weniger schlimm aus, doch wer würde das Chaos meistern, wer ging als Sieger daraus hervor? Er verspürte den Wunsch, die Dinge zu ergründen; so fing es bei ihm immer an. Kein Zweifel, Penny hatte ihn gestärkt, weil sie ihn nicht wie gestern angetrieben, sondern eher gebremst hatte. Ihm gelangen schon einfache Kombinationen, zum Beispiel, dass die Waffenverteilung eine Antwort der Rebellen auf die Land- und Luftangriffe sein konnte. Auch lag ein Widerspruch darin, dass ein Führer der Bereitschaftspolizei wie Caamaño an der Spitze des Aufruhrs stand. Dies und anderes galt es zu klären.
Er bestellte einen Imbiss aufs Zimmer und gab der Telephonzentrale weitere Nummern von der Liste, doch die meisten Leute, die er anwählen ließ, hoben nicht ab. Ein Zahnarzt, der neben dem Teatro Independencia wohnte, das wohl ein Kino war, versicherte, die Waffen würden nicht im Columbus-Park, sondern hier unter seinen Augen im Unabhängigkeitspark verteilt, und zwar von Lastwagen aus an "drei- bis fünftausend Menschen", mehr war von ihm nicht zu erfahren. Bei einem Zollbeamten im Viertel La Fuente (es lag an der umkämpften Brücke, Varela hatte den Stadtplan vor sich) meldete sich die Ehefrau, die ihm stockend sagte, sie halte die Jalousien geschlossen und verfolge mit Schrecken das Fernsehprogramm. Auf dem Bildschirm ziehe noch immer ein Menschenstrom vorbei, zerlumpt oder mit einzelnen Uniformstücken bekleidet, der seinen "entfesselten Gefühlen freien Lauf" lasse. Auf die Frage, was für Gefühlen, drang aus dem Hörer ein seltsam schnüffelndes Geräusch. Er begriff dann, die Frau weinte: ihr Mann war morgens aus dem Haus gegangen und noch nicht zurück... Schließlich sagte ihm ein Angestellter des britischen Konsulats, es sei eine Orgie der Gewalt, "Männer mit Bärten und Kappen im Castro-Stil" würden die Tankwarte zwingen, kostenlos Benzin in Flaschen zu füllen – Molotow-Cocktails zur Panzerbekämpfung und Brandstiftung; aus der unteren Stadt dringe Feuerschein, dort häuften sich die Leichen.
Ein verworrenes Bild, lückenhaft, widersprüchlich. Wo nahmen die Jungs dort so schnell Castro-Kappen her, ganz abgesehen von den Bärten? Und seltsam, dass Tuckers Augenzeugen sich über die Generale kaum beklagten. So sehr ihre Angaben auch schwankten, den Aufstand verurteilten sie alle, das Verhalten der Gegenseite hießen sie gut. Dabei kannte Varela seinen Vorgänger doch als gewissenhaften Mann, der sich nicht bloß auf konservative Informanten gestützt haben konnte. Vielleicht gab es auch andere, linksstehende Gewährsleute, nur gingen die nicht ans Telephon, weil sie auf der Straße waren, verstrickt in die "Orgie der Gewalt".
Eine schwache Erklärung; etwas stimmte da nicht. Der liberale Tucker und dann Freunde wie Tirado (welch ein Name schon für einen Zeitungsmann). Liberal hieß bei Norton Press vor allem unvoreingenommen, zurückhaltend, neutral. Nicht Meinungen, Nachrichten wurden verlangt, Neuigkeiten, notfalls aus zweiter Hand, doch überprüft, gefiltert durch Berufserfahrung. Was ihm aber jetzt nach soviel Stunden blieb, war nicht mehr als ein Haufen unkontrollierbarer Beobachtungen, gestreckt durch Geschwätz.
Nach Mitternacht verlor Varela den Schwung. Er nahm ein Barbiturat, ging zu Bett, und die Erschlaffung kehrte wieder. Es war ihm nicht geglückt, zu einer der US-Dienststellen in Santo Domingo durchzudringen. Dabei galt sein Augenmerk stets den eigenen Leuten, da setzte die gute Story an. Nun, er würde nicht lockerlassen. Botschaft von Putsch überrascht, hatte Penny gesagt – eine Fährte, der zu folgen ihm lohnend schien.
Beim Frühstück hörte Varela von all den Taten der anderen. Cullen von der Herald Tribune war im Sportflugzeug über Santo Domingo gewesen, bis eine Warnung des Kontrollturms den Piloten zur Umkehr gezwungen hatte; doch er brachte Luftbilder mit, beneidenswerte Beute, man sah darauf Qualm über dem Ozama, das Militärlager "27. Februar" (in Rebellenhand) unter Beschuss, rechts davon, gefährlich nahe, die Öltanks von Texaco. Zwei Jungs von Newsweek und den Hearst Newspapers waren im benachbarten Haiti gelandet, sie versuchten jetzt, über die bergige Grenze ans Ziel zu kommen, die offiziell geschlossen, aber kaum bewacht sein sollte. Und ein Fernsehteam von NBC schiffte sich gerade bei Mayagüez ein, im Westen Puerto Ricos, es strebte über die 80 Meilen breite Mona-Passage kühn dem Kriegsschauplatz entgegen.
Männer bei der Arbeit, dachte Varela. Nachdem er schon ein wenig aufgelebt war, fühlte er sich erneut überflügelt und abgehängt. Am meisten beeindruckte ihn Tad Szulc, in nüchterner Perfektion verzichtete der auf Abenteuer und quartierte sich stattdessen beim San Juan Star ein, der englischsprachigen Zeitung hier, wo man ihm ein Büro mit Fernschreiber, Telephon und Bandgerät gab. Er teilte es mit Louis Uchitelle, dem Lokalvertreter von The Associated Press, und diese zwei drückten mit Pressepriorität ständig Gespräche nach Santo Domingo durch. Dort zapften sie Malcolm McLean an, den Presseattaché der US-Botschaft, der seinerseits soviel gute Quellen hatte, dass der Nachrichtenstrom schnell und unaufhörlich floss. Die beiden hatten das Problem durch Arbeitsteilung gelöst, per Blitzgespräch oder Telex meldeten sie nach New York, was ihnen von anderen beschafft worden war. Übrigens, sagte Szulc, kontrollierten die Rebellen das Fernsprechamt dort, ohne den Informationsfluss zu behindern. Das spreche gegen einen stabsmäßig geplanten Umsturz, echte Profis, ob rechte oder linke, hätten die Drähte mit Sicherheit gekappt.
Ärgerlicherweise wurde Varela auch noch in einen Streit verwickelt. Ein Korrespondent von Le Monde, der über Nacht angereist war, bestand darauf, "Konstitutionalisten" zu sagen, wenn er von den Rebellen sprach, so nämlich nannten sie sich selber, als verfassungstreue Kräfte, die Bosch wieder einsetzen wollten. Die Generale hingegen, fälschlich "Loyalisten" genannt, seien in Wahrheit die Putschisten von gestern, von heute, von immer...! Der Franzose warf ihm vor, einer reaktionären Sprachregelung zu folgen; Vare la entschuldigte sich, solche Debatten erbrachten nichts, er floh in sein Zimmer. Mit schmerzendem Kopf, vor dem noch ungemachten Bett, erblickte er im Spiegel sein Gesicht und war froh, allein zu sein. Die Augenringe, die knittrige Haut an den Ohren, unterm Kinn, es würde Stunden dauern, bis er sich wieder ähnlich sah. Seit Monaten dasselbe, er fühlte sich gelähmt, morgens besonders, nur im Stress war er leistungsfähig, doch dann brauchte er Tabletten und wachte wie gerädert auf.
Immerhin, jetzt gelang ihm eine Verbindung zur Botschaft in Santo Domingo, er erreichte dort Arthur E. Breisky, den Zweiten Sekretär. "Die Situation ist heikel und verschlimmert sich stündlich", sagte Breisky. "Wir bereiten schon die Evakuierung amerikanischer Staatsbürger vor. Natürlich ist das freiwillig. Eine Anzahl von ihnen sammelt sich auf unseren dringenden Rat im Hotel Embajador am Westrand der Stadt, wo wir sie mit Hubschraubern auszufliegen hoffen, denn am Hafen wird ja gekämpft."
"Wohin wird man sie bringen?"
"Zunächst auf die 'Raleigh', ein Schiff der Karibischen Flotte mit einer Landeplattform, das zufällig in der Nähe ist. Der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zwingt uns dazu. Wir glauben, dass mindestens ein Fünftel der zweitausendfünfhundert US-Bürger gehen will. Es stimmt, die regierungstreuen Truppen kontrollieren den Luftraum über der Stadt, sie sind von diesem Schritt verständigt worden."
"Haben Sie auch die Rebellen informiert, Sir?"
"Nein, wie kämen wir dazu?"
"Nun, Mr. Breisky, die Regierung ist gestürzt worden; dafür gibt es zwei Seiten in diesem Bürgerkrieg. Wenn Sie zugunsten unserer Bürger mit der einen Seite sprechen, könnten sie es auch mit der anderen tun, nicht wahr? Nach meiner Karte sind Sie nur eine halbe Meile vom Nationalpalast entfernt, dem Hauptquartier der Rebellen, oder sehe ich das falsch?"
"Also, wenn es Sie beruhigt, ich hab gestern Nachmittag gegen sechs eine Abordnung von dort empfangen."
"Militärs?"
"Nein, Zivilisten; darunter Dr. Boschs ehemaligen Minister für Landwirtschaft, Guzmán, und seinen früheren Botschafter in Washington, del Rosario."
"Was wollten diese ranghohen Herren?"
"Dass wir die Luftangriffe der Loyalisten unterbinden. Leider lag und liegt das nicht in unserer Macht. Ihrerseits haben sie es abgelehnt, den Mob von der Straße zu holen und die Waffen wieder einzuziehen, die so leichtfertig verteilt worden sind; einschließlich der selbst gefertigten, wie diese fünfzehntausend Molotow-Cocktails."
Varela wollte sagen, es müsse wohl um beiderseitigen Waffenstillstand gehen, zu seinem Kummer aber wurde er durch ein Mädchen gestört, das im Vorraum den Staubsauger in Gang setzte. Er hob den Hörer wieder ans Ohr – Breisky, an den er noch so viele Fragen hatte, war nicht mehr in der Leitung.
Doch nun, genau zur vereinbarten Zeit, rief Penny an, und er fasste das, was er eben gehört hatte, in wenige druckreife Sätze. (Die Meldung begann: "San Juan, P. R., Monday, April 26 – The United States Navy will begin later today to evacuate American citizens who want to leave the Dominican Republic in view of the mounting threat of a breakdown in public order. A spokesman at the U. S. Embassy in Santo Domingo said in a telephone conversation that about 500 of the 2 500 U. S. citizens in the country were expected to leave...") Als er ihr sein Missgeschick mit den dominicanischen Gesprächspartnern schilderte, riet sie ihm zu folgender Technik: er möge jeden, den er erreicht habe, doch bitten, nicht aufzulegen, ohne das dortige Fernsprechamt zu veranlassen, ihn gleich mit der nächsten Nummer zu verbinden; so kriege man ein Dutzend Leute mit einem Anruf an den Apparat.
"Na ja", sagte er, "aber was meinst du, was das kostet? Ihr müsst mir einen Haufen Geld schicken, sonst hält man mich schon wegen der Hotelrechnung fest."
"Du sollst auch gar nicht weg, Dave. Ich will nicht, dass du dorthin gehst! Du hast genug Tote gesehen, überlass das jetzt anderen und gib uns den Krieg per Telefon, okay? Von mir kriegst du keinen Cent."
Mit einem kleinen törichten Lächeln legte er auf. Bestimmt wusste Penny, dass er kein Bargeld brauchte, weil hier im Hilton seine Kreditkarte galt; aber sie hatte ungewohnt ernsthaft gesprochen, eindringlich, besorgt. Es war zwischen ihnen doch nicht nur Verlangen, es war mehr... Plötzlich schlug seine Stimmung um, er wollte kein weiteres Ferngespräch, das Telefon lockte ihn nicht mehr, seine Neugier verflog, das Interesse an der Sache, wo zum Teufel war es hin? Ach, er kannte das, all dies passierte ihm öfter in der letzten Zeit, auf seinen Elan war kein Verlass. Früher hatte er ihn mit Kaffee und Alkohol stützen oder sonst wie entfachen können, nun kam und ging die Arbeitslust auf unerforschliche Art, kam und ging wie sein Lebensmut, der sich auch nicht herbeizwingen ließ.
Im Vorgefühl einer Depression fuhr er hinab und schlug den Weg zum Hafen ein. Nur nicht brüten, etwas tun, das war das einzige, was jetzt half. Er wollte nach einer Schiffspassage sehen, das redete er sich jedenfalls ein, da es ihn etwas rechtfertigte. Warmer Seewind umhüllte ihn, die Palmenfächer knisterten geheimnisvoll, das Meer schlug an die bleichen, salzzerfressenen Steinquader der Ufermauer; all das war Balsam auf die Wunde. Er liebte das Straßenbild romanischer Städte, die Armut wie den Marmor; die unvermeidlichen Reiterstandbilder beschworen ferne, grandiose Tage und stimmten ihn wehmütig, grüblerisch – ein Seelenzustand, bei dem er sich wohlzufühlen vermochte. Vielleicht dämpfte der Anblick stolzer Vergangenheit und ihres Verfalls die Trauer, deren Quelle ihm verborgen blieb, nahm ihr das Persönliche und löste sie in Weltschmerz auf.
Hier in San Juan, dieser karibischen Drehscheibe, war er mehrmals schon gewesen; und was ihn in stillen Momenten stets berührte, war die naive Erkenntnis, dass er jede Stadt fast so wieder fand, wie er sie verlassen hatte. Man flog weg, das Leben dort ging weiter, pulsierte unverändert, genau wie in der Erinnerung und so, als wäre man noch da – es hing also nicht mit einem selbst zusammen, man beeinflusste es in keiner Weise, hinterließ keine Spur... Varela suchte den Gedanken schärfer zu fassen, doch der entzog sich ihm, als sei er ganz substanzlos.
Etwas konnte nicht in Ordnung mit ihm sein. Woher diese Anwandlungen von Melancholie? Seine letzte Reise, deutlich sah er die Avenida da Liberdade in Lissabon vor sich, mit ihren Kinos, Banken, Schuhputzern und subtropischen Bäumen im feuchten Hauch des Februars, die Autos kreisten um das elfenbeinfarbene Denkmal des Marquês de Pombal, auch jetzt, in dieser Sekunde, umkreisten sie es, so wie da vorn den weiß aufragenden Columbus, San Martín oder Bolívar. Denn all das lief ja weiter, und die Standbilder starben nicht. Es war wohl das Phänomen der Gleichzeitigkeit millionenfacher Abläufe, das ihn niederdrückte, ohne dass er recht wusste, weshalb. Das ungeheuerliche Ausmaß der Schöpfung – ja, dies musste es sein, die eigene Nichtigkeit. Vor Wochen war er in Lissabon den letzten Schritten des Generals Delgado gefolgt, so wie er hier dem Echo dieses Aufstands lauschte... Und wozu das alles, wofür tat er das? Um die Welt zu verbessern – lachhaft, die blieb, wie sie war. Um Karriere zu machen, ein Star zu werden wie Norton – zu spät, nun nicht mehr. Um sein Brot zu verdienen – war das wirklich die Mühe wert?
Varela seufzte, das Gefühl des Misserfolgs, der Vergeblichkeit drang wieder in ihm vor. 12. September, dachte er, oder doch bereits November? Was mit fünfzig nicht geschafft war, blieb unerreicht, das stand außer Frage. Und wozu auch mehr erreichen; selbst ein Star zu werden hätte sich letztlich nicht gelohnt. Auf der anderen Straßenseite erkannte er von weitem einen Menschenauflauf. Aha, das dominicanische Konsulat, an die fünfzig Leute unter dem blauweißroten Wappen, gewiss Dominicaner im Exil, die das Haus belagerten. Jetzt schlang man ein Seil um das Außengitter, suchte es mit einem Auto umzureißen, wie leicht schlug ein Protest hier ins Gewaltsame um. Der Motor heulte, die Menschen schrien, und dort kam Polizei; ein regelrechter Tumult. Als er näher trat, verstand er Rufe und las grob gemalte Losungen wie: Freiheit oder Blut, Wessín – Mörder, Generale – Marionetten des Imperialismus, Juan Bosch – Präsident, Mörder an die Wand, Hoch die Revolutionäre Partei... In den Augen der Demonstranten schienen Bosch und seine Partei die Seele des Aufstands zu sein.
Einer Eingebung folgend, winkte Varela ein Taxi herbei und nannte dem Fahrer Boschs Adresse. An die Arbeit! So oft ihm je etwas gelungen war, dankte er das einem spontanen Entschluss.
Ein Adjutant oder Sekretär des Parteichefs empfing ihn und meldete ihn ohne weiteres an. Diesmal gab es kein Durcheinander von Besuchern und Gepäckstücken, alles schien geordnet und gedämpft wie im Haus eines Kranken; man hatte die Koffer entweder schon weggebracht oder – viel wahrscheinlicher – stillschweigend wieder geleert, als klar geworden war, dass man vergebens auf ein Flugzeug hoffte.
Der Expräsident, in weißem offenem Hemd und gürtelloser Hose, wirkte erschöpft, wohl weil er seit Samstag kaum Schlaf gefunden hatte. Nach seiner Heimkehr gefragt, rauchte er nervös und empfahl Varela, dies ruhig abzuwarten; machte er sich denn noch Illusionen? Die starren Falten schnitten tief in sein Gesicht, als er über die Kämpfe sagte: "Das musste geschehen. Mein Volk hat die Freiheit geschmeckt und nimmt den Verlust nun nicht hin. Man glaubt bei Ihnen, es sei noch nicht reif für die Demokratie, aber es hat soviel gelitten, dass es keinen anderen Weg mehr sieht... Ja, ein paar hundert Polizisten mögen tot sein; sie wurden Opfer der ersten Explosion, Opfer von Menschen, die plötzlich ein Gewehr in der Hand halten, nachdem sie Generationen lang durch Gewehre unterdrückt worden sind."
Obgleich Varela ihm nicht widersprach, wies Bosch grimmig auf einen Leitartikel der New York Times, die mit dem Frühflugzeug gekommen sein musste, und las etwas vor, das Bedauern über den Abgang der Regierung Fonseca ausdrückte. "Unter dessen Regime", rief er, "wurden Militärs über Nacht zu Millionären, und Ihr Land mit all seiner demokratischen Tradition beklagt das Verschwinden eines solchen Regimes?"
"Eine Pressestimme, Exzellenz, gibt nicht unbedingt die amtliche Haltung wieder."
"Ich fürchte, in dem Falle doch. Heute ist der dritte Tag der Revolution, die auf meine Rückkehr zielt, aber noch keine Amtsperson Ihrer Regierung hat versucht, mit mir in Kontakt zu treten. Dabei befinden wir uns ja auf nordamerikanischem Territorium!" Bosch strich über sein dichtes weißes Haar und fuhr temperamentvoll fort: "Ich fordere Präsident Johnson auf, der konstitutionellen Seite beizustehen! Ich tue das durch Sie, Mr. Varela, als dem einzigen US-Journalisten, der es heute noch für richtig hielt, mich aufzusuchen. Und ich hoffe von Herzen, dass Ihr Präsident die rechtmäßige Regierung in Santo Domingo unterstützt, im Geiste seines Amtsvorgängers, der mein Freund gewesen ist, im Geist von Punta del Este und der Allianz für den Fortschritt! Denn sehen Sie, zum ersten Mal in der Geschichte steht mein Volk für eine demokratische, menschenwürdige Ordnung ein – nicht mit dem Stimmzettel, wie vor zwei Jahren, sondern diesmal mit der Waffe. Es kämpft für eine bessere Sozialordnung, für die gerechte Verteilung der Güter und damit um sein Leben. Es ist der gleiche Kampf, wie ihn einst Washington und Jefferson geführt haben. Der Feind besteht aus einer Handvoll korrupter Militärs, gekauft von der hauchdünnen Oberschicht. Aber jene jungen Offiziere, die in Ihren Ausbildungslagern gehört haben, was Demokratie und Freiheit ist, sind auf Seiten des Volkes. Es gibt keinen Grund, an unserem Sieg zu zweifeln."
"Freiheit ist nur ein Wort." Varela liebte Pathos, wenn es echt war, Ausdruck einer Leidenschaft; doch es wurde Zeit, den Partner zu reizen, mochte der auch rechtmäßiger Staatschef sein, sonst bekam man einen Monolog, kein Interview. "Man kann damit Revolution machen, Exzellenz – aber einen Staat?"
"Auch einen Staat, der den Zwang – aufs äußerste beschränkt – zugunsten der Mehrheit handhabt. Das Volk muss sich frei fühlen, sonst verdorren seine besten Kräfte: Mut, Fleiß, Begabung, Bereitschaft zur Kritik..."
Der Expräsident wurde ans Telefon gerufen, man hörte ihn nebenan leise sprechen. Varela fragte Milagro Ortiz, Boschs Nichte und Gehilfin: "Wenn es feststeht, dass kein Flugzeug kommt, werden Sie dann versuchen, per Schiff durchzukommen?"
"Das haben wir schon", antwortete sie kühl. "Freunde von uns haben das dreimal probiert. Aber Ihre Zöllner haben das immer wieder verhindert." Mit diesen Worten verließ Frau Ortiz den Raum, als falle ihr ein, dass sie keine Erklärungen abzugeben habe.
Merkwürdig. Saß Juan Bosch, dessen Ankunft in Santo Domingo womöglich entscheidend war, etwa noch hier, weil er glaubte, die Küstenwache würde sein Boot aufbringen und ihn dadurch lächerlich machen? Feige war er doch nicht. Nach Tuckers Unterlagen hatte er schon einmal, im August 1947, vergebens versucht, mit einem Motorboot auf seiner Insel zu landen; damals von Cuba aus, um Trujillo zu stürzen. Aber nun war er fast sechzig und frei gewählter Präsident seines Landes, in das heimlich sich einzuschleichen wohl seinem Selbstverständnis widersprach.
Zweifellos ein schillernder Charakter, der einlud zu allerlei Deutungen. Varela sah sich selber in Washington sitzen und über diesen Mann schreiben, er habe auf triumphale Rückkehr gehofft, als ein Politiker, der sich für die Rousseausche Verkörperung der nationalen Seele hielt. Womöglich schilderte man dann die Begegnung so: Boschs blaue Augen waren trüb, doch es lag darin noch das bekannte kalte Feuer... er glich einem Leichnam, der um einen Funken Leben ringt... das Gesicht ein Eisblock, zerklüftet von der Bitternis der Emigration. Wenn Reporter Bücher schrieben, wollten sie literarisch sein und neigten zu melodramatischen Klischees, mangels authentischer Anschauung oder eigener Gedanken. Im übrigen stimmte es natürlich, man durfte es nur nicht so pompös formulieren: Emigration war bitter, die Hoffnung meist vergeblich, das Leben der Akteure wohl so enttäuschend wie das der Chronisten, diese Wahrheit sollte durchschimmern – man war den Dingen ausgeliefert. Und insofern müsste die Menschheit so schwermütig wie viele ihrer Volkslieder sein. Doch die Leute zogen es vor, die Augen zu schließen, sie gaben sich einem paradoxen Handlungsdrang oder grundloser Fröhlichkeit hin.
Aber nun kehrte Juan Bosch zurück und sagte ohne sichtbare Gemütsbewegung: "Soeben ist mein Flugzeug gelandet. Wenn Sie mich nach Santo Domingo begleiten wollen, lade ich Sie dazu ein."
Varela saß neben dem Fahrer, vorn im Wagen des Expräsidenten, der in einer Stunde wieder Staatschef sein würde; fünf Autos jagten durch die Vorstädte von San Juan dem Flugplatz zu. Oder träumte er das bloß, war all dies gar nicht wirklich, war es nur in seinem Kopf? Kaum zu fassen, dank eines glücklichen Zufalls nahm man ihn als einzigen Reporter mit auf diesen historischen Flug. Die anderen hatten Bosch gemieden wie Hunde einen abgenagten Knochen, er nicht, und dies war der Lohn! Es kam ihm gar nicht in den Sinn, sein Gepäck aus dem Hotel zu holen. Endlich würde er sich statt durch das Medium fremder Personen unmittelbar unterrichten und ein scharfes Bild des Aufstands liefern; Penny und Norton konnten zufrieden sein.
Hinter ihm sagte Carmen Bosch, stets rastlose und wachsame Gattin: "Was haben sie dir für ein Flugzeug geschickt? Hoffentlich nicht diese alte viermotorige Weltkriegsmaschine, mit der du damals nach México fliegen musstest."
An Boschs Stelle antwortete der Adjutant, der auf dem Klappsitz saß: "Es ist eine zweistrahlige 'Canberra', britischer Typ, mit drei Offizieren an Bord."
"Von den drei Waffengattungen, wie von uns gewünscht?"
"Nein, Señora, das ist die Besatzung..."
Das Rollfeld rückte näher, man sah schon den Kontrollturm und eine tief einschwebende Verkehrsmaschine. Der Flugplatz war hochmodern, vor zehn Jahren erst erbaut, ein Luftkreuz zwischen Europa, Nord- und Südamerika mit mehr als hundert Starts und Landungen am Tag... Jetzt erfasste Varela tiefer Schrecken, sein Herz hämmerte los, denn ihm fiel ein, dass sein Pass ja wie gewöhnlich im Hotelsafe lag. In den Tropen trug er kein Jackett, steckte immer nur die Pressekarte ein! Verzweifelt wandte er sich an den Fahrer, der ein Assistent des Staatschefs war, legte das Missgeschick dar und wurde mit sanfter Gebärde beruhigt: dies sei ein Sonderflug, er nehme als Gast des Präsidenten teil und sei durch dessen Wort hinreichend legitimiert.
Es wurde Varela bewusst, dass er den Flugplatz mit ganz anderen Augen als gestern ansah, alles gefiel ihm daran, er fand ihn sauber und schön. Im Fond hörte er Carmen Bosch halblaut fragen: "Du bist also unwiderruflich entschlossen, ohne Rücksicht auf die reale Situation? Selbst wenn du heil durchkommst, wirst du dort wochenlang keine Ruhe finden... Soll man wirklich das Leben des Präsidenten derart riskieren?"
Bosch antwortete so hochfahrend und rasch, dass Varela ihn nicht verstand; klar war, er wies den Einwand heftig zurück. Wie alle großen Männer vertrug er internen Widerspruch nur schwer. Sicherlich konnte er Gegnern geduldig zuhören, mit Andersdenkenden langmütig debattieren, aber seine Umgebung hatte ihm zuzustimmen oder den Mund zu halten. So verhielt es sich mit Führernaturen, die wären eben nicht das geworden, was sie waren, hätten sie auf ihre Freunde und auf ihre Frauen gehört. Kein Nummer-eins-Mann ohne den festen Glauben, dass jeder Entschluss prinzipiell weise und jedes Wort aus seinem Munde die reine und selbstverständliche Wahrheit sei.
Der Konvoi bog in die Zufahrt des Abfertigungsgebäudes, die Reifen schrillten, Boschs Auto hatte die übliche Starrachse der US-Straßenkreuzer, daher diese Kurvenlage... Varela versuchte, sich jedes Detail einzuprägen, man würde ihm dies bald aus den Fingern reißen. Warum nur war er so mutlos, so verzagt gewesen? Gewiss, er war nicht mehr so wendig, dafür aber reifer, und jetzt hatte er ganz einfach Glück. Weshalb sollte es ihm immer schlecht gehen? Die Sternstunden seiner Laufbahn, weiß Gott, er konnte sie an einer Hand herzählen, damals in Hanoi, elf Jahre war das her, später dann am Bosporus... Und nun an der Seite des Präsidenten in dieses Land, womöglich verband sie das, vielleicht brauchte ihn dieser Mann und er wurde sein Sprachrohr, sein Freund etwa in dem Sinne, wie der Kennedys Freund gewesen war – kein persönliches Gefühl, so vermessen war er nicht, einfach Partnerschaft, Kooperation, sachliche Bindung mit Feinempfinden für die Probleme des Caudillos? Nein, da griff er nicht zu hoch, die Chance war da, das hatte es schon oft gegeben, Castro und Dubois, ihm fielen weitere Beispiele ein. Für die Dauer des Bürgerkriegs an der Seite des Staatschefs, als Chronist und Berater in Sachen Presse, einer der Unentbehrlichen.
Der Wagen hielt, man stieg aus und kam ungehindert durch die Kontrolle, ein Flugplatzbeamter führte sie ohne Formalitäten ganz ans Ende der Halle und schloss eine Nebentür auf. Und dort, weit weg, stand die dominicanische Maschine schlank und silbergrau abseits auf einer Piste, ein leichter Bomber – mittelschwer hätte man zu Varelas Zeit, im zweiten Weltkrieg, gesagt – mit glitzernden Tragflächen, an Rumpf und Leitwerk das fremde Hoheitszeichen. Wie viel Menschen fasste sie wohl, höchstens ein Dutzend... Wie von der gleichen Furcht gepackt, drängten und liefen alle dem Präsidenten nach, dessen weißer Schopf die Spitze des Pfeils markierte, der auf das Flugzeug gerichtet war. Varela spürte leichten Schwindel, die Sonne erschlug ihn, wabernde Hitze über dem Rollfeld – er war nicht in Form, etwas in ihm war nicht so, wie es sein sollte; doch damit würde er fertig werden. Auch die Hotelrechnung fiel ihm ein, nun, Norton musste telegrafisch zahlen... Neben ihm fragte Frau Ortíz: "Wo bringt sie uns denn hin?" Jemand antwortete ihr atemlos: "Vermutlich nach Santiago..." Gewiss, den Flughafen der Hauptstadt hielt die Gegenseite, aber es gab noch andere, von ihr nicht kontrollierte Plätze.
Endlich die Gangway, schmal und steil, blau uniformierte Polizisten und Sicherheitsbeamte sperrten sie ab, Varela sah es mit Sorge, noch konnte man ihn zurückweisen. Da hörte er einen baumlangen US-Polizeioffizier sagen: "Bedaure, Mr. Bosch, es ist zwecklos, einzusteigen, es gibt keine Starterlaubnis."
"Sie haben Befehl, mich festzuhalten?"
"Durchaus nicht, Sir; aber die dominicanische Luftwaffe..."
"Ich wünsche Ihre Vorgesetzten zu sprechen."
"Es liegt nicht bei uns, Sir. Das Flugzeug könnte drüben nirgends landen. Ihre Streitkräfte haben mitgeteilt, dass sie nicht gemeldete Maschinen abschießen; die Basen scheinen ausnahmslos in deren Hand."
Die Sätze klatschten wie Peitschenhiebe, sie rissen Varela aus seinem Traum, zurück in die schäbige Wirklichkeit. Aus, vorbei! Der Offizier übrigens schien nur so groß, er stand auf einer Treppenstufe und erläuterte einen Sachverhalt, für den er keine Verantwortung trug. "Dreihundert Meilen vorm Ziel", schrie jemand. "Und Sie hindern uns...!"
"Keineswegs. Bitte, fragen Sie doch die Besatzung."
Auf alle fielen die Worte herab wie fressendes Feuer, Varela sah Tränen in den Augen seines Nebenmanns. Die Besatzung kletterte heraus, der Pilot meldete: "Hauptmann Caminero. Herr Präsident, wir haben versucht, Santiago zu nehmen, doch es scheint missglückt..."
"Wie sind Sie herausgekommen?", fragte Bosch.
"Wir hatten Befehl, die Hauptstadt anzugreifen, Radio Santo Domingo..."
"Es muss einen Fleck geben, wo Sie landen können!"
"Nicht mit dieser Maschine, Herr Präsident. Auf Plätzen wie Puerto Plata ist die Landebahn zu kurz."
Bosch gab nicht auf, doch man hörte ihn kaum mehr, abseits fauchten Triebwerke, sein Protest erstickte in der schrecklichen Glut. Er hob die Arme, wie ein alt gewordener Schauspieler merkte er nicht, dass der Vorhang längst gefallen war. Wieder spürte Varela sein Herz, wozu hatte er sich auch so hektisch engagiert? Er blickte auf den Hauptmann, seine Sympathie für Bosch schwand, und angewidert sah er sich den Mann aufgeben, dessen Freund er hatte werden wollen: hurenhaft flink wandte er sich dem nächsten zu, diesem Caminero, dessen Story Trost versprach – die Flucht des "Canberra"-Piloten.
Ein Augenblick der Selbsterkenntnis, schlimmer Skrupel, ja! Und ehe ihm klar geworden war, was tun, resignieren oder handeln, brüllte der Polizeioffizier, dem man Camineros Worte übersetzt hatte: "Alles zurücktreten, sofort, es ist Sprengstoff an Bord!" Varela wurde zurückgestoßen, abgedrängt, er fühlte sich gedemütigt und isoliert. Die Dinge waren am alten Platz, er stand wieder da, wo er gestern um diese Zeit hier gestanden hatte.
2
Am Vortag, nach dem erst unsicheren und dann fast vollständigen Sieg im Zentrum von Santo Domingo, war Oberst Juan Tomás sogleich – wenn auch innerlich zögernd – nach Santiago aufgebrochen. Er hatte die Hauptstadt über die Avenida Presidente John F. Kennedy verlassen, einer Rollbahn des ehemaligen Andrews-Flugplatzes. Keine Zeit für Erinnerungen, doch es schien derselbe öde Fleck, wo ihn vier Jahre zuvor Mario Luna gegen seinen Willen in das Komplott gezerrt hatte. Und eben dort, am Ort jenes Wendepunkts, erwartete ihn eine kleine Kolonne aus dem Camp "16. August", fünf Lastwagen und drei Panzer, damit sein Schritt Gewicht bekam; wenigstens symbolisch, das Scheppern von Panzerketten war ja ein starkes Argument.
Ein entscheidender Schritt, das wussten alle. Es ging darum, den Stoß über den Stadtrand hinauszutragen, um "das Land zu tränken", wie Molina Ureña geäußert hatte, der Provisorische Präsident. Die Politiker sahen dies als "Fackel der Freiheit" an, als Funken, der die Herzen entflammen sollte; sie dachten gern in solchen Begriffen. Ihm aber, Tomás, war darüber hinaus auch klar, dass einem gar keine Wahl blieb. Den Gesetzen des Bürgerkriegs folgend musste man einfach ausbrechen – und zwar nach Nordwesten, die zwei anderen Richtungen blockierte der Feind. Im Osten die Faust von San Isidro mit den Panzern Wessíns und der Jagdbomberstaffel, die die Innenstadt angriff; im Südwesten tausend Mann unter General Montás, der in Schweigen verharrte. Sie warteten ab, all die Lokalgrößen und schwankenden Provinzkommandeure, wie üblich bereit, mit dem Sieger zu gehen... Er musste ihnen zeigen, wer das war, bevor der Feind sich dazu aufraffte, es ihnen zu zeigen.
Ein heikler Versuch, mit so geringen Kräften, Ramirez und Caamaño, die militärischen Führer, räumten es ein. Ihre Wahl war auf Tomás gefallen, weil dessen Vater die Nordwestregion befehligte; er selber glaubte allerdings nicht, dass ihm dies viel helfen würde. Ach, er kannte seinen Vater! Der würde ihm zwar keine Falle stellen, wie das bei Montás zu befürchten war, aber letztlich war der General Tomás auch nur einer derjenigen, die sich dem Stärkeren anschlossen. Bemüht, in dem Wirrwarr herauszufinden, wer denn nun den kürzeren zog, stellten die Befehlshaber sich tot, schickten ihre Adjutanten ans Telefon, verharrte die Provinz Gewehr bei Fuß, bis die Würfel gefallen waren.