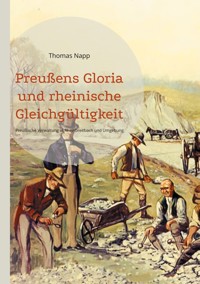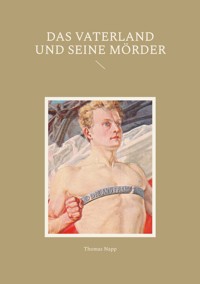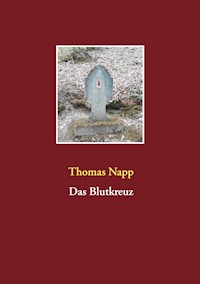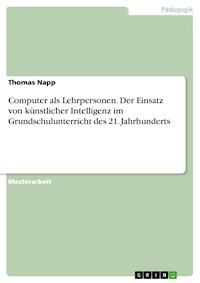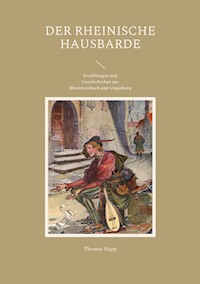
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In diesem Geschichtsbändchen mit dem Titel "Der rheinische Hausbarde: Erzählungen und Geschichtchen aus Rheinbreitbach und Umgebung" wurden einige lokalhistorisch belegte Ereignisse zusammengetragen und mit Phantasie historisch erweitert. Das Ziel ist es dabei historische Ereignisse, die teilweise wirklich passiert sind, wieder zum Leben zu erwecken und in einen möglichen historischen Kontext zu stellen. Da ist z.B. die Geschichte eines erhängten Mannes aus Rheinbreitbach, deren Todesumstände bis heute ungeklärt sind oder das grausame Schicksal eines kleinen Mädchens aus Bruchhausen, dessen Kleid am Kohleofen Feuer fing und elendig verbrannte. Die lokalhistorischen Ereignisse sollen dabei nicht nur die Fakten wiederspiegeln, sondern bewusst auch einen moralischen und erzieherischen Impuls geben, den jeder für sich selbst überdenken kann. Das Büchlein stellt sich dabei ganz in die Tradition von den Kalendergeschichten, die einst im rheinischen Hausfreund von Johann Peter Hebel veröffentlicht wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
In diesem Band mit dem Titel „Der rheinische Hausbarde: Erzählungen und Geschichtchen aus Rheinbreitbach und Umgebung“ sind mehrere Geschichten aus dem Raum der Verbandsgemeinde Unkel zusammengefasst. Schwerpunktmäßig auf Geschichten aus Rheinbreitbach fokussiert, greifen einige Erzählungen lokalhistorische Ereignisse und Entwicklungen auf, die zu unterhaltsamen und lehrreichen Anekdoten umgearbeitet worden sind. Die Geschichten, welche einen historischen Kern haben, sind noch einmal besonders gekennzeichnet. Das Ziel dieses Werkes ist es auf der einen Seite zu unterhalten, aber auch zum Nachdenken anzuregen. Der Titel ist daher an den rheinischen Hausfreund von Johann Peter Hebel angelehnt, der mit seinen historischen Kalendergeschichten ein ähnliches Ziel verfolgte. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
Mit den besten Wünschen
Thomas Napp
Inhaltsverzeichnis
Der Erhängte von Rheinbreitbach
Der Knecht und das Winzermädchen
Der anhaltsche Reiter vom Westerwald
Die Juffer Piele
Adelgund von Breitbach
Die Geschichte vom reichen Weinhändler
Der Schuster und die 30 Silberlinge
Die Rheinfischer
Vom jungen Jäger und dem Freischütz in Rheinbreitbach
Vom kaltherzigen Herren von Berg
Über den richtigen Obstbaumschnitt
Über die Liebe Gottes
Vom tapferen rheinbreitbacher Schuster
Wie die Pest nach Rheinbreitbach kam
Lehrer Heinemann und das erhängte Winzermädchen
Über Flucht und Vertreibung
Geld ist Macht und Macht ist Geld?
Die Freundschaft von Ali und Frederick
Die Erbschuld
Der Erhängte von Rheinbreitbach (historisch)
Es war zu Zeiten des Kaiserreichs im Jahre 1892 in Rheinbreitbach als ein Wanderer mit seinem Hund den Waldweg von der Vonsbach das kleine Tal hinauf Richtung der Breiten Heide nahm, als sein Hund in einem abseits gelegenen Dickicht verschwand und lauthals zu bellen begann. Durch das Gebell aufmerksam geworden, ging der Wanderer dem Hund nach. Als er sah, was dieser dort am Boden liegend entdeckt hatte, lief es ihm eiskalt den Rücken herunter. Im weichen Blätterlaub lag ein abgetrennter junger Männerkopf. Nicht weit entfernt davon ruhte der dazugehörige Körper. An der in der Nähe gelegenen Eiche schwang an einem dicken Ast ein Seil mit einer Schlaufe im Wind leicht hin und her. Offensichtlich hatte sich der junge Mann hier unbemerkt aufgehangen. Da ihn niemand gefunden hatte, war mit der Zeit sein Hals immer länger geworden und der Kopf hatte sich letztlich vom Körper getrennt. Erschrocken über den Fund der Leiche, eilte der Wanderer zurück ins Dorf, um dort den Dorfpolizisten zu alarmieren. Dieser nahm ruhig die Nachricht entgegen, nahm sich zwei Hilfspolizisten und eine Bahre mit und ließ sich vom Wanderer den Tatort zeigen. Schnell war allen Beteiligten klar, dass es sich bei dem Erhängten um einen Selbstmord handeln musste, da keinerlei Fremdeinwirkung festzustellen war und sich unter der freischwingenden Schlinge ein umgekippter Holzhocker befand. Behutsam nahmen die Hilfspolizisten zuerst den Körper auf die Bahre, bevor sie den Kopf des Erhängten aufhoben und zu seinem Körper legten. Als der Dorfpolizist das Gesicht des Erhängten sah, erkannte er den Toten. Es handelte sich um den Dorfschullehrer Mendel aus Rheinbreitbach. Seit ein paar Wochen war dieser als vermisst gemeldet und böse Zunge hatten behauptet, dass er sang und klanglos vom Schulamt an eine andere Schule versetzt worden sei, weil er zu freundlich mit den Kindern umgegangen war und sich der Prügelstrafe widersetzt hatte. Er lebte die Werte von Güte, Liebe und Menschlichkeit anstatt Nationalismus, Vaterlandstreue und blinden Gehorsam zu lehren. Die Kinder liebten und respektierten ihn für diese Einstellung, doch bei seinen Kollegen und der Bevölkerung war er hingegen deshalb nicht gut angesehen. Auch flüsterten die Rheinbreitbacher hinter vorgehaltener Hand, warum ein solch junger Mann noch keine Frau habe und sich nur mit dem Studium der Bücher beschäftigte. Ebenso wenig trank er Alkohol oder rauchte Pfeife. Auch soll er wegen Plattfüßen keinen Militärdienst absolviert haben. Kurz gesagt, der junge Lehrer hatte so gar nicht dem Männerbild des Kaiserreichs entsprochen.
Als nun die Hilfspolizisten mit der Bahre in den Ort Rheinbreitbach kamen, begann zugleich das Gemurmel in der Bevölkerung. Als einer von ihnen den Lehrer Mendel erkannte, ging die Todesnachricht wie ein Lauffeuer herum. Manch einer sagte direkt, dass das bei diesem komischen Kauz wohl nicht verwunderlich wäre. Andere wiederum (vor allem die Kinder) trauerten um den liebevollen Lehrer. Als der Ortspfarrer Katterbach von der Todesnachricht hörte, begab er sich sofort zum Aufbewahrungsort des Leichnams. Zusammen mit dem Dorfpolizisten versuchte er herauszufinden, ob er irgendwelche Angehörigen hatte. Doch der gebürtige geschwisterlose Bonner war schon früh elternlos geworden, sodass er niemanden mehr hatte. Es gab also niemanden, der die Beerdigung für den Toten organisieren. Somit bereitete Pfarrer Katterbach ein Begräbnis außerhalb des Friedhofs von Rheinbreitbach vor. Denn Selbstmörder wie Lehrer Mendel wohl einer war, durften nicht auf dem normalen Friedhof bestattet werden. Es waren einige Tage vergangen und Pfarrer Katterbach nahm die Beichte in der katholischen Kirche von Rheinbreitbach ab, da erschien die einzige junge Lehrerin der Volksschule Rheinbreitbach, Fräulein Ittenbach, in der Kirche. Sie war bekannt für ihre strenge Art und war in der Bevölkerung deshalb beliebt und geachtet. Sie trug ein schlichtes zugeknöpftes Kleid und einen Damenhut auf dem Kopf. Andächtig setzte sie sich in den Beichtstuhl und bekreuzigte sich. Dann begann sie zu erzählen, dass sie sich schuldig gemacht habe und sie nun Buße tun wolle. Pfarrer Katterbach hörte ihr zu und ermutigte sie ihre Sünde zu erläutern. Fräulein Ittenbach erzählte, dass sie der Selbstmord des Lehrers Mendel schwer getroffen habe und sie an dessen Tod wohl nicht unschuldig sei. Pfarrer Katterbach wurde nun aufmerksamer und bat das Fräulein fortzufahren. Diese erzählte nun, dass sie Lehrer Mendel als Kollege nicht gut behandelt habe. Wie allgemein bekannt, war Lehrer Mendel eher ein gütiger als ein strenger Lehrer gewesen. Auch sein Aussehen und Auftreten entsprach eher nicht dem eines typischen Mannes des Kaiserreichs. Oftmals hatten sie und auch andere Kollegen ihn ermahnt, dass er nicht so ein weichgespülter Hanswurst sein solle. Stärke, Disziplin und Strenge seien die Tugenden, die ein Mann vorleben müsse. Als Lehrer Mendel dann entgegen seiner stillen Art mit ihr einmal ein Rendezvous haben wollte, sagte sie, dass sie keinen Mann haben wolle, der sie nicht beschützen und noch nicht einmal mit der flachen Hand auf den Tisch schlagen könnte. Dies hatten einige Rheinbreitbacher mitbekommen, sodass sich die Nachricht wie ein Lauffeuer im Ort verbreitet hatte und sich über ihn lustig machten.
Pfarrer Katterbach hörte Fräulein Ittenbach ruhig zu. Auch er hatte von dieser Begebenheit gehört, sich dabei aber nichts gedacht. Nun sprach er dem Fräulein Ittenbach ins Gewissen. Er sagte, dass es in Ordnung sei, einen Mann abzulehnen, doch sollte dies immer mit Respekt und Nachsicht erfolgen. Das Gesicht desjenigen, der um ein Rendezvous bittet, solle gewahrt bleiben. Beschämt schaute das Fräulein zu Boden und Pfarrer Katterbach erteilte ihr die Absolution mit der Auflage die kommenden Wochen für den Lehrer Mendel zu beten. Als Pfarrer Katterbach am Abend zu Bett ging, dachte er noch einmal über das Begräbnis des Lehrer Mendel dar. Sollte er nach diesen Geschehnissen wirklich wie ein Selbstmörder außerhalb von Rheinbreitbach beerdigt werden? War nicht Mendel auch das Opfer von den unabänderlichen gesellschaftlichen Vorstellungen der Menschen geworden? Lange dachte Katterbach noch darüber nach, was einen Mann eigentlich zum Manne mache. Warum kann ein Mann nicht gutmütig und menschlich sein? Warum muss ein Mann in unserer Gesellschaft in die Rolle des unangefochtenen Patriarchen schlüpfen und seine Familie als Haupternährer versorgen? War Jesus nicht auch ein gütiger und nachgiebiger Mensch gewesen? Erst spät in der Nacht schlief Pfarrer Katterbach ein. Im Traum hörte er eine Stimme sprechen, die ihm riet, seinem Herrn zu folgen, auch wenn dies nicht immer auf Gegenliebe stoßen würde. Am nächsten Morgen wusste Pfarrer Katterbach, was er zu tun hatte. Er ordnete zur Verwunderung der Rheinbreitbacher an, dass der Lehrer Mendel auf dem Friedhof neben der Kirche bestattet werden solle und es eine normale Trauerfeier für den verstorbenen Lehrer Mendel geben solle.
Als der Tag der Trauerfeier gekommen war, waren alle Bänke der Kirche voll besetzt. Ehemalige Kollegen, das Fräulein Ittenbach, zahlreiche Schulkinder sowie viele Rheinbreitbacher hatten sich eingefunden, um der Trauerfeier beizuwohnen. Als die Feier zur Predigt hin ging, warteten alle gespannt auf die Rede des Herrn Pfarrers. Ehrfürchtigen Schrittes erklomm er die Stufen zur Kanzel hin, um von dort oben eine flammende Rede zu halten. Katterbach sprach den Leuten ins Gewissen, dass jeder Mensch das Recht habe so zu leben, wie er es wünsche. Niemand habe sich deshalb über einen lustig zu machen oder ihn deshalb nicht ernst zu nehmen. Respekt vor dem Leben und christliche Nächstenliebe seien die Grundtugenden des Katholizismus, an deren sich einige in Rheinbreitbach versündigt hätten. Lehrer Mendel hingegen habe mit seiner Art diesen Tugenden entsprochen und wurde deshalb von der Gesellschaft als Mann abgelehnt. Die christliche Gemeinschaft habe hier bei Lehrer Mendel versagt und unsere Aufgabe sei es nun, die Erinnerung daran wachzuhalten, dass kein Mensch, egal ob Mann oder Frau, in eine bestimmte Rolle gezwungen werden darf, die er nicht selbst ausfüllen möchte. Aus diesem Grunde würde Lehrer Mendel auch ein christliches Begräbnis auf dem Kirchfriedhof bekommen, da er nicht nur Sünder, sondern auch Opfer der gesellschaftlichen Rollenbilder sei, die in unserem Dorfe vorherrschen.
Als Pfarrer Katterbach seine Predigt beendet hatte, schauten die Rheinbreitbacher betrübt zu Boden. Ein Großteil von ihnen hatte auf die eine oder andere Art abfällig über Lehrer Mendel gesprochen, was sie nun bereuten und zum Denken brachte.
Der Knecht und das Winzermädchen
In dem kleinen Weinort Rheinbreitbach lebte einst im Mittelalter ein wunderschönes Winzermädchen namens Annemarie. Sie hatte lange blonde Haare und braune Augen und war bei den jungen Männern im Ort heiß begehrt. Vor allem ein reicher und starker Bauernsohn namens Heinrich hatte einen Blick auf das Mädchen geworfen und würde es gerne zur Frau nehmen, um es auf den familieneigenen und prächtigen Winzerhof zu führen. Somit warb Heinrich Tag ein und Tag aus um die Gunst des blonden Winzermädchens Annemarie. Doch der Charakter von Heinrich war angeberisch und anmaßend und solche Männer liebte Annemarie überhaupt nicht. Ihre Liebe gehörte einem anderen Mann namens Georg. Georg war arm und seine Körperstatur war schmächtig. Er lebte als Knecht auf der Burg des Herren von Breitbach und war es gewohnt trotz seiner Körperstatur schwere Arbeiten zu verrichten. Doch Annemarie liebte sein gütevolles und mitfühlendes Wesen. Gerne würde sie ihn trotz seiner Armut zum Manne nehmen.
Doch die Eltern von Annemarie hielten nichts von dem abhängigen Knecht. Ihr Favorit war der reiche Heinrich, der den eigenen Familienreichtum mehren sollte. Dies betrübte Annemarie und vor allem den Knecht Georg sehr. Wie gerne hätte er ein kleines Vermögen, um Annemarie heiraten zu können. Denn Georg liebte Annemarie so sehr wie Annemarie ihn. Doch je mehr Gedanken Georg sich über seine Liebe machte, desto bewusster wurde ihm, dass er Annemarie nie bekommen würde.
Doch der Herr von Breitbach, der ein weiser Adliger war, erkannte, dass seinen Knecht etwas quälte. Er ließ ihn zu sich in die Burg kommen und sprach, dass der Knecht trotz seiner schmächtigen Körpergröße außergewöhnliche Arbeit leiste und er sehr zufrieden mit Georg sei. Seit einiger Zeit würde ihm jedoch auffallen, dass er nicht mehr mit Freude und Tatendrang bei der Arbeit sei, sondern traurig und niedergeschlagen wirke. Er wolle wissen, was Georg belaste. George erzählte seinem Herrn von seiner unglücklichen Liebe zu Annemarie und dass er sie nicht heiraten könne, weil er im Gegensatz zu dem Winzersohn Heinrich arm und schmächtig war.
Der Herr von Breitbach verstand seine Situation. Da er jedoch ein gütiger und schlauer Mensch war, ließ er Annemarie, deren Eltern sowie den Winzersohn Heinrich und Georg am nächsten Tage zu sich kommen. Er schlug vor, dass ein Wettkampf gleich dem Gottesurteil zwischen Rittern entscheiden solle, wer Annemarie zur Frau bekommen solle. Der Kampf mit Knüppel und Schild solle entscheiden, wer der Sieger sei. Siegessicher willigte der starke Winzersohn Heinrich sofort diesem Vorschlag zu. Er sah seine Chance gekommen, endlich das wunderschöne Winzermädchen für sich zu gewinnen. Auch die Eltern von Annemarie willigten diesem Vorschlag zu, da sie sich sicher wahren, dass Heinrich dieses Duell gewinnen werde.
Der Knecht Georg hingegen wusste am Anfang nicht recht, ob er darauf eingehen solle. Schließlich sah er kaum eine Chance Heinrich zu besiegen. Doch mit dem Zureden von Annemarie willigte auch er dem Wettkampf zu.
An einem Samstag kamen beide Kämpfer auf dem Burgplatz zusammen. Alle Menschen aus dem Ort hatten sich dort um den vorbereiteten Kampfplatz versammelt. Der Herr von Breitbach saß auf einer kleinen Tribüne auf einem kleinen Holzthron und war der Richter dieses Duells. Beide Kämpfer bekamen ein Holzschild sowie einen dicken Knüppel ausgehändigt und einen ledernen Helmschutz um den Kopf gebunden. Siegessicher stapfte Heinrich zur Mitte des Kampfplatzes und grinste über das ganze Gesicht. „Ich mach dich fertig, kleiner Knecht!“, raunte er zu Georg.
Eingeschüchtert, aber mit festem Schritt trat Georg ebenfalls zur Mitte des Kampfplatzes, sodass sich beide Kämpfer nun gegenüberstanden. Mit einem Fahnenwink begann der Kampf und Heinrich begann mit lautem Geschrei und harten Knüppelschlägen auf den Knecht Georg einzuschlagen. Dieser ließ vor lauter Schreck seinen Knüppel fallen und hielt sich mit beiden Händen fest an dem Holzschild fest, um sich vor den harten Schlägen Heinrichs zu schützen. Ein Raunen ging durch