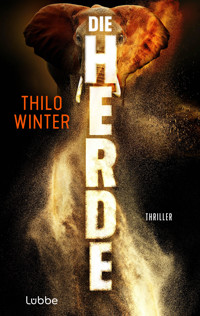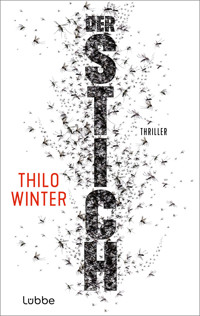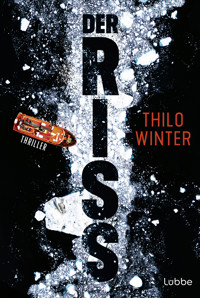
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Vulkanologin Antonia Rauwolf wird mit einem ungewöhnlichen Auftrag zu einer Forschungsstation im bedrohten ewigen Eis der Antarktis geschickt: Sie soll herausfinden, ob die kürzlich entdeckten knapp hundert Vulkane aktiv werden könnten, denn ein Ausbruch hätte katastrophale Folgen für das Weltklima. Was keiner weiß: Sie ist auch gekommen, um nach ihrem Bruder Emilio zu suchen, der nach einer verhängnisvollen Expedition in die eisige Wüste als vermisst gilt. Bei ihren Nachforschungen kommt Antonia gefährlichen Machenschaften auf die Spur. Durch illegale Bohrungen geraten Eisplatten in Bewegung, die seit dreißig Millionen Jahren den Lebensraum vieler Arten beschützt haben. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Ein rasanter Thriller vom eisigsten Schauplatz der Welt
Thilo Winter schreibt erschreckend nah an der Realität
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumHinweisTEIL 1Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13TEIL 2Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26TEIL 3Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41NachwortÜber dieses Buch
Die Geologin Antonia Rauwolf wird mit einem ungewöhnlichen Auftrag ins nicht mehr ganz so ewige Eis der Antarktis geschickt: Sie soll herausfinden, ob die kürzlich entdeckten knapp 100 Vulkane aktiv werden könnten. Ein Ausbruch hätte katastrophale Folgen für die ganze Welt. In der Forschungsstation angekommen, stellt Antonia fest, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Bei ihren Nachforschungen kommt sie dem Robotik-Experten Pietro Malatesta in die Quere, der auf eigene Faust nach Diamant-Vorkommen sucht. Durch die Bohrungen geraten Eisplatten in Bewegung, die seit fünfzig Millionen Jahren den Lebensraum vieler Arten beherbergt und beschützt haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Über den Autor
Thilo Winter ist ein deutscher Schriftsteller und Wissenschaftsjournalist. In seinen Reportagen berichtet er über Unterwasserforschung mit Tauchrobotern, archäologische Funde in abtauenden Gletschern, den Klimawandel als Ursache für den Untergang früher Kulturen und die Zukunft der Polargebiete. Winter arbeitet u.a. für die Zeitschriften Spiegel Geschichte, bild der wissenschaft und Spektrum der Wissenschaft. Er studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Ethnologie. Er ist ein versierter Romanautor, mit »Der Riss« legt er seinen ersten Wissenschaftsthriller vor.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: Kristin Pang
Einband-/Umschlagmotiv: © Michael Schauer/AdobeStock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2848-5
luebbe.de
lesejury.de
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
TEIL
1
Kapitel 1
7. Dezember
Der grüne Pistenbully rollte durch eine weiße Welt ohne Horizont, in der Himmel und Schnee nicht voneinander zu unterscheiden waren. Eiskristalle glitzerten auf der Windschutzscheibe. Emilio drückte sich tief in den Beifahrersitz und bildete sich ein, die sanfte Wärme des Sonnenlichts auf dem Gesicht zu spüren. Tatsächlich war es die Heizung, deren Gebläse die Temperatur in der Kabine auf sieben Grad anhob. Draußen herrschten minus zwanzig Grad Celsius – ein Sommertag in der Antarktis.
Das Kettenfahrzeug schwankte und stöhnte, wenn Malatesta es über Schneeverwehungen rattern ließ. Emilio hatte sich an die Erschütterungen gewöhnt. Seit zwei Tagen waren sie jetzt schon unterwegs nach Südwesten, und zwei weitere Tage lagen noch vor ihnen. Die Stunden krochen so langsam dahin wie das Polarmobil, denn Pietro Malatesta sprach nicht viel. Schon in der Station war der Sizilianer stets in seinem Labor verschwunden, wenn es im Gemeinschaftsraum gesellig wurde, wenn sich ein Kollege an das E-Piano setzte und ein anderer nach der Gitarre griff, um die endlosen Abende mit Leben zu füllen. Hätte Emilio es sich aussuchen können, wäre er lieber mit einem anderen Wissenschaftler der Neumayer-III-Station zu der Reise aufgebrochen, mit einem Biologen wie ihm, mit dem er sich über Artemis hätte unterhalten können. Aber Malatesta war nun mal der Geologe des Teams und sollte am Zielort nach Temperaturanomalien suchen. In der Westantarktis war unter dem Eis ein großes Vulkanfeld entdeckt worden, und bislang war unklar, ob die einundneunzig Vulkane schliefen oder aktiv waren.
Die Entdeckung hatte weltweit für Aufsehen unter Wissenschaftlern gesorgt, denn sie befürchteten, dass ein Ausbruch den Westantarktischen Eisschild abschmelzen lassen könnte. Die unmittelbaren Folgen wäre der Anstieg des globalen Meeresspiegels um mehrere Meter und der Untergang vieler Küstenregionen und Inseln. Nun sollten sich die beiden Forscher vor Ort ein Bild von der Lage machen – in der abgelegensten Region des abgelegensten Kontinents der Erde.
Eisregen prasselte gegen das Fahrzeug. Malatesta schaltete den Scheibenwischer ein, der gefrorene Bröckchen mit einem Kratzen zur Seite schaufelte. Emilio drehte den Regler für die Belüftung der Windschutzscheibe höher. Ein Geräusch wie von einem Föhn brauste durch die Kabine.
Das war typisch für dieses seltsame Land: Im einen Moment zeigte sich das Wetter von seiner freundlichen Seite, im nächsten rollte ein Sturm über die konturlose Landschaft und stellte die Ausrüstung und das Geschick der Forscher auf die Probe. Kein Wunder, dachte Emilio, dass es im Landesinnern der Antarktis kein Leben gab. Sämtliche Tiere und Pflanzen hatten so viel Verstand, entweder im Meer oder an der Küste zu leben. Nur der Mensch musste seine rot gefrorene Nase mal wieder dorthin stecken, wo sie eigentlich nicht hingehörte: mitten in das weiße, kalte Nichts.
Emilio betrachtete die Instrumente. »Wind aus Osten, etwa siebzig Knoten.«
Malatesta stellte den Scheibenwischer eine Stufe höher. Als die Sicht trotzdem nicht besser wurde, schaltete er das zusätzliche Paar Wischer ein. Wie zur Antwort klatschte eine Ladung Schnee gegen die Fenster. Malatesta nahm den Fuß vom Gas und brachte den Motor in den Leerlauf. Der Pistenbully blieb stehen.
»Warum halten wir?«, fragte Emilio.
Der Geologe wandte ihm das Gesicht zu. »Wir warten«, antwortete er. Seine eckigen Züge wirkten hart, und auf seinen Wangen hatte Akne ein Minenfeld hinterlassen, das ein schwarzer Vollbart notdürftig bedeckte. Seine Augen waren tief liegend und sahen geschwollen aus. Emilio schien es, als leide Malatesta an einer Krankheit, die ihm ständig Schmerzen bereitete. Wen wundert’s?, dachte er. Wenn ich mich als Deutscher in dieser Kälte schon nicht wohlfühle, wie muss es dann erst jemandem gehen, der aus Sizilien stammt?
»Zeit für Bewegung«, sagte Malatesta und tippte mit einem behandschuhten Finger gegen die Uhr auf dem Armaturenbrett.
»Jetzt?« Emilio mochte es kaum glauben. Unterwegs hielten sie einen strengen Plan ein und stiegen einmal in der Stunde aus dem Polar 300, gingen umher und brachten den Kreislauf in Schwung. Die Übungen verhinderten, dass sie in der Kabine einschliefen, was angesichts der gleichförmigen Umgebung, des Motorbrummens und des abwechslungslosen Brausens der Lüftung rasch geschehen konnte. In einen Sturm mit Böen von siebzig Knoten hinauszugehen war allerdings viel gefährlicher, als in der Kabine einzudösen.
»Du kannst ja hier sitzen bleiben.« Damit schien für den Geologen alles gesagt zu sein. Wenn er sprach, redete er laut, und seine Worte klangen entweder wie Befehle oder wie Beschimpfungen. Er zog sich die Sturmhaube, die Balaklava, über den Kopf, sodass nur noch seine Augen zu sehen waren, und setzte die Schneebrille auf. Dann schlug er die Kapuze seines Schutzanzugs hoch und schloss den Rand aus synthetischem Fell zu einem Kreis, bis sein vermummtes Gesicht wie aus einem Tunnel herausschaute. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, entriegelte Malatesta die Tür. Als er sie einen Spaltbreit geöffnet hatte, packte der Wind zu und riss sie auf. Frostige Luft wehte in den kleinen Raum, die Kälte biss Emilio in die Wangen. Malatesta schwang sich aus dem Fahrzeug, die Tür flog zu.
Das war doch Selbstmord! Emilio starrte auf den leeren Fahrersitz, auf den sich sanft Schneeflocken senkten, die durch die offene Tür hereingedrungen waren. Er wusste, dass Malatesta eigenartig war, und die Kollegen auf der Station rissen Witze über seine Faszination für Zahlen. Aber das war etwas anderes, als aus dem Kettenfahrzeug in einen antarktischen Sturm zu springen, nur weil die Uhr eine gewisse Zeit anzeigte.
Sechs Uhr. Emilio versuchte, aus dem Fenster zu blicken, aber die Scheiben waren mit Schnee verklebt. Er griff nach seiner Ausrüstung, streifte sich die Handschuhe über und verharrte. Wenn Malatesta sein Leben aufs Spiel setzte, um eine Manie zu pflegen, war das seine Angelegenheit. Warum also sollte Emilio ihm folgen? Die Antwort lag auf der Hand: um ihn wieder in die Kabine zu bringen, bevor der Sturm ihn Gott weiß wohin trieb. Schon in zehn Meter Entfernung würde Malatesta den Pistenbully nicht mehr erkennen können. Und wenn er dann, durch den Wind herumgewirbelt, auch noch die Orientierung verlor, lief er Gefahr, blindlings in die Eiswüste hinauszustapfen.
Emilio schlug mit der dick behandschuhten Hand gegen die Scheibe. »Verfluchter Sizilianer!«, rief er, und der Sturm schien ihn auszulachen. Wenige Augenblicke später stand er im Freien. Er hatte seinen Kopf ebenso geschützt wie Malatesta und trug einen roten Tempex-Anzug, unter dem sich mehrere Lagen Schutzkleidung befanden. Der Kälteschutz war so unförmig, dass er Emilio in einen roten Schneemann verwandelte, der dem Wind viel Angriffsfläche bot. Augenblicklich packte ihn der Sturm und ließ ihn rückwärts taumeln. Er stemmte sich dagegen, um nicht vom Fahrzeug weggetrieben zu werden. Der Polar 300 war der einzige sichere Punkt in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern.
Emilio hielt sich an der Verstrebung der Schaufel fest, die vorn an dem Fahrzeug angebracht war. Mit ihrer Hilfe wurden Hindernisse aus Schnee beiseitegeräumt. Er schaute sich um. Von Malatesta war nirgendwo etwas zu sehen. Mit einer Hand hielt er sich am Pistenbully fest und umrundete ihn bis zur Fahrerseite. Die Spuren, die sein Kollege im Eis hinterlassen haben musste, waren schon wieder verweht. Er rief den Namen des Geologen, aber der Wind riss ihm die Silben von den Lippen.
Vielleicht war Malatesta in den Laborcontainer gestiegen. Der Polar 300 zog sieben Anhänger hinter sich her, die ersten beiden waren mit Containern beladen: einer enthielt die wissenschaftliche Ausrüstung, der andere war als Forschungsstation eingerichtet, denn an ihrem Zielort würden sie zwei Wochen arbeiten.
Schritt für Schritt tastete sich Emilio vorwärts, bis er die Container erreichte. Beide Türen waren verschlossen und mit Metallriegeln gesichert. Wäre Malatesta hineingegangen, hätte er die Riegel nicht wieder anbringen können. Wo trieb sich dieser Wahnsinnige bloß herum?
Ein Knall war zu hören. Emilio konnte den Laut deutlich vom Brausen des Windes unterscheiden. Woher war der gekommen? Er ließ den Blick schweifen, überall herrschte weißes Treiben. Doch da! Eine Gestalt stand in einiger Entfernung und hielt sich an einem Anhänger fest. Malatesta! Immerhin hatte sich der Idiot nicht verlaufen. Emilio winkte mit hoch erhobenem Arm, aber die Gestalt rührte sich nicht. Was war nur los mit diesem Kerl? Vielleicht hatte er sich bei seinen Lockerungsübungen verletzt und schaffte es jetzt nicht mehr allein zur Kabine. Emilio atmete unter seiner Sturmhaube tief durch. Was soll’s, bringe ich ihn halt in Sicherheit. Hauptsache, wir müssen wegen ihm jetzt nicht umkehren. Der Gedanke daran, Artemis wegen Malatesta nicht auf die Spur kommen zu können, machte ihn wütend.
»Ich komme!«, rief Emilio und hangelte sich Stück für Stück an der Reihe der Anhänger entlang. Als er noch zwanzig Meter von Malatesta entfernt war, sah er, wie der Geologe einen Arm hob. Etwas blitzte auf. Wieder hörte Emilio einen Knall, und im nächsten Moment lag er am Boden. Sofort griff der Wind nach ihm und zog ihn über das Eis, bis er gegen die Kufen eines der Schlitten prallte und liegen blieb. In seinem linken Arm brannte Schmerz. Er konnte die Hand nicht mehr bewegen, erst glaubte er, sich bei dem Sturz etwas gebrochen zu haben, dann sah er, dass sich der Schnee unter ihm rot färbte.
Noch ein Knall war zu hören, dumpf hinter dem Vorhang des Schneetreibens. Eis spritzte auf. Malatesta schoss auf ihn! Was war in den Geologen gefahren? Woher hatte er überhaupt eine Waffe? So etwas war auf der Station verboten. Er musste sie eingeschmuggelt haben. Aber warum?
Ein Dutzend Fragen rasten durch Emilios Kopf, während er auf allen vieren über das Eis kroch, bloß weg von dem wahnsinnig gewordenen Sizilianer. Als er sich umdrehte, war von Malatesta nichts mehr zu sehen, das Schneetreiben hatte eine weiße Wand zwischen die beiden Männer gestellt. Emilio versuchte, die Angst zu unterdrücken, die ihm befahl, einfach draufloszurennen und den Schmerz in seinem Arm zu ignorieren. Er spürte ein Ziehen in den Muskeln, vermutlich gefror das Blut auf seiner Haut.
Er versuchte, so ruhig wie möglich zu atmen, bekam aber durch die Balaklava nicht genug Luft. Nach einigen Metern erreichte er die Fahrerkabine, zog sich am Türgriff hoch und stemmte die Tür gegen den Druck des Windes auf. Bevor er hineinkletterte, wandte er sich noch einmal um. Durch das weiße Rauschen kam etwas Rotes auf ihn zu. Malatesta. Emilio spürte Panik in sich aufsteigen, hatte das drängende Gefühl, sich entleeren zu müssen, aber er bekämpfte es. Komm schon, denk nach!, sagte er sich, bewahr einen kühlen Kopf, in dieser Umgebung sollte das doch kein Problem sein.
Wenn er in die Kabine stieg, saß er in der Falle. Dann konnte Malatesta sein Werk an ihm vollenden. Es sei denn, Emilio konnte zuvor losfahren, aber das war mit nur einem Arm schwierig. Bevor er das Fahrzeug in Gang gesetzt hätte, wäre Malatesta längst bei ihm. Emilios Hand krampfte sich um den Türgriff. Die Sicherheit des Polar 300 war nah, aber sie war trügerisch. Schweren Herzens ließ er die Tür wieder zufallen und hangelte sich geduckt in Richtung Schaufelblatt vor, um Distanz zwischen sich und seinen Verfolger zu bringen.
Er lugte über die Metallkante. Näherte sich Malatesta? Hatte er ihn gesehen? Er hörte ein helles Pling, die Schaufel erzitterte, der Sizilianer hatte das Titanblatt getroffen. Wie ein Alarmsignal tauchte der rote Tempex-Anzug aus dem Sturm auf.
Emilio ließ das Schaufelblatt los, stieß sich ab und landete auf dem Hintern. Der Sturm packte ihn und trieb ihn davon. Nach wenigen Augenblicken war er so weit gerutscht, dass er Malatesta und das Kettenfahrzeug nicht mehr erkennen konnte.
Über das Eis gleitend drehte sich Emilio auf die Seite und suchte mit der rechten Hand nach einem Halt im Pressschnee. Sein Handschuh zog Riefen in den Boden, während er wegrutschte. Ich bin ein Blatt im Wind, tönte ihm ein altes Lied durch den Kopf. Er biss sich auf die Lippen, glitt immer weiter, tastete um sich, doch kein Halt war in Sicht. Er warf sich herum, kam auf dem Rücken zu liegen, dabei klemmte er den angeschossenen Arm unglücklich ein und schrie auf. Er bohrte die Absätze der Polarstiefel in den Schnee. Diesmal funktionierte es: Er wurde langsamer, und nach einer Weile lag er still.
Er drückte sich dicht auf den Boden, spürte den Eisregen auf die Schutzkleidung prasseln, hörte den Wind heulen. Die Schneebrille war verrutscht und hatte einen Sprung bekommen. Er rückte sie gerade, so gut es ging. Dann zog er sich den rechten Handschuh aus und tastete in einer Tasche am Oberschenkel seines Anzugs herum. Er fand das Taschenmesser nach einer unendlich langen Zeit. Antonia hatte es ihm geschenkt, als sie noch Kinder waren – einen dieser Begleiter, mit denen man in jeder Lebenslage das richtige Werkzeug parat hatte. Emilio hatte das Messer schon oft benutzt, meist, um beim Zelten eine Dose Ravioli zu öffnen oder eine Flasche Wein zu entkorken. Nie zuvor war es ihm so sinnvoll erschienen wie in diesem Augenblick.
Er klappte die längste der vier Klingen aus, zog sich den Handschuh wieder über und trieb das Messer in den vereisten Untergrund. Dann warf er sich auf den Bauch und kroch vorwärts, auf die Stelle zu, wo er den Pistenbully vermutete, stieß das Messer wieder ins Eis, zog sich ein Stück vorwärts, er war ein Bergsteiger, der an einer horizontalen Wand kletterte. Nach einigen Metern kam er auf allen vieren voran, presste dabei immer wieder den verletzten Arm an den Körper und trieb die Klinge in kurz aufeinanderfolgenden Stößen in den Boden.
Emilio wusste, was er zu tun hatte. Sein Plan gefiel ihm ganz und gar nicht, aber es gab nur diese eine Möglichkeit. Der grüne Schemen des Polar 300 schälte sich aus dem Sturm heraus. Von Malatesta war nichts zu sehen. Diesmal hielt Emilio nicht auf die Kabine zu, denn das war es vermutlich, was der Geologe erwartete. Stattdessen kroch er zu den Anhängern hinüber. Kaum war er in deren Windschatten angekommen, steckte er das Messer weg und gönnte sich eine Pause. Sein Atem ging stoßweise, der Arm schickte ein schmerzhaftes Pulsieren durch seinen Körper. Welcher der Anhänger hatte das Überlebenspaket geladen? Das musste der vierte oder fünfte sein. Die Kiste war etwa zwei Meter lang und signalrot lackiert. Sie war so schwer, dass drei Männer sie tragen mussten, da sie aber auf einen Schlitten montiert war, genügte ein einzelner Mensch, um sie über eine Eisfläche zu ziehen. Was das Wichtigste war: Die Kiste enthielt die Notfallausrüstung, die einen Menschen vierzehn Tage am Leben erhalten konnte.
Emilio musste sie erreichen und mit ihrer Hilfe vor Malatesta fliehen. Vielleicht hatte er die Chance, einen Funkspruch abzusetzen oder, wenn das nichts nutzte, die Neumayer-Station zu Fuß zu erreichen.
Die Vorstellung, dreihundert Kilometer durch die Eiswüste zu wandern, war so absurd, dass ihm der Atem stockte. Emilio kam auf die Beine und arbeitete sich in Richtung des zweiten Anhängers vor. An der Kupplungsstelle lugte er um die Ecke. Die Verriegelung des Wohncontainers war gelöst worden. Emilio zog sich weiter vorwärts, erreichte den dritten Anhänger, den vierten. Darauf fand er das Überlebenspaket.
Der Schlitten war mit Spanngurten befestigt. Einen konnte Emilio lösen, der zweite Verschluss war festgefroren. Er sägte mit dem Taschenmesser daran herum, aber nur wenige der zähen Kunststofffasern lösten sich. Plötzlich ruckte der Anhänger und setzte sich in Bewegung. Malatesta fuhr wieder los! Er schien sich dafür entschieden zu haben, Emilio einfach zurückzulassen. Die Kälte sollte offenbar erledigen, was Malatesta mit der Pistole nicht gelungen war.
Emilio fasste nach dem Spanngurt des Schlittens und hielt sich fest, rutschte mit den Stiefeln neben dem Anhänger her. Der Polar 300 erreichte keine hohen Geschwindigkeiten, war aber zu schnell, um im Schnee daneben herzulaufen. Emilio ließ sich mitziehen. Mit beiden Händen klammerte er sich an den Schlitten, sein rechter Arm war zur Hälfte taub, aber er brauchte jedes bisschen Kraft, um sich festzuhalten. Er durfte jetzt nicht loslassen. Ohne das Überlebenspaket war er zum Tode verurteilt. Mit ihm hatte er immerhin eine Chance.
Das Fahrzeug beschrieb eine Kurve. Die Fliehkraft drückte Emilio in dieselbe Richtung, in die auch der Wind blies. Der Schlitten kam ins Rutschen, blieb an dem angeschnittenen Gurt hängen. Jetzt ragte er schräg über den Anhänger heraus. Emilio griff fester zu, dann ließ er sich einfach fallen. Sein Körpergewicht sorgte dafür, dass der Schlitten kippte, für einen Moment stand er senkrecht in der Luft, dann riss der zweite Gurt mit einem Knall. Emilio fand sich auf dem Boden wieder, neben sich den Schlitten, und sah zu, wie ein Anhänger nach dem anderen an ihm vorbeizog und in dem weißen Treiben verschwand.
Kapitel 2
Vier Wochen später
Das also war das Ende der Welt: eine weiße Leinwand, auf der das Sonnenlicht eine Palette aus Farben ausgoss. Von ihrem Sitzplatz im Flugzeug konnte Antonia die Endlosigkeit sehen. Die Antarktis – für manche ein Paradies, für andere die Hölle auf Erden.
Antonia lehnte die Stirn gegen das kühle Fenster und stellte sich vor, wie ein Strom frischer Luft in die überheizte Kabine floss. Ihr Atem ließ das Fenster beschlagen. Obwohl es im Innern der Turbo-Prop-Maschine warm war, gefror die Feuchtigkeit auf der Kunststoffscheibe. Mit den Fingern kratzte sie ein Loch frei und ließ den Blick über die weiße Landschaft schweifen, versuchte, Einzelheiten auszumachen. Da hinten, an der Küste, die rötlich verfärbte Fläche mit den dunkeln Punkten, das musste eine Kolonie Kaiserpinguine sein.
Das Flugzeug, eine Twin Otter mit zwei Propellern, dröhnte, wackelte und vibrierte. Die Maschine war mit Fracht und Gepäckstücken beladen, in jeder freien Ecke waren Kisten und Rucksäcke gestapelt und festgebunden. Von der Decke hingen Kabel. Antonia hatte die beiden Piloten auf das Durcheinander angesprochen, und einer von ihnen, ein bulliger Russe namens Maxim, hatte gebrummt, sie solle sich besser nicht an den Kabeln festhalten, wenn sie mal zur Toilette müsse. Sonst könne es passieren, dass einer der Motoren ausfiel.
Den Besuch der Kunststoffkabine im hinteren Teil des Frachtraums hatte Antonia bislang vermeiden können. Um darin trotz Turbulenzen sitzfest zu bleiben, musste man sich mit Spanngurten festschnallen. Das war nicht allen Benutzern gelungen, wie Antonia nach einem prüfenden Blick in den Toilettenraum hatte feststellen müssen. Jetzt versuchte sie, nicht weiter an die Alarmsignale ihres Körpers zu denken, und schaute aus dem Fenster. Wie weit war es denn noch bis zur Forschungsstation Neumayer III?
Auf dem Sitz schräg vor ihr stützte der einzige weitere Passagier beide Arme auf dem Polster ab und kniff die Augen zusammen. Er war Mitte dreißig, trug das Haar modisch zerzaust. Beim Einsteigen hatte er sich neben Antonia setzen wollen, doch die Piloten hatten dazu geraten, dass jeder Passagier eine eigene Sitzreihe in Anspruch nahm. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, hatten sie jedem eine kleine Flasche Sauerstoff und eine Packung Ohrschützer in die Hände gedrückt. Antonias Mitreisender hatte das Ganze anscheinend für einen Witz gehalten und gelacht, Antonia hingegen hatte geahnt, dass die Piloten es ernst meinten, und jetzt, nach zwei Stunden Flugzeit in der Twin Otter, war sie für beide Gaben dankbar.
Der Lärm im Frachtraum ähnelte dem eines riesigen Staubsaugers – wenn man sich vorstellte, in dessen Inneren zu stecken. Mit den Ohrschützern klang das Dröhnen, als arbeite der Staubsauger unter Wasser. Wie hoch die Twin Otter flog, war nicht festzustellen, wohl aber, dass die kleine Maschine einen schlechten Druckausgleich hatte. Ständig schluckte Antonia und bewegte den Unterkiefer, es knackte in ihren Ohren, wenn sie sich von dem Druck im Kopf befreit hatte, und dann begann das Spiel nach einigen Minuten von vorne. Dem Mann vor ihr schien das weniger gut zu gelingen. Als er sich zu ihr umdrehte, sah sie, dass er blass im Gesicht war, die Augen traten hervor, und er keuchte. Antonia deutete auf die Sauerstoffflasche, um die er seine Finger gekrampft hatte. Er schüttelte den Kopf. Sein Haaransatz war schweißnass. Anscheinend litt er nicht nur an einem Anflug von Sauerstoffmangel, sondern auch noch daran, dass die Magensäure in seinem Innern herumschwappte. Antonia warf einen skeptischen Blick zur Kunststofftoilette hinüber, dann holte sie einen leeren Beutel für geologische Proben aus ihrem Handgepäck und reichte ihn dem Schicksalsgenossen zwischen den Sitzen hindurch.
Erneut lehnte sie sich gegen das Fenster und suchte nach der Küstenlinie. Angesichts der Fremdartigkeit der Landschaft erschien ihr die Landung auf der russischen Forschungsstation Nowolazarewskaja, die auf einer vorgelagerten Insel lag, wie ein Ereignis aus einem anderen Leben. Dabei war sie erst vor sieben Stunden dort angekommen und nach einer kurzen Pause in die Twin Otter umgestiegen, um die letzte Etappe ihrer Reise anzutreten, einen weiteren langen Flug zur Neumayer-Station des Alfred-Wegener-Instituts, einer der weltweit führenden Einrichtungen für die Erforschung der Polargebiete mit Sitz in Bremerhaven. Die Stunden vergingen wie die einer verregneten Woche in Deutschland.
Was für eine lange, seltsame Reise! Bevor sie die russische Station erreicht hatte, war sie sechs Stunden von Kapstadt aus unterwegs gewesen, davor dreizehn Stunden, um von Bremerhaven nach Südafrika zu kommen. Und wiederum davor – Antonia atmete tief ein und aus – lag eine Reise, die vor achtunddreißig Jahren hier in der Antarktis begonnen hatte. Der Kreis schloss sich. Was würde sie dort vorfinden, wo sich Ende und Anfang trafen? Ihren Bruder hoffentlich. Seit vier Wochen war Emilio Rauwolf verschollen. Bis auf das kurzzeitige Aufflackern eines Notrufs gab es kein Lebenszeichen von ihm. Der Leiter der Neumayer-Station hatte Suchtrupps losgeschickt, doch alle drei Expeditionen, zwei am Boden und eine in der Luft, waren ergebnislos zurückgekehrt. Die Forscher und Techniker auf Neumayer III hatten die Hoffnung aufgegeben, Emilio und seinen Kollegen Pietro Malatesta lebend zu finden. Antonia aber würde nicht ruhen, bevor sie ihren Bruder in den Armen hielt, lebendig oder, wenn das Schicksal es so wollte, tot. Die Vorstellung, dass er allein im ewigen Eis auf Hilfe wartete, verursachte ihr körperliche Schmerzen. Das war natürlich absurd. Emilio war mittlerweile erfroren, so steif und kalt wie Eis. Längst hatte sein Herz aufgehört zu schlagen, waren seine Züge, die denen Antonias so sehr ähnelten, erstarrt. Nie wieder würde sie ihn lachen hören oder seine Arme um sich spüren. Nie wieder das Gefühl von Sicherheit empfinden, wenn er ihr zur Seite sprang, so wie er es auf dem Schulhof getan hatte, als sie von anderen Kindern zu Boden gestoßen worden war, und auf der Universität, als Dozenten Antonia im Seminar mit Fragen gequält hatten, deren Antwort sie nicht kannte. In Fällen schmerzhafter Einsamkeit, bei Liebeskummer, Geldsorgen oder wenn sie glaubte, den Wahrheitsfunken nach durchzechter Nacht erkennen zu können: Ihr Bruder war immer da gewesen, auch dann, wenn sie beide nicht im selben Raum, nicht einmal in derselben Stadt waren. Sie konnte seine Anwesenheit spüren. Auch jetzt noch.
Emilio lebte. Er musste einfach. Etwas anderes war so unvorstellbar wie unerträglich. Und es war ihr gleichgültig, ob das absurd war.
Antonia setzte die Maske auf das Gesicht, ließ den kühlen Sauerstoff in ihre Nase strömen und drehte den Verschluss nach einigen Atemzügen zu. Der Mann auf dem Sitz vor ihr atmete wieder ruhiger. Er wandte sich wieder zu Antonia um und bedankte sich für die Hilfe. Jetzt würde wohl das Gespräch beginnen, das Antonia die ganze Zeit über zu vermeiden gehofft hatte.
»Francisco Nero«, stellte er sich vor, »aus Portugal. Ich bin Fotograf und mache Aufnahmen für die Zeitschrift ›Im Spiegel der Wissenschaft‹.«
»Antonia Rauwolf«, sagte sie. »Vulkanologin.« Sie hoffte, die knappe Antwort würde als Signal deutlich genug sein, um das Gespräch zum Versiegen zu bringen, bevor es überhaupt zu sprudeln begann.
»Was untersuchen Sie denn in der Antarktis?«, wollte Nero wissen. Ein Bartschatten umrahmte sein Gesicht, und aus seinen Augen sprühte Neugierde. Natürlich, der Mann war Journalist.
»Vulkane«, antwortete Antonia. »Wie der Name meines Fachgebiets schon sagt.«
»Ich habe vom Mount Erebus gehört«, sagte der Fotograf, »aber der liegt am anderen Ende des Kontinents.«
Es war wohl das Beste, Nero die Geschichte in einem Rutsch zu erzählen, bevor er sie den Rest des Fluges über mit Fragen löcherte. »Bis vor Kurzem waren vierzig Vulkane auf dem Südkontinent bekannt«, erklärte Antonia. »Einige davon auch in der Nähe von Neumayer III. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ein britisches Team hat weitere entdeckt, sogar ein ganzes Vulkanfeld. Einundneunzig Kegel. In der Westantarktis.«
Nero riss die Augen auf. »Einundneunzig? Davon habe ich noch nichts gehört.«
»Wir Vulkanologen hängen unsere Entdeckungen nicht gern an die große Glocke«, erklärte Antonia weiter. Sie wollte nicht zu viel verraten. Das Vulkanfeld könnte eine globale Bedrohung darstellen, aber für eine klare Aussage schwebten noch zu viele Fragezeichen darüber. »Die Vulkanologie ist eine furchtbar langweilige Wissenschaft«, sagte sie stattdessen. »Sobald einer von uns anfängt, von seiner Arbeit zu berichten, fällt ein ganzer Saal voller Zuhörer in Tiefschlaf und kann nur durch ein Erdbeben geweckt werden.«
Nero lächelte. »Oder durch eine Eruption«, sagte er. »Ist dieses neue Vulkanfeld aktiv?«
»Um das herauszufinden bin ich hier«, sagte Antonia. »Schauen Sie! Dort unten!« Sie klopfte gegen die Fensterscheibe. Auf der weißen Fläche waren jetzt fingernagelgroße Blöcke aufgetaucht, ein Dutzend kleinere Quader gruppierte sich um einen größeren, dessen blaue, weiße und rote Lackierung in der Sonne strahlte: die Neumayer-Station. Sie hatten ihr Ziel erreicht.
Nero ließ sich ablenken, holte eine Kamera aus seinem Rucksack und fotografierte durchs Fenster. Antonia lehnte sich in ihrem Sitz zurück und genoss die Aussicht, als sich die Twin Otter auf die Seite legte, um die Landebahn anzusteuern. Die Piloten brauchten nur wenige Augenblicke, um die Maschine auszurichten, dann gingen sie in den Sinkflug. Die Propeller heulten auf, und die Nase des Flugzeugs senkte sich. Die kleine Twin Otter hatte den Vorteil, dass sie keine ausgedehnten Flächen brauchte, um landen zu können. In der Antarktis war das von großem Nutzen, denn die Landebahnen bestanden aus Eis und mussten bei jedem Anflug von Schneeverwehungen freigeräumt werden, damit die Kufen der Maschine gefahrlos aufsetzen konnten. Je größer das Flugzeug war, umso länger musste die Bahn sein, und das bedeutete wiederum mehr Arbeit mit den Pistenraupen.
Durch das Dröhnen hindurch war der Funkverkehr aus dem Cockpit zu hören. Antonia konnte beobachten, wie Maxim, der russische Pilot, eine Hand zur Decke hob und einen Hebel betätigte. Arlo, sein kanadischer Co-Pilot, streckte ebenfalls eine Hand zu demselben Hebel aus, wozu das gut war, wusste Antonia nicht. Was sie aber wusste: Piloten in der Antarktis galten als die besten – und verrücktesten – der Welt.
Die Station wurde größer, schon waren Einzelheiten zu erkennen: die Antennen und Laufwege auf dem Dach, die Fenster an den Seiten, die die Station wie ein Kreuzfahrtschiff aussehen ließen, die Stützen, auf denen die Konstruktion ruhte. Antonia kannte Neumayer von Bildern und Filmen, jetzt kam es ihr vor, als flöge sie direkt in eine Fotografie hinein. Eine kleine Gruppe Menschen brachte Bewegung ins Bild. Sie standen, in rote Schutzkleidung gehüllt, neben der Station und winkten der Twin Otter zu.
An den Tragflächen konnte Antonia beobachten, wie sich die Landeklappen ausstellten. Das Flugzeug stand etwas zu schräg, um mit beiden Kufen gleichzeitig aufsetzen zu können. Antonias Bauchmuskeln verkrampften sich. Kurz darauf bekam die Maschine einen Schlag von links und befand sich nun in einer perfekten Horizontalen. Die Piloten hatten den Wind mit einberechnet, der in Bodennähe stärker zu sein schien als in den höheren Luftschichten.
Es gab einen Ruck, als die Kufen auf dem Eis aufsetzten, die Maschine hüpfte, fand dann aber endgültig Halt und sauste über die Landebahn.
Jemand schrie. Das war die Stimme des jungen Kanadiers. Durch die offene Tür zum Cockpit konnte Antonia beobachten, wie sich der Russe gegen die Rückenlehne des Pilotensitzes presste, die Arme gegen den Steuerhebel stemmte und ihn herumriss.
Die Maschine drehte sich, stand mit einem Mal quer zur Landebahn, schoss aber weiter in die Richtung, die die Fliehkraft ihr diktierte. Schnee stob vor dem Fenster auf. Ein Krachen war zu hören, die Kabine bekam Schlagseite, dann folgte ein Kreischen. Der Ton drang durch die Ohrschützer hindurch und schmerzte in den Zähnen. Antonia presste eine Hand gegen den Kopf. Im Cockpit sah sie, wie sich die Münder der Piloten bewegten, hörte aber nicht, was sie sich zuriefen. Arlo hielt sich mit beiden Händen irgendwo fest, Maxim hatte noch immer den Steuerknüppel gepackt und zitterte im Zweikampf mit den Kräften, die auf das Ruder einwirkten. Schließlich wurde das Flugzeug langsamer und kam zum Stillstand.
Antonias Herzschlag wollte sich nicht beruhigen. Sie versuchte aufzustehen, aber der Sicherheitsgurt hielt sie fest. Außerdem konnte sie die Finger nicht von der Schulter des Fotografen lösen, die sie fest umklammert hielt. Er drehte sich zu ihr um, das Gesicht verzogen.
»Sie können mich jetzt loslassen«, sagte er. »Ich glaube, wir haben es überlebt.«
Antonia befreite Francisco Nero von ihrem Griff und ihre Ohren von den Stöpseln. Im nächsten Moment war das Flugzeug erfüllt von Flüchen aus dem Cockpit. Maxim zwängte sich in den Frachtraum, unter seinen buschigen dunklen Augenbrauen warf er einen finsteren Blick auf die Fracht, dann auf die Passagiere und öffnete, nachdem er festgestellt hatte, dass beides keinen Schaden genommen hatte, die Tür.
Der eisige Atem der Antarktis wirbelte in die Kabine und zerschnitt die abgestandene Luft. Ein wenig hatte Antonia erwartet, einen vertrauten, aber schon lange vergessenen Geruch wahrzunehmen. Aber alles, was ihr in die Nase stieg, waren die Aromen von Frost und Flugbenzin.
»Seid ihr alle wahnsinnig geworden?«, schimpfte Maxim, trat gegen die Trittleiter, die daraufhin nach außen klappte, und kletterte ins Freie.
Antonia löste den Gurt, stand auf, zog den Parka über und hängte sich ihren Rucksack über die Schultern. Sie ging an Nero vorbei auf den Ausstieg zu. Ihre Beine fühlten sich schwer und taub an, ihr Hintern schmerzte. Das Licht, das durch die offen stehende Tür ins Flugzeug fiel, war so gleißend weiß, dass sie überrascht die Augen zusammenkniff. Mit unsicherem Tritt kletterte sie die Metallleiter herunter und stand im nächsten Moment der Antarktis gegenüber.
Das Gefühl von Weite war überwältigend. Vor Antonia lag eine scheinbar endlose weiße Welt, die sich bis an den Horizont erstreckte. Der Himmel war tiefblau und riesengroß. Der Wind peitschte über die gefrorene Landschaft und schnitt wie ein Messer in ihr Gesicht. Augenblicklich wurden ihre Wangenknochen taub. Sie klappte die Kapuze des Parkas hoch, tastete nach dem Reißverschluss und versuchte, sich daran zu erinnern, in welcher Tasche die Sonnenbrille steckte.
»Bei dir alles in Ordnung?«, fragte jemand auf Englisch und fasste nach ihrem Arm. Es war der kanadische Co-Pilot Arlo. »Du solltest nicht so lange hier draußen bleiben. Neuankömmlinge müssen rasch in die Station.«
Antonia nickte und folgte ihm. Erst jetzt fiel ihr auf, dass die Twin Otter auf einer Seite eingeknickt war. »Was ist damit geschehen?«, fragte sie.
Arlo deutete auf das Fahrwerk. »Wir sind in eine gefrorene Schneeverwehung geraten. Die sind hart wie Beton. Die Bahn war nicht vollständig geräumt. Das hat uns eine Kufe gekostet.«
Antonia erkannte, dass die linke Verstrebung des Fahrwerks eine Rinne in das Eis gefräst hatte. Daher war vermutlich das Kreischen gekommen, dessen Echo sie noch immer zu hören glaubte. Sie wollte etwas sagen, aber Arlo zog sie weiter, um das Flugzeug herum. Antonia sah sich um, der Fotograf folgte ihnen. Sie liefen auf die Stützen der Station zu. Zwischen den mittleren Säulen ragte ein roter Block aus dem Eis, darin war eine Tür zu erkennen, vermutlich der Eingang mit dem Treppenhaus. Davor stand die Gruppe rot gekleideter Menschen und versuchte, Maxim zu beruhigen, der jemanden von der Besatzung an den Schultern gepackt hielt, ihn schüttelte und anbrüllte, während sein Opfer sich zu befreien versuchte.
Maxim trug über seiner Thermohose nur ein T-Shirt. Er war aus dem bullig warmen Cockpit ins Freie gesprungen, ohne sich etwas überzuziehen. Wie es schien, brachte ihn sein Zorn zum Glühen wie eine russische Sauna.
»Lasst uns durch!«, rief Arlo. »Die Passagiere müssen ins Innere.«
Antonia erfuhr nicht mehr, ob sich der Co-Pilot durchsetzen konnte. Mit einem Mal war ihr schwindelig, und sie spürte, wie das Blut in ihren Adern in die Beine sackte. Sie hob den Blick zum Himmel, dessen Blau in eine Kreiselbewegung geraten war, versuchte, die Dachkante der Station als Fixpunkt im Blick zu behalten, doch die Linie kippte weg, stand mit einem Mal senkrecht, und der Schnee, der jetzt direkt vor ihrem Gesicht war, wurde schwarz.
Kapitel 3
5. Januar
»Das passiert fast jedem.« Arlo saß auf einem Hocker neben Antonias Bett und sog an einem Strohhalm, der in einem Beutel Fruchtsaft steckte. »Kein Grund zur Sorge.« Arlo war zwar Kanadier, aber seine Vorfahren schienen aus einem ostasiatischen Land zu stammen. Darauf deutete auch sein Nachname hin. »Kawamura« war auf einem Schild zu lesen, dass auf der linken Brustseite seines Schutzanzugs angenäht war.
Neben ihm stand Maxim, so breit und schweigsam wie ein Möbelstück aus Taigaholz. Er hielt eine dampfende Tasse in der Hand und rieb mit einem breiten Daumen an einem Fleck auf dem Henkel herum. Maxim hatte die hohen Wangenknochen und leicht mandelförmigen Augen, wie sie Menschen aus dem östlichen Teil Russlands eigen waren. Seine Brauen waren Fontänen drahtdicken Haars, und in seinen Augen lag eine Andeutung der russischen Steppe.
Antonia richtete sich auf. Sie lag auf einem Bett in der Krankenstation. Medizinische Geräte standen auf fahrbaren Tischen an der Wand, Pressluftflaschen, die vermutlich Sauerstoff enthielten, waren in einen Metallkäfig eingesperrt, und auf einem Tischchen blitzte der blanke Stahl medizinischer Instrumente.
Antonia trug ihren dünnen hellen Rollkragenpullover und die dunkelblaue Thermohose, nur die Schnürstiefel und den orangefarbenen Parka hatte man ihr ausgezogen.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Du bist aus den Schuhen gekippt«, brummte Maxim.
»Das meine ich nicht«, sagte Antonia. »Euer Flugzeug. Was ist damit?«
»Eine Kufe ist weggebrochen, deshalb müssen wir das Fahrwerk schweißen«, erklärte Maxim.
»Die Kufe müssen wir bestellen«, sagte Arlo und strich sich eine Strähne seines tiefschwarzen struppigen Haars aus der Stirn. »Wenn wir Glück haben, kommt das Ersatzteil in einer Woche hier an. Bis dahin sitzen wir fest.«
»Verdammte Wissenschaftler«, knurrte Maxim. »Die können berechnen, wie oft ein Pinguin am Tag aufs Klo geht. Aber eine Landebahn können sie nicht freischaufeln.«
»Die verdammten Wissenschaftler müssen euch jetzt eine Woche lang durchfüttern, deshalb würde ich mir gut überlegen, wen ich verfluche.« Die Stimme kam von der Tür her. Der Mann im Eingang war hochgewachsen und hager, die Furchen auf seiner Stirn waren wie mit dem Messer gezogen, und darunter schauten funkelnde, kalte Augen hervor.
»Ich muss mit Doktor Rauwolf allein sprechen«, sagte der Neuankömmling. Maxim und Arlo drängten sich an ihm vorbei und verschwanden durch die Tür. Auf der Schwelle drehte sich Arlo noch einmal zu Antonia um. »Weißt du, was der Vorteil an einem Flug mit einer Twin Otter durch die Antarktis ist? Wenn du das einmal hinter dir hast, wirst du danach die schlimmste Holzklasse als Luxus empfinden.«
Der Mann in Arbeitshose und rotem Kapuzenpulli kam zu Antonia ans Bett, schüttelte ihre Hand und stellte sich als Justus Henlein vor. Antonia erinnerte sich, ihn auf einem der Fotos gesehen zu haben, die sie während der Vorbereitung der Reise studiert hatte. Henlein war Leiter der Neumayer-Station und der Arzt des Teams.
Und er war sauer.
Während er Antonia eine Blutdruckmanschette anlegte, fragte er barsch: »Warum sind ausgerechnet Sie hergekommen?«
»Weil die herzlichen Begrüßungen hier so berühmt sind, dass ich sie unbedingt selbst erleben wollte«, entgegnete Antonia. Sie wusste, dass Henlein gegen sie gestimmt hatte, als es darum gegangen war, die geologische Stelle auf der Station neu zu besetzen, den Posten des verschollenen Pietro Malatesta. Jetzt würde sich zeigen, wer sich gegen wen behaupten konnte. Eins war klar: Zurückschicken konnte Henlein Antonia nicht ohne Weiteres, aber er konnte ihr das Leben auf Neumayer III schwer machen.
Der Stationsleiter drückte auf die Taste des Messgeräts, und der Kompressor begann, Luft in die Manschette zu pumpen. Während sich der Klettverschluss um Antonias Arm zusammenzog, musterten sich der Arzt und die Vulkanologin wie Ringer, die den Gegner nach Schwachstellen absuchen, bevor sie aufeinander losgehen. »Ihr Chef hat Sie hergeschickt, weil Sie angeblich die Beste für die Untersuchung der Vulkane sind«, sagte Henlein. »Aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit.«
»So?«, fragte Antonia. »Und wie lautet Ihrer Meinung nach der Rest?«
»Ihr Vorgesetzter muss dieselben Bedenken gehabt haben wie ich. Ihr Bruder ist verschwunden, und Sie sind persönlich viel zu betroffen, um hier saubere Arbeit leisten zu können.« Er beugte sich zu ihr herüber. »Für Forscher, die nicht richtig funktionieren, habe ich keine Verwendung, keinen Platz und keine Zeit. Verstehen Sie? Für die Untersuchung der Vulkane benötigen wir Ihre volle Aufmerksamkeit. Wenn dieses Vulkanfeld aktiv sein sollte, müssen wir es noch in dieser Saison wissen, bevor der arktische Winter alle Arbeiten im Freien zum Erliegen bringt. Da draußen wartet eine Aufgabe von großer Bedeutung auf Sie, in der größten und kältesten Wüste der Welt. Wenn Sie nicht bei der Sache sind, gefährden Sie das Projekt, sich selbst und alle, die mit Ihnen arbeiten.«
Die Manschette presste sich schmerzhaft um Antonias Arm. Sie deutete darauf, doch Henlein schaltete das Gerät nicht aus. Der Stoff zog sich weiter zusammen. Schließlich drückte sie selbst auf die Taste. Das Messgerät piepste, und der Druck ließ nach.
Augenblicklich schaltete Henlein das Gerät wieder ein. »Ich bin hier der Mediziner, ich leite die Station, und wenn Sie meinen, Sie könnten sich Freiheiten herausnehmen, dann irren Sie sich. Ich muss Sie als Wissenschaftlerin akzeptieren, weil Ihr Chef es irgendwie hinbekommen hat, die EU und das Alfred-Wegener-Institut von seiner Fehlentscheidung zu überzeugen. Aber Ihre Unterstützer sind weit weg, und ab sofort bin ich für Ihre Sicherheit verantwortlich, also richten Sie sich nach dem, was ich sage.«
Antonia riss sich die Manschette vom Arm und drückte sie Henlein in die Hand. »Sie waren auch für die Sicherheit meines Bruders verantwortlich, und jetzt ist er verschwunden. Sie sagen, da draußen liege die größte und kälteste Wüste der Welt. Warum suchen Sie dann nicht nach Emilio, statt ihn darin erfrieren zu lassen?«
Henlein senkte die Augen. »Dazu ist es längst zu spät. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um ihn zu finden, das müssen Sie mir glauben. Emilio Rauwolf und Pietro Malatesta sind am fünften Dezember mit einem Pistenbully und einem Konvoi aus Anhängern losgefahren. Erst wollten sie etwas am Filchner-Ronne-Eisschelf untersuchen und dann weiter bis zum Rand des Vulkanfelds fahren. Drei Tage nach ihrem Aufbruch haben wir einen Notruf aufgefangen. Die Verbindung war schlecht, aber wir konnten die Stimme Ihres Bruders erkennen. Was er sagte, klang verworren, Malatestas Name fiel, ich nehme an, Emilio wollte uns mitteilen, dass sein Begleiter ums Leben gekommen war. Ihr Bruder bat um Hilfe und gab seine Koordinaten durch. Die Ziffern waren nur bruchstückhaft zu verstehen, aber das genügte, um ein Gebiet von fünfzig Quadratkilometern abzustecken. Wir hatten zwar kein Flugzeug, konnten aber mit dem Helikopter starten. Drei Tage lang haben wir aus der Luft gesucht, danach sind noch einmal sechs unserer Leute mit Kettenfahrzeugen losgefahren und haben am Boden nach den Vermissten und dem Polar 300 Ausschau gehalten.« Er schüttelte den Kopf und schaute Antonia an, in seinem Blick lag echtes Bedauern.
»Hören Sie, Justus.« Antonia versuchte, Ruhe in ihre Stimme zu bekommen. »Ich bin mir meiner Verantwortung als Forscherin bewusst. Das Vulkanfeld könnte von noch größerer Bedeutung für den Klimawandel sein als das Abholzen des Regenwaldes. Dagegen ist das Schicksal eines einzelnen Menschen vermutlich bedeutungslos. Aber Emilio ist mein Bruder. Geben Sie mir etwas Zeit, damit ich selbst nach ihm suchen kann. Ich halte es für möglich, dass er noch am Leben ist.«
»Das ist Unsinn.« Henleins Stimme nahm wieder einen harten Ton an. »Niemand überlebt da draußen länger als eine Woche, zwei Wochen wären schon ein Wunder. Ihr Bruder ist seit einem Monat verschollen. Was, glauben Sie, werden Sie da draußen finden? Eine Eismumie?« Er verstummte und presste die Lippen aufeinander.
»Wenn es das ist, was von Emilio übrig ist, dann will ich seine Eismumie finden, ganz recht.« Antonia blinzelte einige Male, um wieder einen klaren Blick zu bekommen. Emilio tot? Sie schüttelte den Gedanken ab. Sie wusste, dass er am Leben war, aber wie sollte sie Henlein davon überzeugen? Wenn sie ihre Gefühle als Grund anführte, würde er sie auslachen. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Es wird ein bisschen dauern, bis die Vorbereitungen für die Expedition zum Vulkanfeld abgeschlossen sind. Geben Sie mir drei Tage und einen Helikopter mit Piloten. Wenn ich Emilio dann nicht gefunden habe, werde ich das Thema ruhen lassen.«
Henlein sah sie mit einer Leichenbittermiene an. »Das kann ich nicht. Ich habe schon zwei Forscher verloren, das wird mir mein Leben lang nachhängen. Noch mehr Risiken werde ich nicht eingehen. Niemals!« Er stand auf und deutete auf das Messgerät. »Ihr Blutdruck ist offensichtlich in Ordnung. Ursache für ihre kurzzeitige Bewusstlosigkeit war vermutlich eine Hypoxie, ein Sauerstoffmangel im Blut, der …«
»Ich weiß, was eine Hypoxie ist«, unterbrach ihn Antonia barsch.
»… der vermutlich durch die ungewohnte Höhe hervorgerufen wurde, auf der wir uns hier befinden. Die Landmasse der Antarktis liegt bis zu dreitausend Meter unter uns, wir leben hier sozusagen permanent auf einem Gebirge aus Eis. Hinzu kommt das Phänomen, dass wir uns am unteren Ende des Globus befinden, die Erdrotation lässt die Atmosphäre hier dünn werden. Ich rate Ihnen, Ihren Körper in den nächsten Tagen zu schonen, er muss sich anpassen.« Er stand auf, holte eine Medikamentenschachtel aus einem Schränkchen und reichte sie Antonia. »Sollten Sie sich weiterhin benommen fühlen, nehmen sie eine davon.«
Antonia wollte etwas erwidern, doch Henlein brachte sie mit erhobener Hand zum Schweigen. »Sollten Sie sich besser fühlen«, fuhr der Arzt fort, »können Sie die Krankenstation verlassen. Ihre Kabine liegt den Gang runter und dann links. Nummer zweiundzwanzig, Ihr Name steht auf dem Schild neben der Tür.« Er zog zwei Bögen Papier aus einer Hosentasche, faltete sie auseinander und legte sie aufs Bett. »Die Hausordnung. Verstöße werde ich streng bestrafen, insbesondere, wenn sie von Ihnen kommen.« Er stand auf und verließ die Krankenstation, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Antonia setzte sich auf, zog ihre Schuhe an und schaute auf das Papier, das Henlein zurückgelassen hatte. »Bei klarem Wetter herrscht Kondition I, das Verlassen der Station ist in Begleitung mindestens einer weiteren Person erlaubt«, las sie. »Frischt der Wind bis zu achtundvierzig Knoten auf, sinkt die Sichtweite auf unter vierhundert Meter. Nun gilt Kondition II: Nur absolut notwendige Außenarbeiten sind erlaubt. Wird das Wetter noch schlechter, und der Wind erreicht Geschwindigkeiten über fünfundfünfzig Knoten, fällt die Sichtweite unter dreißig Meter. Niemand darf in einer solchen Situation die Station verlassen.«
Antonia schaute zum Fenster. Die Sonne schien durch die Scheiben, und eine Prise Driftschnee wehte vorüber.
Irgendwo dort draußen wartete Emilio auf sie.
Kapitel 4
5. Januar
Die Kabine war überraschend groß. Ein Bett, ein durchgesessenes Sofa, ein Schreibtisch und ein Kleiderschrank füllten nur die Hälfte der Fläche aus. Das Fenster war so hell erleuchtet, dass sich Antonia die Hand vor die Augen halten musste, als sie sich durch den Raum tastete, um das Rollo herunterzuziehen. Es schloss nicht, sodass am unteren Ende ein Spalt offen blieb. Wird schon nicht so schlimm sein, dachte sie und warf ihren Rucksack auf das Bett. Jemand hatte ihr Gepäck aus dem Flugzeug geholt und in einer Ecke gestapelt, zwei Rollkoffer und drei Aluminiumkisten mit Messgeräten. Sie hatte darauf bestanden, ihre eigene Ausrüstung mitzubringen, da sie nicht wusste, in welchem Zustand ihr Vorgänger die Instrumente in der Station zurückgelassen hatte. Überdies hatte Pietro Malatesta die GNSS-Sensoren und die Seismometer zur Messung von Erdstößen und Instabilitäten des Eisschilds vermutlich mit auf die Expedition in den Westen genommen, und nun waren sie ebenso verschwunden wie der Geologe selbst.
Antonia drehte sich langsam im Kreis. Kaum vorstellbar, dass sie in einem Metallcontainer stand. Die Wände waren isoliert, und es war so warm, dass sie sich von ihrem Pullover befreite. Das dunkelblaue T-Shirt, das sie darunter trug, genügte. Anscheinend gab es in der Antarktis nur zwei Temperaturextreme: Entweder war es so kalt, dass man auf der Stelle erfror, oder so warm, dass man sich wie in einem Gewächshaus fühlte.
Emilios Lieblingspflanze war die Orchidee. Die Königin der Blumen nannte er sie. Vor seiner Abreise hatte er Antonia erzählt, dass es Orchideen auf der ganzen Welt gab, nur nicht in der Antarktis. Deshalb hatte er ein Exemplar zur Neumayer-Station mitnehmen wollen. Zwar wäre eine Orchidee in der Antarktis so dauerhaft wie eine Schneeflocke in der Karibik, aber Emilio hatte sich das Experiment in den Kopf gesetzt. Eigentlich war es verboten, Pflanzen oder Tiere mit auf den Südkontinent zu bringen. Doch Emilio war Biologe und konnte geltend machen, Forschungen an der Orchidee betreiben zu wollen. Was für ein Kindskopf! Antonia lächelte beim Gedanken an ihren Bruder. Zugleich fühlte sie sich vollkommen allein.
Während sie die Koffer auspackte und die Fächer des Kleiderschranks füllte, ging ihr durch den Kopf, was Kulack gesagt hatte. Klaus Kulack, ihr Chef beim Geologischen Forschungsinstitut in Bremerhaven, hatte sie vor drei Wochen in sein Büro gebeten. Dort hatte ihre Reise begonnen.
In den Tagen der ersten Antarktisforscher hatten sich Männer wie Shackleton und später Amundsen und Scott in edwardianisch eingerichteten Salons versammelt, waren den Geldgebern von der Royal Geographical Society mit Portwein und Scotch um den Bart gegangen und hatten Zigarren rauchend fabuliert, welche Abenteuer sie bestehen, welche Erkenntnisse sie gewinnen würden. Im Büro von Klaus Kulack gab es bloß schlichte Funktionsmöbel, eine Tasse angebrannten Kaffee, den sich Antonia selbst einschenken musste, und vertrocknete Sukkulenten auf der Fensterbank.
Schon als Kulack sie die Tür hinter sich schließen ließ, wusste Antonia, dass Emilio etwas passiert war. Kulack, der durch und durch Naturwissenschaftler war, redete nicht lange um den heißen Brei herum. »Ihr Bruder ist in der Antarktis verschollen«, sagte er. Dann erst bot er Antonia einen Platz an. »Die Suchmannschaften haben ihn bislang nicht gefunden«, fuhr Kulack fort und zählte das Wenige auf, das bekannt war. Er begann mit Emilios Expedition und endete mit dessen mutmaßlichem Tod. Drei Sätze, die ein Schicksal besiegelten.
Damit hatte sich Antonia nicht zufriedengeben wollen.
Sie krallte die Finger in das schwarze Kunstleder der Armlehnen, bis ihre Knöchel weiß hervortraten. Sie wusste, dass sie, sobald sie losließ, die Hände vors Gesicht schlagen würde, um sich aus einer Welt zurückzuziehen, in der es Emilio nicht mehr geben sollte. Kulack ließ ihr Zeit, beobachtete sie aufmerksam. Nach einer Weile griff Antonia nach ihrer Kaffeetasse und goss die lauwarme Brühe mit zitternder Hand in sich hinein.
»Ich kann Emilio finden«, sagte sie, während sie spürte, wie ihr Magen gegen den Kaffee rebellierte. »Egal, wo er ist, ich finde ihn, und wenn ich dafür bis an den Rand des Sonnensystems reisen müsste.«
Kulack lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück und schaute sie lange schweigend an. Dann strich er sich über das schüttere blonde Haar. »Antonia, das ist absurd.«
Sie tat seinen Einwand mit einem Schnauben ab. »Emilio wurde schon einmal für tot erklärt und hat überlebt.«
»Antonia, bitte«, raunte Kulack.
»Ich kann das bezeugen. Ich war dabei«, sagte sie und hämmerte die Tasse auf den Schreibtisch.
»Ich kenne diese alte Geschichte«, sagte Kulack, »aber deshalb wird Sie niemand in die Antarktis reisen lassen, damit Sie dort Suchtrupps organisieren. Ich rate ihnen, niemandem davon zu erzählen, wenn Sie als Wissenschaftlerin ernst genommen werden wollen. Damit ist das Thema beendet. Ich will nichts weiter davon hören.« Um seinen Mund lief ein Zucken, wie es zu sehen war, wenn Kulack vor versammelter Mannschaft die Bewilligung von Fördermitteln verkündete. »Jetzt mal zurück zur Arbeit. Sehen Sie sich das hier mal an.« Er reichte ihr einen Bogen Papier über den Tisch. »Das ist eine Anfrage der EU. Die haben ein Problem, weil gemeinsam mit Ihrem Bruder auch der Geologe Pietro Malatesta verschwunden ist.«
Antonia kannte den Namen. Malatesta hatte die Forschungsstelle auf Neumayer III bekommen, auf die sich auch Antonia beworben hatte. Sie und Emilio hatten versucht, gemeinsam in der Antarktis zu arbeiten. Doch die Kommission hatte sich für Malatesta entschieden.
»Die EU und das Alfred-Wegener-Institut wollen dort unten Ersatz, jemanden, der die neu entdeckten Vulkane untersucht«, fuhr Kulack fort. »Und zwar noch vor Einbruch des arktischen Winters, also innerhalb von zwei Monaten. Das ist überstürzt, kann aber funktionieren.«
Antonia überflog das Schreiben. »Die Kommission will, dass Sie diese Aufgabe übernehmen, Klaus. Ich gratuliere.«
Kulack hatte genickt, die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt und einen Bleistift zwischen beiden Händen gedreht, das äußere Anzeichen für seine ständig rotierenden Gedanken. »Ja, die Anfrage ist schmeichelhaft. Aber, Antonia, Sie wissen ja von meinem Gesundheitszustand. Eine solche Reise würde meinen alten kranken Körper so sehr belasten, dass ich am Zielort kaum noch Forschung betreiben könnte.«
Kulack war zweiundvierzig und einer der sportlichsten Menschen, die Antonia kannte. Er fuhr regelmäßig Ski, nahm an Segelregatten teil und kam auf Inlineskates zur Arbeit. »Sie? Krank?«, fragte sie. Dann verstand sie, worauf er hinauswollte.
»Ich habe der Kommission geantwortet, dass ich die Aufgabe nicht übernehmen kann.« Er machte eine Pause. »Aber dass ich jemanden empfehle, der ein ebenbürtiger Ersatz wäre, die einzige Expertin sowohl für Vulkane als auch für die Antarktis. Antonia! Bitte reisen Sie an meiner Stelle zur Neumayer-Station. Finden Sie heraus, ob diese Vulkane aktiv sind und welche Bedrohung sie für das Weltklima darstellen.« Er ließ den Bleistift fallen. »Und finden Sie Ihren Bruder.«
Zwei Tage später war Antonia von Bremerhaven zum Vorbereitungskurs in die Ötztaler Alpen aufgebrochen. Auf dem Taschachferner-Gletscher hatte man ihr beibringen wollen, wie man einen Schneeschutz baut und sich in einem Whiteout zurechtfindet, jenem gefürchteten Zustand minimaler Sichtweite, wenn das Schneetreiben so dicht ist, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Dazu hatten sie und die anderen Teilnehmer des Kurses weiße Plastikeimer über die Köpfe gestülpt bekommen und blind einen hilflos im Schnee liegenden Verletzten finden müssen, der leise um Hilfe rief. Antonia hatte alle drei Schwierigkeitsstufen der Prüfung auf Anhieb gemeistert und jedes Mal darauf geachtet, kräftig gegen den im Schnee liegenden Kursleiter zu treten, der es darauf anlegte, dass die weiblichen Teilnehmer über ihn stolperten und auf ihn fielen. Später hatte der Mann Antonia ein Kompliment für ihren Orientierungssinn gemacht und zugegeben, selbst noch nie in der Antarktis gewesen zu sein.
Und jetzt – drei Wochen später –, war sie hier, auf dem unerforschtesten Kontinent der Erde, der mit einer Fläche von vierzehn Millionen Quadratkilometern fast zweimal so groß war wie Australien, und der als windigste und trockenste Region des Planeten galt. Sogar am Nordpol war es angenehmer, denn dort herrschten im Jahr durchschnittlich minus achtzehn Grad Celsius. In der Antarktis zeigten die Messgeräte im Jahresmittel minus neunundvierzig Komma drei an.
Antonia hatte die letzte Tasche geleert und legte ihre Schutzkleidung auf das Sofa. Jetzt war es Zeit, sich mit den anderen Besatzungsmitgliedern bekannt zu machen. Vielleicht konnte ihr jemand einen Hinweis darauf geben, was mit Emilio passiert sein könnte. Denn an eines glaubte Antonia nicht: dass ihr Bruder einem Unfall zum Opfer gefallen war.
*
Antonia Rauwolf war in ihrer Kabine. Eilig ging er an ihrer Tür vorbei. Nummer zweiundzwanzig. Schon bald würde die Bewohnerin wieder verschwunden sein: aus ihrem Zimmer, aus der Station, aus der Antarktis. Dafür würde er sorgen.
Er hatte gehofft, dass sie nicht herkommen würde, dass sie erkranken oder den Gesundheitscheck nicht bestehen würde. Aber dann war sie vorhin aus der Turbo-Prop-Maschine gestiegen. Und jetzt war sie hier, und er hatte ein Problem.
Der Name Rauwolf hing wie ein Fluch über dem Unternehmen. Erst hatte Emilio sich in Malatestas Expedition gedrängt und so lange gebettelt, bis er mitfahren durfte. Malatesta hatte keine andere Möglichkeit gehabt, als sich seines Beifahrers zu entledigen, bevor der zu einem Mitwisser werden konnte. Und nun, nachdem sich die Wogen geglättet hatten, tauchte Emilios Schwester auf, und erneut drohte Gefahr, dass alles herauskam.
Diesmal lag es an ihm, diese Gefahr zu beseitigen.
Seine Kabine lag am anderen Ende des Gangs, Nummer einundvierzig. Er schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Seine Augenlider flatterten, und der Schweiß brach ihm aus. Alles in ihm schrie danach, sich einen Schluck Cognac von Karim zu holen, aber er durfte jetzt nicht auffallen. Wenn er zu viel trank, würde ihm das nur Ärger einbringen, und davon hatte er schon genug.
Stattdessen musste er einen Plan schmieden, um Antonia Rauwolf loszuwerden. Das würde ihn auch von dem Zerren in seinen Eingeweiden ablenken. Was konnte er tun?
Er ging in der Kabine auf und ab. Das Bett war nicht gemacht, auf dem Boden lag schmutzige Wäsche, und aus den Regalen hingen die Ärmel von achtlos hineingestopften Pullovern heraus. Der Raum war ein Abbild seines Geistes. Er hob die Matratze an und tastete darunter herum, bis er die Glock fand. Er zog die Pistole hervor, prüfte die Sicherung und ließ das Magazin herausschnappen. Sechs Kugeln steckten darin, eine würde genügen, und das Problem Antonia Rauwolf wäre beseitigt. Doch wenn Emilios Verschwinden schon einen Sturm auf Neumayer III entfesselt hatte, würde ein Besatzungsmitglied mit einem Loch im Kopf einen Orkan hervorrufen, der alles mit sich fortreißen würde, was er und Malatesta so sorgfältig aufgebaut hatten.
Er schob die Glock wieder unter die Matratze. Es musste einen anderen Weg geben. Und er wusste auch schon, wohin der führte.
Kapitel 5
5. Januar
Antonia stieg die Treppe hinunter, die von Deck zwei auf Deck eins führte. Dabei studierte sie die Zettel, die Henlein ihr gegeben hatte: einen Lageplan der Station und zusätzliche Informationen über die riesige Anlage, deren zweitausenddreihundert Tonnen Gewicht auf Stelzenbeinen stand. Sechzehn hydraulische Stützen ermöglichten es, das riesige Gebäude anzuheben, wenn sich der Schnee an seinen Füßen auftürmte. Auf diese Weise war garantiert, dass die untere Plattform stets sechs Meter über dem Eis schwebte. Auf ihrer Oberfläche befanden sich einhundertachtzehn Container zum Wohnen und Arbeiten. Etwa die Hälfte der etwa fünftausend Quadratmeter Fläche war beheizt. Im Innern lebten derzeit knapp dreißig Wissenschaftler und Techniker, jeder mit seinen eigenen Problemen, doch alle durch dasselbe Schicksal miteinander verbunden: Sie waren vierzehntausend Kilometer von zu Hause entfernt.
Neumayer III war eine von insgesamt vierzig Stationen in der Antarktis. Wie die meisten lag auch die deutsche Forschungseinrichtung in Küstennähe, denn dort war das Klima milder als im Landesinneren, und in den Sommermonaten zwischen November und Februar herrschte Hochbetrieb. Dann erlaubte das Wetter auch Forschung im Freien, und auf der voll besetzten Station wurde es eng.
In den Unterlagen stieß Antonia auf eine Comicfigur, die einer anderen eine Faust ins Gesicht schlug. Um die Figuren war eine Staubwolke gezeichnet, darunter stand »Es wird darum gebeten, keine Gewalttaten an den Technikern zu verüben, denn sie sind für das Überleben aller auf der Station wichtig.« Antonia lächelte und faltete die Blätter zusammen. Bei Wissenschaftlern konnte man offenbar eine Ausnahme machen.
Auf dem Weg zur Kantine kam sie an einem an der Wand montierten Basketballkorb vorbei und warf einen Blick auf eine Galerie mit gerahmten Fotografien. Die ersten beiden zeigten Porträts von Alfred Wegener, einem aufgeräumt wirkenden Herrn mit stechendem Blick, und Georg von Neumayer, dem Antarktisforscher mit seiner langen weißen Mähne. Unwillkürlich strich sie sich über das eigene Haar, das dunkel und kurz geschnitten war. Wegen der Reise hatte sie sich von ihren langen Locken getrennt, zum einen, weil das unter mehreren Schichten Schutzkleidung praktischer war, zum anderen, weil die Zeit, die man unter der Dusche verbringen konnte, begrenzt war. Jetzt musste sie sich erst an das neue Gefühl gewöhnen und ertappte sich immer wieder selbst dabei, wie sie nach ihrem verschwundenen Schopf griff.
Antonia wandte sich von Georg von Neumayer ab und ging weiter die Galerie entlang. Es folgten Bilder sämtlicher Teams, die in den vergangenen vierzig Jahren auf Neumayer I, II oder III den antarktischen Winter verbracht hatten. Sie standen vermummt im Schnee, nutzten die Station als Kulisse und winkten in die Kamera. Antonia hatte Berichte von Überwinterern gelesen und fragte sich, wie man das aushielt: sechs Monate ohne Sonnenlicht mit nur einem Dutzend Menschen um sich herum, immer dieselben Gesichter – da musste man ja verrückt werden.
Sie drehte sich um und schaute aus einem der großen Fenster. Die Sonne schien auf die endlose Landschaft, erst in sechs Wochen würde sie wieder untergehen. Kurz zuvor würde das letzte Flugzeug von Neumayer abheben. Wer dann zurückblieb, musste ein halbes Jahr lang ausharren, denn im Winter kamen weder Flugzeuge noch Schiffe hierher.
Da draußen bewegte sich doch etwas! Antonia kniff die Augen zusammen. Ein Kettenfahrzeug fuhr Kurven auf dem Eis und schob mit der Schaufel große Mengen Schnee zusammen. Antonia meinte, Arlo Kawamura in der Fahrerkabine zu erkennen. Was machte er da? Räumte er eine zweite Landebahn frei?
Sie folgte einem Reflex und klopfte gegen das Fenster, aber das war natürlich Unsinn. Arlo konnte sie weder hören noch sehen, also lief sie weiter den Gang entlang. Besatzungsmitglieder kamen ihr entgegen, manche nickten zur Begrüßung, andere hasteten einfach vorüber. Geschäftigkeit war vielleicht eine Möglichkeit, mit der großen Leere ringsumher fertig zu werden.
Aus den Lüftungskanälen roch es nach Schnee, Metall und Desinfektionsmittel. Dann mischte sich ein verlockenderes Aroma darunter, das von Kaffee, Rührei und gebratenem Speck. Der Duft erinnerte Antonia daran, wie hungrig sie war, und sie beschleunigte ihre Schritte. Sie öffnete eine Tür, auf der »Messe« stand, und fand sich in der Kantine wieder. Zusammengeschobene Tische aus Holzimitat bildeten lange Reihen. Männer und Frauen in Wollpullovern saßen vor Tabletts voller Speisen und Getränken. Man unterhielt sich, begleitet vom Klicken des Bestecks. An einem der Tische beugten sich zwei Männer über eine Landkarte.
Antonia nickte denjenigen zu, die ihr kurz das Gesicht zuwandten, dann stellte sie sich an der Essensausgabe an, bestellte, was ihre Nase ihr verheißen hatte, fand einen leeren Platz und genoss ihre erste Mahlzeit am Ende der Welt. Schmeckte es wirklich besser als jemals zuvor, oder war das bloß Einbildung? Gerade lehnte sie sich zurück und faltete ihre Serviette zusammen, als sich ihr jemand gegenübersetzte, ein massiger Mann mit olivfarbener Haut und einer kleinen Papierhaube auf dem Kopf. Durch das dünne Material war Haar zu erkennen, dass ebenso dunkel war wie ihres.
»Du bist die Neue, nicht wahr?«, fragte er. Seine Stimme hatte einen sprudelnden Unterton. Er lächelte. »Ich heiße Ignacio, ich bin hier der Koch.«