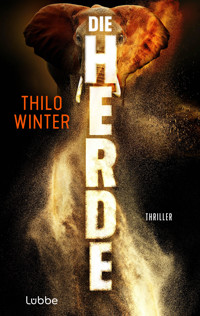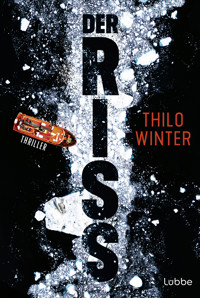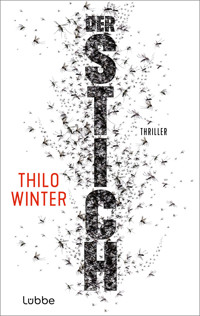
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Quito Mantezza kann es nicht fassen, als ihm das Stipendium am College in Key West, Florida, fristlos gestrichen wird. Jemand scheint verhindern zu wollen, dass sich der Biologiestudent gegen Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Moskitos einsetzt. Er klagt gegen die Kündigung und muss miterleben, wie sein Anwalt im Gerichtssaal tot zusammenbricht. Als Augenblicke später auch die Richterin ohnmächtig wird, bricht Panik im Justizgebäude aus. Während die Behörden noch rätseln, was die Ursache für die Todesfälle ist, gelingt es Quito herauszufinden, was wirklich hinter der rätselhaften Seuche steckt: der Stich einer bislang unbekannten Mückenart ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumHinweisWidmungTEIL 1Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32TEIL 2Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58NachwortÜber dieses Buch
Quito Mantezza kann es nicht fassen, als ihm das Stipendium am College in Key West, Florida, fristlos gestrichen wird. Jemand scheint verhindern zu wollen, dass sich der Biologiestudent gegen Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Moskitos einsetzt. Er klagt gegen die Kündigung und muss miterleben, wie sein Anwalt im Gerichtssaal tot zusammenbricht. Als Augenblicke später auch die Richterin ohnmächtig wird, bricht Panik im Justizgebäude aus. Während die Behörden noch rätseln, was die Ursache für die Todesfälle ist, gelingt es Quito herauszufinden, was wirklich hinter der rätselhaften Seuche steckt: der Stich einer bislang unbekannten Mückenart …
Über den Autor
Thilo Winter ist ein deutscher Schriftsteller und Wissenschaftsjournalist. In seinen Reportagen berichtet er über Unterwasserforschung mit Tauchrobotern, archäologische Funde in abtauenden Gletschern, den Klimawandel als Ursache für den Untergang früher Kulturen und die Zukunft der Polargebiete. Winter arbeitet u. a. für die Zeitschriften Spiegel Geschichte, bild der wissenschaft und Spektrum der Wissenschaft. Er studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Ethnologie. Er ist ein versierter Romanautor, mit »Der Riss« legt er seinen ersten Wissenschaftsthriller vor.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Susanne George, Bergisch Gladbach
Umschlaggestaltung: Kristin Pang
Einband-/Umschlagmotiv: © Piman Khrutmuang /AdobeStock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4783-7
luebbe.de
lesejury.de
Die folgende Geschichte ist ein Werk der Fiktion. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sowie real existierenden Institutionen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Chuck und Brianne
TEIL
1
Kapitel 1
»Wir werden kentern!« Es ist nicht Inéz, die das ruft, die einzige Frau an Bord der »Dios con nosotros«, sondern der riesenhafte Mann, der gern damit angibt, ihr Liebhaber zu sein. Diego Calavera klammert sich an seinen Platz auf der Holzpritsche neben Inéz und brüllt ihr ins Ohr. Der Wind über der Floridastraße zwischen Kuba und den USA presst den acht Menschen die nasse Kleidung gegen die Haut und massiert ihre Gesichter. Er rauscht in allem, was rauschen kann, und zeichnet weiße Adern auf die Dünung. Mein Gott, wir sitzen nicht mal in einem richtigen Boot, denkt Inéz. Der Mann, dem die Flüchtenden ihre Ersparnisse für die Überfahrt auf der neunzig Seemeilen langen Strecke gegeben haben, hat sie überrascht mit etwas, das er zwar als Boot bezeichnete, das aber nichts weiter ist als ein aus alten Latten gezimmertes Gerüst, in dessen Zwischenräumen Platten aus Styropor stecken – eine Ausgeburt des Irrsinns. Ständig läuft Wasser herein, bisweilen versinken die vor Kälte und Angst zitternden Passagiere bis zu den Hüften im Meer, doch immer wieder bekommt das Fahrzeug Auftrieb durch das Styropor und springt wie ein Korken an die Meeresoberfläche zurück. Wer mit ungelenker Schrift und weißer Farbe »Dios con nosotros«, Gott mit uns, auf eine Planke der schäbigen Außenbordwand gepinselt hat, weiß Inéz nicht, aber sie ist sich sicher, dass an diesem Abend jeder der Passagiere betet.
Einen Vorteil hat die absurde Konstruktion gezeigt: Die kubanische Küstenwache hat die Verfolgung schnell aufgegeben. Die Guarda Fronteras hielten es offenbar nicht für nötig, dem halb versunkenen Vehikel in einen aufziehenden Sturm hinterherzufahren, weil sie wussten, dass das Meer ihnen die Arbeit abnehmen würde. Salzwasser sprüht Inéz ins Gesicht. So wie es aussieht, werden die Grenzpolizisten recht behalten.
Das Segel aus olivgrünen Lastwagenplanen knallt im Wind. Zwei Männer, Gustavo und Ernesto, schöpfen mit Blecheimern Wasser aus dem Boot, bis die Kraft sie verlässt und sie die Eimer an ihre Sitznachbarn weiterreichen. Als Nächster ist Diego an der Reihe. Erst will er sich nicht von Inéz wegbewegen, aber sie versucht ihm durch das Tosen des Windes, das Klatschen der Wellen und das Knattern des Segels verständlich zu machen, dass ihrer aller Überleben von seiner Kraft abhängt. Schließlich erhebt er sich. Sein Bauch hängt über den Rand der klatschnassen Hose, seine mächtigen Arme quellen aus den kurzen Ärmeln seines Hemds, und in seinem Gesicht mit den vollen, aber kleinen Lippen zeichnet sich Entschlossenheit ab, eine Entschlossenheit, wie sie nur Menschen an den Tag legen können, denen im Leben noch nie etwas geschenkt worden ist.
Kaum ist Diego von ihrer Seite gewichen, fühlt sich Inéz frei. Diese Empfindung und das merkwürdige Verhältnis zu ihrem Begleiter passen zu dem Wahnsinn auf diesem Boot, denkt sie, während sie die wasserdichte Verpackung ihres Rucksacks prüft. Durch die Ablenkung lässt das Zittern ihrer Hände nach. Sie kann es schaffen, ihre Furcht vor den entfesselten Elementen zu zügeln, nicht aber vor der Unberechenbarkeit Diego Calaveras.
Er nimmt einen Eimer von Gustavo entgegen und reißt Ernesto einen weiteren aus den Händen. Nun kann er sich nirgendwo mehr festhalten, deshalb stemmt er die Füße gegen die Bootswände und beginnt die Arme wie Schiffsschrauben zu bewegen. Wasser schwappt in mächtigen Schwallen über den Bootsrand und wird dem Meer zurückgegeben, aber das Meer schiebt es wieder zurück. Inéz sieht dem Kampf Mann gegen Ozean zu und weiß, dass nicht einmal Diego ihn gewinnen kann.
Ihr wird schwindelig, als sie die wirbelnden Eimer beobachtet, deshalb heftet sie den Blick auf den Horizont, eine schwach erkennbare Linie im Norden, irgendwo zwischen dem Blaugrau des Himmels und dem Graublau des Wassers. Sie schlingt die Arme um den Mast und betet. Unter all dem Lärm ist plötzlich ein Geräusch wie das Sirren eines Insekts zu hören, ein viel zu feiner Laut in einem tropischen Sturm. Woher kommt er?
Das Boot sinkt, bekommt Auftrieb, sinkt wieder, jedes Mal ein Stückchen tiefer. Das kalte Wasser macht die Beine taub. Der Gedanke ans Ertrinken nimmt immer mehr Raum in Inéz’ Kopf ein. Diego arbeitet schneller, wilder. Für einige Sekunden hebt eine Welle den Bug des Bootes in die Luft, lange genug, um das Wasser ablaufen zu lassen, dann prallt der Rumpf unter dem Geräusch brechenden Holzes wieder auf.
Nur eine Planke ist gebrochen. Noch hält die Konstruktion, denn das Styropor macht das Boot flexibel. Ein Hoffnungsschimmer für die Passagiere. Bembe ruft lachend dem Wind etwas zu, zeigt die Ruinen seiner Zähne und schüttelt eine Faust. Wenn das so weitergeht, werden wir noch alle verrückt, denkt Inéz.
Dann kommt der Hai über das Dollbord. Er spült einfach hinein und beginnt, als er seine Gefangenschaft bemerkt, wild mit der Schwanzflosse zu schlagen. Inéz schreit und zieht die Beine an. Gustavo wird von dem panischen Tier getroffen und geht über Bord. Der Hai ist nicht groß, ein kleiner Mako, aber er hat Angst, schlägt und schnappt.
Alle versuchen, auf die Sitzbänke zu gelangen. Antonio springt über Bord, ob vor Entsetzen oder um Gustavo zu helfen, kann Inéz nicht erkennen, denn jetzt baut sich Diego schützend vor ihr auf. Seine Beine stehen wie Pfosten im Wasser, der Hai erwischt ihn mit der Flosse, aber Diego wankt nicht. Immer noch hält er die Henkel der Eimer gepackt, jetzt setzt sich der Motor seiner mächtigen Arme wieder in Gang, und die Blecheimer sausen wie Fallbeile auf den Hai nieder. Der Raubfisch weicht aus, wird aber an einer Flanke getroffen. Ein Geräusch ist zu hören, es klingt wie ein Schrei. Diego hält in der Bewegung inne. Er lässt die Eimer fallen. Seine Hände stoßen herab, er packt das Tier an der Schwanzflosse. Der Leib zuckt, der Mako windet sich, und seine Flossen klatschen gegen Diegos Bauch. Für einen Moment ringen die beiden miteinander. Dann zieht Diego den Hai in Richtung Bordwand und schleudert ihn ins Meer. Der Fisch verschwindet. Doch nun gerät Diego aus dem Gleichgewicht. Es ist Inéz’ Hand, die ihn festhält, die ihn zurück in die Mitte des Bootes zieht. Als er wieder neben ihr auf dem Brett sitzt, wischt er sich das Salzwasser aus den Augen. »Dem ging es wie allen hier«, ruft er durch das Tosen des Windes. »Er wollte nur seine Freiheit.«
Da ist das Sirren wieder, wird lauter, entfernt sich, kommt und geht wie die Dünung des Meeres. Das Geräusch einer Mücke. Es gehört nicht hierher. Es gibt keine Mücken auf dem Meer.
Inéz wird übel. Sie will sich am Bootsrand festhalten, aber der ist plötzlich verschwunden. Sie kippt weg und fällt mit dem Gesicht auf etwas Weiches. Sie riecht Gras. Es fühlt sich an wie Gras. Als sie die Augen aufschlägt, ist alles grün.
Sie hat geschlafen, und was sie erlebt hat, war ein Traum und doch wahr. Langsam dringt die Wirklichkeit in ihr Bewusstsein. Sie ist in Key West. Das Boot hat es bis an die Küste Floridas geschafft. Ohne Gustavo und Antonio, doch die anderen haben überlebt.
Sie will aufstehen, aber die Übelkeit überkommt sie, sodass sie es nur auf alle viere schafft. Ihre Rechte juckt, auf dem Handrücken sieht sie die Schwellung eines Mückenstichs. Das Insekt aus ihrem Traum hat zugestochen. Das letzte Bild, das sie von der »Dios con nosotros« in Erinnerung hat, sind die von Rissen durchzogenen Styroporplatten, auf die sie gestarrt hat, während die amerikanischen Grenzpolizisten das Boot an Land gezogen haben.
Wo ist der Rucksack? Er ist ihre Zukunft. Die Vorstellung, ihn verloren zu haben, pumpt Adrenalin durch ihre Adern. Die Übelkeit verschwindet. Aber der Rucksack hängt vor ihrer Brust, so, wie sie ihn aufgesetzt hat, die Taschenöffnungen an ihren Körper gepresst. Es ist unwahrscheinlich, dass sich einer der anderen daran zu schaffen gemacht hat, ohne dass sie es bemerkt hat, aber trotzdem …
»Inéz«, ruft jemand.
»Sie ist wach«, kommt die Antwort. »Inéz, gleich ist es so weit.«
Sie weiß, dass der Moment von Bedeutung ist, aber zunächst muss sie nach dem Inhalt des Rucksacks schauen. Das hat sie zuletzt am Abend zuvor getan. Zwölf Stunden ist das her.
Sie steht auf, setzt sich auf den Rand eines Feldbetts und wirft einen misstrauischen Blick in die Runde. Über ihr, wo gerade noch das grüne Segel war, bauscht sich das Dach eines weißen Leinenpavillons im Wind – dem sanften Wind eines Landes, das ihre Zuflucht werden soll. Sechs weitere Feldbetten sind unter dem provisorischen Wetterschutz aufgebaut, auf jedem liegt oder sitzt einer ihrer Leidensgenossen. Einzig Diego liegt auf dem Boden, denn das leichte Aluminiumgestänge mit dem Polyesterbezug hätte seinem Gewicht nicht standgehalten.
Aufgebaut ist die Notunterkunft im Garten des Barracuda Processing Center, das vom US-Heimatschutzministerium betrieben wird. Seit fünf Tagen, seit dem 10. Mai, leben die Geflüchteten schon im Innenhof der Behörde und warten darauf, dass über ihre Situation entschieden wird. An diesem Montag soll es so weit sein, hat man ihnen gesagt.
»Ich bin gleich fertig.« Inéz streift die Riemen des Rucksacks von den Schultern, zieht den Reißverschluss auf und schaut hinein. Das mit Plastikfolie umwickelte Holzkästchen ist noch da, die Gummibänder sind kreuzweise um den Deckel geschlungen. Niemand hat den Inhalt angerührt, trotzdem ist Inéz erst beruhigt, nachdem sie den Deckel geöffnet und die Zigarren gesehen hat. Sie legt die Hand auf die trockenen Tabakblätter und schließt die Augen, spürt, wie sie ihre Zukunft berührt, und verstaut die Kiste wieder, bevor zu viel Wärme und Feuchtigkeit an die Zigarren gelangen.
Das Feldbett wackelt, als Bembe sich neben sie setzt. Bembe war von Anfang an dagegen, dass Inéz mitkommt. Doch sein Aberglaube, dass Frauen auf See Unglück bringen, hat sich nicht bestätigt, und jetzt ist er noch mehr gegen Inéz eingenommen, weil sie ihn durch ihre bloße Anwesenheit als Hasenfuß entlarvt hat.
»Nun wird sich zeigen, ob wir dir zu Recht vertraut haben oder ob du uns alle in den Untergang führen wirst.« Bembe ist ausgemergelt von seiner Zeit im Gefängnis von Santiago, und sollte er nach Kuba zurückgeschickt werden, wird er seine Zelle wohl nicht noch einmal verlassen.
Inéz schließt rasch den Rucksack und setzt ihn wieder auf. »Du weißt so gut wie ich, dass die Einwanderungsbehörde unsere einzige Chance ist.« Sie deutet auf das hohe weiße Gebäude im karibischen Stil, in dem gerade die Fenster aufgestoßen werden, um Morgenluft hereinzulassen.
»Und du weißt, dass wir hätten gehen können. Einfach gehen.« Seine vernarbte Rechte mit den vier Fingern zeigt auf den Garten ringsum. »Es gibt keine Mauern, nicht mal einen Zaun. Am Wochenende war kaum jemand hier. Wie einfach wäre das gewesen.«
Inéz wirft Diego einen Hilfe suchenden Blick zu, aber ihr Begleiter schläft. Also muss sie allein mit Bembe fertigwerden. »Das ist genau das, was die Einwanderungsbehörde von uns erwartet. Ich habe es euch doch erklärt. Wenn wir losgezogen wären, einfach in die USA hinein, wären wir illegale Einwanderer. Dann hätten sie einen Grund gehabt, uns zurückzuschicken. Dadurch, dass wir noch immer hier sind, haben wir gezeigt, dass wir die Gesetze dieses Landes respektieren. Wir werden Asyl erhalten. Wir haben guten Willen gezeigt.«
»Der gute Wille ist der schwache Wille. Wir sind Dummköpfe. Wir könnten längst irgendwo in Miami untergetaucht sein. Niemand würde uns finden.«
Auf der Rückseite des Processing Center öffnet sich eine Tür, und ein Mann in der Uniform eines Bürokraten – schwarze Schuhe, helle Hose und hellblaues Hemd – schaut hinaus.
Inéz blickt Bembe ernst an. »Ich zwinge dich ja nicht zum Hierbleiben. Du kannst immer noch verschwinden und das Gesetz des Landes brechen, das dir helfen soll. Aber wenn wir uns irgendwann wiedersehen, werde ich in einem kleinen Haus leben, mit Kindern, die in den USA geboren wurden und die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, und du wirst das Leben eines Kriminellen führen, ständig auf der Flucht vor der Polizei.«
»Ein kleines Haus mit Kindern? Wer soll denn der Ehemann in dieser Idylle sein? Diego? Du weißt, was an seiner Seite aus dir werden wird.« Bembe schaut sie hämisch an, und Inéz hasst ihn dafür, dass sie nicht widersprechen kann. »Glaub an die Götter, Bembe. Sie beschützen uns.«
Von der Hintertür her nähert sich der Mann im hellblauen Hemd. Der Bogen Papier in seiner Hand flattert in der Morgenbrise. Während er über den Rasen geht, schaut er immer wieder auf das Blatt, und mit einem Schlag ist Inéz’ Hoffnung dahin. Sie ahnt, dass darauf kein Text steht, den er nicht längst im Kopf hätte. Das Papier ist einzig und allein dazu da, den Blick nicht auf die Geflüchteten richten zu müssen, während er ihnen die niederschmetternde Nachricht überbringt.
Inéz wird heiß. Sie steht auf, richtet ihr nach hinten gebundenes Haar, das von zwei Knoten zusammengehalten wird. Sie zieht die Säume ihrer Jeans über die Schuhe und zupft an dem verwaschenen schwarzen T-Shirt mit der kleinen US-Flagge darauf. »Diego«, sagt sie und weiß, ohne sich umzusehen, dass Diego im nächsten Moment neben ihr sein wird, so wie immer, wenn sie seinen Namen ausspricht.
Der Mann von der Einwanderungsbehörde bleibt in einiger Entfernung zum Pavillon stehen, nah genug, um verstanden zu werden, aber weit genug weg, um sich sicher zu fühlen. Da wird Inéz’ Ahnung zur Gewissheit, und die nun folgende Verkündung ist nur mehr eine Bestätigung.
»Guten Morgen«, sagt der Mann und stellt sich als Max Aitchinson vor, Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde. Ihn haben die Geflüchteten noch nicht kennengelernt, die Asylanträge hatte eine Frau entgegengenommen, zu essen und zu trinken haben sie wiederum von anderen Leuten bekommen, jeden Tag neue Gesichter. So können keine Sympathien entstehen.
»Wir haben Ihre Anträge geprüft.« Aitchinson hält sich die Faust vor den Mund und räuspert sich. »Wir sind Ihren Angaben nachgegangen und haben versucht herauszufinden, ob Ihnen in Ihrer Heimat Repressalien drohen, wenn Sie dorthin zurückkehren.«
»Das ist nicht mehr unsere Heimat«, ruft Bembe.
Max Aitchinson nickt und lächelt. »Wir haben keinerlei Hinweise dieser Art.«
»Was heißt das?«, fragt Bembe.
»Wir werden abgeschoben«, fasst Inéz zusammen. Aber so einfach will sie es dem Überbringer der schlechten Nachricht nicht machen. »Welche Informationen haben Sie denn aus Kuba erhalten?«, fragt sie. »Von welcher Stelle? Lassen die uns in Ruhe, wenn wir zurückkehren? Haben Sie Garantien?«
Aitchinson verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere. »So etwas gibt es nicht, jedenfalls nicht von der kubanischen Regierung.«
»Dann schicken Sie uns in den Tod«, ruft Camillo. Es sind die ersten Worte, die Inéz von dem Sechzehnjährigen hört, seit er mit einem Gebet auf den Lippen in das Boot gestiegen ist.
Diego will auf Aitchinson loswalzen, aber Inéz hält ihn mit einer Berührung am Unterarm zurück. »Was ist mit ›Trockene Füße, nasse Füße‹?«, fragt sie den Behördenmitarbeiter. »Geflüchtete dürfen nur dann zurückgeschickt werden, wenn sie noch keinen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt haben. Danach darf man bleiben.«
»Das stimmt doch, oder nicht?«, schaltet sich Diego mit Drohen in der Stimme ein.
»Diese Regelung ist seit der Amtszeit von Präsident Obama abgeschafft«, teilt der Beamte mit und gibt vor, von dem Blatt Papier abzulesen. Die Worte klingen wie ein Urteil. Darunter mischt sich das Schlagen von Autotüren. An der Straße steigen Polizisten in schwarzer Uniform aus einem Transporter mit Drahtgittern vor den Fenstern.
»Unsere Götter haben wohl keine Macht in diesem Land«, zischt Bembe Inéz ins Ohr.
Die Polizisten, es sind ausschließlich kräftige Männer, kommen über den Rasen auf den Pavillon zu. Sie sehen aus wie eine Mauer, an der die Träume der sechs Kubaner zerschellen werden.
Ausgerechnet jetzt kehrt das Sirren zurück. Ein Stechen zuckt durch Inéz’ rechte Hand. Sie erschlägt die Mücke und sieht gerade noch, dass Diego den Cops entgegengeht. Einige greifen nach ihren Pistolentaschen, andere zücken Schlagstöcke. Mit einem Mal fühlt sich Inéz wie in Santiago, wo sie versucht hat, mit Parolen die Welt zu verändern. Diesmal bleiben ihr die Worte im Hals stecken.
Bembe läuft an ihr vorbei, dicht gefolgt von Camillo. »Inéz!«, ruft der Junge. »Lauf!«
Kapitel 2
Key West, Monroe County Courthouse
Das Sirren sägt durch den Gerichtssaal. Es kommt näher, wird lauter, ein grelles Geräusch wie ein Warnsignal. Erst ist es an Quitos linkem Ohr, dann am rechten. Aufs Geratewohl schlägt er nach der Mücke, zerteilt aber nur die Luft. Der Angriff lenkt seine Aufmerksamkeit von der dunkelhaarigen Frau in der schwarzen Robe ab, die sich am Richtertisch leise mit seinem Anwalt bespricht.
Es ist heiß im Gericht von Key West, und es ist gerade mal Mitte Mai. Die Morgensonne brennt durch die hohen Fenster und malt die Schatten der Fensterkreuze auf den Fliesenboden. Jetzt ist Quito froh, dass er Bermudas zu seinem hellen Sportsakko trägt – trotzdem fühlt er sich unwohl in dem Aufzug, ruckelt mit den Schultern und zupft an dem dünnen Jackett. Dadurch verrutscht das steife Hemd, und nun muss er dessen Sitz ebenfalls korrigieren. Er verändert seine Haltung auf dem kleinen Holzstuhl und wünscht sich seine gewohnte Kleidung, ein T-Shirt und Flipflops.
Das Sirren verstummt. An der rechten Wade kribbelt Quitos Haut. Er schlägt zu. Das Klatschen explodiert im Saal und trägt ihm einen tadelnden Blick von Richterin van Beuren ein. Er hebt die Hand, um nachzusehen, ob er den Quälgeist erwischt hat, aber es ist kein zermalmtes Insekt zu entdecken und auch nicht die verräterische Rötung eines Einstichs an seinem Bein.
In diesem Augenblick wiederholt sich das Klatschen. Josh Mangiardi, Quitos Anwalt, reibt sich den Hals, schaut prüfend in seine Handfläche und wischt sich die Finger an der Krawatte ab. Unbeeindruckt redet er weiter auf Richterin van Beuren ein.
An ihrem Gesichtsausdruck versucht Quito zu erkennen, wie die Richterin seinem Anliegen gegenüber eingestellt ist: ob sie dafür sorgen wird, dass er das Stipendium zurückbekommt, das die Bennerley-Stiftung ihm gestrichen hat.
Weil er etwas Gerechtes getan hat!
Erneut durchflutet ihn Empörung, als er daran denkt, was DNArtists vorhaben. Jemand musste etwas dagegen unternehmen, und da weder der Gouverneur des Staates Florida noch die Polizei von Monroe County auf seine Hinweise reagiert haben, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen.
»Dauert die Besprechung da vorne noch lange?« Rechtsanwalt Melvin Ross, der die Stiftung vertritt, schiebt seinen Stuhl zurück und schaut demonstrativ auf seine protzige Armbanduhr. »Sonst bestelle ich mir schon mal einen Lunch hierher.«
Van Beuren sieht an Josh Mangiardi vorbei. »Dies ist kein Schnellimbiss. Wir nehmen uns Zeit für alle Einwände«, weist sie Ross zurecht. Während Josh leise weiterspricht, wandert ihr Blick scheinbar ziellos umher. Das ist kein gutes Zeichen, denkt Quito. Die Richterin ist unkonzentriert – vermutlich, weil sie längst zu einer Entscheidung gekommen ist und ihr Urteil gefällt hat. Sie schiebt den linken Ärmel ihrer Robe hoch, schaut auf die dunkle Haut ihres Arms und fährt mit der rechten Hand darüber. Ein Juckreiz am langen Arm des Gesetzes, Quito kann ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Josh redet unterdessen weiter. Van Beuren schüttelt den Kopf, wischt an ihrem Gesicht entlang und prustet wie jemand, der ein Haar von seinen Lippen wegblasen will. Während ihr Blick nun auf dem Tisch vor ihr ruht, streckt sie die Hand nach dem Richterhammer aus. Langsam hebt sie das allmächtige Werkzeug des US-amerikanischen Rechtswesens.
Quito vergeht das Schmunzeln. Was hat sie vor? Verkündet sie ihre Entscheidung, ohne noch einmal das Wort an ihn zu richten? Hat Josh vergeblich versucht …?
Einen Moment zögert Van Beuren, dann schlägt sie zu. Der Hammer knallt auf den Resonanzblock. Ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als sie das kreisrunde Holzstück hochhebt und Josh präsentiert.
»Erwischt!«, stellt die Richterin fest. »So geht man mit Gewalttätern um.« Sie kramt ein Taschentuch aus ihrer Robe hervor und wischt das Holz ab, ein kleiner roter Fleck verschmiert darauf.
»Todesstrafe mit sofortiger Exekution«, pflichtet Josh bei. Erstaunlicherweise trifft der geschmacklose Scherz den Humor von Richterin van Beuren, und beide lachen in lautstarkem Einvernehmen.
Die Mücke ist tot.
»Nichts anderes habe ich getan«, ruft Quito. Er steht auf.
»Sie bleiben sitzen, bis das Hohe Gericht Sie aufruft«, verlangt einer der Gerichtsdiener neben der Tür. Bis auf die beiden Uniformierten, Quito, die Richterin und die Anwälte ist der Saal leer.
Das Lachen in Richterin van Beurens Gesicht erlischt. Sie legt den Hammer beiseite. »Mister Mantezza«, sagt sie in vorwurfsvollem Ton zu Quito, »Sie haben nicht ein einzelnes Insekt getötet, sondern Zehntausende, indem Sie das Wasser aus den Brutbehältern haben ablaufen lassen, sodass die Larven vertrocknet sind. Diese Larven waren das Eigentum von jemand anderem. Sie haben es zerstört, und dafür sind Sie bestraft worden. Die Bennerley-Stiftung hat Ihr Stipendium gestrichen, und ich sehe keine Veranlassung, Ihren Widerspruch gegen diese Entscheidung anzuerkennen.«
Abgelehnt. Quito fühlt sich wie die Mücke unter van Beurens Hammer. Als er einen Schritt zurückweicht, stößt er gegen den Stuhl und wirft ihn um. Das Poltern klingt wie der Donner in seinem Herzen, wie die Fäuste, die er jetzt gern auf den Richtertisch schlagen würde. »Verstehen Sie nicht?«, ruft er. »Hat Mister Mangiardi denn nicht ausführlich erklärt, warum diese Larven nicht schlüpfen durften? Josh!«
Aber nun ist die Reihe an dem Anwalt, unaufmerksam zu sein. Mangiardi verzieht das Gesicht und hält sich den Hals. Als er die Hand wegnimmt, ist da eine Schwellung von der Größe eines Taubeneis zu erkennen. Die Haut glänzt in Schlammfarbe.
»Es ist die Tat, die das Gericht zu beurteilen hat, weniger das Motiv, das dazu führte«, belehrt ihn Richterin van Beuren. Auf ihrem Gesicht glänzt Schweiß. Sie rutscht auf ihrem Stuhl hin und her, scheint sich in dem Talar ebenso unwohl zu fühlen wie Quito in seinem Aufzug.
Er hat genug von dieser Farce, öffnet den Knopf seines Jacketts und zieht es aus. Augenblicklich fühlt er sich freier. Er wird sich nicht geschlagen geben. Er steht vor genau der Instanz, die DNArtists noch Einhalt gebieten kann. Alles, was er tun muss, ist, Richterin van Beuren auf seine Seite zu ziehen. Jetzt geht es nicht mehr nur um sein Stipendium, jetzt geht es um mehr.
»Hohes Gericht«, Quito räuspert sich und streicht sich die Haare nach hinten, spürt ihre Wellen an der Innenfläche der Hand. »DNArtists ist im Begriff, die Natur unserer Heimat zu zerstören.«
»Quito, nicht!« Josh kommt auf ihn zu, mit verzogenem Gesicht, vermutlich will er seinen Mandanten beruhigen. Doch dazu ist es zu spät. Quito drückt ihm das Jackett in die Hand und redet weiter. »Diese Leute setzen gentechnisch veränderte Lebewesen in freier Wildbahn aus, und das zu fragwürdigen Zwecken. Niemand kann abschätzen, was das nach sich zieht, niemand weiß …«
Der Hammer knallt, zermalmt seine Worte. »Mister Mantezza«, blafft die Richterin, »ich rufe Sie zur Ordnung. Dies ist ein ordentliches Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind hier nicht auf Kuba. Merken Sie sich das.«
Etwas in Quito wird zu Beton. Gleichzeitig spürt er das Blut seiner Vorfahren in sich rauschen, kubanisches Blut, damit haben seine Großeltern einen hohen Preis für ihren Kampf gegen die Kommunisten gezahlt. »Ich bin amerikanischer Staatsbürger«, bringt er hervor, »ich dachte, vor dem Gesetz dieses Landes seien alle gleich.«
Van Beuren lehnt sich zurück und lächelt süffisant. »Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein junger Mann wie Sie über meine Arbeit belehren muss. Offenbar habe ich mich geirrt.« Jetzt funkelt sie ihn an. »Bis das amerikanische Rechtssystem zulässt, dass der Angeklagte die Verhandlung führt, handeln wir nach dem, was am heutigen Tag Recht und Gesetz ist. Und das vertrete in diesem Fall ich.« Sie stützt die Ellbogen auf den Tisch und lehnt sich nach vorn, dabei verliert sie den Halt auf ihrem linken Arm und knickt ein wenig zur Seite weg. »Quito Mantezza«, sagt sie, darum bemüht, den Lapsus zu überspielen, »ich lehne Ihren Widerspruch ab. Die Bennerley-Stiftung hat Ihr Stipendium zu Recht beendet. Sie können von Glück reden, dass DNArtists Sie nicht auf Schadensersatz verklagen, denn das hätte ich getan.«
Der Beton in Quitos Innerem bekommt Risse, daraus quillt etwas hervor. »Mein Name wird Kito ausgesprochen, K-I-T-O, nicht Kwito. Und Sie sollten Ihr Rechtsverständnis noch einmal überdenken«, er spricht jetzt lauter, »denn nach den Gesetzen der Natur sind wir mittlerweile alle Verbrecher.« Plötzlich findet er sich vor dem Richtertisch wieder.
Van Beuren ruft nach den Gerichtsdienern, Josh fasst nach seinem Arm, doch Quito befreit sich aus dem laschen Griff und stößt den Anwalt zurück. Im nächsten Moment liegt Mangiardi am Boden, und der Schatten des Fensterkreuzes malt sich auf seinem Körper ab.
»Hilfe!« Van Beurens Stimme ist schrill.
Hände fassen nach Quitos Schultern, ein Arm, breit wie ein Oberschenkel, legt sich um seine Kehle, zieht ihn nach hinten und drückt ihm die Luft ab. Quito versucht sich zu befreien. Die Gerichtsdiener bellen Befehle, aber er versteht die Worte nicht, denn er kann den Blick nicht von seinem Anwalt nehmen.
Josh Mangiardi liegt mit durchgedrücktem Rücken auf den Fliesen und paddelt mit den Füßen, dabei versucht er, Luft durch seinen aufgerissenen Mund einzusaugen. Seine Augen sind geweitet, er schüttelt den Kopf in einer Geste ohnmächtigen Widerstands.
Der Arm um Quitos Hals und die Panzerfinger an seinen Schultern sind plötzlich weg, weil die beiden Gerichtsdiener auf den zuckenden Mann zustürzen, der gerade noch ein eleganter Anwalt war. Quito mustert seine rechte Hand. Hat er Josh damit zu Fall gebracht, und ist dieser dabei so unglücklich gestürzt, dass …?
»Er erstickt«, ruft einer der Gerichtsdiener. »Wir brauchen ein Messer. Luftröhrenschnitt.«
Es gibt keine Messer in Gerichtssälen. Jeder der Anwesenden weiß das. Aber vielleicht kann der Hausmeister helfen oder der Pförtner.
Quito rennt zur Tür. Als er sie aufreißt, stößt er mit zwei weiteren Gerichtsdienern zusammen. Hinter ihnen sind Männer und Frauen in Anzügen und Kostümen zu sehen, entlang des breiten Korridors stehen die Türen zu den Büros offen, der Lärm im Gerichtssaal hat alle in dem sonst stillen Gebäude alarmiert. Hälse werden gereckt, jemand hebt ein Mobiltelefon über die Köpfe.
»Hat hier jemand ein Messer?«, brüllt Quito. »Rufen Sie die Ambulanz!« Noch während er spricht, wird er zurück in den Gerichtssaal geschoben. Dort haben Joshs Beinbewegungen aufgehört. Die uniformierten Helfer verstellen den Blick auf den Anwalt, aber Richterin van Beuren ist deutlich zu erkennen. Sie hat sich vom Richtertisch erhoben und steigt von dem Podest herunter, schwankend presst sie mit der Linken ein Telefon ans Ohr, dabei rutscht der Ärmel ihrer Robe nach unten. Auf dem Unterarm ist eine Beule zu sehen, in Form und Farbe der an Joshs Hals ähnlich. Eine helle Flüssigkeit sickert daraus hervor. In diesem Augenblick fällt ihr das Telefon aus der Hand. Der Apparat schlägt auf dem Fliesenboden auf, und das Display zerplatzt mit einem reißenden Geräusch. Seufzend sinkt van Beuren in die Knie, tastet nach dem Gerät, fasst sich an die Brust und kippt zur Seite.
Weitere Männer in Uniform drängen in den Saal. Jemand brüllt: »Das ist Anthrax! Ich kenne die Symptome!« Die Rufe im Korridor werden lauter. »Wir müssen hier raus!«, schreit eine Frau, irgendwo schlagen Türen.
Quito verspürt mit einem Mal eine besinnungslose Angst. Seine Beine wollen hinaus auf den Korridor, den anderen folgen und aus dem Gerichtsgebäude fliehen, aber sein Verstand befiehlt ihm, zu bleiben und Hilfe zu leisten. Er läuft zu Richterin van Beuren, die in einem Haufen schwarzen Stoffes zusammengesunken ist. Sie keucht. Als er die Robe zurückschlägt, sieht er, dass die Geschwulst an ihrem Arm aufgeplatzt ist. Die Haut am Rand schillert grün, und dort, wo sie sich gelöst hat, ist das Gewebe zu sehen. Quito zögert keine Sekunde. Er kennt sich medizinisch zwar nur bei Meeresschildkröten aus, aber es ist offensichtlich, was hier zu tun ist. Mit einer fließenden Bewegung zieht er das Hemd über den Kopf, reißt einen Streifen Stoff heraus und bindet den Arm über dem Ellbogen ab. Was auch immer diese Wunde hervorgerufen hat, es darf auf keinen Fall über den Blutkreislauf in andere Teile des Körpers gelangen. Nun schaut er der Richterin ins Gesicht und stellt erleichtert fest, dass sie frei atmen kann. Ihr Fall liegt anders als der von Josh, vielleicht weil bei ihm die Geschwulst am Hals aufgetaucht ist. Trotzdem sind ihre Augen glasig und verdreht. Sie hat einen Schock erlitten. Quito rüttelt an ihren Schultern und spricht sie an. Als er zwei Finger an ihren Hals legt, um nach der Schlagader zu tasten, erhält er einen Stoß. »Zur Seite«, ruft eine Stimme mit einer Autorität, wie sie nur ein Arzt ausstrahlt. Ein Mann in einem blauen Poloshirt und mit ebenso blauer Gesichtsmaske stellt einen Erste-Hilfe-Koffer neben van Beuren ab. Ein ähnlich Gekleideter macht sich am Kopf der Richterin zu schaffen. Keine fünf Meter entfernt wird Josh Mangiardi von zwei Helfern auf eine Trage gehoben, sein rechter Arm hängt schlaff über den Rand, bis eine Sanitäterin in Rettungsweste ihn an der Trage befestigt. Jemand öffnet die Fenster, und warme Luft strömt herein.
»Was ist hier passiert?«, ruft der Notarzt, während er eine Atemmaske auf das Gesicht von Richterin van Beuren presst. Eine weitere Trage wird hereingebracht. Die Gerichtsdiener reden durcheinander. Ihre Gesichter sind schweißbedeckt, ihre Worte überschlagen sich, verhaken sich ineinander, ergeben keinen Sinn. Einer der Männer schaut immer wieder zu Quito hinüber.
Zeit zu verschwinden, bevor es noch Ärger gibt. Der Korridor ist voller Menschen, die versuchen, aus dem Gebäude zu entkommen. Quito taucht in die Menge ein. Obwohl er halb nackt ist, zieht er keine Blicke auf sich, als er die Freitreppe erreicht, dafür herrscht zu viel Aufruhr in der Fleming Street. Am Rand der Straße ist eine Gruppe Touristen stehen geblieben, einige filmen das Geschehen mit ihren Telefonen. Wenn er sich dorthin wendet, wird er noch an diesem Abend auf allen bekannten Onlinekanälen zu sehen sein. Also hält er sich nach rechts, Richtung Whitehead Street, aber von dort kommen ihm Streifenwagen entgegen. Geh einfach weiter, befiehlt er sich selbst, du hast nichts Unrechtes getan. Im nächsten Moment findet er sich auf dem Boden wieder, neben ihm liegt ein schwarzer Rucksack, darüber ist er gestolpert. Jemand muss ihn fallen gelassen haben. Quito kommt auf die Beine und sieht sich um, doch niemand schenkt ihm oder dem Gepäckstück Beachtung. Um das Hindernis aus dem Weg zu räumen, hebt er den Rucksack auf.
Kapitel 3
Key West, Town Center
Inéz rennt los. Sie lässt das Processing Center hinter sich, folgt Bembe und Camillo. Die beiden sind schnell. Sie alle wissen: Die Verfolger werden sich auf die Langsamste der Gruppe konzentrieren, und die anderen haben eine Chance zu entkommen.
Sie hört das Keuchen ihrer Gefährten, sie hört die Rufe der Polizisten, die sie zum Stehenbleiben auffordern. Werden sie schießen? Auf Kuba wäre das längst geschehen.
Inéz’ Schuhe sind zum Laufen kaum noch geeignet, billige Converse-Imitate. An den Rändern ist der Leinenstoff ausgefranst, schon seit der Überfahrt scheuert sie sich darin die Knöchel wund. Jetzt versucht sie, nicht an ihre Füße zu denken, sondern nur ans Entkommen.
Sie ist kleiner als die Männer vor ihr, aber leichter und schneller. Als sie aufschließt, stößt Bembe ihr den Ellbogen gegen die Rippen, jedenfalls versucht er das, doch der Rucksack fängt den Stoß ab. Inéz taumelt nach links und nutzt den Schwung, um in eine Seitenstraße abzubiegen. Camillo rennt weiter geradeaus, Bembe bleibt an ihrer Seite, verliert durch das Manöver jedoch an Boden und fällt zurück. Sie spürt ein Ziehen an den Tragegurten des Rucksacks, Bembe hat sie gepackt und versucht sie zu Fall zu bringen. Als sie nach hinten ausschlägt, kommt sie frei.
Mit ihrem Landsmann und den Rufen der Polizisten im Rücken wird Inéz auf ein hohes Gebäude aus rotem Backstein zugetrieben. Über einer Freitreppe mit weißen Säulen leuchtet ein Dreiecksgiebel mit einem Relief und der Inschrift »Monroe County Courthouse«. Ausgerechnet auf ein Gericht hält sie zu! Besser können es die Verfolger nicht treffen. Vermutlich lachen sie schon darüber, dass das Wild von selbst in die Falle gehen wird. Aus dem Gerichtsgebäude strömen Menschen. Einige rufen etwas, alle haben es eilig wegzukommen, dabei stoßen sie gegeneinander, eine junge Frau im Hosenanzug stürzt die Freitreppe hinab. Ein junger Mann mit bloßem Oberkörper hilft ihr auf. Inéz steuert auf die Leute zu. Es gelingt ihr, zwischen Schultern, Rücken und Bäuchen unterzutauchen. Was ist hier überhaupt los?, fragt sie sich, während sie vorwärtsdrängt. Sie hört Hilferufe, die Leute haben Angst. Gegen den Strom bewegt sie sich auf etwas zu, von dem alle anderen wegkommen wollen.
Eine an einem behaarten Arm befestigte Armbanduhr kratzt durch ihr Gesicht. Für einen Moment ist sie zwischen Sakkos und Kostümjacken eingezwängt, kommt nicht mehr vom Fleck. Sie stößt mit den Schultern, schiebt mit Fäusten und gelangt schließlich zu der Freitreppe. Ein Blick zurück verrät ihr, dass die Polizisten, die sie gerade noch verfolgten, nun alle Hände voll damit zu tun haben, die Leute zu beruhigen und den Aufruhr in den Griff zu bekommen. Sie hat etwas Zeit gewonnen, sie wird sie nutzen.
Weiter links lädt eine kleine Straße dazu ein, entlang den weißen Häusern mit den prachtvollen Veranden zu verschwinden. Inéz läuft los, da durchströmt sie ein Schreck wie ein Schluck zu starker Cafecito. Sie schaut an sich herab. Der Rucksack ist weg. Obwohl ihre Augen die Katastrophe bereits gemeldet haben, tasten ihre Hände Oberkörper und Schultern ab. Wie konnte das geschehen? Vorhin hat Bembe an dem Rucksack gerissen, aber danach hat sie ihn noch getragen, hatte ihren größten Schatz, ihre Zukunft, ihr Leben geschultert.
Sie kehrt um. Ohne die Zigarren ist ihre Flucht nur eine Anekdote, die sie ihren Freiern hinter der rosa gestrichenen Tür eines Bordellzimmers erzählen kann, in dem sie enden wird.
Sirenen heulen, und eine Megafonstimme verkündet, dass es für Panik keinen Grund gebe. Inéz lacht auf, obwohl ihr zum Weinen zumute ist. Die Menschenmenge beginnt, sich zu zerstreuen. Wo gerade noch Bäuche gegen Rücken, wo Oberschenkel gegen Gesäße drückten, entsteht Raum. Eine Frau sinkt am Stamm einer Palme zu Boden und hält sich die Hände vors Gesicht. Zwei Sanitäter laufen mit medizinischem Gerät in das Gericht hinein. Hat es einen Anschlag gegeben? Die Polizisten sind von einem halben Dutzend Männern in Anzügen umringt, die durcheinanderreden. Wo ist der Rucksack? Inéz sucht mit Blicken den Rasen und die Sträucher um das Gerichtsgebäude ab. Sie versucht, den Weg zu erkennen, den sie gekommen ist.
Jemand fasst sie an der Schulter, sie schrickt zusammen. »Entschuldigung«, sagt ein Mann in forstgrünem Hemd, »wir sind von Key TV und versuchen herauszufinden, was hier los ist. Waren Sie im Gerichtsgebäude? Können Sie uns sagen, was dort drinnen passiert ist?«
Voller Entsetzen schaut Inéz in das Auge einer Kamera, die der Begleiter des Journalisten auf sie gerichtet hat, und die Linse starrt erbarmungslos zurück. »Ich war da nicht drin«, sagt sie, »ich suche nach meinem Rucksack. Er ist schwarz und etwa so groß.« Sie breitet die Hände aus, spürt die Luft dazwischen schwer werden.
»Ist es der dort?« Der Kameramann schwenkt sein Aufnahmegerät in Richtung eines weiß blühenden Plumeriabusches. Davor steht der Mann mit dem bloßen Oberkörper und macht sich an ihrem Rucksack zu schaffen.
»Das ist meiner!«, ruft Inéz so laut sie kann. Sie erreicht den Dieb in dem Augenblick, als er die Hand in den Rucksack steckt. Sie will ihm das Gepäckstück entreißen, aber er schlingt beide Arme darum.
»Gib ihn her!« Inéz muss sich zwingen, nicht zu schreien, und schaut sich nervös nach den Polizisten um. Die sind zum Glück noch mit den Anzugträgern beschäftigt. Leiser sagt sie: »Er gehört mir.«
»Das kann jeder behaupten«, erwidert der Kerl. Er hat dunkles, gewelltes Haar, die Schatten unter seinen pinienholzfarbenen Augen schimmern violett. Seine Haut, von der viel zu sehen ist, hat die Farbe und den Glanz von Baumharz. »Vielleicht bin ja nicht ich der Dieb, sondern du.«
Inéz’ Hand schießt vor, doch der junge Mann bringt den Rucksack hinter seinem Rücken außer Reichweite. »Wenn du ihn mir nicht gibst, rufe ich die Polizei«, droht sie.
»Gut«, sagt er und streckt einen Arm in Richtung ihrer Verfolger aus. »Da vorn stehen die Kollegen meines Vaters. Er ist der stellvertretende Polizeichef von Key West.«
Sie lacht. Die Männer auf Kuba haben ihr schon die unglaublichsten Lügen erzählt, aber nie war eine so blöd wie diese.
»Wenn du mir verrätst, was drin ist, gebe ich ihn dir. Ganz einfach, oder?«
»Schmutzige Wäsche ist drin«, sagt sie. »Ich bin unterwegs zum Waschsalon.« Vielleicht wird ihn das davon abhalten, in den Rucksack zu schauen.
Er weicht einige Schritte zurück und zieht den Reißverschluss weiter auf. Mit einer Hand hält er Inéz auf Distanz, mit der anderen holt er die Holzschachtel hervor.
»Da sind Zigarren drin«, sagt sie schnell. »Lass die Finger davon!«
Sie versucht, ruhig zu bleiben, während er mit der Schachtel hantiert. Wenn er den Wert der Cohibas erkennt, wird er ihr den Rucksack niemals zurückgeben. Inéz überlegt, ob sie sich auf ihn stürzen soll, da nickt er zufrieden und hält ihr das Gepäckstück hin.
»Das hättest du gleich sagen können.« Er zuckt zusammen angesichts der Heftigkeit, mit der Inéz ihm den Rucksack abnimmt. Sie zieht den Reißverschluss zu und will ihn sich wieder umhängen, aber der linke Gurt ist aus der Naht gerissen.
Mit einem Mal wird Inéz alles zu viel: der Schreck über den Verlust der Zigarren, die Angst vor ihren Verfolgern, die Ungewissheit über jeden ihrer Schritte – all das baut sich in ihrem Innern zu einer riesigen Welle auf, die über sie hereinzubrechen droht.
Der Fremde streckt eine Hand aus. »Zeig mal her, das kriegen wir schon wieder hin.«
Sie lässt zu, dass er ihren linken Arm hebt und sich an dem Rucksack zu schaffen macht, den sie mit dem anderen Arm umklammert hält. Verwundert schaut sie zu, wie er das lose Ende des Gurts durch eine Schlaufe zieht und verknotet, dasselbe dann auf der anderen Seite wiederholt. »Ich bin Quito«, murmelt er, während er prüfend an dem Gurt ruckt. »Und du bist …« Als Inéz ihren Namen nicht nennt, schaut er sie fragend an, in seinem Blick funkelt etwas, das sie nicht deuten kann. »… eine junge Frau mit einer Menge teurer Zigarren, die mit der Polizei lieber nichts zu tun haben möchte. Ich würde sagen, du gehörst zu der Gruppe kubanischer Geflüchteter, die im Garten des Processing Center kampiert. Und die Zigarren …«, er deutet auf den Rucksack, »… willst du verkaufen, damit du Startkapital in den USA hast. Das ist klug. Wenn du Geld mitgenommen hättest, hätte es dir der Bootsführer abgenommen.«
Inéz fällt auf, dass er sie nicht nach einer Bestätigung für seine Vermutungen fragt. Er fasst ihre Situation mit der Selbstverständlichkeit des Unverschämten zusammen, und ihr bleibt nichts anderes übrig, als ihn anzustarren. Empörung kocht in ihr hoch. Sie hat alles dafür getan, hierherzukommen, alles, um so unauffällig wie möglich zu sein, alles, um bleiben zu können, und jetzt muss sie sich dafür verspotten lassen. »Woher weißt du das?«
»Von den Geflüchteten? Ich hab doch schon gesagt, mein Vater ist der stellvertretende Polizeichef. Er erzählt solche Dinge beim Abendessen.«
Inéz wendet sich ab. Sie hat keine Zeit für diesen Unsinn. Sie muss weiter. Noch stehen Schaulustige herum und beobachten die Arbeit der Einsatzkräfte, noch ist sie nur eine unter vielen. Wo war noch die Straße, in die sie vorhin verschwinden wollte?
»Warte!«, ruft er hinter ihr her. Dann ist er neben ihr, und sie spürt seinen muskulösen Arm um ihre Schultern. Seine Körperwärme dringt durch ihr T-Shirt, er zieht sie an sich.
»Was fällt dir …«, weiter kommt sie nicht.
»Hallo, Mike!«, ruft er, und jetzt bemerkt Inéz den Polizisten in schwarzer Uniform, der auf sie zugelaufen kommt, einen großen, durchtrainierten Mann, dem man ansieht, dass er sich hauptsächlich von Proteinen ernährt.
»Quito?« Der Polizist bleibt stehen. Seine Blicke fliegen von Inéz zu dem Mann an ihrer Seite und wieder zurück. »Alles in Ordnung bei dir?« Er dreht den Polizeiknüppel in der Hand.
»Wir haben nur einen Schreck bekommen wegen der Aufregung hier«, sagt Quito. »Besser wir verschwinden und stehen dir bei der Arbeit nicht im Weg.« Er hebt eine Hand, geht los und zieht sie mit sich.
Inéz muss sich nicht umschauen, um zu wissen, dass der Cop ihr mit seinen Blicken Löcher in den Rücken brennt, dass er sie erkannt hat, dass es nicht sein kann, dass Quitos Freundin zufällig der flüchtigen Kubanerin aus dem Processing Center ähnlich sieht. Sie versucht die Zweifel zu zerstreuen, indem sie einen Arm um Quitos Taille legt. Als sie sich noch einmal umdreht, hat sich der Polizist abgewandt, er hilft einem Sanitäter dabei, ein kleines Mädchen zu beruhigen, das weinend auf dem Boden sitzt und einen Hund in den Armen hält. Das Kind erdrückt das Tier beinahe. Der Hund kläfft und japst, und die Männer haben alle Mühe, dafür zu sorgen, dass beide unversehrt bleiben.
Nachdem sie außer Sichtweite des Polizisten sind, nimmt Quito seinen Arm von ihren Schultern. Die Anspannung fällt von Inéz ab. Die kleine Straße wirkt nach dem Chaos vor dem Gericht wie eine andere Welt. »Du bist wirklich der Sohn des Polizeichefs«, stellt sie fest. »Warum hast du mir geholfen?«
»Meine Eltern waren auch Bootsflüchtlinge aus Kuba«, sagt er. »Wenn man sie zurückgeschickt hätte, wäre ich jetzt nicht hier.«
»Dein Vater ist vom Bootsflüchtling zum Polizeichef aufgestiegen?«
Er breitet die Arme aus. Sie sind lang und sehnig, kräftig genug, um damit die Welt zu umarmen. »Du bist in Amerika, schon vergessen? Hier ist alles möglich.«
Inéz ist es auf einmal egal, ob Quito die Wahrheit sagt. Wichtig ist einzig und allein die Erkenntnis, dass er in der Lage ist, ihr zu helfen. »Gibt es hier einen Ort, an dem ich mich eine Weile verstecken kann, bis sich die Aufregung gelegt hat?«
»Ich kenne den perfekten Ort, aber ich bringe dich nur unter einer Bedingung dorthin.« Da ist wieder dieses Flackern in seinen Augen, und Inéz mag die Unsicherheit nicht, die es in ihr hervorruft.
»Was für eine Bedingung?«
»Du verrätst mir deinen Namen.«
*
Diego ist groß und schwer, und im Weglaufen war er noch nie gut. Deshalb musste er lernen zuzuschlagen. Als die Polizisten das Camp stürmen, ringt er zwei nieder, damit Inéz entkommen kann. Dann rennt er hinter ihr her, ruft nach ihr, einmal, zweimal, schließlich bleibt ihm die Luft weg.
Einer der Polizisten heftet sich an seine Fersen.
Diego biegt in eine Straße ein und prallt gegen einen Mann mit einem Pappbecher in der Hand. Er nimmt ihm den Becher ab, dreht sich um und schüttet dem Polizisten den Inhalt ins Gesicht. Das verschafft ihm einen Vorsprung. Er läuft die Straße hinauf, eine Bar reiht sich an die andere. In vielen sitzen schon um diese Uhrzeit Gäste, saugen an Strohhalmen und kauen an schwerem Essen. Von irgendwoher ist Gitarrenmusik zu hören, zu der jemand singt. Diego läuft Slalom durch die Passanten und zieht eine Spur der Empörung hinter sich her.
Wo ist Inéz? Sie muss in der Nähe sein. Der Gedanke, dass die Polizisten sie überwältigen, ihr die Arme auf den Rücken drehen und ihr wehtun könnten, lässt Diego noch schneller laufen. Die Polizei hat Inéz auf Kuba verfolgt, und dasselbe geschieht nun auch hier. Er muss sie finden, danach mit ihr untertauchen und sich durchschlagen nach Miami, wie Bembe es geplant hatte. Vielleicht treffen sie ihn und die anderen dort im kubanischen Viertel wieder. So leben wie auf Kuba, das möchte Diego, aber in Freiheit, vor allem Inéz soll sagen und singen können, was sie will. Er hat geglaubt, das ginge hier, in diesem Land, in dem jeder eine Chance bekommen soll. Genau die braucht er: eine Chance.
Er kommt an einem Schaufenster vorbei, nimmt ein buntes Flimmern aus dem Augenwinkel wahr, sieht genauer hin. Das Schaufenster ist voller Computer und Monitore, alle Bildschirme zeigen dasselbe: eine junge Frau, die aussieht wie Inéz in ihrem schwarzen T-Shirt mit der Flagge darauf, und neben ihr ein junger Mann. Er ist halbnackt und hält sie im Arm.
Diego ist schon an dem Fenster vorbei, als ihm bewusst wird, was er da gerade gesehen hat. Das war keine Fernsehserie, kein Spielfilm, nicht mal eine Übertragung aus einem anderen Teil der USA. Das war Inéz, und dieser Kerl macht sich über sie her.
Diego kehrt um. Er muss alles sehen. Er muss wissen, wo Inéz ist, damit er ihr helfen kann. Er vergisst den Polizisten, er nimmt auch dessen Kollegen auf der anderen Straßenseite nicht wahr. Alles, was Diego sieht, sind die Monitore. Die Kamera schwenkt über Krankenwagen, erfasst Passanten, Polizisten und Sanitäter, und jetzt schiebt sich ein Mann mit einem Mikrofon ins Bild.
»Stehen bleiben!«, ruft eine befehlsgewohnte Stimme.
Diego hat ohnehin nicht vor wegzulaufen, nicht, bevor er Inéz noch einmal gesehen hat. Tatsächlich kommt sie wieder ins Bild, am hinteren Rand des Ausschnitts, nicht im unmittelbaren Interesse des Kameramanns, aber noch Teil des Geschehens. Der halbnackte Kerl hat weiterhin einen Arm um sie gelegt und führt sie in eine Seitenstraße. Diego schlägt mit den Fäusten gegen das Schaufenster. Bevor sich die Polizisten auf ihn stürzen, erkennt er auf den Bildschirmen noch ein rotes Backsteingebäude mit Säulen und Freitreppe. Dann schlingen sich Arme um ihn und drücken ihn zu Boden. Ein Knie presst sich auf seinen Rücken, er spürt es kaum, denn seine Knochen und Nerven sind von einem Panzer aus Fettgewebe ummantelt, und außerdem kann er nur noch an Inéz denken, Inéz, die jetzt irgendwo in dieser Stadt einem zudringlichen Amerikaner ausgeliefert ist.
Angestachelt von dieser Vorstellung, gelingt es Diego, den Polizisten von seinem Rücken abzuwerfen und einem anderen die Faust ans Kinn zu dreschen. Dann sprüht ihm jemand etwas ins Gesicht, und seine Augen füllen sich mit Tränen, sodass er nichts mehr sehen kann. Seine Lungen brennen, er hustet, bekommt keine Luft.
»Er erstickt«, sagt einer der Polizisten. »Der spielt uns nur was vor«, meint ein anderer. Sie drehen ihm die Handgelenke auf den Rücken und fesseln ihn mit etwas, das sich wie Kabelbinder anfühlt. Dann ziehen sie ihn auf die Beine. Obwohl seine Augen verquollen sind, reißt er sie auf, um einen letzten Blick auf die Monitore zu werfen. Verschwommen erkennt er, dass die Szene noch übertragen wird.
»Das Haus da im Fernsehen«, krächzt er. »Wo ist das?«
»Was hat er gesagt?«, fragt einer der Cops und stößt ihn in den Rücken. Diego taumelt vorwärts.
Ein anderer Polizist lacht. »Ich glaube, er will wissen, wo das Gericht ist.« Nun fallen die anderen in das Gelächter ein. »Dahin bringen wir dich noch früh genug. Jetzt geht es erst mal in die Zelle.«
Aber so weit kommt es nicht, denn im nächsten Moment sinkt einer der Polizisten auf die Knie. Diego blinzelt, er bekommt den Blick frei und erkennt, dass der Cop, dem er den Kaffee ins Gesicht geschüttet hat, eine Hand auf seinen ausrasierten Nacken presst und das Gesicht verzieht. Die anderen beiden scheinen unschlüssig zu sein, ob sie ihm helfen sollen, denn dazu müssten sie Diego loslassen. Aber als der Kniende endgültig zusammenbricht, gibt es buchstäblich kein Halten mehr. Überrascht verfolgt Diego, wie sich einer der Polizisten um seinen Kollegen kümmert, während der andere auf einem Telefon herumtippt.
Die Götter sind mit ihm. Diego läuft los. Er wird das Gericht finden und von dort aus Inéz.
Kapitel 4
Santiago de Cuba
In der Schule war Inéz unter den Schwächsten ihrer Klasse. Das zeigte sich vor allem im Mathematikunterricht. Schon als Señora Echevarria zum ersten Mal Zahlen an die verschrammte Schiefertafel schrieb, fürchtete Inéz, dass sie den Sinn dahinter niemals würde verstehen können. Arabische Zahlen nannte die Lehrerin diese Zeichen, die Inéz erschienen wie aus einer anderen Welt, fremd und fern.
Nur eine Zahl gab es, deren Wert sie erfasste, und das war die Null. Cero – so groß waren ihre Chancen, aus ihrem Leben etwas machen zu können. Das jedenfalls sagten ihre Mitschülerinnen der Alameda-Grundschule, denn sie wussten: Inéz gehörte nicht nur zu den schlechtesten Schülerinnen, sondern stammte auch aus einer der ärmsten Familien. Ihre Eltern waren Landarbeiter und wurden von Inéz’ Großmutter Floramaria unterstützt. Deren verstorbener Ehemann hatte mit einer Zigarrenfabrikation ein Auskommen gehabt. Floramaria war es, die ihr riet, nicht so wie die anderen Kinder davon zu träumen, möglichst viele Nullen zu sammeln, um diese dann mit einer Ziffer davor und einem Dollarzeichen dahinter zu versehen. Glück im Leben finde man nicht durch Hirngespinste, erklärte die Großmutter, sondern weil man im richtigen Moment mit beiden Händen zupackte. Anfangs teilte Inéz diese Einschätzung nicht, aber als sie zwölf war, erkannte sie, dass sie statt der Sprache der Mathematik die der Musik verstehen konnte. Sie entzifferte Noten und ließ daraus Töne auf dem alten blauen Klavier ihrer Großmutter entstehen. Schon vom ersten Augenblick an liebte sie das Gefühl der ausgeleierten Tasten unter ihren schmalen Fingern. Und das Beste war: In der Welt der Töne gab es keine Null.
Zunächst lächelte Floramaria über das ungelenke Klimpern der Enkelin, nach einigen Wochen hörte sie mit einem grüblerischen Ausdruck auf dem Gesicht zu, dann rief sie nach Inéz’ Mutter und der großen Schwester Guillerma. Die drei Frauen waren sich einig: Inéz sollte Unterricht erhalten. Zu ihrem Lehrer wurde Señor Labrada auserkoren, ein alter Freund Floramarias aus den Tagen der Revolution, der sie fortan für wenig Geld ausbildete, ihr allerdings nur die alten Lieder beibrachte: über tapfere Streiter, die mit geschultertem Gewehr dem Sieg entgegenmarschieren, über die Gleichberechtigung aller Menschen und die Errungenschaften des Kommunismus. Zunächst war sie von dieser Musik begeistert, denn die Töne waren einfach zu spielen, und die Großmutter, eine glühende Anhängerin von Fidel Castro, hörte mit leuchtenden Augen zu. Bald jedoch erkannte Inéz, dass die Musik der Revolutionäre schlicht war, und sie begann, die simplen Melodien zu hinterfragen. Sie stieß auf Wiederholungen in den Harmonien, nicht nur innerhalb eines Liedes, auch die Stücke ähnelten sich. Diese Art Musik folgte stets demselben einfachen Rezept. Als sie das Señor Labrada sagte, drohte der, ihre Finger unter dem Klavierdeckel zu brechen, sollte sie noch einmal etwas Derartiges äußern.
Inéz war fünfzehn, als sie ihre Großmutter bat, einen anderen Klavierlehrer für sie zu finden. Stattdessen lud Floramaria Señor Labrada zum Kaffee ein und fragte ihn über Inéz’ Karrieremöglichkeiten aus. Sie selbst saß dabei und musste mit anhören, wie er ihr Talent »in den höchsten Tönen« lobte – das war ein Wortspiel, mit dem er Floramaria zum Lachen brachte. Die beiden malten sich zwischen zwei Schlucken Cafecito aus, wie Inéz bei einer Kundgebung der Kommunistischen Partei Kubas im Orchester sitzen würde. Der Lehrer schien zu spüren, dass seine Weiterbeschäftigung davon abhing, wie viel Glück er dem Mädchen prophezeite, denn als Nächstes verkündete er, die Schülerin bei Sonanda Viva angemeldet zu haben, dem Wettbewerb für die Musik der revolutionären Garden. In diesem Moment wurde Inéz klar, dass sie zu Tanzmusik oder Kampfliedern verurteilt sein würde, wenn sie weiter Klavier spielen wollte – es sei denn, sie nahm die Dinge selbst in die Hand.
Zu dieser Zeit begann Inéz zu erblühen. Ihre Brüste wuchsen – nur ein wenig, ihr war klar, dass sie niemals so vollbusig sein würde wie ihre Schwester –, die Brustspitzen wurden dunkler, ihr Gesicht verlor die Rundlichkeit, ihre Lippen bekamen einen Schwung, und ihre Augenbrauen wurden dichter. Die Behaarung an anderen Körperstellen hatte schon einige Zeit zuvor eingesetzt und schien kein Ende nehmen zu wollen, sehr zu ihrer Besorgnis. Sie fürchtete, dass sie beim Klavierspielen Haare auf den Fingern entdecken würde, und schwor sich, in diesem Fall Señor Labrada darum zu bitten, die Drohung mit dem Klavierdeckel in die Tat umzusetzen.
Doch statt Haaren bekamen ihre Finger Kraft und Eleganz. Durch das beständige Üben an den Tasten entwickelte Inéz Muskeln an Händen und Armen, und Adern zogen sich dicht unter ihrer Haut entlang, um das Kraftwerk darunter mit Energie zu versorgen. Eines Nachmittags, weindunkle Schatten lagen in den Winkeln des Raums, spürte sie die Blicke von Señor Labrada auf ihren Händen so stark, dass sie ihr wie Berührungen erschienen. Und mit einem Mal wusste sie, wie sie sich des Lehrers und seiner verknöcherten Auffassung von Musik entledigen konnte.
Vor der nächsten Unterrichtsstunde machte sich Inéz zurecht. Zum ersten Mal putzte sie sich für einen Mann heraus, für einen Achtzigjährigen. Um dem Erfolg bei ihrem Vorhaben den Weg so breit wie möglich zu ebnen, vertraute sie sich ihrer Schwester an, verriet ihr allerdings nur, sie wolle einem Mann den Kopf verdrehen. Um wen es sich handelte, verschwieg sie, und Guillerma schien auch nicht sonderlich daran interessiert zu sein. Die große Schwester setzte das Mädchen vor den Frisiertisch in ihrem Zimmer, begann damit, Unreinheiten auf ihrer Haut zu verdecken, trug eine getönte Gesichtscreme und einen Puder auf, von dem sie behauptete, er helfe, die Schminke zu fixieren. Dann sah Inéz im Spiegel zu, wie sie sich unter den Händen von Guillerma verwandelte. Lidschatten in einem schimmernden Grün hob ihre Augen hervor, und ein pfirsichfarbenes Rouge betonte ihre Wangen. Für den Mund verwendete Guillerma einen Lippenstift in einem hellen Rot und betonte die Kontur mit einem dunkleren Ton. Derart gerüstet fühlte sich Inéz, als schwebte sie zur Klavierstunde, statt wie sonst mit schweren Schritten im Takt der Lustlosigkeit in das Zimmer mit dem blauen Klavier zu stapfen.
Die Wirkung ihrer Verwandlung stand Señor Labrada ins Gesicht geschrieben. Inéz erklärte ihm ihr Aussehen damit, dass sie ihn um seine Meinung bitten wollte: War sie präsentabel für den Auftritt bei Sonanda Viva?
Zuvor hatte sie sich gefragt, was sie wohl alles anstellen müsste, um den alten Lehrer in Verlegenheit zu bringen, doch wie sich herausstellte, war dazu gar nicht viel nötig. Labrada verlangte, wie immer, dass sie »Hasta siempre, Comandante« spielte, und sie gehorchte, gab dem einfachen Rhythmus einen ungewohnten Schwung und streifte während der Passagen in den hohen Registern Labrada wie zufällig mit dem bloßen Unterarm. Im Verlauf dieser denkwürdigen Unterrichtsstunde war sie überhaupt nicht störrisch, und ihr Schmollmund schien den Lehrer diesmal nicht zu provozieren, sondern vielmehr seine Aufmerksamkeit zu erregen. Inéz fiel auf, dass Labrada verdrießlich neben ihr auf der Klavierbank herumruckte. Schließlich erhob er sich und erklärte den Unterricht für beendet – zum ersten Mal zehn Minuten vor der Zeit.
Inéz wusste, dass sie gewonnen hatte, obwohl sich der Erfolg ihrer Bemühungen erst nach zwei weiteren Unterrichtsstunden einstellte. Jedes Mal verwandelte Guillerma sie in einen Schmetterling, kein einziges Mal stellte die Schwester Fragen, und Inéz liebte sie dafür. Señor Labrada verlor endgültig die Nerven, als seine Schülerin ihn in einem weißen Kleid erwartete. Es war das Kleid, das ihre Großmutter für das Konzert genäht hatte, mit einem geraden Schnitt und einem asymmetrischen Dekolleté, das eine Schulter entblößte. Das Kleid hatte nur einen langen Ärmel mit einem Volant am Ende, der die Hand bedeckte. Eine Brosche in Form einer Rose war an der Schulter befestigt und bildete einen zarten Kontrast zu dem weißen Stoff. Niemand hätte vermutet, dass es aus dem Stoff eines alten Vorhangs geschneidert war, am allerwenigsten Señor Labrada.
»Wie finden Sie es?«, fragte Inéz und lächelte, nur ein wenig, damit das Make-up über ihren Pubertätspickeln keinen Schaden nahm. Sie verbeugte sich in seine Sprachlosigkeit hinein.
Irgendwie gelang es dem Klavierlehrer, diese letzte gemeinsame Stunde mit Würde hinter sich zu bringen. Unablässig studierte er die Noten und sah Inéz nicht ein einziges Mal an. Nachdem der letzte Ton verklungen war, ging er und kam nie mehr wieder. Großmutter Floramaria erklärte er, er habe der Enkelin alles beigebracht, sie sei ein Naturtalent und bestens gerüstet für alles, was vor ihr liege.
Inéz war frei. In der Zwischenzeit hatte sie das professionelle Klavierspiel zu ihrem Lebensziel erklärt und sich an der Musikhochschule, dem Conservatorio de Esteban Salas, die Unterlagen für die Einschreibung abgeholt. Die Erfüllung ihres Traums war zum Greifen nah. Ein Jahr Schulzeit trennte sie noch davon, und sie würde jeden Tag zum Üben nutzen. Zu Hause versteckte sie die Papiere unter der Matratze. Bevor sie ihrer Familie die Pläne offenbarte, wollte sie Großmutter, Mutter, Vater und Guillerma erst beim Konzert von ihren Fähigkeiten überzeugen.
Aber dann ging alles schief.
Das Festival Sonanda Viva fand in einem verrauchten Saal mit großer Bühne und Tanzfläche statt. An den Wänden hingen Plakate und Fotos berühmter Musiker, die dort einst ihr Debüt gegeben hatten. Als Inéz sich an den Flügel setzte, den Volant über ihrer Hand zurechtzog und das Kleid glatt strich, musterte sie die Porträts und spürte, wie sie ein Gefühl von Triumph überkam. Niemals würde sie Musik spielen, um andere dazu anzutreiben, den Karren des Kommunismus aus dem Dreck zu ziehen.
Das Orchester setzte ein, es spielte »Canción de harapos« in einer Version für Streicher, Piano und Blechbläser. Inéz hatte keine Probleme, ihren Teil beizutragen. Auch »El necio« begleitete sie unaufgeregt und verzierte es mit einem bescheidenen Solo. Dann war »Hasta siempre, Comandante« an der Reihe. Die ersten Takte sollte Inéz allein auf dem Klavier spielen und dazu singen, doch sobald der Abschiedsbrief von Che Guevara in den Versen zitiert würde, sollte das Orchester einsetzen, um die Worte des Nationalhelden mit Pathos zu unterstreichen.
Sie verabscheute das Stück. Es war die Hymne ihrer persönlichen Unterdrückung durch Señor Labrada. Saß er im Publikum? Sie hoffte es, denn dann würde er zu hören bekommen, dass mehr in ihr steckte als ein Musikpüppchen im Keuschheitsgürtel der Revolution.
Sie spielte das Lied einen halben Ton höher als notiert. Einige der Musiker warfen ihr verstörte Blicke zu. Alle anderen waren zu schockiert, um zu reagieren, als die junge Frau am Flügel zu singen begann. Inéz hatte die Worte verändert. Statt »Wir lernten dich zu lieben, seit dem historischen Höhepunkt, wo die Sonne deiner Tapferkeit dem Tode einen Glorienschein verlieh« sang sie »Wir lernten zu gehorchen, und unser schönster Tag wird der sein, an dem wir frei sein werden und unsere eigenen Entscheidungen fällen können«.
Das hatte sie getan, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, um sich freizusingen von Zucht und Ordnung. Natürlich hatte sie gewusst, dass ihre Zeilen auch als Kritik an der Regierung verstanden werden konnten, ein wenig hatte sie das sogar gehofft, damit sie nie wieder jemand auffordern würde, ein Regierungslied zu spielen. Aber mit dem, was folgte, hatte sie nicht gerechnet.