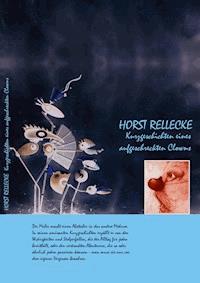Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
In welchem Zusammenhang stehen der schreckliche Fund in einem herrenlosen Koffer und die mysteriösen Vorgänge in einer Kunstausstellung im Gropiusbau zu Berlin? Im ersten Erzählstrang wird der Weg der Kunstwerke von ihrem Schöpfer bis zu ihren aktuellen Besitzern aufgezeigt, im zweiten, welche Auswirkungen daraus noch 500 Jahre später erwachsen. Kunstgeschichte und Psychologie würzen eine spannende Erzählung, die beweist, dass die großen Entscheidungen nur zu oft von Kleinigkeiten abhängen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Rellecke
DER ROTE PUNKT
I. Die Anlieferung
Die beiden zerlumpten Gestalten schoben ihren Karren mit den zwei großen Scheibenrädern nur mit Mühe und deshalb langsam, obwohl es ihnen sehr viel lieber gewesen wäre, wenn Sie diesen heiklen Auftrag möglichst schnell hätten erledigen können, aber der schwere Wagen und das grobe Pflaster hatten sich gegen sie verschworen - und alle Teilnehmer am dichten Gedränge in den Straßen und Gassen Roms auch. Das Fortkommen war in mehrfacher Hinsicht atemberaubend. Zum einen ließ der schwere Karren mit seiner Last die Männer keuchen – zumal es bisweilen auch noch bergauf ging – zum anderen durchzog ein bestialischer Gestank die engen Gassen. Was die Nachttöpfe hergegeben hatten, verband sich mit dem alltäglich anfallenden Unrat zu einem schlüpfrigen Straßenbelag, auf dem ein Transport mit einem solchen Gefährt echte Knochenarbeit war – was bei dieser Fuhre auch noch in anderer Hinsicht zutraf. Der Gestank wurde nur noch vom Lärm übertroffen, den schreiende Händler, zänkische Weiber, tollende Kinder, stimmgewaltige Gaukler und sabbernde Bettler zu einem lautstarken Gemeinschaftswerk zusammenfügten. Später sollte man diese Zeit als den Beginn der Neuzeit bezeichnen, als Ende des Mittelalters. Aber auf einer römischen Gasse im Jahre des Herrn 1515 lag die neue Zeit noch gut verborgen unter den festgetretenen Hinterlassenschaften von Mensch und Tier.
Es war den beiden Fuhrleuten jedoch genau so aufgetragen worden, nämlich die Ware bei Tage und dem geschäftigsten Treiben anzuliefern. Bei Dunkelheit hätten sich aus vielen Fenstern Dutzende von Augenpaaren in die mit Holzscheiten kaum verdeckte Tuchrolle gebohrt. Neugier und Misstrauen hätten schnell einen Skandal zusammengebraut, den ihr Auftraggeber unter allen Umständen vermeiden wollte.
Der Karren mit den zwei Lumpenmännern erreichte nun eines der besseren Quartiere der Stadt, Bürgerhäuser, kleinere Palazzi und auch schon mal ein etwas größerer – die keimende Kulturschicht auf dem Pflaster war hier schon erheblich dünner und der Mief der Stadt vermischte sich mit dem zarten Duft von Lavendel und Zitronen. Die Anwesen hier schlossen mit ihren Fassaden unmittelbar zur Gasse ab. Meistens hatte die Außenmauer ein Gesicht: ein Maul und zwei kleine Augen, durch die man im Bedarfsfall alles Treiben in der Gasse beobachten konnte, aber natürlich der Umkehr der Beobachtung einiges entgegen setzte. Das angegebene Ziel stand nun endlich vor ihnen in Gestalt einer großen hölzernen Pforte, breit genug, um einen sperrigen Karren samt zweier Begleiter zu verschlucken. Die Männer gönnten sich kaum eine kurze Verschnaufpause. Der Ring im Löwenmaul schlug drei Mal auf harte Pinie. Es hätte kaum bis zum fünften Klopfzeichen gereicht, als die Pforte schon von einem stattlichen Mittdreißiger aufgetan wurde. Ohne ein Wort wurde der Karren durch die Pforte in den Innenhof geschoben. Der noch jugendlich wirkende Mann mit dichtem Lockenkopf heuchelte eine bescheidene Mithilfe, indem er vorsichtig zwei Finger an das bekleckerte Rad legte. Nach Durchfahrt des Karrens warf er schnell noch einen sichernden Blick in die Gasse und schloss sodann unverzüglich die Pforte.
Salai wandte sich an die ältere der beiden Lumpengestalten.
„Hat Euch jemand beobachtet oder gar angesprochen?“
„Je mehr uns sehen, umso weniger werden wir beobachtet.“
„Sehr gut – wartet einen Moment! Ich sage dem Meister Bescheid.“
Salai überquerte hurtig den Innenhof und verschwand im Haus. Fast gleichzeitig schoben die Männer ihre dreckigen Kopflappen zurück und nutzten die Pause für ein paar ruhige Atemzüge, die dem Jüngeren genug Luft für eine Frage gaben.
„Was macht er eigentlich damit?“
„Er schneidet sie auf.“
Der Leibhaftige machte in Sekundenbruchteilen aus einem zwar schmutzigen, aber doch halbwegs ebenmäßigen Gesicht eine Maske des puren Schreckens. Der Maskenträger bekreuzigte sich ebenso schnell wie heftig, zur Sicherheit gleich noch mal, wobei er gleichzeitig den Dreck, den die jetzt Kreuz schlagende Hand gerade noch am Rad des Karrens gefunden hatte, als übel riechende Stigmata auf seinem Leib und seiner Stirn gerecht verteilte.
„Die heilige Mutter Gottes stehe uns bei! Das ist eine Todsünde – glaube ich. Wir werden in der Hölle schmoren, weil wir…“
„Halt den Mund!“ zischte es aus einem ebensolchen, allerdings beinahe zahnlosen.
Der Alte ergriff den Höllenkandidaten am Arm und, obwohl keine Menschenseele im Innenhof hätte Zeuge werden können, flüsterte er ihm drohend ins Ohr, das er an der richtigen Stelle unter den struppigen Haaren vermutete.
„Du wirst über diese Sache Dein verdammtes Maul halten! Kein Sterbenswörtchen zu irgendeinem! Sei froh, dass Du ein paar Geldstücke dazu verdienen kannst. Um Dein Seelenheil brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Der Kerl auf dem Karren war ein übler Schweinehund, der vollkommen zu Recht aufgeknüpft wurde, dessen lausige Knochen weiß Gott nicht in geweihte Erde gehören und dessen Seele schnurstracks zum Satan gefahren ist. Unser Auftraggeber hat so etwas nicht zum ersten Mal gemacht. In Florenz soll er das sogar im Krankenhaus mit Billigung der Obrigkeit gemacht haben – und auch in Mailand. Hier in Rom sieht die Sache zwar jetzt etwas anders aus – aber wenn die Mailänder und die Florentiner dafür nicht zur Hölle fahren müssen, kann es ja wohl für Römer auch nicht so schlimm kommen. Notfalls sprich ein paar Ave Maria vor dem Altar unserer allerheiligsten Jungfrau in der Kirche Santa Ma…..“
Er ließ den Arm sinken, weil Salai in Begleitung eines jungen Mannes von etwa 25 Jahren den Innenhof betreten hatte.
„Bringt ihn dort in das Studio des Meisters! Die Holzscheite könnt Ihr hier unter dem Abdach zu den anderen stapeln!“
Dabei wies Salai auf eine Tür im Seitenhaus und anschließend auf einen Holzstoß. Die Männer räumten zunächst die Holzscheite über den mottenzerfressenen und verdreckten Lumpen beiseite. Zu viert umfassten sie die freigelegte Rolle, hoben zeitgleich an und bewegten sich mit ihrer Last auf die angewiesene Türe zu – auf der einen Seite zwei zerlumpte Totengräber, auf der anderen zwei junge Edelmänner.
Der Mann, der dem ungleichen Vierergespann die Tür von innen öffnete, war hoch gewachsen, einfach, aber elegant gekleidet. Sein scharf geschnittenes Gesicht war umrahmt von fast weißem Haupthaar und einem ebensolchen Bart. Die wallende Haar-und Barttracht unterschied ihn deutlich von den modisch beschnittenen Köpfen seiner Zeit. Sein Erscheinen im Türrahmen veranlasste die beiden Lieferanten zur sofortigen Einnahme einer geduckten Körperhaltung. Mit einer kaum merklichen Geste deutete er auf einen Tisch in der Mitte des Raumes. Die Träger wuchteten die Rolle wie geheißen auf den Tisch. Salai steckte dem alten Lumpenkerl einen Beutel zu, nicht ohne durch ein leises Schütteln seinen Inhalt zu verraten. Dies verstanden die beiden Männer als Aufforderung, sich unverzüglich zu entfernen, aber auch Holzscheite ungestapelt zu lassen und samt ihrem Karren schnellstens das Weite zu suchen.
Leonardo schickte nun auch Salai und Francesco hinaus, um Zwiesprache mit dem Inhalt des Lumpenwickels und sich selbst zu halten. Er war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt. Sein unstetes Leben hatte ihn von seinem Heimatort Vinci nach Florenz, dann nach Mailand und von da wieder nach Florenz geführt – und das waren nur die wesentlichen Stationen mit langen Arbeitsaufenthalten gewesen – und schließlich war er mit großen Erwartungen 1513 nach Rom gekommen. Von seinem ersten Aufenthalt 1501 her kannte er die Stadt, die sich trotz der prosperierenden Städte in Norditalien und im restlichen Europa immer noch als Zentrum der bekannten Welt verstand. Seit zwei Jahren war er nun schon Gast des Giuliano de Medici, dem jüngeren Bruder des neuen Papstes Leo X., im Belvedere des Vatikans. Die erhofften Aufträge waren jedoch an die ungeliebten Konkurrenten gegangen. Obendrein hatte Leo X. ihm auch noch den Zutritt zum Hospital Santo Spirito nahe dem Vatikan zwecks weiterer anatomischer Untersuchungen verwehrt.
Ein aus seiner Sicht junger Mann – Leo X. zählte noch keine 40 Jahre – hatte ihm die Sektion des menschlichen Körpers verboten. Dabei hatte er doch zuvor in Mailand zusammen mit dem Arzt Marcantonio della Torre wohl schon an die dreißig Leichname für seine anatomischen Studien untersucht! Was sollte er von diesem Medici auch anderes erwarten als von den anderen verschlagenen Schurken seines Geschlechts? Er hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass dieses Verbot die ignorante Demonstration purer Macht war. Hatte doch schon Lorenzo der Prächtige mit einer Dreistigkeit sondergleichen ein Beispiel für aberwitzigen Nepotismus gegeben, indem er seinem Zweitgeborenen Giovanni im zarten Alter von 14 Jahren die Kardinalswürde zugeschachert hatte. Diese Ernennung durch Papst Innozenz VIII. war die Gegenleistung für die Vermählung der ältesten Medici-Tochter Maddalena mit Innozenzens Sohn Francechetto. Mit 37 Jahren bereits war Giovanni dann wundersam zum Papst gewählt worden, musste aber nachträglich erst noch zum Priester und zwei Tage später zum Bischof geweiht werden, um der „Wahl“ nur ja den Anschein einer gottgefälligen Ordnung zu geben. Wen sollte es da noch wundern, dass die Christenheit an ihrer obersten Autorität zweifelte? Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Wut ihren Weg bahnen würde.
Tatsächlich umgab sich Leo wie beinahe alle Renaissance-Päpste mit herrschaftlichem Prunk und exotischem Luxus – so hielt er sich in seinem Privatzoo sogar einen Elefanten namens Hanno. Mit dem Ablasshandel sollte das Finanzproblem gelöst werden, denn der Bau des neuen Petersdoms sowie die Beschaffung der Kostbarkeiten für die päpstlichen Schatzkammern und privaten Gemächer und nicht zuletzt der Unterhalt der eigenen Truppen verschlangen gigantische Summen.
Zwar erteilte Leo X. reichlich Aufträge für großartige Kunstwerke, aber ausschließlich zur Darstellung der Macht und Herrlichkeit des Vatikans. Michelangelo und Raffael wussten wohl das prunkvolle Dekor zu liefern. Aber er, der in Florenz und Mailand so hoch geschätzte Leonardo da Vinci, kam dabei kaum zum Zuge, weil ihm das Verständnis der Schöpfung wichtiger war als ihre Verherrlichung.
Für Leonardo war es offensichtlich, dass dieser Papst immer noch nicht begriffen hatte, wie wichtig die Anatomie für das Wohl der Menschen war. Nur wegen dessen Uneinsichtigkeit war er jetzt auf die Geldgier dieser verschlagenen Totengräber angewiesen, um einen Leichnam für seine Studien auf den Seziertisch zu bekommen, den nun wirklich niemand mehr haben wollte und den zu bestatten sogar die Obrigkeit eigentlich zu geizig war. Durch dieses ebenso willkürliche wie ärgerliche Verbot sah sich Leonardo daran gehindert, noch mehr der unendlich vielen Geheimnisse der wahren Schöpfungskrone zu entdecken und sein vor vielen Jahren schon begonnenes Werk zu vervollständigen. Nun wollte er sich aber auch durch das päpstliche Dekret nicht mehr länger daran hindern lassen.
Unter den gegebenen Umständen war es natürlich ausgeschlossen, die Sektionen im Belvedere vorzunehmen. Dass Leonardo in diesem eher bescheidenen Raum mit dem schweren Tisch in der Mitte ein halbwegs geeignetes Ausweichquartier gefunden hatte, war nur der Tatsache zu verdanken, dass er auch außerhalb des Vatikans gute Kontakte unterhielt. Doch missfiel ihm diese Heimlichkeit und noch mehr verletzte ihn die Erniedrigung, die damit einher ging.
Die Abhängigkeit vom Wohl und Wehe, den Launen und Sympathien durchweg skrupelloser Machtmenschen war das Los der Künstler seiner Zeit – und aller anderen Menschen natürlich auch. Da, wo diese Geschichte enden wird, führte gerade ein besonders übles Exemplar dieser Gattung namens Heinrich VIII. sein blutiges Regiment. Mit diesem sollte der nächste Papst aus dem Hause Medici eine Menge Ärger bekommen. Guilio de Medici folgte als Clemens VII. seinem Cousin Leo X. auf den Thron – nach dem kurzen Intermezzo des letzten deutschen Papstes Hadrian VI. vor Benedikt XVI.
Leonardo öffnete die Rolle und betrachtete den Körper, dessen Besitzer am frühen Morgen den Preis für einen ebenso dummen wie hinterhältigen Raubmord hatte bezahlen müssen. Was für ein Gesicht! Es war noch immer blau vom Strang, der auch die mäandernden Würgemale am Hals hinterlassen hatte. Die Ausmaße des Unterkiefers standen in geradezu lächerlichem Verhältnis zu den wenigen Zahnresten, die noch die Kauleiste zierten. Die Nase mit scharfem Abknick gewaltig. Der Kerl sah noch im Tode brutal aus.
Solche Gesichter hatte Leonardo früher oft skizziert. Heute war er mehr an den unteren Extremitäten, insbesondere am Knochenbau des Fußes interessiert. Er legte die Papiere zurecht, die Federn und die Tusche, band sich ein mit Wohlgerüchen getränktes Tuch vor Mund und Nase. Dann nahm er endlich das Messer in die Linke. Es kostete ihn immer noch eine ganze Menge Überwindung, in die Haut zu schneiden, um so Muskeln, Knochen und Sehnen frei zu legen. Der erste Schnitt war immer der schlimmste. Er musste sich beeilen und seine Zeichnungen fertig haben, bevor Lavendel-und Zitronenduft zu schwach sein würden.
1. Der Fund
Der Zollinspektor Norbert Napiralla und seine junge Kollegin, Inspektoren-Anwärterin Claudia Wasserzieher, standen vor dem Rollband und verrichteten mit gemächlicher Routine in dem einem Fall, gespannter Erwartung im anderen, was Napiralla schon seit Jahren und seine Assistentin heute zum ersten Mal im Rahmen ihrer Ausbildung zu tun hatten: den nächsten Koffer oder Sack, die nächste Reisetasche oder Kiste oder das nächste wie auch immer gestaltete Behältnis vom Gepäck-Container auf das Rollband mit der richtigen Arbeitshöhe wuchten und bis zum Arbeitsplatz rollen. Hier waren alle Werkzeuge in Schalen oder an Haken griffbereit, die man für ein schnelles, aber behutsames Öffnen eines Koffers benötigt. Für die harten Fälle waren Brechstange und Flex natürlich auch im Maschinenpark vorhanden. Der Einsatz von schwerem Gerät wurde aber weitgehend vermieden, weil die Gepäckstücke durch den Eingriff ja nicht unbrauchbar werden sollten. Die meisten waren ohnehin entweder gar nicht verschlossen oder nur mit einfachsten Spielzeugschlössern versehen, die allenfalls ein Aufplatzen des Koffers oder bei den Reisetaschen ein Öffnen der Reißverschlüsse verhindern sollten. Solche Verschlüsse wurden mit einem Griff erledigt. Die Samsonites, sonstige Diplomatenkoffer und Hartschalen boten da manchmal schon mehr Widerstand.
Sein Hobby American Football hatte die Figur des Zöllners geformt – deshalb war ein 30-Kilo-Koffer für ihn ein Witz, hundert davon ein gutes Training. Zurzeit wurde das Muskelspiel auch gerne gezeigt, weil die junge Kollegin ein echtes Sahneschnittchen war. Napiralla konnte es nach gut sechs Jahren mit jedem Safeknacker aufnehmen. Auch die Hartschalen mit festen Schlössern waren meistens nach wenigen Sekunden unter Einsatz einfacher Werkzeuge geknackt, wobei fast immer ein Besteck mit verschiedenen Nadeln, Dornen und Haken genügte – einem Fahrradpannen-Set nicht unähnlich oder einem Schweizer Offiziersmesser.
Mit im Raum war noch ihr unmittelbarer Vorgesetzter, Zolloberinspektor Herbert Geschonneck, ein gemütlicher Pykniker mit Halbglatze und einer Pensionswartefrist von grob geschätzt 22 Jahren. Er war der Herr über Telefon, Computer und Digital-Kamera.
Mit geübtem Griff öffnete Napiralla den vor ihm liegenden Koffer: mittelgroß, rot, von außen schon als Damenkoffer erkennbar. Während seine Hände durch Blusen und Büstenhalter fuhren, bot er seiner neuen Kollegin fachliche Informationen im Doppelpack mit philosophischen Erkenntnissen.
„Dreht ein Gepäckstück immer noch einsam seine Runden, wenn alle Fluggäste bereits weg sind und das Band dann für einen anderen Flug gebraucht wird, kommt es hierher zu uns ins Fundbüro, bekommt einen Aufkleber mit Datum, wird hier ins Regal gestapelt und maximal sechs Monate aufbewahrt. Überall, wo es ein Namensschild oder einen anderen Hinweis gibt, eine Adresse oder Telefonnummer, versucht die Fundstelle, den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Nach ein bisschen Schonzeit öffnen wir die Koffer ohne Namenschild. Gibt es im Koffer einen eindeutigen Hinweis, wird auch dieser Besitzer benachrichtigt. Über die Hälfte aller Teile wird in dieser Zeit auch abgeholt. Vor der Versteigerung werden alle Gepäckstücke von uns geöffnet und der Inhalt überprüft. Ich mache das hier schon ein paar Jahre – der Herbert noch länger. Bisher ist es mir nie langweilig geworden. Ich bin noch immer neugierig, was ich in dem Gepäckstück finde. Zuerst sieht man, ob der Koffer auf dem Hin-oder auf dem Rückflug verloren gegangen ist – die einen sind sorgfältig gepackt, die anderen eher Kraut und Rüben. Meistens riecht man es auch. Dann sieht man auch, ob es ein Damen-Herren- oder Kinderkoffer ist, weil ja der Inhalt immer typisch ist. Natürlich gibt es das auch gemischt, Pyjama und Nachthemd für Paare oder Schminktasche mit Teddybär für Mutter-Kind-Kombinationen. Bei jedem Koffer mache ich mir meine Gedanken und stelle mir die Person vor, der er mal gehört hat. Dahinter steckt immer auch eine ganze Geschichte. Die Stücke kommen ja aus aller Welt hierher – das finde ich richtig spannend.“
Er legte die Kleidungsstücke einzeln beiseite, schaute noch mal in jedes Fach und unter jeden Boden.
„Die hier auf diesem Container sind schon vorsortiert und durchleuchtet, damit sie uns nicht um die Ohren fliegen, wenn mal ein Kracher drin liegt. Die haben außen keine Namensschilder. Hier beginnt unsere Aufgabe ja erst richtig, nämlich den Besitzer zu ermitteln. Manchmal finden wir ein Schildchen innen, Geschäftspapiere oder einen Liebesbrief, eine Visitenkarte als Lesezeichen in einem Buch, Namensschild im Kragen – irgendwas, das uns Hinweise auf den Besitzer geben kann.“
Dieser Koffer gab sein Geheimnis nicht preis. Der gesamte Inhalt kam retour. Napiralla verschloss den Koffer wieder und beförderte ihn in den Wagen für die Versteigerungsobjekte.
„So einer bringt vielleicht hundert Euro.“
Während sich Frau Wasserzieher mit einer unscheinbaren blauen Reisetasche beschäftigte und Napiralla eine grüne Hartschale ergriff, wurde das nächste aufgeschlagen.
„Ich mag ja die Koffer am liebsten, Reisetaschen und Rucksäcke mag ich nicht so – die sind meistens langweilig. dreckige Unterwäsche und Räucherstäbchen, Sportzeug und Kinkerlitzchen. Seesäcke sind auch nicht spannend. Kisten kommen selten. Gestern hatten wir eine mit getrockneten Mückenlarven.“
Der blonde Engel legte Teil für Teil neben die Reisetasche, nicht ohne in den Kragen zu schauen und stellte beim Stichwort „Getrocknete Mückenlarven“ die daraus zu folgernde Frage.
„Was haben Sie denn bisher Spannendes gefunden?“
„Alles was man sich überhaupt nur vorstellen kann und noch viel mehr: eine komplette Sado-Maso-Ausrüstung, eine versilberte Autobatterie, ein paar goldene Handschellen, eine Perücken-Sammlung, ein Glas mit abgeschnittenen Fingernägeln, ein gebrauchtes Kondom im Senfglas, einen Herzschrittmacher mit eingraviertem Monogram, getrocknetes Viehzeug aller Art, einen Stapel Wahlplakate, bei dem sich jemand die Mühe gemacht hat, dem Kandidaten alle Augen und Münder auszuschneiden, und jede Menge wilde Fotos … jeden Tag was Neues. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Natürlich sind auch immer mal Drogen, außerordentliche Wertgegenstände oder Bargeld dabei. So etwas nehmen wir vorher raus und wenn es einen Verdacht auf einen kriminellen Hintergrund gibt, ziehen wir dann die Kripo hinzu. Wenn die Schnäppchenjäger bei der Blindversteigerung darauf spekulieren, haben sie sich geschnitten. Was mit den Gepäckstücken blind versteigert wird, kommt meistens nur mit Kleidung oder üblichen Gebrauchsartikeln. Trotzdem ist die Bude immer voll, wenn alle sechs Monate im Kinosaal an der Flughafenstraße der Hammer fällt. Da ist richtig was los. In dem Zeitraum sammeln sich allein hier in Düsseldorf bis zu 6000 herrenlose Teile aller Art an – vom Handy bis zur Beinprothese. Bei der Versteigerung sind dann meistens so zwischen 200 bis 300 Koffer dabei. Wenn ein Koffer edel genug aussieht, werden auch schon mal 300 Euro dafür geboten.“
Die Auflistung der außergewöhnlichen Fundstücke provozierte natürlich die Frage nach dem Superlativ.
„Was war denn bisher Ihr spektakulärster Fund?“
Erst bei dieser höchsten Stufe des Frage-Antwort-Spiels merkte Geschonneck auf, denn spätestens hier hielt er die Antwort für Chefsache.
„Das war vor etwa einem Jahr. Koffer, Hartschale, aber nichts Auffälliges. Oben drauf lag das Übliche. War auch eine ganze Menge Bargeld dabei. Da waren dann zwei schwarze Mappen drin mit je etwa einem Dutzend Klarsichttaschen. Wir wussten erst gar nicht, was das für Zeug war in diesen Hüllen. Sah aus wie unterschiedlich große Lederstücke mit Zeichen und Schrift drauf. Der Groschen ist bei mir erst gefallen, als ich den Oberarm Ihres Kollegen da sah.“
Zwei katzengrüne Augen wanderten am Arm des Zöllners hoch und entdeckten unter dem halben Ärmel eines gelben Diensthemdes die magischen Worte `Rhine Fire Forever` und ein pillenförmiges Zeichen mit Banner – sauber in Taubenblau unter die Haut gestochen.
„Das waren Hautstücke mit Tattoos – eine ganze Muster-Kollektion oder die Privatsammlung irgendeines durchgeknallten Fetischisten. Was weiß ich!“
In diesem Moment zwickte ein Arschgeweih über einem rosafarbenen String-Tanga. Die Besitzerin stellte die nächste folgerichtige Frage:
„Was haben Sie dann damit gemacht?“
„So was ist eigentlich nicht mehr unser Job. Wenn es heikel wird, geben wir die Sache an unsere Kollegen von der Kripo weiter. Die Kollegen haben sich das Zeug angesehen, aber letztlich ist dabei nichts herausgekommen. Der Koffer gab keinerlei Hinweise auf den Besitzer, kein Mensch wusste, wo er her kam, und so war der Inhalt keiner Straftat zuzuordnen.“
Während das kleine Röschen über dem rechten Außenknöchel jetzt auch zu zwicken begann, folgte die angehende Inspektorin weiterhin konsequent der Lebensweisheit, dass man nur durch beharrliches Fragen zu Kenntnissen kommen kann.
„Ist der Koffer dann auch versteigert worden?“
„Der Koffer schon. Die Kripo hat ihn kriminaltechnisch eingehend untersucht, absolut nichts feststellen können und ihn dann zur Versteigerung freigegeben. Die beiden Mappen samt Inhalt natürlich nicht. Die sind dann schließlich in der Kuriositätensammlung des Landeskriminalamts gelandet.“
Geschonneck wandte sich wieder seinen Papieren zu; seine Leute widmeten sich den nächsten Gepäckstücken. Während Napiralla einen mit Gürtel gesicherten Pappkoffer erwischte, der seiner unregelmäßigen Verfärbung nach zu urteilen längere Zeit in einem Regenfass mit lindgrüner Gülle gelegen haben musste, entschied sich Miss Düsseldorf-Oberbilk für eine gepflegte Hartschale in Blaugrau. Die geschickten Napirallahände öffneten beide geschwind, bevor sie wieder dem viereckigen Wasserschaden zuleibe rückten. Da es nicht den geringsten Hinweis auf den Eigner gab und der gesamte Inhalt einen Reißwolf noch beleidigt hätte, wollte Napiralla dieses Gepäckstück gerade schwungvoll in den Müllcontainer befördern, als ein schriller Schrei ihn genau in dieser Pose mit Koffer in Vorhalte erstarren ließ. Die katzengrünen Augen seiner zauberhaften Kollegin waren so groß wie Pfefferminztaler. Beide Hände hatte sie vor den Mund gerissen. Unfähig sich zu bewegen, starrte sie in den Koffer.
Als Claudia Wasserzieher am Abend ihrem Lebensabschnittspartner von Ihrem Fund berichtete, witterte der angehende Journalist, zurzeit noch im Volontariat, eine Riesen-Story. Veröffentlicht wurde ein kleiner einspaltiger Artikel mit 24 Zeilen in der Rheinischen Post
II. Leonardo und Leo X.
Der Bote des Papstes hatte unmissverständlich klar gemacht, dass man sich unverzüglich in den Audienzräumen seiner Heiligkeit einzufinden habe. Des Weiteren erklärte er, dass er Befehl habe, nicht ohne den Einbestellten zurückzukehren. Auf dem Weg vom Belvedere zum Audienzraum hatte Leonardo ausreichend Zeit, sich auszumalen, welche Strafe ihn treffen könnte, denn ihm war klar, was der Grund für die Order war. Die Mauern des Vatikans waren aus Augen und Ohren errichtet worden. Hier konnte nichts im Verborgenen bleiben. Er hatte gleich den Verdacht gehabt, dass der deutsche Handwerker, der ihm zugeteilt worden war, ein Spitzel des Papstes war.
Angekommen wurde Leonardo von Wachleuten eskortiert vor den Papst geführt. Der saß keineswegs in Achtung gebietender Pose auf seinem Thron, angetan mit allen Insignien seiner Macht und Würde, sondern er ging vor dem bedeutendsten Thron der Zeit wütend hin und her. Ein weiser Mann ging vor einem 38jährigen in die Knie, der lediglich ein weißes Nachthemd und die rote Papstmütze mit Hermelinbesatz, den Camauro, trug sowie ebenso rote Pantoffel. Leo wandte sich dem Unterwürfigen zu, zeigte ihm seinen Siegelring zum Kuss, verschränkte dann die Arme auf dem Rücken und begann mit der Strafpredigt von höchster Stelle.
„Erhebe Er sich! Uns ist zu Ohren gekommen, dass Er wider Unser Gebot das Ebenbild des Herrn aufgeschnitten hat, um Seine abscheulichen Studien zu betreiben. Weiß Er nicht, dass Unser Wort wie das Wort Gottes ist? Weiß Er nicht, dass Wir die Macht, die Uns der Herr verliehen hat, wohl zu nutzen verstehen? Ganz sicher weiß Er es! Was Er nicht weiß, ist, dass Wir Uns heute über die Maßen unpässlich fühlen, denn auch der Stellvertreter des Herrn ist nicht vor Zahnschmerzen gefeit. Er wird daraus Schlüsse ziehen und wissen, dass die Verhandlung über Sein Vergehen auf einen wahrlich schlechten Tag gefallen ist. Wir sind in höchstem Maße verärgert!“
Leo ließ sich mit samt seiner Wut im Bauch in seinen Thron fallen. Der Hofnarr hatte sein Stichwort gehört, sprang vor seinen Herrn und wollte gerade einen trefflichen Spaß zur Vertreibung der üblen Laune beginnen, als eine päpstliche Ohrfeige sein Ansinnen schon im Keim erstickte.
„Verschwinde! Dummkopf! Auch die Wachen hinaus – alle hinaus!“
Der Narr trollte sich und dachte an Gift. Die Wachen machten zumindest noch den Versuch eines schneidigen Abgangs. Zwei Kardinäle und als letzter der Kardinal-Kämmerer, der Camerlengo, schwebten huldvoll hinterdrein.
„Ist das der Dank dafür, dass Wir Euch auf Bitten Unseres Bruders in Unseren Dienst genommen haben. Ihr beleidigt den Herrn, indem Ihr die Euch von Gott gegebene Gabe vernachlässigt, der beste Eurer Zunft zu sein. Nun geht Euch auch der Ruf voraus, dass es Euch an Disziplin mangelt und dass Ihr vieles nicht fertig bringt. Wenn Wir Ihm ein Bildwerk auftragen, kocht er Öle und Kräuter für den Firnis anstatt das Werk zu beginnen. Wir ahnten es: O weh – das ist keiner, der etwas zuwege bringt, wenn er damit beginnt, ans Ende des Werkes zu denken, ehe er noch angefangen hat. Ihr vergeudet Eure und Unsere Zeit, indem Ihr Leichname zerschneidet und Knochen und Eingeweide zeichnet.“
Es entstand eine kurze Pause, in der beide dachten, dass es doch vielleicht besser gewesen wäre, dem Hofnarren eine kleine Chance zu geben. Leonardo war klug genug, um die kleinste Veränderung der Anrede und Tonart zu bemerken. Die Anerkennung seiner Meisterschaft vermochte ihn also doch noch vor der ganzen Wucht des päpstlichen Bannstrahls zu bewahren. Deshalb wagte er die Gegendarstellung.
„Eure Heiligkeit! Euer Vorwurf schmerzt. Aber sind denn nicht nach meinen Überlegungen die Pontinischen Sümpfe trocken gelegt, Civitavecchia befestigt und die Pläne für den Trajanshafen verfasst worden.“
„Da Gott Uns das Pontifikat verliehen hat, so wollen Wir es auch genießen. Was zählen Uns da trockene Sümpfe oder Hafenmauern? Wir preisen den Herrn am höchsten, wenn Wir Ihm hier in Sankt Peter den prächtigsten Tempel seit Anbeginn der Zeit errichten. Wir haben die Mittel. Der Ablasshandel füllt Uns die Kassen. Michelangelo und Raffael sind voller Inbrunst am Werk. Wollt Ihr hintan stehen?“
„Eine Kirche – auch die größte und prächtigste – bleibt Menschen-werk. Der menschliche Körper ist Gotteswerk. Deshalb gilt ihm mein Augenmerk.“
„Indem Ihr das Gotteswerk aufschneidet? Ihr versündigt Euch an diesem Gotteswerk. Deshalb haben Wir es Euch verboten.“
„Haben nicht die Vorgänger Eurer Heiligkeit, die seligen Päpste Sixtus IV. und Alexander V. die Sektion ausdrücklich erlaubt, weil sie erkannt hatten, dass das Wissen um die Beschaffenheit des Menschen allein keine Schmähung des göttlichen Gedankens ist, sondern im Gegenteil bessere Möglichkeit bietet, die Krone der Schöpfung zu erhalten – vielleicht sogar zum eigenen Nutzen?“
„Will Er Unsere Unfehlbarkeit bezweifeln?“
„Keineswegs Eure Heiligkeit. Aber dann müsste ich die Eurer Vor-gänger in Zweifel ziehen.“
Ein unwilliger Blick traf zwei rote Pantoffel. Dieser war lang genug, um einen Erklärungsnotstand zu überstehen.
„Es kann Gottes Wille sein, dass unter den Geboten der Zeit eine Frage unterschiedlich ausgelegt wird. Deshalb waren die Entscheidungen von Sixtus und Alexander ebenso richtig wie Unsere.“
„Aber das ist es ja gerade: je mehr Wissen uns gegeben ist, umso gereifter werden unsere Urteile sein.“
„Das höhere Gut ist der Glauben – nicht das Wissen!“
Leonardo war zu Ohren gekommen, dass Leute im Umfeld des Papstes gelegentlich Zweifel an Leos eigenem Glaubensbekenntnis geäußert hatten. Weil es damit also vermutlich soweit nicht her war, wagte Leonardo einen handfesten Vergleich.
„Warum springt der kluge Mann nicht in den Tiber? Weil er weiß, dass er ertrinken wird – das Vertrauen, von Gottes Hand gerettet zu werden, gibt ihm keinen Schutz vor dem nassen Tod.“
„Meister Leonardo! Ihr begebt Euch in die gefährliche Nähe zur Häresie! Wir sind die Instanz, die die Uns aufgetragene göttliche Wahrheit verkündet, um dadurch Chaos und ewige Finsternis zu verhindern. Die heilige Kirche ist in Gefahr. Die Christenheit wird aufgewiegelt von dunklen Mächten. Selbst Würdenträger wagen es, Unsere Entscheidungen in Zweifel zu ziehen, wie jene Kardinäle, die den segensreichen Ablasshandel kritisieren, der doch einzig der Lobpreisung unseres Herrn dient.“
Leonardo war längst klar, dass nicht die Wahrung des Glaubens, sondern die Angst vor dem Machtverlust das Denken dieses Papstes und wohl auch der ganzen Kirche bestimmte. Ein Gewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen würde dieses System untergraben und vielleicht auch zu Fall bringen, wenn es sich nicht öffnen könnte.
„Sind nicht auch diese Kardinäle von Gott in diese Ämter berufen worden, weil sie klug und voller Verantwortung sind. Sollten nicht ihre Gedanken Euer Ohr finden, auf dass Ihr mit noch mehr Kenntnis einen Sachverhalt noch besser abwägen könnt?“
„Viele Kenntnisse bringen auch viele Zweifel. Ihr wollt mich wieder locken auf Euren Weg der Wissenschaft. Allein – nur der Glaube führt zu Gott!“
„Ich kann nicht erkennen, warum sich beides ausschließen sollte!“
Darauf hatte seine Heiligkeit keine Antwort. War das lange Schweigen nur Unsicherheit oder ein echtes Bedenken dieser Ansicht? Eigentlich hatte er ja nur seiner gekränkten Eitelkeit mit einer milden Strafe Wiedergutmachung verschaffen wollen – und fand sich nun wieder in einem Disput mit einem Mann, der ja noch nicht einmal dem Klerus angehörte. Ein selbstherrlicher Papst mit genug Respekt vor einem großen Geist wollte hier nicht mehr Position beziehen. Er vergaß sogar, den Ring zu Kuss vorzustrecken.
„Geht nun – Meister Leonardo! Vielleicht reden wir ein anderes Mal. Mein Zahn plagt mich, dass ich nicht mehr denken noch reden mag.“
Leonardo verneigte sich und verließ den Raum rückwärts in der festen Überzeugung, dass das Schmerzpotential der verbliebenen päpstlichen Zähne die verheißene Fortsetzung niemals zulassen würde. Ein weiterer Gedankenaustausch, der vielleicht Einiges verhindert und Vieles möglich gemacht hätte, fand nicht mehr statt. Darüber hinaus war es nun offensichtlich, dass auch zukünftig vom Vatikan keine bedeutenden Aufträge mehr an ihn vergeben würden, und somit sein Aufenthalt in Rom ohne sinnvolle Perspektive blieb. Das einzige Kunstwerk von Rang aus seiner römischen Zeit würde das Gemälde „Johannes der Täufer“ bleiben.
Zwei Jahre später schlug ein kleiner Augustinermönch ein Papier an eine Kirchentür in Wittenberg. Bis dahin hatte Leo immer noch nicht gelernt, zwei Seiten einer Sache sorgfältig abzuwägen. Er sollte Leonardo nur um zwei Jahre überleben und so schnell sterben, dass es noch nicht einmal zum Empfang der Sterbesakramente reichen sollte.
2. Anfängerglück einer angehenden Zöllnerin
Das Fundbüro im Parkhaus des Düsseldorfer Flughafens und das Revier der Flughafenpolizei sind nur ein paar Schritte von einander entfernt. Dafür braucht man höchstens drei Minuten. Vier Finger, die zu zwei kräftigen Polizistenhänden in weißen Handschuhen gehörten, hielten einen Klarsichtbeutel ganz vorsichtig an den Ecken hoch. Der Inhalt war durch den Pressverschluss des Beutels luftdicht abgeschlossen.
Auch für einen Laien war es ganz offensichtlich: ein Fuß – ganz eindeutig ein echter menschlicher Fuß ohne den ganzen restlichen Körper. Wenn so etwas einzeln auftaucht, muss irgendetwas Unnormales dahinter stecken. Bei diesem Fuß war obendrein auch noch die Haut abgezogen worden, so dass Sehnen und Knochen ganz deutlich zu sehen waren.
„Riecht nicht.“
Stellte Polizeihauptmeister Peckedraht schnüffelnd fest. Er legte das unheimliche Fundstück zurück in den Koffer, um mit seinem weißen Handschuhzeigefinger auf den Beutel zu drücken.
„Bretthart.“
Der Kollege Kieserling, mit genauso vielen Pickeln auf dem Schulterstück, wandte sich der immer noch sichtlich geschockten jungen Zöllnerin zu.
„Anfängerglück! Nehmen Sie es nicht so tragisch. Machen Sie hier für heute Schluss oder kommen Sie wenigsten zu uns rüber – wir haben drüben den besseren Kaffee als die Versager hier. Den Koffer samt Corpus Delicti bringen wir zur kriminaltechnischen Untersuchung ins Hauptrevier.“
Die Handschuhhand drückte den Kofferdeckel nieder, bis er einrastete. Dann wurde der ganze Koffer in einen der großen Plastikbeutel eingetütet, die für solche Fälle im Fundbüro vorgehalten wurden. Die Polizisten verließen das Fundbüro mit ihrer Beute, nicht ohne das Angebot mit dem Kaffee zu wiederholen. Auf der Fahrt ins Hauptrevier streifte die Unterhaltung nacheinander mehrere Themen: Splatter Movies, Snuff Videos, Frankenstein und Dr. Mabuse, und vor allem die Frage, warum die Polizisten des Düsseldorfer Flughafens zwar den besseren Kaffee, die Schlappsäcke vom Zoll aber die schärferen Weiber haben.
Nachdem sie eine Karte für den Vorgang angelegt hatten, brachten sie den Koffer gleich in die Pathologie. Dr. Mabuse heißt hier Dr. Hummelsheim, hagere zwei Meter lang, oben Billardkugel mit Schnäuzer.
„Was bringt Ihr mir denn heute wieder Schönes?“
Statt zu antworten legte Peckedraht den Koffer auf eine Arbeitsfläche mit Rädern, zog sich selbst die Handschuhe an und dem Koffer den Plastikbeutel aus, öffnete den Deckel, nahm den Klarsichtbeutel mit dem bekannten Vierfingergriff heraus und hielt ihn vor den Schnauzbart.
„Na – ich würde mal sagen: Schuhgröße 42.“
Die pathologische Untersuchung des Fußes sowie die kriminaltechnische Untersuchung des Koffers und seines Inhalts ergab folgendes Ergebnis:
Der Fuß war eindeutig ein menschlicher Fuß, ein linker männlicher Fuß, der besonders sorgfältig präpariert wurde. Daher ist auch kein Verwesungsgeruch bemerkt worden. Die Abtrennung von den Unterschenkelknochen ist sauber und professionell ausgeführt worden. Ebenso professionell ist die Haut abgezogen worden. Wer immer dies getan hat, verstand sein Geschäft. Aus der Art und Weise der Behandlung ist nicht zu ersehen, zu welchem Zweck sie durchgeführt wurde.
Die Kleidungsstücke im Koffer deuteten auf einen Mann von etwa 1,78 Meter Körpergröße und ca. 90 Kilogramm Gewicht. Die leichten Straßenschuhe waren wirklich Größe 42. Im Toilettenbeutel fand sich alles, was normalerweise in solche Beutel gehört, mit zwei Ausnahmen: 12 lose Magnesiumtabletten und ein Tubenpräparat gegen Fußpilz.
Wie nicht anders zu erwarten war der Koffer mit Fingerabdrücken völlig unterschiedlicher Urheberschaft übersät.
Außer Kleidungstücken und Toilettenartikeln befand sich im Koffer nur noch ein Ausstellungskatalog über eine Leonardo da Vinci – Ausstellung im Getty-Museum Los Angeles (englisch) mit einem ausgerissenen Zeitungsartikel (deutsch), der offensichtlich als Lesezeichen verwendet wurde. Der Zeitungsartikel war eine Vorankündigung, dass diese Leonardo-Ausstellung im Anschluss im Berliner Gropius-Bau gezeigt werden soll. Der ausgerissene Artikel steckte zwischen zwei Seiten, wovon eine die Anatomie-Zeichnung eines Fußes zeigte. Auf dem Katalog befand sich eine Vielzahl von Fingerabdrücken. Die Zahnbürste wurde auf Speichelspuren untersucht zwecks DNA-Analyse. Der Vergleich mit den einschlägigen Datenbanken hat jedoch keine Übereinstimmung mit erfassten Daten ergeben. Am und im Koffer gab es keinerlei Hinweise auf den Eigentümer.
3. 72 Kostbarkeiten im Dunkel
Auszug aus der Rede des Regierenden Bürgermeisters der Stadt Berlin Gert Uschkureit anlässlich der Leonardo da Vinci-Ausstellung im Gropius-Bau zu Berlin im Juli 2007
Als Regierender Bürgermeister von Berlin begrüße ich zur Eröffnung der Ausstellung Leonardo da Vinci: Anatomie
den……...die………das……….
....
….
Meine sehr verehrten Damen und Herren
Eine Leonardo da Vinci – Ausstellung ist auch für das mit kulturellen Höhepunkten verwöhnte Berlin ein Ereignis der Kategorie A. Ein solches Ereignis bedarf einer jahrelangen Vorbereitung und einer perfekten Logistik, was wir hier in Berlin aber beherrschen wie sonst nur noch wenige Städte in der Welt. Für das Zustandekommen dieser Ausstellung sind wir zu großem Dank verpflichtet zuallererst der Leihgeberin, Ihrer Majestät, der Königin von England Elisabeth II., aus deren Sammlung die kostbaren Zeichnungen von unschätzbarem Wert stammen. Als den Stellvertreter Ihrer Majestät begrüße ich deshalb besonders herzlich den Botschafter des Vereinigten Königreichs, seine Exzellenz Sir Baldwin Thurnball.
Ebenso herzlich begrüße ich die Sponsoren dieser Ausstellung, ohne die ein solches Ereignis niemals zustande kommen könnte. Als Repräsentanten der Deutschen Bank begrüße ich den Vorstandsprecher Herrn Dr. Geerschund und vom Konzern Gazprom den Aufsichtsratvorsitzenden Herrn Gregory Intalerow.
Es steht mir nicht zu, hier einen inhaltlichen Vortrag zum Thema zu halten – das wird nachfolgend Frau Dr. Marga Schiefmann-Wüllner tun – aber gestatten Sie mir ein Wort, das meiner ganz besonderen Wertschätzung dieses Künstlers Ausdruck verleihen soll.
Wenn auf einen Künstler der Begriff Universalgenie Anwendung finden darf, dann steht dieser unangefochten an der Spitze. Den ganzen Leonardo kann kein Museum der Welt präsentieren, weil das Werk zu vielfältig und, alle Teile gezählt, viel zu umfangreich ist. Der Versicherungswert wäre zudem so astronomisch hoch, dass sich ein solches Unternehmen finanziell einfach nicht darstellen ließe. Wir bescheiden uns hier also auf allerhöchstem Niveau. Hatten wir hier in dieser Stadt vor 24 Jahren die Ausstellung über die ihrer Zeit weit voraus gedachten Erfindungen Leonardos, so liegt der Schwerpunkt dieser Ausstellung auf Leonardos Anatomie-Zeichnungen. Nie zuvor ist mit solcher Intensität, aber auch dem Mut zum Risiko, ein solches Werk begonnen worden – ja Leonardo hat als Künstler mit seiner bahnbrechenden Leistung der Wissenschaft einen Weg gewiesen. …….
Frieder Kohoutek kannte die eigene stereotype Choreographie von Ausstellungseröffnungen berufsbedingt gut genug, ob Leonardo in Berlin gezeigt wurde oder ein lebendes Exemplar seiner Zunft in der Provinz. Meistens wurden so viele wichtige Leute begrüßt, dass den Gästen schon die Augen zufielen, bevor sie das erste Bild gesehen hatten. Die Höchststrafe war dann eine wissenschaftliche Einführung in das Thema von einem hochrangigen „Kunsthysteriker“.
Nachdem Schall und Rauch sich verzogen und Kleingruppen sich zum Small Talk auf der jeweils passenden Ebene gefunden hatten, gab es für die Interessierten endlich auch die Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen. Schon übertrieben! Der Begriffsinhalt von Sehen war nur zum Teil erfüllt – zumindest ab Dioptrien plus/minus 2,5 und für Nachtblinde.
In die zentrale hohe Halle des Gropius-Baus hatte man eine Box eingebaut mit einem schwarz betuchten Eingang und einem ebensolchen Ausgang. Das gleißende Licht der Feierlichkeit noch auf der Retina, reagierte nicht der feinste Sehnerv auf die Welt hinter dem schwarzen Vorhang – oder zumindest dauerte es eine ganze Weile, bis sich das Auge auf die unerwartete Dunkelheit eingestellt hatte. Danach konnte man zwei Blöcke erkennen, in denen jeweils 24 Vitrinen standen, die in zwei Reihen zu je zwölf Stück Rücken an Rücken standen. Über jeder Vitrine schwebte ein Glühwürmchen stationär im Formationsflug mit 23 anderen. Unter leicht geneigten Glasscheiben, auf deren Innenseite jeweils oben rechts ein silbergraues Plättchen in der Größe einer Centmünze mit abgehendem Feindraht angebracht war, lagen die Unschätzbaren in Passepartouts, darüber wiederum ein feiner Filzrahmen in edlem Mausgrau. Die Wissenden mit ausreichender Sehkraft konnten nun eintauchen in die Aura des physischen Objektes – allen anderen hätte man auch Faxkopien anbieten können.
Wohl wissend, dass 500 Jahre alte Zeichnungen die nächsten 500 Jahre nicht aushalten würden, wenn bei jeder Ausstellung auch nur ein wenig zu viel Licht sie träfe, war Frieder Kohoutek dennoch etwas enttäuscht, weil er schon von Jugend an mit zwei Glasbausteinen auf der Nase herumlaufen musste und allein schon deshalb die Ausbeute für ihn hier ziemlich mager ausfiel.
Seinen Artikel hatte er ja schon nahezu fertig, inhaltlich sowieso, weil in der eigenen Bibliothek und auch in dem hervorragenden Katalog beste Reproduktionen und fein ziselierte Texte nur noch in Bausteine aufgeteilt und neu zusammengesetzt werden wollten. Außerdem hatte er im Kurator der Ausstellung Dr. Thomas Hagenau eine nie versiegende Informationsquelle. Der Mann wusste über Leonardo aber auch wirklich alles. Was noch fehlte, war der frische Glanz der großen Gala. Kohoutek hatte sich in die Materie eingelesen und war zurzeit in der Redaktion von ars longa der bestinformierte Mann zum Thema.
Frieder Kohoutek – Kohoutek wie der Komet – war einer von denen, die beim Sportabitur zwar viel langsamen Anlauf genommen hatten, aber dann vor dem Sprung über den Kasten doch lieber in Schockstarre verfielen. Über Barren oder Reck wollen wir lieber gar nicht erst reden. Wegen dieser Unsportlichkeit hatte sein Körper von 190 Zentimetern beim Stand von 38 Lebensjahren die Idealform der Birne angenommen. Die jüngste deutsche Geschichte hatte bewiesen, dass man auch damit zum Frauentyp werden konnte.
Damit war es dann aber doch nicht so weit her. Seine erste Ehe hatte er perfekt in den Sand gesetzt. Der zweite Versuch war der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung. Sein Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte hatte er mit einem Doktortitel gekrönt, den er für seine Dissertation „Andrea Mantegna in Rom 1488/89“ cum laude erhielt. Es gab bisher keinen Grund anzunehmen, dass diese intellektuelle Schnecke von 105 Kilo Lebendgewicht bald auf die Überholspur wechseln würde.
4. Die erste Kopie
Das Phänomen der langen Warteschlangen vor den Tempeln der Kunst hatte man bei der MOMA-Ausstellung 2004 in der Berliner Nationalgalerie staunend beobachten können. Wartezeiten bis zu zehn Stunden hatten die Leidensfähigkeit manches Kunstfreundes aufs Äußerste strapaziert. Die Besucher waren spiralförmig um den strengen Baukörper des Mies van der Rohe aufgereiht und arbeiteten sich tippelnd zum Kopf der Schlange vor, wobei jeder, der mit einer magischen Karte sofort im Nebeneingang Einlass fand, von hundert Augenpaaren ermordet wurde.
Ein solcher Andrang war bei der Ausstellung im Gropius-Bau nicht zu erwarten. Der 1881 errichtete Bau, von Martin Gropius im Stil der Renaissance entworfen, bot dem großen Genie eben dieser Epoche ein würdiges Ambiente, hätte aber die MOMA-Schlange nicht verkraftet. Der Weg von der Schwanzspitze bis zum Kopf der Leonardo-Schlange kostete aber auch sofort nach der Freigabe für das gemeine Fußvolk satte drei Stunden, weil die Anzahl der Besucher in der schwarzen Box nicht über 80 Personen hinaus gehen sollte. Nach einer Woche pendelte sich die Wartezeit auf etwa zwei Stunden ein und blieb auch nach der dritten Woche auf diesem Stand. Während der Öffnungszeiten waren also ständig ca. 80 Besucher, 2 Aufsichtspersonen, 48 Vitrinen mit insgesamt 72 Zeichnungen und eine Überwachungskamera im Raum.
Alfons Wisgalle hatte die Kurve gerade noch gekriegt. Nach der Wende waren die Zeiten hart für ehemalige Volkspolizisten. Der dunkelblaue Anzug mit hellblauem Hemd und die passende Krawatte dazu machten aus ihm wohl eine ansehnliche Person, verschafften aber bei Weitem nicht so viel Respekt wie die alte schmucklose grüngraue Uniform. Die Lücke wusste er aber noch mit dem in langen Dienstjahren erprobten sprachlichen Duktus zu füllen. Gerade hatte er die Kurzstrecke von 18 Metern und die lange von 36 Metern zweimal durchschritten – weil Dr. Hagenau einige VIPs durch die Ausstellung führte und es dann nicht gut aussah, wenn man nur auf seinem Stuhl saß – als er auf eben diesem Stuhl den vergessenen Ausstellungskatalog entdeckte. 28 Euro – einfach liegen gelassen.
„Ick hab nich jesehn, wer den Katalog uff den Stuhl jelegt hat. Uff de leeren Ecken im Raum achtet man ja auch nich so. Da is ja nüscht außer de beeden Stühle. Uff de Vitrinen solln wir ja achten – ha ick ja ooch. Ick hab den Katalog erst enfach liejen lassen. Der Besitzer hätte ihn dort ja abholen können. Bei Schichtwechsel wollte ick ihn an der Kasse abjeben – und dann finde ick de Zeechnung mit de Schulter drin. Ick hab vielleecht nen Schreck jekricht, bin dann sofort zu de Vitrine jeloofen, wo se hinjehört. Die Zeechnung war Jott sei Dank noch in de Vitrine. Ick hab die aussem Katalog uff de Vitrine jelegt, aber bee dem Licht sahen beede völlig jleich aus.“
Frau Dr. Schiefmann-Wüllner stand am Fenster ihres Büros und hielt die Kopie ans Tageslicht, um sie besser in Augenschein nehmen zu können. Ihr Schweigen zeugte von der Konzentration der Betrachtung. Nach einer Weile wandte sie sich dem stolzen Finder zu.
„Vielen Dank, Herr Wisgalle. Sie können jetzt Feierabend machen. Es ist ja nichts passiert – ganz im Gegenteil: dank Ihnen haben wir ja jetzt eine Zeichnung mehr.“
Wortlos reichte sie das Blatt an Hagenau zurück und schaute ohne festes Ziel aus dem Fenster. Aus Hagenaus Büro konnte man die benachbarte Außendokumentation über das Machtzentrum der NS-Diktatur „Topographie des Terrors“ sehen. Auch die darauf folgende Epoche hatte hier ihre Zeichen gesetzt. Die Mauer hatte so dicht vor dem Gropius-Bau gestanden, dass man den eigentlichen Haupteingang nicht mehr benutzen konnte. Hier war aber schon eine von den wenigen Stellen, wo man Mauerreste noch genau erkennen konnte.
Hagenau betrachtete das Blatt versonnen, wobei ihm zwei Ereignisse in Erinnerung kamen.
„So etwas gab es schon mal – nicht genau so, aber durchaus vergleichbar. Im Jahr 2000 wurde der `Strand in Pourville` von Monet in einer Ausstellung in Posen durch eine Kopie ersetzt und im Contemporary Art Museum Caracas hat man erst nach Jahren festgestellt, dass am Platz der `Odaliske in roter Hose` von Matisse eine Kopie hing. Aber dabei diente der Austausch natürlich der Entwendung des Originals – unseres ist jedoch noch sicher in seiner Vitrine“
Er reichte die Zeichnung „Die Muskeln des rechten Arms, der Schulter und der Brust“ weiter an seinen Assistenten Stratenkötter. Auch der betrachtete sehr konzentriert jedes Detail der Zeichnung, fühlte mit dem Zeigefinger die Oberflächenstruktur des Blattes und unter Zuhilfenahme des Daumens auch die Stärke des Papiers.
„Es ist eindeutig kein Faksimile. Es ist wirklich eine Handzeichnung und nach meinem Dafürhalten eine verdammt gute Kopie. Das Papier ist zwar ziemlich ähnlich was die Farbe und Struktur anbelangt, aber auf den ersten Blick schon zu neu. Der Kopierer wollte anscheinend nur kopieren und nicht fälschen – sonst hätte er ja versuchen müssen, das Papier künstlich zu altern. Aber warum zum Teufel macht sich einer die Mühe, eine so gute Kopie herzustellen und sie samt Katalog achtlos liegen zu lassen?“
Hagenau antwortete seinem jungen Kollegen:
„Weil er wollte, dass sie gefunden wird!“
Die Chefin war etwas verblüfft.
„Was hat er davon, wenn niemand von seinem Talent erfährt?“
„Das wissen wir ja noch nicht. Vielleicht meldet sich in den nächsten Tagen irgendein verkrachtes, von der Welt zu unrecht mit Nichtbeachtung bestraftes Genie und bringt uns einen Pressewirbel ins Haus, nur damit er mal in die Zeitung kommt.“
„Könnte durchaus so sein. Wie auch immer: wir legen die Kopie meinetwegen in den Tresor – steckt ja immerhin eine Menge Arbeit drin, die hätte ja auch ihren Preis. Wenn Ihre Theorie nicht stimmt, kommt vielleicht einer und will sie einfach nur wieder haben.“
Bevor die erste Dame des Hauses sein eher bescheidenes Büro mitsamt der Kopie verließ, schob Hagenau noch eine blitzschnelle Idee nach.
„Vielleicht sollten wir das doch in die Presse lancieren. Solche Nachrichten im redaktionellen Teil sind kostenfreie Reklame. So könnten wir unsere Besucherzahlen noch etwas nach oben treiben.“
„Das lassen wir mal! Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt!“
Abgeblitzt! Hagenau biss sich auf die Lippe, während die Chefin den Raum verließ.
Hagenau und Stratenkötter waren ein gutes Team gewesen in der Vorbereitung der Ausstellung. Sie waren gemeinsam nach Los Angeles, London und Paris gereist, wobei der junge Doktorand mal daran schnuppern durfte, wie es ist, wenn man auf diesem Level Ausstellungen plant. Der Kontakt war immer freundlich, wenn auch nicht herzlich, dafür waren sie von Herkunft und Charakter einfach zu verschieden. Wo die von Anfang an bescheidenen Verhältnisse den Jüngeren zu Mühe, zu Zähigkeit und – was noch viel schlimmer war – zu Disziplin und Sparsamkeit zwangen, konnte der Ältere mit seiner anscheinend angeborenen Souveränität fast jede Situation meistern. So einer kommt zweisprachig auf die Welt, spielt vor der Einschulung schon Klavier und weiß, wie man Dienstboten bei guter Laune hält.
Im Hause galt Dr. Thomas Hagenau nicht nur als exzellenter Fachmann der Renaissance im Allgemeinen, sondern für Leonardo da Vinci im Besonderen. Dabei kamen ihm seine Sprachkenntnisse des Italienischen sehr zugute. Englisch beherrschte er ebenso perfekt. Man wusste auch, dass er aus einer steinreichen Hamburger Kaufmannsdynastie stammte. Sein Lebensstil machte allen deutlich, dass er seinen Beruf wirklich lieben musste, denn um des Geldes wegen hätte er ihn wahrlich nicht ausüben müssen. Mittelgroß, etwas zuviel Hüftgold um die Taille, mittelblond mit Geheimratsecken, die langsam mit dem Kahlschlag um den Wirbel eine gemeinsame Freifläche bildeten. Zum Ausgleich trug er einen gepflegten Drei-Tage-Bart. Mit seinen 48 Jahren führte er das Leben eines gebildeten Bonvivants, der sich einerseits leidenschaftlich seinem Interessensgebiet widmete, andererseits aber auch das Leben zu genießen wusste. Dazu gehörten die besten italienischen Restaurants von Berlin, edle Weine wie Brunello di Montalcino, Barolo und noch ein paar andere, sein schokoladenbrauner Oldtimer Jaguar MK II in einem Zustand eine Nummer besser als fabrikneu, ein Penthouse am Spreebogen sowie diverse Immobilien an verschiedenen Standorten. Er war Junggeselle, was die einen seinem langweiligen Äußeren zuschrieben, die anderen als Parallele zu seinem verehrten Genie Leonardo betrachteten. Da Geld das erste Problem leicht gelöst hätte, war die zweite Vermutung wahrscheinlicher. Um in der Freiheit, dieses Leben auch so zu genießen, nicht zu sehr beschränkt zu sein, war er auch nicht fest angestellt oder gar verbeamtet. Er stand dem Haus als freier Mitarbeiter immer dann zur Verfügung, wenn der Schwerpunkt in seinem Interessensgebiet lag. Bei Leonardo kam man einfach nicht an ihm vorbei.
Gerrit Stratenkötter war nahezu in jeder Hinsicht das Gegenteil von Hagenau, wobei der Altersunterschied von exakt zwanzig Jahren und sein Potential zum Schwiegersohn des Jahres nur die deutlichsten äußeren Anzeichen waren. Er sah etwa so aus wie die jungen Assistenzärzte in den Krankenhaus-Sagas. Um ein Haar, sprich um ein paar Zehntel im Numerus Clausus, wäre er das auch geworden. Ein teures Studium im Ausland als Umgehungsstraße, was sein Nebensitzer mit etwa gleichem Abiturschnitt in Budapest absolvieren konnte, hätte die finanziellen Möglichkeiten seiner Familie gesprengt. Groß, schlank, breitschultrig, dunkelhaarig, aber arm – immerhin ein Geschenk an die Frauen. Eine blonde Fee hatte diese Gabe aber recht schnell und eigennützig vom Markt genommen. Das Ergebnis war eine kleine Zuckerpuppe von jetzt zwei Jahren. Mit der Kunstgeschichte konnte er jedoch auch ganz gut leben, wenn er nur davon hätte leben können. Auch das zweite Gehalt seiner Frau konnte manchen Engpass nicht schließen. Er konnte sich bescheiden, solange er für sein Hobby noch immer genug zusammenkratzen konnte. Die Surfbretter und die Ausrüstung waren ja nicht mal das Teuerste, aber wenn man mal nicht mehr Wannsee, sondern Meeresbrandung unter der Finne haben wollte, riss das eben immer gleich ein Riesenloch. Nach dem letzten Surf-Urlaub in El Medano auf Teneriffa, wo er natürlich auch Kite-Surfen lernen und einen Kite-Schirm kaufen musste, war die Farbe des Haushaltloches einen Ton tiefer als schwarz. Er hoffte auf bessere Aussichten für eine einigermaßen gut bezahlte Festanstellung, wenn er erst seine Doktorarbeit über das Werk von Leo Strehlerck erfolgreich zum Abschluss gebracht hätte.
5. Die zweite Kopie
Beim zweiten Mal lag der Katalog zwischen den Flachbildschirmen. Vor der Außenwand der Black Box war über die ganze Länge ein Board angebracht, auf dem die zwölf Bildschirme standen, über die man sich jede erdenkliche Information über Leonardo und seine Zeit einholen konnte. Hier saßen manchmal Leute stundenlang, um sich durch die Themen zu klicken. Viele verglichen die Angaben im Katalog mit den viel umfangreicheren im Rechner und machten sich Notizen.
Irgendwann wollte eine nichts ahnende Studentin ihre Ehrlichkeit unter Beweis stellen, indem sie das Aufsichtspersonal auf den offensichtlich herrenlosen Katalog aufmerksam machte. Der Kollege Wisgalle hatte seine Kollegen ja umgehend darüber informiert, welchen Anteil er an der wundersamen Kunstvermehrung gehabt hatte – und so ahnte man schon, was dies zu bedeuten hatte, und fand sogleich die Bestätigung in Gestalt der Zeichnung „Knochenbau des Rumpfes“.
Dieses Mal gab es eine Vollversammlung. Die Leiterin des Hauses saß sinnend über dem Blatt. Frau Dr. Marga Schiefmann-Wüllner wurde allgemein nur die „Fregatte“ genannt, was gar nicht böse gemeint war, sondern lediglich lautmalerisch beschrieb, wie sie mit ihrer beachtlichen Oberweite voran die Wellen des Kulturbetriebs durchpflügte. Ihre eigentlich glatten grauen Haare hielt sie in einem etwas zu jugendlich wirkenden Rotblond und schlug das Ganze zu einem Vogelnest über dem Kopf zusammen. Sie wusste sich wirklich zu kleiden – durchaus auch mit extravaganten Kleidungsstücken, die aber immer zu ihr passten und niemals jenseits jener feinen Linie waren. Kurzum eine elegante Erscheinung, die genau wusste, was sie wollte. Ergänzend ist noch zu sagen, dass sie mit dem ehemaligen stellvertretenden Direktor der Berliner Landesbank verheiratet war – dessen Nomen auch zum Omen geworden war verbunden mit einem glanzlosen Übergang vom Arbeitsleben zum Pensionärsstatus – und einen Sohn großgezogen hatte, der in Oslo als Anästhesist arbeitete.
Neben ihr saß der gute Geist des Hauses, ihr Stellvertreter Dr. Egbert Schauerte. Ein kleiner Mann mit listigen Äuglein hinter runden Brillengläsern und vielen Lachfalten drum herum. Der Haarkranz und der Schnäuz waren zartgrau. Etwas weiter unten saß meistens eine Fliege, mit voller Absicht in scheußlichen Farbkombinationen. Mit seiner netten und freundlichen Art war er im ganzen Haus beliebt. Von der Putzfrau bis zu seiner Chefin – die weiß Gott nicht immer einfach war – hatte er für alle immer ein freundliches Wort. Vielleicht hatte er sich sein angenehmes Wesen bewahren können, weil ihm immer schon der letzte Ehrgeiz gefehlt hatte. Er hatte sich in der Stellvertreterposition bequem eingerichtet und überhaupt kein Problem damit gehabt, dass man ihm vor Jahren eine Frau vor die Nase gesetzt hatte, was vielen Männern seiner Generation haufenweise Magengeschwüre eingebracht hat. Allen anderen Mitarbeitern war damals aber klar, dass bei der Besetzung der Direktorenstelle nicht fachliche Kompetenz entschieden hatte, sondern Vitamin B. Ohne Ausnahme bedauerten alle Mitarbeiter des Hauses, dass er schon im letzten Jahr seines Berufslebens stand und das Haus in absehbarer Zeit verlassen würde. Bisweilen wurde er von einigen auch „Pelé“ genannt, was er einer Leidenschaft verdankte, die unter promovierten Kunsthistoriken etwa so häufig vorkommt wie eine Blaue Mauritius im Postamt. Wenn es um Fußball ging, gab es kein Halten mehr. Sollte sich jemand leichtsinniger Weise als Anhänger von Bayern München outen, war damit die Freundschaft beendet. Schauerte stammte aus dem Rheinland – deshalb war nicht etwa die Hertha sein Verein, sondern die Borussia, die andere aus Mönchen-Gladbach. Was nur wenige im Hause wussten: seine Tochter als sein einziges Kind war an Leukämie gestorben bevor ihr erster Jugendfreund sie zum ersten Mal hatte küssen können.
Hagenau und Stratenkötter stellten die jüngere Fraktion des Plenums. Auf allen Gesichtern war Ratlosigkeit abzulesen. Die Fregatte reichte die Zeichnung an Schauerte weiter.
„Ja – meine Herren! Was fällt Ihnen zu der Sache ein? Ich kann mir beim besten Willen keinen Reim darauf machen. Kopiert jetzt hier jemand so nach und nach die ganze Ausstellung? Auf alle Fälle werde ich das Gefühl nicht los, dass es mit dem zweiten Blatt nicht sein Bewenden haben wird. Da kommt was nach!“
Schauerte ergänzte.
„Ich denke, es wird in die Richtung gehen, die Kollege Hagenau bei der ersten Kopie schon angedeutet hat. Da draußen ist einer, der ein unglaubliches Talent zum Kopieren hat, aber keinen Ehrgeiz, zu fälschen und damit Geld zu verdienen – das ist so, als wenn jemand vor dem freien Tor steht und wartet, bis der Torwart von der Toilette zurückkommt. Da steckt irgendein sportlicher Ehrgeiz dahinter. Der muss ein begnadete Zeichner sein und vermutlich so mediengeil, dass er so einen Medienrummel provozieren und auch aushalten kann. Meistens schließt das eine das andere aus. So viele sind es nicht, die dafür in Frage kommen, aber ein paar Gesichter habe ich schon vor Augen, die hier in Berlin für eine solche Nummer gut genug sind. Sie werden sehen, dass einer wie Bender oder Gorsky in Bälde aktiv wird.“
Der Torwartvergleich kam nicht bei allen Teilnehmern der Runde gleich gut an, aber jeder grub in seinem Gedächtnis nach Namen und Gesichtern. Weil sie da nicht fündig wurde, wollte sich die Direktorin helfen lassen.
„Wer käme denn noch in Frage? Dr. Hagenau – Sie sind unser Experte.“
„Ich kenne mich leidlich in der Renaissance aus. Mit der aktuellen Berliner Szene bin ich nicht so vertraut. Aber wenn Sie mich schon so fragen: Ich würde auf alle Fälle den Meisner noch dazu zählen und vielleicht noch Brigitte Tappelt. Kann ja auch eine Frau sein.“
„Müsste der Kopierer nicht auch Linkshänder sein – wegen dem Strich?“, bemerkte Stratenkötter.
„So weit ich weiß, ist Meisner Linkshänder. Aber ich denke, wenn jemand überhaupt so perfekt kopieren kann, dann kann er auch als Rechtshänder den Aufstrich eines Linkshänders nachmachen. Meisner und Bender waren bei der Ausstellungseröffnung anwesend. Wir könnten uns die Video-Bänder der Überwachungskamera ansehen, ob von unseren Kandidaten welche dabei sind. Beim Ablegen der Kataloge konnte die Kamera ja niemanden erfassen, weil der Stuhl innerhalb des Ausstellungsraums im toten Winkel der Kamera steht und an der Außenwand gar keine Kamera ist.“
„Dr. Hagenau – ich bitte Sie! Ich denke, dass wir uns stundenlanges Betrachten langweiliger SchwarzWeiß-Filme erst einmal ersparen sollten, solange ja eigentlich kein Schaden vorliegt. Vielleicht geht ja unsere Phantasie mit uns durch? Zurzeit hat uns jemand zwei wunderschöne Kopien liegen lassen – und das ist ja noch kein Verbrechen. Trotzdem: ermahnen Sie bitte das Aufsichtspersonal zu erhöhter Wachsamkeit!“
Ihre Beurteilung der Lage hatte noch eine zweite Bedeutung, nämlich ihre Richtlinienkompetenz unter Beweis zu stellen. Weil Hagenau ein untauglicher Weisungsempfänger war, setzte er gänzlich unbeeindruckt seinen Gedankengang fort.
„Wenn wir alle dessen sicher sind, dass irgendetwas im Busch ist, sollten wir auch nicht einfach zuwarten. Ich habe da eine Idee. Der Kohoutek von der ars longa hat ja mehrfach mit Herrn Stratenkötter und mir über die Ausstellung gesprochen. Der ist darüber bestens informiert – jedenfalls war sein Artikel ganz ordentlich. Außerdem kennt er die Szene besser als wir alle zusammen. Wenn der sich bei unseren Kandidaten meldet und denen was von einer Portrait-Serie `Künstler in Berlin` erzählt, kommt der in jedes Atelier. Bei der Gelegenheit könnte er dann den Leuten mal sehr vorsichtig auf den Zahn fühlen.“
Der Vorschlag provozierte eine missbilligende Mine der Direktorin.
„Aber dann haben wir doch die Presse am Hals! Sie wissen doch, dass mir das nicht gefällt!“
„Die haben wir sowieso schon am Hals, weil man unserem Personal keinen Maulkorb verpassen kann. Irgendwann schnappt jemand etwas auf und dann ist die Sache gar nicht mehr zu kontrollieren. Die Pandorabüchse ist offen.“
Dabei machte Hagenau eine Geste als würde er seiner Chefin eine dampfende Suppenschüssel mit geöffnetem Deckel präsentieren. Die angebotene Mahlzeit wurde angenommen.
„Na – gut! Meinetwegen. Wie wollen Sie Ihren Kontaktmann dazu bewegen, diese Interviews zu führen?“
Die spontan wirkende Geste mit der Suppenschüssel war wohl schon Teil eines konkreten Plans.
„Ich lade ihn zum Essen bei meinem Lieblingsitaliener ein und erteile ihm einfach einen Auftrag.“
„Nur wenn dem Haus dadurch keine Kosten entstehen!“
„Machen Sie sich darüber keine Gedanken! Das ist mir der Spaß allemal wert.“
Die anderen drei Personen im Raum nickten verständig und erkannten, wie klein und nichtig manches Hindernis erscheint, wenn man genügend Kleingeld hat. Und alle streifte sogleich der Gedanke, dass man die Freiheit einfach auch öfter haben möchte zu sagen: Ja – das gönne ich mir jetzt mal. Der Neid aber wurde hinter drei artigen Gesichtern erfolgreich versteckt.
6. Italienisch Essen
Wenn es um italienische Küche ging, kannte sich Hagenau ebenso gut aus wie in der Renaissance. Zudem war er ein passabler Hobbykoch. Mit anderen Worten, wenn ein italienisches Restaurant seinem Anspruch genügen wollte, musste es schon wirklich gut sein. Als ersten Lackmus-Test bestellte er immer Saltimbocca – nur um auszuprobieren, ob es wenigstens genauso gut war wie sein von ihm selbst zubereitetes. War es besser als seines, wurde der persönliche Stern verliehen. In den wenigen Restaurants, die das Kriterium erfüllten, war er ein gern gesehener Gast, weil er schon mal eine miese Tagesbilanz hochreißen konnte. Das „Pestello“ war zurzeit sein Favorit.
Er hatte schon an seinem Lieblingstisch gesessen, stand aber wieder auf, als Kohoutek zum verabredeten Zeitpunkt eintraf, um ihn zu begrüßen.
„Hallo Herr Dr. Kohoutek – es freut mich, dass sie meiner Einladung gefolgt sind! Nehmen Sie Platz!“
„Wer mich ins `Pestello` einlädt, muss bei mir keinen Widerstand befürchten, Herr Dr. Hagenau. Schauen Sie mich an, dann kennen Sie schon eine schwache Seite von mir!“
Kohoutek umschrieb mit beiden Händen seinen runden Leib. Sein Blick nach unten kam über den Äquator nicht hinaus.
„Na – ich sollte auch mal mehr auf die Linie achten. Kleiner Aperitif vorab?“
„Ja gerne.“
„Kennen Sie Trinkessig – so eine Art Balsamico, nur besser?“