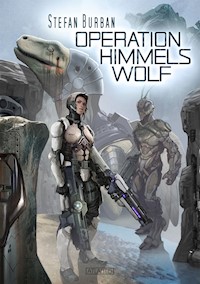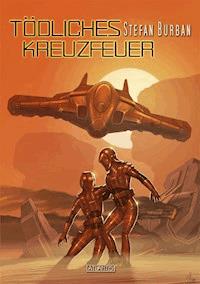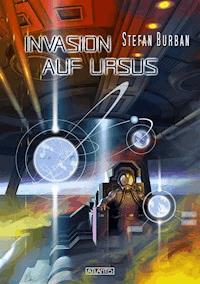
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Ruul-Konflikt Prequel
- Sprache: Deutsch
Ende des 21. Jahrhunderts hat die Menschheit ihre Streitigkeiten größtenteils beigelegt und sucht ihren Platz inmitten der Sterne. Das Terranische Konglomerat expandiert in alle Richtungen und gründet eine Vielzahl neuer Kolonien. 2097 kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall auf Ursus, der am weitesten entfernten Kolonie des von Menschen besiedelten Raumes. Das Erkundungsschiff einer bislang unbekannten Rasse trifft auf ein Patrouillenboot der Menschen. Die Reaktion des fremden Volkes erfolgt ebenso schnell wie tödlich. Doch damit nicht genug, löst diese Begegnung eine verheerende Invasion der landwirtschaftlich geprägten Ursus-Kolonie aus. Niemand weiß, wer die Fremden sind, woher sie kommen oder was ihre Absichten sind. Nur ihre Bezeichnung ist bekannt: die Ruul.
Während sich die zahlen- und waffenmäßig unterlegenen Kolonisten mit dem Mut der Verzweiflung gegen die drohende Niederlage stemmen, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand, dass dieser örtlich begrenzte Konflikt einen Flächenbrand auslöst, der die halbe Galaxis erfassen wird …
Die Ereignisse in diesem Band spielen vor denen aus Stefan Burbans Auftaktband der Reihe DER RUUL-KONFLIKT (DÜSTERE VORZEICHEN).
Die Romane der Reihe:
Prequel 1: Tödliches Kreuzfeuer
Prequel 2: Invasion auf Ursus
1: Düstere Vorzeichen
2: Nahende Finsternis
3: In dunkelster Stunde
4: Verschwörung auf Serena
5: Bedrohlicher Pakt
6: Im Angesicht der Niederlage 7: Brüder im Geiste
8: Zwischen Ehre und Pflicht
9: Sturm auf Serena
10: Die Spitze des Speers
11: Gefährliches Wagnis
Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Epilog
Weitere Atlantis-Titel
Stefan Burban
Invasion auf Ursus
Prolog
Ursus-KolonieTerranisches Konglomerat2. Januar 2097
»Und? Wie findest du es?«
Rory Callahan stemmte seine Fäuste in die Hüften und bedachte seine Frau Beatrice mit einem auffordernden Blick.
Diese musterte den Grundriss ihres neuen Hauses, den ihr Gatte abgesteckt hatte, zunächst mit einem wenig überzeugten Ausdruck auf dem Gesicht. Doch damit konnte sie Rory nicht täuschen. Er wusste, sie war begeistert und wollte ihn nur ein wenig auf die Folter spannen.
Tatsächlich weichte ihre Miene unter seiner ungeteilten Aufmerksamkeit schnell auf und ein breites Lächeln teilte ihre Lippen. Es entblößte zwei Reihen weißer, makelloser Zähne.
»Ich finde es großartig«, erwiderte sie ehrlich.
Er ging zu ihr und nahm sie stürmisch in den Arm. »Ich wusste, dass du das so siehst.« Er deutete auf den Grundriss, der sich deutlich auf dem grasbedeckten Boden abzeichnete. »Ich sehe es schon deutlich vor mir. Unsere neue Farm wird hier entstehen. Der Boden ist ideal zum Anbau von Kartoffeln und Kohl. Und das Wetter ermöglicht die Ausbringung von mindestens zwei Ernten pro Jahr.«
Ein Schatten huschte über ihr Gesicht. »Hoffentlich hast du recht. Auf der Erde hungern die Menschen.«
Er bemerkte, wie ihre Stimmung kippte, und nahm sie nur noch fester in den Arm. »Ja, jetzt noch, aber das wird schon bald anders sein. Die Auswanderungswellen tragen bereits Früchte. Hunderttausende von Menschen haben die Erde bereits in Richtung der neuen Kolonien verlassen und Hunderttausende werden noch folgen. Du wirst sehen. Das Konglomerat war bisher nur ein Wort, damit die Nationen auf der Erde den Frieden halten, doch nun wird es endlich Realität. Hungersnöte wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Krieg auf der Erde gibt es ja jetzt bereits nicht mehr. Es wird wunderbar werden.«
Rory sog die kühle, würzige Luft von Ursus tief in seine Lungen. »Atme diese Luft, Beatrice. Atme sie tief ein. Riechst du das?«
Sie folgte der Aufforderung und sah ihn schließlich verständnislos an. »Was meinst du?«
Er grinste. »Keine Umweltbelastung. Kein Rauch aus Fabriken. Diese Welt ist bisher völlig unberührt. Wir werden hier sehr glücklich werden. Viel glücklicher, als wir auf der Erde hätten werden können.«
»Ich hoffe, das bleibt auch so.« Sie schmunzelte, um ihren Worten die Spitze zu nehmen. »Ich hoffe, sie laden die Fertighäuser bald aus und bringen uns eins. Ich habe keine Lust, heute Nacht unter freiem Himmel zu schlafen.«
Er rümpfte dennoch die Nase und es war nur zum Teil aus Spaß. »Du bist ein alter Miesepeter. Das hier ist ein Abenteuer.«
»Drei Jahre Wartezeit für die Emigration von der Erde, fast zwei Monate eingepfercht in ein Kolonistenschiff, wir mussten sogar Silvester in diesem Schiff feiern. Ich hoffe wirklich, deine Voraussagen treffen ein.«
Rory verzog etwas die Miene. Er hätte sich etwas mehr Enthusiasmus von seiner Frau gewünscht. Sie hatte jedoch nicht unrecht. Es war ein Risiko, ein neues Leben fernab der Erde aufzubauen. Auf der Erde standen die Dinge nicht zum Besten. Der letzte Krieg auf dem sogenannten Blauen Planeten war noch nicht so lange her und das Terranische Konglomerat mehr eine Idee denn eine wirkliche Nation. Man war immer noch dabei, das Ödland, das einmal Neu-Delhi und Seattle gewesen war, zu dekontaminieren und die Trümmer zu beseitigen. Dann waren da noch Hungersnöte, Armut und natürlich der Bürgerkrieg mit dem Mars, der ebenfalls tiefe Wunden geschlagen hatte. Wer konnte, machte sich davon. Wenn die Pläne der Regierung halbwegs realistisch waren, dann sollte das Solsystem in zwanzig, dreißig Jahren ein Paradies sein, doch im Moment war es noch die Hölle.
Auf der Erde hatte er eine Farm in Nebraska besessen, seine Frau Beatrice war Lehrerin gewesen. Sie waren seit fast zwanzig Jahren verheiratet und wünschten sich nichts sehnlicher, als der Erde zu entfliehen.
Der Bürgerkrieg auf dem Mars war einer der Gründe für ihre Emigration gewesen. Rorys Vater war als einer der Ersten gefallen und anschließend war Rory dem Ruf zu den Waffen gefolgt. Zum Glück hatte er das Gröbste verpasst. Der Mars hatte kapituliert, bevor er dort angekommen war. Doch dann hatten die Anschläge und der Aufstieg der sogenannten Freiheitsliga begonnen. Die Terrorwelle war furchtbar gewesen, doch Rory hatte sie überlebt. Und als Teil seines Solds hatte man ihm ein kleines Fleckchen auf einer entfernten Kolonie überschrieben – beinahe so, wie die Legionäre im antiken Rom oftmals bezahlt worden waren.
Natürlich steckte da eine Menge Methode dahinter. Auf die Weise gab man der Auswanderungswelle einen kleinen Stups in die richtige Richtung und bekam gleichzeitig ein paar an verschiedenen Waffen ausgebildete ehemalige Soldaten auf die Kolonien, ohne langfristig regelmäßigen Sold zahlen zu müssen. Eine simple, aber für die Regierung in jeder Hinsicht gewinnbringende Idee.
Rory kümmerte das wenig. Seine Farm in Nebraska hatte ohnehin nicht genügend abgeworfen. Die Erde war zu belastet. Dem Boden fehlten verschiedene Mineralien aufgrund mehrerer Dürrekatastrophen; er musste erst wieder umständlich und zeitaufwendig damit angereichert werden. Doch der Boden auf Ursus war auf geradezu unanständige Weise fruchtbar.
Das hier war ein Abenteuer. Hier war der richtige Ort, um Kinder großzuziehen. Das war ein weiterer Grund für ihre Emigration gewesen. Sie wollten, dass ihre Kinder ein glückliches Leben führten.
Im Moment war dies auf der Erde eher zweifelhaft. Die Kinder, die dort aufwuchsen, hatten noch für gut eine oder zwei Dekaden mit den Sünden ihrer Eltern zu kämpfen. Rory und Beatrice hatten bereits eine Tochter im Teenageralter, doch sie planten durchaus noch weitere.
Ursus war die am weitesten von der Erde entfernte Kolonie und man sagte, mit Ausnahme von Alacantor sei sie von allen Welten am besten für Landwirtschaft geeignet. Sein Traum nahm langsam Gestalt an. Er würde wieder eine eigene Farm haben und Beatrice konnte im nahen Lacross wieder als Lehrerin arbeiten. Lehrer wurden dort dringend benötigt.
Seine Frau schien zu spüren, dass ihre Laune dabei war, ihn herunterzuziehen. Sie schmiegte sich mit ihrem leicht üppigen Körper an ihn und umfasste seine Hüften mit ihren Armen. »Tut mir leid«, flüsterte sie.
Er lächelt liebevoll auf sie herab. »Muss es nicht. Es wird alles wundervoll. Du wirst sehen.«
Sie nickte. »Du hast natürlich recht. Ich bin einfach nicht so abenteuerfreudig wie du, aber auf der Erde konnten wir nicht bleiben. Da hast du recht.« Sie schmunzelte. »Und es hat natürlich seinen Reiz, eine ganze neue Welt zu erkunden und zu helfen, sie aufzubauen.«
Er drückte sie noch fester. »Na siehst du? Das ist schon besser.« Er sah sich in plötzlichem Erstaunen um. »Wo ist Bianca? Ich möchte, dass sie diesen Augenblick mit ihren alten Eltern auskostet.«
Beatrice wandte kurz den Blick ab. »Du kannst dir denken, wo sie ist.«
Rorys Blick zuckte in Richtung der planetaren Hauptstadt. Direkt daneben wurde eine riesige Parabolantenne aufgebaut. Sie war noch nicht ganz fertig, doch sie würde es bald sein. Diese Hyperkomanlage würde die Kommunikation revolutionieren und zwischen nahen Systemen Gespräche in beinahe Echtzeit ermöglichen. Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen entfernteren Welten wurde von Wochen und sogar Monaten auf maximal Stunden reduziert. Doch das war es nicht, was Rory im Moment interessierte.
Eine Einheit der TKA war vor gut drei Tagen angekommen und war dort ganz in der Nähe nun in Zelten untergebracht, bis man den Soldaten ihre Quartiere in den Kasernen zuwies. Seine Tochter Bianca schlich sich trotz aller Verbote des Militärs und ihres Vaters dorthin, sooft sie nur konnte. Weil sie wusste, dass er dort war.
»Sag bloß, sie ist schon wieder mit diesem Kerl zusammen.«
Angesichts seiner ablehnenden Haltung, verkniff sich Beatrice nur mit Mühe ein Schmunzeln. »Du wirst dich damit abfinden müssen, dass Jason dein Schwiegersohn wird.«
»Nur über meine Leiche«, entgegnete er halb im Scherz.
»Sie liebt ihn und immerhin hat er sich extra zur Kolonialschutztruppe der TKA gemeldet, um hier sein zu können. Nur das hat es ihm ermöglicht, das Solsystem zu verlassen. Ansonsten wäre er noch auf der Erde. Wenn das also keine Liebe ist …« Sie ließ den Satz vielsagend ausklingen.
Ein lautes Geräusch ließ die Luft um sie herum erzittern und ersparte es Rory, sich eine passende Antwort überlegen zu müssen. Beide sahen gleichzeitig nach oben. Rory löste seine rechte Hand von ihr und überschattete damit seine Augen. Drei Schiffe durchstießen die obere Atmosphäre und nahmen Kurs auf den Horizont. Wenn er sich nicht sehr irrte, dann steuerten sie die planetare Hauptstadt Lacross an.
»Wie es aussieht, kommt bereits die nächste Kolonistenwelle. Wir hatten Glück, dass wir uns so frühzeitig zur Auswanderung entschieden hatten. Wer jetzt kommt, muss sich mit dem begnügen, was übrig bleibt.«
»Es gibt immer noch genügend Land«, schalt sie ihn sanft. »Vergiss nicht, die Leute werden unsere Nachbarn sein. Sei nett.«
Er sah sie in gespieltem Ernst an. »Ich bin immer nett.« Insgeheim war er froh, dass die Regierung sich um alles gekümmert und ihnen ein gutes Stück Land gegeben hatte. Andere würden nicht so viel Glück haben und sich mit einem weit weniger guten Flecken Ursus abfinden müssen. Rory und Beatrice’ Farm würde Teil einer kleinen Gemeinschaft aus über einem Dutzend Gehöften sein. Aus Erfahrung wusste er, wie schwierig Farmer sein konnten, und er hoffte, mit ihnen gut auszukommen.
»Aber natürlich.« Der Sarkasmus in ihrer Stimme war unüberhörbar. Rory neigte in manchen Situationen dazu, seine Mitmenschen zu provozieren. Er verspürte wenig Geduld mit Leuten, die er als mögliche Konkurrenz einstufte.
Ein weiteres Geräusch lenkte ihre Aufmerksamkeit nach oben. Zwei weitere Schiffe sanken sanft durch die Atmosphäre herab und folgten der Flugbahn der anderen drei. Diese Schiffe waren jedoch eindeutig nicht ziviler Natur.
Rory rümpfte erneut die Nase. »Militär.« Er stieß das Wort regelrecht aus und es gelang ihm, den Begriff wie etwas Widerwärtiges klingen zu lassen. »Wozu brauchen wir denn die? Die haben die Dinge auf der Erde doch erst so richtig versaut.«
»Sei nett«, wiederholte sie ihre Forderung. »Die sind hier, um uns zu beschützen.«
»Beschützen? Vor was denn? Wir haben hier draußen keine Feinde.«
»Vergiss nicht, wir sind nicht die Einzigen hier draußen.«
»Und wer sollte uns bitte schön angreifen? Die Til-Nara? Die kümmern sich um ihre eigenen Sachen. Die Sca’rith? Für die haben wir nichts von Interesse. Sie können nicht einmal unsere Nahrung verdauen, weshalb sogar unsere Ernten keinen Überfall lohnen würden. Oder vielleicht die Meskalno? Oder die Asalti? Beide Völker besitzen nicht einmal Militär. Und mit den Meskalno unterhalten wir sogar ein Handelsabkommen, weshalb sie sich mit einem Angriff ins eigene Fleisch schneiden würden. Nein, wir sind hier absolut sicher und brauchen kein Militär.«
»Ich habe gehört, man richtet derzeit einen Flottenstützpunkt bei New Born ein, um die äußeren Kolonien zu schützen.«
»Völlig unnötig, wenn du mich fragst. Das Geld sollte man lieber in Entwicklung der Kolonien und Erforschung neuer Technologien stecken. So was brauchen wir jetzt, nicht neue und immer bessere Methoden, wie wir uns alle gegenseitig umbringen können.«
»Ich weiß nicht so recht. Hast du die Gerüchte nicht gehört? Es heißt, dass kleinere Schiffe spurlos verschwinden. Mich persönlich beruhigt die Anwesenheit einiger Soldaten.«
Rory schnaubte abfällig. »Ich sag es dir nochmals, mein Schatz: Wir sind absolut sicher hier.«
1
Das Patrouillenboot mit der Bezeichnung PU-K 1297 war ein neueres Modell der Explorer-Klasse. Es war nicht sehr gut bewaffnet, aber es war schnell und verfügte über die neueste Sensorgeneration, weshalb es bestens zur Aufklärung der äußeren Systeme geeignet war.
Das Schiff besaß weder die Schlagkraft noch die Panzerung, um es mit etwaigen feindlich gesinnten Schiffen aufnehmen zu können. Das war auch gar nicht seine Aufgabe. Diese bestand vielmehr darin, die Randsektoren des rasch expandierenden Konglomerats zu kartografieren und katalogisieren. Das Hauptaugenmerk bestand im Finden von Systemen, die sich zur Kolonisierung eigneten, aber auch im Markieren möglicher zukünftiger Militärstandorte. Kurz gesagt, das Patrouillenboot war ein Vermessungsschiff.
Die Besatzung des Schiffes bestand aus lediglich fünf Personen. Das Kommando führte Lieutenant Marcus Pole. Den Befehl über Patrouillenboote erhielten normalerweise Offiziere, die frisch von der Akademie kamen. Auf derart einfachen und im Prinzip relativ risikolosen Einsätzen konnten sie Erfahrung sammeln, die sie auf den Dienst an Bord größerer Schiffe vorbereitete.
Bei Marcus war die Sache allerdings ein wenig anders gelagert. Der Mann galt unter seinen Vorgesetzten als schwierig, eigenbrötlerisch und aufsässig. Er war mittlerweile zweiundvierzig Jahre alt und war im Lauf seiner Dienstzeit nicht weniger als dreimal degradiert worden. Normalerweise hätte er längst Lieutenant Commander oder sogar Commander sein können.
Marcus verzog leicht das Gesicht. Teufel auch, es gab sogar Schiffskommandanten, die jünger waren als er. Marcus wusste sehr gut, warum man ihm das Kommando über ein Patrouillenboot gab. Es war ein Gnadenbrot. Er würde an Bord dieses Schiffes sein Dasein fristen, bis es Zeit für die Pensionierung wurde. Hätten seine Vorgesetzten genug gegen ihn in der Hand gehabt, sie hätten ihn ohne viel Federlesens unehrenhaft aus dem Dienst entlassen.
Dieser Gedanke zauberte ein Lächeln auf Poles Gesicht. Er hatte ihnen nie genug geliefert, um diese Maßnahme zu rechtfertigen. Also versetzte man ihn auf den langweiligsten Posten, den man sich vorstellen konnte. Er war sich sicher, hätte er einen Antrag auf vorzeige Quittierung des Dienstes gestellt, so hätte besagter Antrag die Hürden der Marinebürokratie in Rekordzeit durchlaufen und wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit positiv beantwortet worden.
Marcus ließ seine Gedanken schweifen und dachte darüber nach, was ihn hierher gebracht hatte. Aus seiner Sicht war gar nicht viel zusammengekommen. Ein paar Schlägereien, hier und da Fraternisierung mit einer Untergebenen, die eine oder andere Beleidigung eines höheren Offiziers. Wirklich nichts Weltbewegendes.
Er schmunzelte erneut. Wenigstens hatte er bei den Beleidigungen immer darauf geachtet, mit dem Ziel seines Verdrusses allein im Zimmer zu sein. Wären auch nur ein einziges Mal Zeugen anwesend gewesen, so wäre er vermutlich nun im Gefängnis. Es hieß, auf dem Eisplaneten Lost Hope werde gerade ein Militärgefängnis eingerichtet. Es solle dazu dienen, Leute wegzusperren, um sie schlichtweg zu vergessen.
Ein Schauder lief seinen Rücken hinab.
Er verspürte nicht die geringste Lust, dort seinen Lebensabend zu verbringen. Dann doch lieber an Bord eines Patrouillenbootes.
»Dany?«, wandte er sich an den jungen, weiblichen Ensign, der die Sensoren bediente. »Wie sieht’s diesmal aus?«
Ensign Danielle Brubaker warf ihren Sensoren einen letzten Blick zu, bis sie ihren Sessel so drehte, dass sie ihrem Kommandanten frontal gegenübersaß.
»Das System ist uninteressant. Hier könnte man nicht mal eine Militärbasis einrichten. Der Aufwand wäre zu hoch. Die Planeten sind unbewohnbar, ohne vollständigen Anzug kann man dort nicht überleben. Dann gibt es noch ein Asteroidenfeld. Aber ein sehr kleines. Nur ein paar Gesteinsbrocken. Könnte mal ein Mond gewesen sein.«
Marcus nickte zufrieden. »Das einzig Interessante wäre also seine Lage. Es wäre das ideale Sprungbrett, wollte jemand einen Angriff auf Ursus oder New Born starten.«
Danielle hob eine Augenbraue. »Ein Angriff? Wer sollte uns denn angreifen? Wir haben hier draußen keine Feinde.«
Marcus schürzte die Lippen. »Wir sind die Marine, Dany. Es ist unser Job, immer mit einem Angriff zu rechnen.«
Sie neigte leicht den Kopf, um ihm zu zeigen, was sie von dieser Erklärung hielt. »Und ich dachte, unser Job wäre die Friedenssicherung.«
»Das eine schließt das andere nicht aus.« Er zwinkerte ihr verschmitzt zu.
Sie lächelte und drehte ihren Sessel wieder so, dass sie die Sensoren im Blick hatte. Währenddessen ließ Marcus seinen Blick über die Figur seiner Untergebenen wandern. Er genoss den Anblick ihres schlanken, wohlproportionierten Körpers, der sich unter ihrer Uniform abzeichnete, und der langen, blonden Löwenmähne, die über ihre Schultern fiel. Wenn er es recht bedachte, hatte er nichts dagegen, mal wieder mit einer Untergebenen zu fraternisieren.
Er kicherte leise. Was wollten die Herren Admiräle denn machen? Ihm das Kommando über einen Müllfrachter geben?
Er stutzte. Konnten die das? Nun, da er so darüber nachdachte, war er gar nicht mal so sicher, dass sich diese Möglichkeit fern jeder Realisierung befand. Er ließ den Blick erneut über Danielles Körper gleiten. Obwohl … das wäre es vielleicht sogar wert.
Ein diskretes Hüsteln lenkte ihn ab. Neben seinem Kommandosessel stand Lieutenant Giacomo Blanco. Der Mann hatte die unschöne Angewohnheit, urplötzlich wie aus dem Nichts irgendwo aufzutauchen. Jedes Mal musste Marcus an sich halten, um nicht zusammenzuzucken. Der Mann war rangjünger als er – was angesichts seines eher schillernden Werdegangs keiner Erklärung bedurfte – und fungierte auf dieser Fahrt als sein Erster Offizier.
Marcus warf dem Mann aus dem Augenwinkel einen schiefen Blick zu. Dieser stand ungerührt mit hinter dem Rücken verschränkten Armen neben ihm und ließ die Musterung seines kommandierenden Offiziers ungerührt über sich ergehen. Blanco brachte immer das Kunststück fertig dazustehen, als hätte er einen Stock verschluckt.
Marcus war sich sicher, dass sein XO die Blicke bemerkt hatte, die er Danielle zugeworfen hatte. Wenn er Blanco richtig einschätzte, dann missbilligte er dies mit Sicherheit.
»Was gibt es, Giacomo?«
»Ich wollte Sie nur daran erinnern, was die Vorschriften besagen, wenn sich ein System als unzureichend erweist: es …«
»… in den Sternkarten entsprechend markieren, das System für regelmäßige Patrouillenflüge vormerken, damit sich hier kein Gesindel breitmacht, und so schnell wie möglich das nächste System auf der Liste anfliegen.« Marcus ratterte die Liste problemlos herunter. Er kannte die Vorgehensweise aus dem Effeff.
»Darf ich dann fragen, warum wir noch hier sind, wenn dieses System doch ganz offensichtlich nichts zu bieten hat?«
Marcus seufzte. »Ich wollte gerade den Befehl geben, mein Bester.«
Blanco neigte zur Pedanterie und ging Marcus damit zuweilen gehörig auf die Nerven. Wenn der Mann nicht bald etwas lockerer wurde, versprach dies eine sehr, sehr lange Fahrt zu werden.
»Pete«, wandte er sich an seinen Navigator. »Kurs setzen auf …«
»Sir? Ich habe etwas«, unterbrach Dany ihn unvermittelt.
»Und was?«
»Ein Sensorkontakt. Ich glaube, es könnte ein Schiff sein.«
Marcus schnallte sich los und ließ sich von der Schwerelosigkeit zu Danys Station tragen. Nur am Rande war er sich der Tatsache bewusst, dass Giacomo ihm wie ein Schatten folgte. Leicht neidisch registrierte er, wie behände sich der Mann über die Brücke bewegte. Für jüngere Offiziere stellte die Schwerelosigkeit an Bord von Raumschiff trotz umfassender Ausbildung oft ein Problem dar. Für seinen XO war dies allem Anschein nach nicht der Fall. Er ignorierte ihn. Stattdessen sah er Dany neugierig über die Schulter. Aufmerksam studierte Marcus die eingehenden Telemetriedaten. Die Geschwindigkeit des Objekts war relativ niedrig. Allem Anschein nach strahlte es jedoch weder Lebenszeichen noch eine Energiesignatur ab.
»Wie kommen Sie darauf? Vielleicht ist es lediglich ein Komet oder ein Asteroid. Bei dieser Geschwindigkeit könnte es sich sogar lediglich um Raumschrott handeln, der unseren Kurs kreuzt.«
»Das ist es definitiv nicht.«
»Wieso?«
»Es hat vor etwa einer Minute den Kurs gewechselt, gleich nachdem es in Sensorreichweite kam. Das fremde Objekt wird ungefähr zehn Meter unterhalb unseres Bugs unseren Kurs kreuzen, wenn wir unseren Flug auf dieser Bahn fortsetzen.«
»Interessant.« Marcus strich sich über das glatt rasierte Kinn. »Wie lange bis zum Kontakt?«
»Etwas mehr als eine Stunde.«
»Soll ich den Kurs ändern?«, wollte Peter Draxton wissen, sein Navigator.
Mehrere Gedankengänge zuckten durch Marcus’ Geist. Der Raum, den sie durchstreiften, wurde von niemandem beansprucht. Weder Til-Nara noch eines der anderen Völker, auf das die Menschheit getroffen war, wurde in diesem Teil des Weltraums oft gesehen. Außerdem hätten die sich inzwischen identifiziert. Wenn es sich also um ein Schiff handelte, welchem Volk gehörte die Besatzung an? Was, wenn es einem bisher unbekannten Volk angehörte? Ein Lächeln teilte sein Gesicht.
Kein Kommandant eines Patrouillenbootes hatte bisher einen Erstkontakt in seiner Vita zu verbuchen. Er wäre der Erste. Mit einem solchen Erfolg auf seiner Habenseite hatte die Admiralität gar keine andere Wahl, als ihn zu befördern und ihn auf einen besseren Posten zu hieven, ungeachtet der Dinge, die früher passiert waren.
Er ermahnte sich zur Ruhe. Etwas zu überstürzen, würde seinen im Aufsteigen begriffenen Stern schnell wieder zum Absturz bringen. Er musste sichergehen, dass es sich tatsächlich um ein Schiff handelte.
»Ja«, beantwortete er endlich die Frage seines Navigators. »Gehen Sie auf einen Kurs, der uns vertikal in einen Neunzig-Grad-Winkel und horizontal in einen Siebzig-Grad-Winkel zum fremden Schiff bringt.«
»Aye, Skipper«, bestätigte der Navigator den Befehl.
Marcus nickte zufrieden. Falls es sich tatsächlich um ein Schiff auf einem Abfangkurs handelte, würde es erneut den Kurs ändern, um an dem terranischen Patrouillenboot dranzubleiben.
Das Boot schwenkte gehorsam in die angegebene Richtung. Kaum hatte es die Kursänderung vollzogen, drehte das fremde Objekt bei, um das Patrouillenboot nicht zu verlieren.
Marcus nickte und konnte nicht verhindern, dass sich das Lächeln auf seinem Gesicht ausweitete. »Damit dürfte klar sein, dass es sich um ein Schiff handelt.«
»Wie gehen wir weiter vor?«, wollte sein XO wissen. Die Stimme des Mannes vibrierte in ungewohnter Weise angesichts der Situation. Es machte ihn beinahe sympathisch. Er war nicht gefeit gegen die Spannung, die sich auf der Brücke breitmachte.
»Dany? Bereiten Sie die Grußbotschaft vor. Mal sehen, wie sie reagieren. Dann sehen wir weiter.«
Jedes Schiff des terranischen Konglomerats – egal ob zivil oder militärisch – führte in den Bordcomputern zum Zweck möglicher Erstkontakte eine Standardgrußformel mit sich, die im Bedarfsfall sofort abgestrahlt werden konnte. Sie bestand lediglich aus mehrere mathematischen Formeln, da man davon ausging, dass Mathematik eine einfache, für alle verständliche Sprache darstellte und eine raumfahrende Rasse sie ohne Probleme würde entschlüsseln können. Sie besagte im Prinzip: Wir kommen in Frieden. Bringt mich zu eurem Anführer. Zumindest einfach ausgedrückt. Natürlich gehörte noch wesentlich mehr zu der Botschaft, doch dies war die Kernaussage.
»Botschaft ist raus«, bestätigte Dany.
»Na schön«, nickte Marcus. »Dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zu warten.«
Tolek’karis-esarro erwachte in einem Meer aus Schmerzen. Dies war der erste Gedanke, der ihm durch das von Pein vernebelte Gehirn schoss. Zu Beginn der Mission hatte man ihm erklärt, er würde sich fühlen wie im Leib seiner Mutter. Geborgen und sicher.
Es war eine Lüge gewesen.
Tolek öffnete die Augen. Er befand sich in einem Tank voller Flüssigkeit. Schläuche führten in seinen Körper. Panik ergriff von ihm Besitz – bis er sich daran erinnerte, dass er sich selbst in diesen Tank begeben hatte. Es war notwendig. Nur auf diese Art ließ sich die gewaltige Distanz und die tiefe Schwärze zwischen den Galaxien durchqueren – in einem Zustand, der dem Tod zu ähnlich war, um wirklich angenehm genannt zu werden.
Doch warum wurde er nun geweckt? Langsam klärte sich die drogeninduzierte Verwirrung seines Hirns. Der Bordcomputer seines Kreuzers hatte Anweisung, ihn zu wecken, sollte sich etwas von Interesse ereignen. Vielleicht hatten sie ihr Ziel erreicht. Eine neue Galaxis voller Welten, die sein Volk ausplündern konnte. Dieses Mal vielleicht sogar mit Welten, die man besiedeln konnte.
Nur mit Abscheu erinnerte er sich an die letzte Galaxis, die sein Volk heimgesucht hatte. Es hatte unzählige Welten voller Rohstoffe gegeben, doch keine war wirklich wert, besiedelt und zu ihrer neuen Heimat gemacht zu werden. Einige waren zu heiß, die meisten jedoch viel zu kalt. Ruul waren Kaltblüter. Mit kaltem Wetter kamen sie nicht gut zurecht.
Es hatte auch Völker gegeben, doch sie waren nur unzureichend entwickelt gewesen. Keine Gegner für ein Volk, das für den Krieg lebte. Keine Gegner für die Ruul. Er leckte sich über die Lippen. Einige dieser Völker waren wenigstens überaus schmackhaft gewesen. Immerhin ein kleiner Trost.
Tolek spannte seine muskulösen Beine an und stieß sich ab vom Boden des Tanks, in dem er sich befand. Mit seinen gewaltigen Pranken öffnete er den Zugang. Noch während er aus dem Tank stieg, löste er die Schläuche und ließ sie in den Tank zurückgleiten. Das Lösen jeden einzelnen Schlauches schmerzte und er fletschte die Zähne. Der Schmerz klang nur langsam ab. Wenn er je den Techniker fand, der diese Methode entwickelt hatte – oder seine Nachkommen –, dann würde er ihm liebend gern die Kehle herausreißen. Nur so zum Spaß.
Er ließ sich auf das blanke Deck fallen. Das Metall fühlte sich gut unter seinen Krallen an. Endlich etwas, das Substanz hatte. Tolek würgte und übergab sich lautstark, leerte seine Lungen von all der Flüssigkeit.
Er erhob sich und streckte seinen Körper. Die Zeit in der Starre hatte seine Glieder steif werden lassen. Der Bordcomputer registrierte seine Anwesenheit. Überall an Bord gingen die Lichter an, Systeme erwachten zum Leben und meldeten volle Betriebsbereitschaft.
Tolek drehte sich um. Seine Besatzung befand sich immer noch im Tiefschlaf. Reihe um Reihe drängten sich Behälter von der gleichen Machart wie der, in dem er sich aufgehalten hatte, in dem Laderaum des Kreuzers. Es waren insgesamt dreihundervierundsechzig. Hunderte solcher Schiffe eilten seinem Volk voraus. Es handelte sich um eine erste Speerspitze. Sie hatten die Aufgabe, neue Jagdgründe ausfindig zu machen und die Ankunft der übrigen Stämme vorzubereiten.
Hinter dem Vorauskommando folgte der Großteil der ruulanischen Flotte. Eine Armada aus Tausenden von Schiffen und Millionen von Soldaten. Und weit dahinter folgte der eigentliche Reichtum seines Volkes – die Stammesschiffe. Riesige, langsam fliegende Generationenraumer, die die ganze ruulanische Zivilisation beherbergten. Alle Stämme drängten sich an Bord dieser Schiffe, auf der Suche nach einer neuen Heimat.
Tolek eilte zu einer nahen Konsole und rief den Statusbildschirm der Behälter seiner Besatzung auf. In den meisten regte sich bereits der Insasse. Seine Besatzung erwachte. Einige wenige jedoch blieben dunkel und bar jeder Bewegung.
Der Statusbildschirm gab ihm einen Überblick über die Verfassung seiner Krieger. Sie bestätigte seine Befürchtungen. Zweiunddreißig Tanks waren während des viele Zyklen währenden Fluges ausgefallen, die Insassen tot.
Zweiunddreißig. Es hätte schlimmer kommen können.
Als Nächstes rief er über die Konsole den Status der übrigen Schiffe des Vorauskommandos auf. Alle Schiffe sendeten ihren Standort ständig an alle Schiffe des Vorauskommandos. Auf diese Weise wurde gewährleistet, dass man sich schnell wieder zusammenfinden konnte.
Der Computer spuckte auch diese Information schnell aus, doch das Ergebnis war wenig befriedigend. Das Vorauskommando bestand aus mehr als tausend Schiffen. Doch nur noch dreihundertelf gaben ein Signal ab. Von den anderen fehlte jede Spur. Es war ein langer Flug gewesen und alles Mögliche konnte in dieser Zeit passiert sein. Der Verlust einiger Schiffe war durchaus einkalkuliert worden, doch beinahe siebenhundert Schiffe einzubüßen, war bitter. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, waren die Überlebenden über fast zweihundert Lichtjahre verstreut. Es würde Zeit kosten, sie zu sammeln. Viel Zeit. Er ermahnte sich zur Ruhe. Gut möglich, dass es auf den anderen Schiffen zu Fehlfunktionen gekommen war und lediglich ihre Transponder ausgefallen waren. Bei näherem Überlegen war das sogar wahrscheinlich. Sie würden wieder zusammenfinden, sobald die Besatzungen erst einmal erwacht waren. Da war er sich sicher.
Ein Krieger von stämmigem Körperbau und etwas kleiner als Tolek gesellte sich zu ihm. »Herr«, grüßte der Ruul respektvoll.
Tolek schenkte ihm lediglich ein kurzes Nicken. Zeli’karis-esarro diente ihm schon lange als Adjutant und genoss sein volles Vertrauen. Darüber hinaus war er der zweite Sohn seiner Tante. Die beiden waren wie Brüder aufgewachsen. Normalerweise hätte er den Krieger überschwänglicher begrüßt, doch etwas beanspruchte seine volle Aufmerksamkeit.
Zeli trat neugierig näher. »Was hat uns aufgeweckt? Haben wir bewohntes Gebiet erreicht?«
Tolek nickte. »Es scheint wohl so. Ein Schiff ruft uns. Einfache Bauart. Nur unzureichend bewaffnet. Fünf Lebewesen an Bord.«
»Ist es unsere Aufmerksamkeit wert?«
»Auf jeden Fall ist es ein Anfang. Stell einen Entertrupp zusammen. Bring mir zumindest einen lebendig. Und sichere den Bordcomputer. Ich aktiviere derweil die Übersetzungsmatrix. Vielleicht finden wir etwas Interessantes in den Datenbanken.«
»Verstanden.«
»Es tut sich etwas.«
Bei Danys Ausruf beugten sich sowohl Marcus als auch sein XO tiefer über den Bildschirm. Seit nunmehr fast fünfzig Minuten hielt das fremde Schiff auf sie zu. Doch nun änderte es abermals den Kurs. Es würde immer noch ihren Weg kreuzen, doch nun oberhalb des Bugs. Außerdem nahm es zusehends an Fahrt auf.
»Oh, oh.«
»Was ist?«, wollte Marcus ungeduldig wissen.
»Ich kann inzwischen Lebenszeichen an Bord orten. Eine Menge. Über dreihundert. Und das Schiff strahlt inzwischen eine deutliche Energiesignatur ab. Ich glaube …«
Marcus nickte. »Die versorgen ihre Waffen mit Energie.«
»Sir?«, meinte Giacomo Blanco zögernd. »Wir sollten …«
»… verschwinden«, vollendete er den Satz. »Seh ich genauso.« Er stieß sich ab, kehrte zu seinem Sessel zurück und schnallte sich an. »Pete. Volle Wende. Bringen Sie uns zurück zur Nullgrenze. Maximalgeschwindigkeit.«
»Verstanden.«
In diesem Moment stieß das feindliche Schiff zwei kohärente Energiestrahlen aus, die sich am Heck des Patrouillenbootes trafen. In Sekundenbruchteilen zerschmolz der verheerende Angriff Antrieb und Energieleitungen des kleinen Bootes.
Die Lichter auf der Brücke fielen flackernd aus, nur um kurz darauf von der roten Notbeleuchtung ersetzt zu werden.
»Status«, verlangte Marcus.
Sein XO trieb zu seiner Station und überprüfte einkommende Daten auf dem Bildschirm. »Antriebsenergie nur noch zu sechs Prozent verfügbar. Waffenenergie noch zu fünfzig Prozent.« Er wandte sich zu seinem kommandierenden Offizier um. »Sollen wir zurückfeuern?«
»Wozu?« Marcus schüttelte den Kopf. »Mit unseren Spielzeugkanonen hämmern wir nicht einmal eine Beule in deren Panzerung. Wenn sie uns erledigen wollten, hätten sie es längst getan. Die wollen uns entern.«
Das Patrouillenboot lag nun mit fast schon lächerlich anmutender Geschwindigkeit im Raum, der Willkür des unbekannten Gegners hilflos ausgesetzt. Das Schiff kam drohend näher. Es war nun bereits mit bloßem Auge zu erkennen. Die Umrisse wirkten für menschliche Begriffe seltsam unförmig, sogar beinahe unfertig, als wäre das Schiff zu früh aus der Werft gekommen, bevor alle Arbeiten beendet worden waren.
Betäubtes Schweigen breitete sich auf der Brücke aus. Dany und Pete warfen ihm immer wieder hoffnungsvolle Blicke zu. Er wusste, was in ihren Köpfen vor sich ging. Sie wünschten sich Führung von ihm. Sie wollten einen Befehl hören, der all dies zum Guten wenden mochte. Den Gefallen konnte er ihnen leider nicht tun. Es gab nichts, was einer von ihnen noch tun konnte.
Die Tür ging auf und Chief Cal Boyd trieb auf die Brücke. Marcus sah auf. Der Chief schüttelte lediglich den Kopf und bestätigte damit, was Marcus ohnehin schon wusste: Sie konnten nicht entkommen.
»Vielleicht wollen sie uns einfach nur kennenlernen«, meinte Giacomo optimistisch. Das angstvolle Zittern in seiner Stimme strafte seine eigenen Worte Lügen.
»Da bin ich mir sicher«, hielt Marcus dagegen. »Ich glaube nur nicht, dass uns das sonderlich gut gefallen wird. Man benötigt keine Waffen, um einfach nur Hallo zu sagen.«
Ein Gedanke durchzuckte sein von Angst beherrschtes Gehirn. Er schluckte schwer. »Die Datenbank!«, stieß er aus. Die Bordcomputer des Patrouillenbootes beinhalteten natürlich vor allem Navigationsdaten, unter anderem zur Erde und zu sämtlichen Kolonien im Umkreis von fünfzig Lichtjahren. »Die Datenbanken sofort löschen!«, ordnete er an.
Das war alles an Anweisung, was Dany benötigte. Sie wandte sich ihrer Station zu und hämmerte auf ihre Tastatur ein. Auf dem Bildschirm erschien ein Balken, der den Fortschritt ihrer Bemühungen anzeigte. Marcus’ Blick huschte zwischen dem Brückenfenster und Danys Station hin und her.
Das fremde Schiff war jetzt genau über ihnen. Eine Warnmeldung auf seinem Hauptbildschirm informierte ihn darüber, dass das Schiff nun angedockt hatte.
»Schneller, Dany«, drängte Marcus.
»Ich mache, so schnell ich kann.«
Mit einem Mal sanken sein XO und der Chief auf den Boden der Brücke hinab. Beide starrten sich erst gegenseitig, dann ihren Kommandanten mit großen Augen an.
Marcus spürte den Zug der Schwerkraft ebenfalls an seinem Körper ziehen. Er schluckte. Dieses Schiff verfügte über künstliche Schwerkraft und hatte es irgendwie geschafft, diese auf das kleine Patrouillenboot auszuweiten.
»Sollten wir uns nicht bewaffnen?«, wollte Giacomo wissen. Der Mann stieg etwas in Marcus’ Ansehen, als er tatsächlich den Vorschlag machte, ihr kleines Schiff gegen eine feindliche Übernahme zu verteidigen. Marcus dachte sogar über den Vorschlag nach, verwarf ihn jedoch beinahe augenblicklich wieder. Fünf Figuren sollten ihr Schiff gegen mehr als dreihundert Feinde verteidigen? Der Widerstand wäre kaum mehr als symbolischer Natur und Marcus verspürte nicht die geringste Lust, heute zu sterben.
»Nein. Wehrt euch nicht. Vielleicht nehmen sie uns nur gefangen.«
Sein Befehl löste ungläubige Blicke seiner Crew aus. Es interessierte ihn nicht. Er wusste sehr wohl, es war gegen die Tradition der Marine, sich kampflos zu ergeben. In der Vergangenheit hatten unterlegene Marine-Einheiten sogar lediglich ein paar Raketen oder Torpedos auf feindliche Schiffe abgefeuert und sich anschließend sofort ergeben, um sich nicht des Vorwurfs der Feigheit auszusetzen. Marcus tat nichts dergleichen. Gut möglich, dass auch nur ein einzelner Schuss für die Fremden als Vorwand gelten mochte, sie alle umzubringen. Wenn möglich wollte er seine Leute hier lebend rausbringen.
Funken stoben aus der Decke, als die Eindringlinge sich daranmachten, sich ihren Weg auf die Brücke freizuschneiden.
Der Fortschrittsbalken auf Danys Bildschirm zeigte inzwischen siebzig Prozent an.
»Gleich geschafft«, informierte sie ihn.
In diesem Moment fiel ein Teil der Decke einfach herab. Die Ränder glühten noch. Eine Gestalt ließ sich durch das Loch fallen – und Marcus sah sich Auge in Auge mit dem größten Außerirdischen gegenüber, den er je gesehen hatte, sowohl auf Bildern als auch in echt. Der Eindringling hatte grüne, schuppige Haut. Die Abstammung von Reptilien war unverkennbar. Ein breiter Kopf saß auf einem muskulösen Körper. Das Wesen öffnete den Mund und entblößte Reihen kleiner, weißer Zähne.
Marcus war kein Anthropologe, doch selbst ihm war auf den ersten Blick klar, dass sie es hier nicht mit einem Pflanzenfresser zu tun hatten.
Der Fremde war in einen Panzer gehüllt, der aussah, als könne er die meisten Waffen problemlos aufhalten. Am Gürtel trug er eine Art Sichelschwert und etwas, das nach einer Energiewaffe aussah.
Zwei weitere, ähnlich gekleidete und bewaffnete Krieger ließen sich durch das Loch fallen. Alle drei beäugten die Menschen aus boshaften, aber interessiert blickenden Augen. Marcus konnte förmlich spüren, wie sie alles begutachteten und in Gedanken notierten.
Danys Verhalten war bewundernswert. Während ihre drei Schiffskameraden die Neuankömmlinge einfach nur fassungslos musterten, hämmerte sie weiter auf ihre Tastatur ein und ignorierte die feindliche Entermannschaft völlig.
Der Krieger, der offenbar den Befehl führte, blickte von Marcus zu Dany und wieder zurück. Marcus warf seiner Kameradin aus dem Augenwinkel einen Blick zu. Der Balken auf ihrem Bildschirm zeigte achtzig Prozent an.
Dem Außerirdischen schien klar zu werden, was vor sich ging. Er überbrückte die Distanz zu Danys Station mit einem Satz und zog in derselben Sekunde sein Schwert. Es fiel herab wie eine Sense und trennte Danys rechte Hand über dem Handgelenk ab. Das abgetrennte Glied blieb reglos auf der Tastatur liegen.
Dany schrie auf, mehr vor Schock denn vor Schmerz. Die Klauenhand des Außerirdischen fuhr hoch und zerriss ihre Kehle. Aus dem Schrei wurde röchelndes Gurgeln. Sie rutschte von ihrem Sessel auf das Deck. Sie war tot, noch bevor sie den Boden erreichte. Ihre ganze Station war mit Blut besudelt.
Der Balken stand bei vierundachtzig Prozent still.
Der Anführer der Entermannschaft musterte die vier überlebenden Menschen mit einem Ausdruck in den Augen, den Marcus nur berechnend nennen konnte. Er gab seinen Kriegern einen Wink und die zogen ohne Umschweife ihr Sichelschwert. Zu Marcus’ grenzenlosem Entsetzen, schlugen sie ohne Zögern Pete, Cal und Giacomo den Kopf ab. Die Leichen ließen sie achtlos liegen. Die Außerirdischen unterhielten sich in ihrer seltsam anmutenden gutturalen Sprache und gaben quietschende Laute von sich. Schnell wurde Marcus klar, dass sie über seine toten Kameraden Scherze austauschten.
Er wandte sich wie mechanisch dem Krieger zu, der offensichtlich den Befehl führte. Marcus fühlte weder Trauer noch Angst. Sein ganzer Körper war wie betäubt. Der feindliche Anführer musterte ihn erneut, bis er schließlich einem seiner Untergebenen ein kurzes Zeichen gab.
Dieser gab Marcus einen Stoß und bugsierte ihn auf die Öffnung in der Decke zu. Von oben wurde eine Leiter herabgelassen.
Marcus schluckte schwer. Mit diesem Erstkontakt hatte er eigentlich in die Geschichte eingehen wollen. Das würde nun wohl auch geschehen: als der erste Mensch, der einen Fuß in ein Schiff dieser unbekannten Rasse setzen würde. Das würde bestimmt ein oder zwei Kapitel in den Geschichtsbüchern wert sein, das hieß, falls je wieder jemand etwas von ihm hörte.
2
»Willkommen in eurem neuen Zuhause.«
Die TKA-Soldaten warfen ihren Seesack achtlos auf die nächste freie Pritsche, die sich anbot. Die meisten ließen sich danach selbst auf die Liege fallen, wobei einige beinahe augenblicklich anfingen zu schnarchen.
»Puh, was für eine dreckige Absteige«, meinte einer und wedelte mit der Hand vor der gerümpften Nase. »Wann hat hier das letzte Mal jemand ein Fenster aufgemacht?«
»Tut mir leid, dass wir Ihren Geschmack, was die Unterkunft betrifft, nicht getroffen haben, Murphy«, erwiderte eine tiefe Stimme vom Eingang her. »Ich werde das bei nächster Gelegenheit mit dem Colonel besprechen. Vielleicht haben die Einheimischen hier ja ein Viersternehotel, von dem ich noch nichts weiß.«
Master Sergeant Caesar Crook trat mit weit ausgreifenden Schritten in den Raum. Jedenfalls so weit ausgreifend, wie es seine O-Beine zuließen.
Bei seinem Erscheinen sprangen die Soldaten von den Pritschen auf, sogar diejenigen, die bereits am Dösen gewesen waren. Der Master Sergeant genoss großen Respekt, außerdem wollte niemand Extradienst schieben, nur weil er die Disziplin nicht beachtet hatte.
Doch heute war Crook ausnahmsweise in großzügiger Stimmung. Er winkte nur ab und bedeutete den Soldaten, sich wieder hinzulegen. Nicht wenige kamen dieser stillen Aufforderung nur zu gern und mit einem leicht gequälten Aufstöhnen nach.
Lieutenant Jason Grey, den Seesack noch über der Schulter, folgte dem Master Sergeant in die Unterkunft, die bis auf Weiteres sein Zuhause sein sollte. Abwartend blieb er stehen.
»Alle mal herhören!« Crooks Stimme forderte unbedingten Gehorsam. »Wie ihr wisst, hat der Truppentransporter, der sich unserem Konvoi bei New Born angeschlossen hat, einige Leute befördert, um die letzten Lücken in unserer Aufstellung zu schließen.«
Crook drehte sich um und deutete auf Jason und die Männer, die hinter ihm standen. »Das sind sie«, sagte der Mann, ohne sie jedoch einzeln vorzustellen. »Tut mir einen Gefallen und macht es ihnen nicht schon am ersten Tag zu schwierig. Ich hab keine Lust, Babysitter für ein paar Neuankömmlinge zu spielen. Ich hab auch so schon genug um die Ohren.«
Obwohl einige der Neuankömmlinge Offiziere waren und damit in der Hierarchie weit über Crook standen, behandelte der Master Sergeant die Männer und Frauen mit der für Unteroffiziere typischen Furchtlosigkeit gegenüber höheren Dienstgraden. Für Männer wie Crook bestand der Unterschied zwischen einfachen Soldaten und Offizieren hauptsächlich darin, dass Soldaten meistens wussten, was sie taten.
Einige Männer feixten, andere warfen den neuen Offizieren neugierige Blicke zu, als würden sie ausloten, ob es sich lohnen würde, sie beim Pokern bis auf die Unterwäsche auszuziehen.
Crook drehte sich um und wandte sich direkt an Jason. »Tut mir leid, Lieutenant, aber vorläufig gibt es keine Unterkünfte eigens für die Offiziere. Alle müssen gemeinsam untergebracht werden. Lässt sich nicht ändern. Hier ist alles noch etwas provisorisch.«
»Schon in Ordnung, Sarge«, erwiderte er. »Das wird schon gehen.«
Crook nickte zufrieden angesichts dieser Antwort und drängte sich an den Männer vorbei aus dem Gebäude. Jason seufzte. Er hatte nicht gerade das Hilton erwartet, aber das Wort provisorisch beschrieb die Unterkunft nicht wirklich adäquat.
Jason warf seinen Seesack auf die nächste freie Liege und setzte sich daneben.
Er wollte sich schon daranmachen, seine wenigen Habseligkeiten auszupacken, als einer der anderen Offiziere auf ihn zukam und ihm auffordernd die Hand hinhielt. »Lieutenant Steven Murphy«, stellte er sich vor.
»Lieutenant Jason Grey.« Jason ergriff die Hand und drückte sie kurz.
Ohne dazu aufgefordert zu werden, setzte sich der Offizier neben Jason und musterte ihn unverhohlen. »Und? Was treibt dich hierher?«
»Wie bitte?«
»Na irgendetwas treibt jeden von uns her. Ohne Grund ist keiner am entferntesten Außenposten der Menschheit.«
»Warum willst du das denn wissen?«, fragte Jason abweisend.
»Ich bin nur neugierig.«
»Und warum bist du hier?«
»Das Abenteuer.«
Jason sah auf. »Abenteuer?«
Steven nickte enthusiastisch. »Aber klar doch. Wir sind Pioniere. Wir sind die ersten Menschen, die Ursus betreten und uns diese Welt untertan machen.«
»Ursus ist schon seit gut zehn Jahren von Menschen besiedelt.«
Steven machte ein leicht enttäuschtes Gesicht. »Du weißt genau, was ich meine.«
Jason schmunzelte. Die leicht naive Art des Mannes, machte diesen ja beinahe schon sympathisch. »Ja, schon möglich.«
Er nahm sich einen Augenblick Zeit, um sich die anderen Soldaten im Raum anzusehen. »Warum sind dann die alle hier?«, fragte er nun auch neugierig.
»Der da …« Steven deutete auf einen langen Lulatsch von mindestens zwei Meter, der aber so dünn war, dass man ihn schon hager nennen musste. Er trug die Rangabzeichen eines Corporal. »Das ist Vega. Angelo Vega. Er ist hoch verschuldet. Du weißt ja, die TKA übernimmt alle Schulden für Soldaten, die sich verpflichten, mindestens fünf Jahre hier draußen in der Wildnis Dienst zu tun.« Er deutete auf einen anderen Soldaten, diesmal einen einfachen Gefreiten. »Und der da? Noori Omura. Der flüchtet vor zwei Exfrauen. Sagt, er habe keine Lust mehr, ständig mit ihnen im Streit zu liegen.« Steven kicherte. »Muss ja schlimm sein, wenn er deswegen so weit nach draußen geht.« Er schmunzelte leicht. »Bei den anderen ist es mehr oder weniger dasselbe. Einige wollen einfach nur von zu Hause weg, andere wollen, dass ihre Schulden übernommen werden, wiederum andere suchen das Abenteuer.« Er lachte erneut. »Wie ich.«
Jason nickte. Dieser Steven schien eine echte Frohnatur zu sein.
»Und was ist nun mit dir?«, fragte Steven erneut.
Jason seufzte. Der Kerl ließ einfach nicht locker. Und dabei hatte er so gehofft, bei dieser ganzen Erzählerei hätte der Jason wieder vergessen.
Jason gab sich geschlagen. »Ein Mädchen.«
Steven bekam große Augen. »Ein Mädchen? Erzähl.«
»Ihre Eltern sind emigriert. Und dabei waren wir schon verlobt. Ich kam frisch von der Offiziersschule, als ich es erfuhr.«
»Wo kommst du ursprünglich her?«
»Anchorage.«
»Und weiter?«
»Na ja, ich erfuhr, dass die TKA noch dringend Leute zum Schutz der Kolonien sucht und jeder, der sich meldet, willkommen ist. Und hier bin ich.«
»Ja, hier bist du«, schloss Steven. »Und deine Kleine ist auch hier?«
Jason nickte. »Ist erst kurz vor uns hier angekommen. Ich habe speziell um die Versetzung nach Ursus ersucht.«
»Das muss ja wirklich Liebe sein, wenn du deswegen einen fast zweimonatigen Flug auf dich nimmst. Von der Zeit auf New Born ganz zu schweigen, in der sie dir beibringen, wie du dich in einer völlig fremden Umgebung zurechtfindest, ohne draufzugehen.«
»Oh ja, es ist wirklich Liebe.« Jason senkte leicht verlegen den Blick. Verstohlen berührte er das Amulett, das er um den Hals trug und unter seiner Uniform verborgen hielt. Es war in jeder Hinsicht gegen die Vorschriften, doch er brachte es einfach nicht über sich, es abzunehmen. Es bestand aus zwei Teilen, die perfekt ineinander passten. Sowohl er als auch Bianca besaßen einen Teil und in jedem der zwei Amulette steckte ein Foto, das sie beide zeigte.
»Erzähl mir etwas über unser Regiment«, bat er, doch mehr um das Thema zu wechseln. Im Prinzip wusste er schon alles Wichtige.
Erwartungsgemäß zuckte Steven mit den Achseln. »Da gibt es nicht viel. Unser Regiment gibt es noch nicht so lange. Das 51. wurde erst vor gut zwei Jahren aufgestellt. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Kampfeinsatz mitgemacht.«
»Seit Ende des Bürgerkrieges ist es auch schwer, Kampfeinsätze zu erleben. Und nach allem, was ich über Krieg weiß, können wir auch froh darüber sein.«
»Eine seltsame Einstellung für einen Soldaten.«
»Findest du? Ich finde es passend, wenn gerade ich als Soldat gegen Krieg bin. Oder findest du es besonders erstrebenswert, in die Schlacht zu ziehen.«
»Nicht wirklich.«
»Na siehst du!«
»Hast du noch Familie auf der Erde?«
Jason war von dem plötzlichen Themawechsel einen Moment wie paralysiert, doch er fing sich schnell wieder. »Einen kleinen Bruder. Michael. Und natürlich meine Eltern.« Jason schmunzelte. »Nach dem, was mein Vater kurz vor meinem Aufbruch erzählt hat, arbeiten sie auch schon an dem nächsten Geschwisterchen für mich. Wenn es nach meinem Vater geht, soll es wieder ein Sohn werden.« Jason verdrehte die Augen. »Er hat auch schon einen Namen: Colin.« Jason schnaubte abfällig. »Mir das zu sagen, war wohl seine Art, mich am Fortgehen hindern zu wollen.«
»Was sagten sie zu deinem Aufbruch?«
»Sie waren nicht begeistert. Vor allem mein Bruder. Er studiert gerade. Will auch irgendwann zum Militär. Ihn zieht es allerdings zur Flotte.«
»Ah, unser Taxidienst«, frotzelte Steven. »Und deine Eltern?«
Jason öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch in diesem Moment erschien wieder Crook auf der Bildfläche. Zielstrebig kam er auf Jason und Steven zu.
»Lieutenant Grey?«
»Sarge?«
»Haben Sie sich schon beim Colonel vorgestellt?«
Jason verfluchte sich im Stillen selbst. Es hatten so viele neue Eindrücke auf ihn gewirkt, dass er das total vergessen hatte. Er sprang von seiner Liege auf und glättete seine Uniform.
»Habe ich verschwitzt, Sarge.«
»Das sollte eigentlich das Erste sein, was ein neuer Offizier bei Antritt seines neuen Postens tut.«
»Ich weiß. Ich hole das sofort nach.«
»Sie haben Glück. Unser Colonel ist ein recht umgänglicher Mann. Er wird Ihnen dafür nicht gleich den Kopf abreißen.« Crook wandte sich halb um. Sein Blick fixierte mehrere andere Offiziere. Seine Stimme wurde zusehends lauter. »Vor allem, da Sie beileibe nicht der Einzige sind, der vergessen hat, vorstellig zu werden.«
Die Gesichter der Angesprochenen liefen von einer Sekunde zu nächsten rot an. Die Männer sprangen von ihren Pritschen auf oder unterbrachen schlagartig die Gespräche, die sie gerade geführt hatten.
Jason wandte sich ein letztes Mal Steven zu. »Wir sehen uns später. Ich muss los.«
»Ja, den Alten solltest du wirklich nicht warten lassen«, frotzelte dieser, hielt Jason aber noch für eine Sekunde zurück. »Und Jason? Willkommen beim 51.«
3
New Born war eine der ältesten Kolonien an den Grenzen des terranischen Raumes. Sie war vor gut dreißig Jahren besiedelt worden, nur wenige Jahre nach dem Beginn der ersten Expansionswelle.
Dabei war die Besiedlung des einzig bewohnbaren Planeten des Systems eigentlich ein reiner Zufall. Das erste Kolonistenschiff, das es hierher verschlug, erreichte durch einen Fehlsprung das System. Eigentliches Ziel war Calliope, ein System rund vierzig Lichtjahre südlich von New Born.
Ironischerweise stellte New Born verglichen mit Calliope ein Paradies dar. Das Klima war auf nahezu dem ganzen Planeten gemäßigt, es gab viel essbare einheimische Flora und Fauna sowie keine Fressfeinde, die die Menschen als Nahrungsquelle für sich auserkoren. Alles Dinge, die auf Calliope nicht zutrafen. Die Kolonie dort kämpfte immer noch ums Überleben.
Der ganze Planet dort glich besorgniserregend der Wüste Sahara. Demzufolge gab es weder Wasser in übermäßiger Menge noch Flora und Fauna in adäquatem Umfang. Was es aber gab, waren Sandflöhe – ein Insekt von der Größe eines Ponys, das unter dem Sand lebte –, die aufgrund des Mangels an Nahrungsquellen schnell Geschmack an Menschenfleisch fanden.
In den letzten zwanzig Jahren waren schon mehrfach Stimmen laut geworden, die die Aufgabe der Kolonie forderten, doch der Menschenschlag, den es nach Calliope gezogen hatte, war überaus stur und so blieben die Menschen und machten das Beste daraus – während die Kolonie auf New Born ohne große Anstrengungen wuchs und gedieh. Sie zählte inzwischen schon gut hunderttausend Menschen und ein Ende der Bevölkerungsexplosion war noch nicht abzusehen. Offensichtlich begünstigte die Umgebung die Lust der Menschen am Akt der Fortpflanzung.
Dieser Gedanke ließ Konteradmiral Benedict van Horten amüsiert aufschnauben, während er aus dem Fenster sah. New Born war nicht nur aus siedlungstechnischen Aspekten ein Glücksfall, sondern auch aus strategischen Erwägungen. Das System war derart günstig gelegen, dass sich die Einrichtung einer militärischen Kommandozentrale regelrecht aufdrängte. Jede Kolonie des Sektors ließ sich von New Born aus in kürzester Zeit erreichen.
Das Gebäude des Hauptquartiers der 3. Flotte lag auf einem Hügel, sodass sich die planetare Hauptstadt Hamshire unter ihm ausbreitete. Vor zwanzig Jahren war all das hier nur eine Reihe von einfachen Fertighäusern gewesen, die die Kolonisten errichteten, indem sie ihre Schiffe demontierten. Inzwischen handelte es sich bei Hamshire um eine blühende Metropole.
Sein Blick wanderte zum Himmel. Der Himmel war wolkenlos und so klar, dass man sogar die Sterne jenseits der Atmosphäre erkennen konnte. Dort zeichnete sich ein Stahlgerippe vor dem mit weißen Flecken gesprenkelten Sternenhintergrund ab. Es würde noch Jahre dauern, bis die Raumstation fertig war und das Oberkommando dorthin umziehen konnte, aber irgendwann würde es so weit sein und dann war New Born wahrlich nicht nur ein Ort, an dem man gut leben konnte, sondern auch der wirtschaftliche und militärische Mittelpunkt des Sektors.
Eine Staffel Piranha-Jäger zog am Himmel vorüber. Die wendigen zweisitzigen Maschinen waren der Inbegriff metallgewordener Eleganz. Die im New-Born-System befindlichen Einheiten der 3. Flotte umfassten im Moment lediglich dreiundfünfzig Schiffe. Manche mochten die Flotte klein nennen, doch sie war die größte derzeit existente terranische Flotte, und sobald weitere Werften fertiggestellt waren, würde sie schnell anwachsen. Die Raumfahrtakademien konnten sich kaum vor Rekruten retten. Alles, was Beine hatte, wollte zur Raumflotte, um das Universum zu erkunden. Es würde ihn schon sehr wundern, wenn die Flotte nicht in spätestens zehn Jahren aufs Dreifache, vielleicht sogar aufs Vierfache angewachsen war.
Benedicts Brust blähte sich leicht auf. Es erfüllte ihn mit nicht wenig Stolz, dass man ihm das Kommando über all das übertragen hatte. Sicher, der hiesige Gouverneur führte das Zepter, doch als Militärkommandant genoss er Mitspracherecht in allen wichtigen Belangen. Was war die Zivilregierung schon ohne den Schutz des Militärs?
Benedict riss sich von dem Anblick los, der sich ihm bot, und konzentrierte sich erneut auf seinen Gast. Der Mann sah aus wie ein Schulprofessor: sorgfältig gestutzter Bart, Brille auf der Nase. Und er wirkte, als stehe er ständig unter Strom. Er trat unruhig von einem Bein auf das andere. Für gewöhnlich empfand Benedict diesen Charakterzug gelinde gesagt als irritierend. Dieses Mal jedoch konnte er die Aufregung des Mannes in gewissem Umfang nachvollziehen.
»Und Sie sind sicher, dass es nicht schon wieder nur heiße Luft ist, die Sie und Ihr Team von sich geben?« Benedict machte nicht einmal ansatzweise den Versuch, seine Zweifel zu verbergen. Diese Haltung kam durchaus bei seinem Gesprächspartner an, denn dieser rümpfte leicht beleidigt die Nase.
»Ich bin mir sicher, wir haben einen Durchbruch erzielt. Die Ergebnisse lassen keinen anderen Schluss zu.«
»Professor Bernström, Sie müssen sich absolut sicher sein. Ich kann meinen Vorgesetzten nicht schon wieder einen Erfolg melden und zwei Tage später einen Rückzieher machen, sobald die Tests ein weiteres Mal versagen. Wenn ich das noch einmal mache, werden unser beider Karrieren irreparabel Schaden nehmen und zumindest bei meiner würde ich das gern vermeiden.«
»Ob Sie es glauben oder nicht, aber ich bei meiner auch.« Manchmal war sich Benedict nicht sicher, ob Bernström ihn auf den Arm nahm. Der Humor des Mannes war recht trocken und nicht immer als solcher verständlich.
»Ihr Wort in Gottes Ohr, aber dieses Mal möchte ich mir gern die Tests persönlich ansehen, bevor ich eine Vollzugsmeldung zur Erde schicke und die dortigen Admiräle mit den Sektkorken knallen.«
»Glauben Sie mir. Dieses Mal haben wir es.«
»Glauben ist gut. Kontrolle ist besser. Also? Wann kann ich es mir ansehen?«
»Sofort, wenn Sie wollen.«
Benedict hob eine Augenbraue und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »So schnell?!«
Bernström nickte enthusiastisch. »Wir können jederzeit loslegen.«
»Also gut.« Benedict stand auf und zeigte auf die Tür. »Gehen Sie voran.«
Das Duo verließ ohne weitere Worte das Büro des Admirals und eilte zielstrebig und schweigend durch die Korridore und Gänge des Hauptquartiers in den Westflügel. Dort befand sich die Abteilung Forschung und Entwicklung. Hier wurde ohne Unterlass an allerlei technischen Spielereien gefeilt, die das Leben von Soldaten und Offizieren der Flotte und der TKA sowie der Marines schützen sollte. Wenn auch nur die Hälfte von dem zutraf, was der Professor behauptete, dann hatten seine Techniker auf diesem Weg gerade nicht nur einen großen Schritt, sondern gleich einen ausgewachsenen Hüpfer nach vorn gemacht.
Sie erreichten eines der Labore. Es glich den übrigen wie ein Ei dem anderen. Nichts deutete darauf hin, dass hier vermutlich die größte Entdeckung in der bemannten Raumfahrt seit der Entwicklung des IFF-Antriebs gemacht worden war.
Vier von Bernströms Assistenten warteten bereits. Sie wirkten nicht minder aufgeregt als ihr Vorgesetzter. Es war schwer, sich von ihrer Zuversicht nicht anstecken zu lassen, doch Benedict rief sich selbst zur Ordnung. Er wollte nicht schon wieder enttäuscht werden wie so oft in den vergangenen Monaten.
Bernström wollte etwas sagen, doch Benedict kam ihm zuvor und bedeutete dem Professor wortlos fortzufahren. Die technischen Einzelheiten interessierten ihn nicht – und ganz offen gesagt, hätte er sie wohl auch nicht verstanden. Ihn kümmerte einzig und allein, ob es funktionierte oder nicht.
Der Professor nickte auf Benedicts unausgesprochene Aufforderung hin und drehte sich zu einem Pult um. Hinter ihm in einem abgeschotteten Raum, dessen Innenleben lediglich durch eine Panzerglasscheibe ersichtlich war, stand ein Gerät, wie Benedict es noch nie zuvor gesehen hatte.
Es handelte sich um einen Metallzylinder, in dessen Mitte eine Aussparung aus einem Spezialmaterial in Form einer durchsichtigen Kugel eingelassen war. Das Spezialmaterial ähnelte Plastik, war aber wesentlich robuster. Hitze war kaum in der Lage, es zu beschädigen. Lediglich bei Temperaturen ab vierhundert Grad konnte es brechen und bei solchen Einflüssen hätte fast jedes Material nachgegeben.
Am meisten interessierte Benedict jedoch die Flüssigkeit im Inneren der durchsichtigen Aussparung. Sie war von dunkelblauer Farbe und waberte ständig umher wie in einer Vulkanlampe. Außerdem befanden sich zu beiden Seiten des Zylinders zwei Flügel aus Titan.
Bernström betätigte mehrere Schalter. Nahezu augenblicklich fingen die zwei Flügel an, sich um den Zylinder zu drehen. Langsam zuerst, doch ihre Geschwindigkeit nahm beständig zu. Am Ende drehten sie sich so schnell, dass sie vor den Augen verschwammen und den Eindruck vermittelten, es wären wesentlich mehr als nur zwei Flügel. Benedict ertappte sich sogar bei dem Gedanken, es würde aussehen, als würde sich eine Blase um den Zylinder bilden, wo zuvor nur die zwei Flügel aus Titan gewesen waren. Das war natürlich Unsinn und widersprach den Gesetzen der Physik.
Plötzlich fing der Bereich um den Zylinder und den beiden sich drehenden Flügeln an zu schimmern. Es war zunächst kaum wahrnehmbar, doch die Intensität steigerte sich. Der Schimmer wurde schnell so hell, dass Benedict die Augen reflexartig zukniff. Er spürte, wie ihm Tränen in die Augen traten, doch er blinzelte sie ungeduldig weg.
Nur am Rande bekam er mit, wie Bernström einem seiner Untergebenen ein Zeichen gab. Dieser betätigte mehrere Kontrollen und plötzlich schoss ein Energiestrahl quer durch den Quarantänebereich des Labors und bohrte sich in den Zylinder.
Benedict kniff die Augen noch etwas weiter zusammen, um besser sehen zu können. Nein, der Energiestrahl bohrte sich nicht in den Zylinder. Vielmehr wurde er kurz davor von dem Schimmer aufgehalten. Der Energiestrahl zerfaserte, umwaberte den Schimmer, war jedoch nicht fähig, weiter vorzustoßen.
Der Versuch endete so schnell, wie er begonnen hatte. Sowohl Energiestrahl als auch Zylinder wurden abgeschaltet. Der Schimmer verschwand und die beiden Flügel kamen langsam zur Ruhe.
Benedict blinzelte die letzten Tränen weg. Bernström drehte sich um. Erst jetzt bemerkte Benedict, dass sowohl der Professor als auch dessen Assistenten Schutzbrillen trugen, wie sie gerne für Laborexperimente benutzt wurden.
Bernström nahm seine ab und musterte Benedict aus großen Augen. »Oh, ich hätte Ihnen wohl auch eine geben sollen. Tut mir leid.«
In Benedicts Ohren klang die Entschuldigung gerade so ernsthaft, dass er daran zweifelte, ob sie wirklich auch ernst gemeint war. Manchmal war er sich wirklich nicht sicher, ob der Professor ihn nicht auf den Arm nahm, an manchen Tagen mehr als an anderen.
Nerdhumor! Er schluckte seinen Ärger hinunter. Da er sich keine Blöße vor den Wissenschaftlern geben wollte, entschied er sich, zum eigentlichen Thema seines Besuchs zurückzukehren.
»Und? Wie ist das Ergebnis?«
Bernström grinste über das ganze Gesicht. »Ein grandioser Erfolg. Es hat gehalten. Energieverlust fast achtzig Prozent, aber es hat gehalten. Der Schutzschirm funktioniert.«
Benedict trat näher und begutachtete fasziniert den Zylinder in dem Quarantänebereich. »Dann besitzen wir jetzt tatsächlich den funktionstüchtigen Prototypen eines Schutzschildgenerators?«
»In der Tat«, erwiderte der Professor stolz.
»Was glauben Sie? Wie lange würde es dauern, ein Schiff mit diesem Ding auszustatten?«
»Ein Schiff? Sie meinen jetzt sofort? Holla, immer langsam mit den jungen Pferden.« Bernström hob abwehrend die Hände. »Wir haben gerade mal die erste Testreihe halbwegs erfolgreich hinter uns gebracht. Von der praktischen Verwendung sind wir noch weit – noch sehr weit – entfernt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Glauben Sie mir, Admiral, der Tag wird kommen, an dem jedes einzelne Schiff der Raumflotte von einem Schutzschildgenerator geschützt wird. Nicht einmal die Til-Nara besitzen so etwas und sie gehören zu den ältesten und fortschrittlichsten raumfahrenden Rassen.«
Benedict nickte leicht enttäuscht. »Schade. Mein neues Flaggschiff ist gestern angekommen. Das erste Schlachtschiff der Hades-Klasse, das vom Stapel gelaufen ist. Ich hätte mir gewünscht, das Schiff am besten gleich damit auszustatten. Dann wäre es wirklich perfekt gewesen. Aber da muss ich mich wohl noch etwas gedulden.«