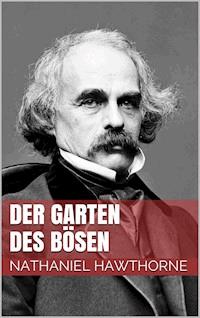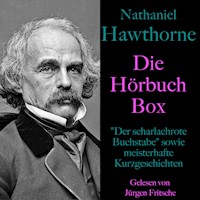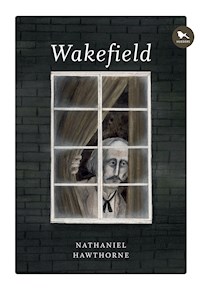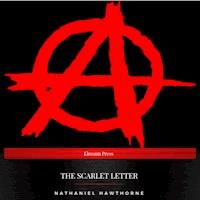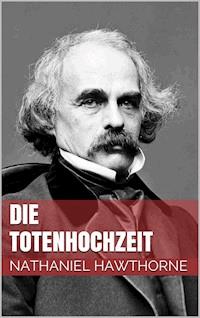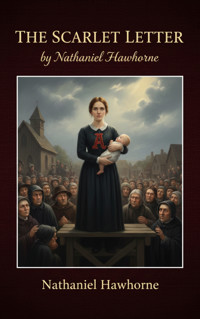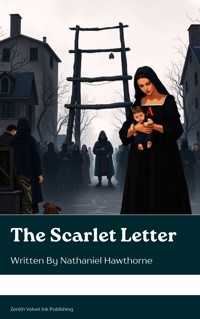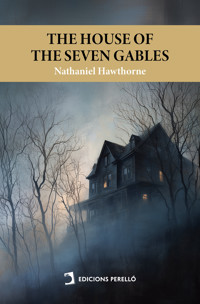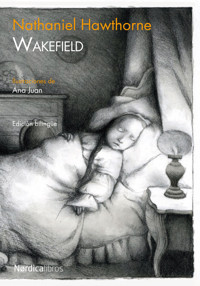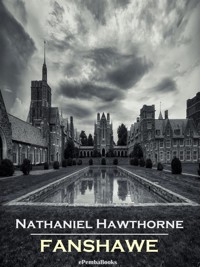Der scharlachrote Buchstabe
Nathaniel Hawthorne
Inhaltsverzeichnis
1. DIE GEFÄNGNISTÜR
2. AUF DEM MARKTPLATZE
3. DAS ERKENNEN
4. DIE UNTERREDUNG
5. DIE FREIHEIT
6. DAS KIND
7. IM HAUSE DES GOUVERNEURS
8. DER PREDIGER UND DAS KIND
9. DER ARZT
10. DER ARZT UND SEIN PATIENT
11. QUAL EINES HERZENS
12. NÄCHTLICHE ERSCHEINUNG
13. HESTERS VERWANDLUNG
14. HESTER UND DER ARZT
15. HESTER UND PERLE
16. GANG DURCH DEN WALD
17. DER PRIESTER UND DIE FRAU
18. SONNENSCHEIN
19. DAS KIND AM BACHE
20. AUFRUHR DES GEWISSENS
21. FESTTAG IN NEUENGLAND
22. DER FESTZUG
23. DAS GEHEIMNIS DES SCHARLACHROTEN BUCHSTABENS
24. AUSKLANG
1
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
Impressum
Public Domain
(c) mehrbuch
1. DIE GEFÄNGNISTÜR
Vor einem hölzernen Gebäude, dessen Tür mit schweren Eichenbalken versehen und mit Eisenspitzen beschlagen war, drängte sich eine Menge Volkes. Bärtige Männer in dunkler Kleidung und mit grauen, spitzen Hüten, aber auch Frauen, barhäuptig oder mit schlichten Hauben, standen in dichten Gruppen beisammen. Aus ihren Zügen sprach gespannte Erwartung.
In jeder neuen Kolonie, mochte sie ursprünglich auch nichts als die Verwirklichung menschlicher Tugend und menschlichen Glücks zum Ziele gehabt haben, waren die Begründer nur allzu bald genötigt, einen Teil des unberührten Bodens zum Friedhof, einen anderen zum Platz für ein Gefängnis zu bestimmen. Auch die Vorväter von Boston haben – so dürfen wir wohl annehmen – diesen Erfordernissen menschlicher Schwäche und Hinfälligkeit Rechnung getragen und sehr bald ihr erstes Gefängnis sowie ihren ersten Friedhof errichtet, denn bereits etliche fünfzehn oder zwanzig Jahre nach der Begründung der Stadt war das hölzerne Gefängnis von solchen Spuren der Verwitterung und des Alters gezeichnet, daß sie dem finsteren, düsteren Bau ein noch dunkleres Aussehen verliehen. Der Rost auf dem schweren Eisenwerk der Eichentür schien älter zu sein als alles andere in der neuen Welt, ja der ganze Bau schien – wie alles, was zum Verbrechen gehört – wohl überhaupt nie jung gewesen zu sein.
Vor diesem häßlichen Gebäude erstreckte sich bis zur Fahrbahn der Straße ein Rasenplatz. Er war überwuchert von Kletten, Gänsefuß und anderen unscheinbaren Pflanzen, denen dieser Boden wohl besonders zusagte, der so früh schon das dunkle Gewächs menschlicher Zivilisation, das Gefängnis, getragen hatte. An einer Seite der Tür jedoch, unmittelbar an ihrer Schwelle wurzelnd, stand ein wilder Rosenstrauch, der jetzt im Juni über und über mit köstlichen Blüten bedeckt war. Fast schien es, als wolle er ihren Duft und ihre zarte Schönheit dem Gefangenen, der hier eintrat, oder dem Verurteilten, der aus dieser Tür heraus seiner Strafe entgegenging, als Zeichen darbringen, daß die Natur wenigstens ihm Freundlichkeit und Erbarmen entgegenbringe.
Durch einen seltsamen Zufall blieb die Erinnerung an diesen Rosenstrauch in der Überlieferung lebendig. Vielleicht, weil er der letzte Überrest der alten Wildnis war, nachdem die riesigen Fichten und Eichen, die ihn einst überschatteten, längst gefallen waren; vielleicht auch, wie manche glaubhaft machen wollen, weil er unter den Fußtritten der frommen Anna Hutchinson hervorsproßte, als sie durch diese Tür das Gefängnis betrat.
2. AUF DEM MARKTPLATZE
An einem Sommermorgen vor mehr als 200 Jahren war also der Rasenplatz vor dem Gefängnis in Boston von einer großen, neugierigen Menschenmenge belebt. Die bärtigen Gesichter der guten Leute trugen dabei einen solchen Ausdruck grimmiger Strenge, daß man zu jeder anderen Zeitepoche oder bei jeder anderen Bevölkerung hätte annehmen müssen, es handle sich bei dem mit so großer Spannung erwarteten Ereignis zumindest um die Hinrichtung eines Verbrechers oder um die öffentliche Sühne eines anderen schändlichen Vergehens. In jener Frühzeit des Puritanismus jedoch war eine solche Vermutung keineswegs immer zutreffend. Vielleicht sollte nur ein fauler Diener oder ein ungehorsames Kind, das seine Eltern der Obrigkeit überliefert hatten, am Schandpfahl gezüchtigt werden – vielleicht auch galt es, einen Quäker, Antimonianer oder anderen sektiererischen Irrgläubigen aus der Stadt zu peitschen, oder einen faulen, umherstreifenden Indianer, der unter dem Einflusse des Feuerwassers des weißen Mannes auf den Straßen herumgelärmt hatte, in seine Wälder zurückzutreiben. Es konnte auch sein, daß eine Hexe, wie die alte Hibbins, die zänkische Witwe des Stadtrichters, auf dem Galgen sterben sollte – in jedem Falle lag dieselbe unbarmherzige Strenge auf den Gesichtern der Zuschauer, wie es sich einem Volke geziemte, bei dem Religion und Gesetz fast identisch waren und dessen Bewußtsein von beiden so durchdrungen war, daß es dem mildesten wie schwersten Akt öffentlicher Bestrafung in gleicher Weise mit scheuer Ehrfurcht und Entsetzen beiwohnte. Dürftig fürwahr und kalt war die Teilnahme, die aus solchem Zuschauerkreise dem Übeltäter entgegengebracht wurde, doch konnten anderseits damals auch Strafen, die in unseren Tagen eine Flut von Spott und Lächerlichkeit zur Folge haben würden, mit ebenso strenger Würde über einen Sünder verhängt werden wie die Todesstrafe selbst.
Es war bemerkenswert, daß an jenem Sommermorgen, an dem unsere Erzählung beginnt, die Frauen, die sich in der Zuschauermenge befanden, mit ganz besonderem Interesse dem bevorstehenden Strafgericht entgegen zu fiebern schienen. Die Zeit war noch nicht so verfeinert, daß ein Gefühl von Unschicklichkeit etwa die Trägerinnen von Unterrock und Mieder zurückgehalten hätte, sich unter die gaffende Menge zu mischen und ihre gewichtige Persönlichkeit selbst bis an die Stufen des Blutgerüstes vorzudrängen. Geistig sowohl wie auch körperlich waren jene Frauen und Mädchen von altenglischer Geburt und Erziehung aus gröberem Stoff als ihre schönen Nachkommen von heute. Denn durch die ganze Kette der Geschlechter hindurch hatte jede Mutter ihrem Kinde stets eine zartere Schönheit, ein vergänglicheres Blühen, geringere Körperkräfte – und wohl auch einen weniger kraftvollen und gediegenen Charakter vererbt, als sie selbst besaß. Die Frauen, die hier das Gefängnistor umstanden, waren kaum ein halbes Jahrhundert von jener Periode der Geschichte entfernt, in welcher Königin Elisabeth ihr Geschlecht so kraftvoll vor der ganzen Welt repräsentiert hatte. Die roten, vollen Wangen, die breiten Schultern und üppigen Gestalten, die nun die Morgensonne beschien, stammten noch aus der fernen Heimatinsel her und waren in der Luft Neuenglands kaum bleicher und magerer geworden. Auch die Redeweise dieser Matronen – denn die meisten von ihnen schienen solche zu sein – war von einer Kühnheit und Derbheit sowohl im Inhalt wie im Tone, daß sie uns heute wohl in gewaltiges Erstaunen setzen würde.
„Hört einmal“, sagte eine etwa fünfzigjährige Frau, „ich will euch etwas sagen. Es wäre wahrhaftig zu wünschen, daß wir Frauen von reifem Alter und gutem Ansehen die Bestrafung solcher Übeltäterinnen wie diese Hester Prynne in die Hände bekämen. Wenn wir fünf, die wir hier gerade beisammen stehen, über dieses nichtsnutzige Weibsbild zu richten gehabt hätten, wäre sie wohl mit so einem Urteil davongekommen, wie es die Richter gefällt haben? Verlaßt euch darauf –!“
„Die Leute sagen“, hob eine andere an, „der ehrwürdige Pastor Dimmesdale nimmt es sich gar sehr zu Herzen, daß gerade in seiner Gemeinde ein solches Ärgernis vorfallen mußte.“
„Die Richter sind ja gottesfürchtige Herren, aber viel zu gnädig!“ meinte ein drittes dieser Frauenzimmer. „Sie sollten dieser Hester Prynne mindestens mit glühendem Eisen ein Brandmal auf die Stirne gedrückt haben, da wäre sie wohl zurückgeschreckt, haha –! Aber was schert sich so ein Weibsbild, was man ihr ans Mieder heftet? Mit einer Brosche kann sie es ja verdecken oder einem ähnlichen heidnischen Aufputz und ebenso frech einherstolzieren wie ehedem!“
„Mag sie auch das Zeichen verbergen, wie sie will, seine stechende Pein wird sie doch immer in ihrem Herzen fühlen“, wandte in sanfterem Tone eine junge Frau ein, die ein Kind an der Hand hielt.
„Was wird da viel von Zeichen und Brandmalen geschwätzt, ob auf ihrem Mieder oder ihrer Stirne?“ schrie ein anderes Weib, das häßlichste und erbarmungsloseste zugleich. „Sie hat Schmach und Schande über uns alle gebracht und dafür gebührt ihr der Tod! Steht es nicht so in der Bibel wie in unserem Gesetz? Mögen die Richter, die es nicht anzuwenden wagten, es sich selbst zuschreiben, wenn ihre eigenen Weiber und Töchter auf Abwege geraten!“
„Gnade uns Gott!“ rief ein Mann aus der Menge, der diese Worte mitangehört hatte. „Kommt denn alle Weibertugend nur aus der Furcht vor dem Galgen? Ihr sprecht wahrhaftig ein hartes Wort! Doch still! – Eben dreht sich der Schlüssel in der Gefängnistür und hier kommt sie nun selbst, Hester Prynne!“
Die Tür des Kerkers wurde von innen aufgestoßen und wie ein schwarzer Schatten, der plötzlich ans Tageslicht taucht, erschien die grimmige, düstere Gestalt des Stadtbüttels, ein Schwert an der Seite und seinen Stab in der Hand. Dieser Mann verkörperte schon in seinem Aussehen fürwahr die ganze grausame Strenge des puritanischen Gesetzes, dessen Ausübung und Durchführung ihm oblag. Während er seinen Stab mit der Linken vorstreckte, legte er seine Rechte schwer auf die Schulter einer jungen Frau und schob sie vorwärts, bis sie ihn an der Schwelle der Tür durch eine Geste so voll natürlicher Hoheit und Würde zurückwies, daß er sie unwillkürlich freigab und sie aus eigenem Willen heraus ins Freie trat. Auf ihren Armen trug sie ein Kind, ein Mädchen von kaum drei Monaten, das blinzelnd sein Köpfchen von dem allzu grellen Licht des Tages abwandte, hatte es doch bisher in seinem Dasein nur das graue Dämmern irgend einer düsteren Zelle des Gefängnisses gekannt.
Als die junge Frau – die Mutter dieses Kindes – nun so der versammelten Menge gegenüberstand, drückte sie unwillkürlich ihr Kind ganz fest an die Brust, doch nicht so sehr aus einem Gefühl mütterlicher Zärtlichkeit heraus, sondern um dadurch ein gewisses Zeichen zu verbergen, das an ihrem Kleide angebracht war. Einen Augenblick später jedoch zog eine brennende Röte über ihr Antlitz.
War es nicht vergeblich, das eine Zeichen ihrer Schande mit dem anderen verbergen zu wollen? Ein wehes, doch stolzes Lächeln huschte über ihre Züge, sie nahm das Kind auf den Arm zurück und sah sich mit entschlossenem Blicke, frei von jeder peinvollen Verlegenheit, in dem Kreise ihrer Nachbarn und Mitbürger um, die sie gaffend umstanden.
Mitten auf ihrer Brust, aus feinem, scharlachrotem Tuche geschnitten und mit kunstvoller Stickerei aus Goldfäden umschlungen, sah man den Buchstaben A[1]. Er war mit solcher Kunstfertigkeit ausgeführt und so prächtig verziert, daß er ein Schmuck und Aufputz ihres Gewandes zu sein schien, das gleichfalls, trotz des düsteren Geschmackes der Zeit, überaus kostbar war und inmitten der allgemein üblichen strengen Schlichtheit prächtig auffiel.
Die Gestalt der jungen Frau war groß und schlank und von ausgeprägter Vornehmheit. In ihrem dunklen, üppigen Haar spiegelte sich das Licht der Sonne, ihr Antlitz, das die Schönheit ebenmäßiger Züge trug, wurde von einer klaren Stirne und tiefen, ausdrucksvollen Augen beherrscht. In ihrer Haltung zeigte sie jene Stattlichkeit und Würde, die in damaliger Zeit die Frau der höheren Stände kennzeichnete. Und niemals war Hester Prynne vornehmer erschienen – im alten und eigentlichen Sinne dieses Wortes – als nun, da sie aus dem Gefängnis heraustrat! Diejenigen, die sie schon früher gekannt und nun erwartet hatten, sie niedergedrückt und elend vor sich zu sehen, bemerkten mit Erstaunen und Verwunderung, wie ihre Schönheit strahlender denn je aufleuchtete und das Unglück und die Schmach, von der sie umhüllt war, fast in einen Schein der Verklärung verwandelte. Dennoch mochte es sein, daß ihr Anblick für einen empfindsamen Beobachter etwas unsagbar Schmerzliches an sich hatte. Ihre Kleidung, die sie sich für diese Gelegenheit im Gefängnis selbst angefertigt und nach eigenem Geschmack zusammengestellt hatte, war in ihrer wilden, malerischen Eigentümlichkeit nur ein Ausdruck der verzweifelten Unbekümmertheit, die ihre Seele erfüllte. Doch der Gegenstand, der nun aller Augen auf sich zog und Hester Prynne förmlich verwandelte, so daß die Männer und Frauen, mit denen sie sonst in vertrauten Verhältnissen gelebt hatte, sie anstarrten, als sähen sie sie zum ersten Male – war der scharlachrote Buchstabe, dessen prächtige Stickerei ihre Brust zierte. Er hob sie wie durch einen Zauber aus allen gewohnten, menschlichen Verhältnissen heraus und schloß sie in eine Welt ein, in der sie völlig allein stand.
„Sie versteht es, mit der Nadel umzugehen, das läßt sich nicht leugnen“, bemerkte eine der Zuschauerinnen bissig. „Aber wagte es je eine Frau, dies auf solche Art zu zeigen wie das schamlose Weibsbild? Was? – Lacht sie damit nicht unseren würdigen Richtern ins Gesicht und brüstet sich mit dem, was ihr als Strafe auferlegt worden ist?“
„Man sollte ihr das prächtige Kleid vom Leibe reißen“, murmelte ein anderes der alten Weiber mit giftiger Stimme. „Und was den roten Buchstaben betrifft, so will ich ihr einen Lumpen von altem Flanell besorgen, der besser paßt als dieses verzierte Ding!“
„Oh, still, Nachbarin, seid still!“ flüsterte daneben eine junge Frau. „Laßt sie das nicht hören! Kein Nadelstich an diesem gestickten Buchstaben, der ihr nicht mitten durchs Herz gegangen wäre!“
Nun hob der grimme Büttel seinen Stab.
„Macht Platz, ihr Leute, im Namen des Königs!“ schrie er. „Öffnet eine Gasse und ich verspreche euch, daß Frau Prynne dorthin geführt werden soll, wo ihr alle, Männer, Frauen und Kinder, ihren feinen Aufputz nach Herzenslust bewundern könnt, von jetzt ab bis eine Stunde nach Mittag! Denn jedes Unrecht kommt in unserem rechtschaffenen Lande ans Licht! Nur vorwärts, Frau Hester, und zeigt Euer scharlachrotes Zeichen all diesen Leuten auf dem Marktplatz!“
Durch die Menge der Zuschauer öffnete sich eine Gasse. Unter dem Vortritt des Büttels und begleitet von der nachdrängenden Menge finster blickender Männer und feindseliger Weiber schritt Hester Prynne hindurch zu dem Orte, der für ihre Strafe bestimmt war. Eine Schar neugieriger Schulbuben, die nicht viel mehr verstanden, worum es sich handelte, als daß sie dadurch einen halben Feiertag hatten, lief vor dem Zuge her und wandte beständig die Köpfe, um bald Hesters Gesicht, bald das blinzelnde Kindchen in ihren Armen oder den scharlachroten Buchstaben an ihrer Brust anzustarren.
Es war zu jener Zeit nicht weit vom Gefängnis bis zum Marktplatz, für die Gefangene jedoch schien sich der Weg endlos hinzuziehen. Trotz des verschlossenen, stolzen Gesichtsausdruckes litt sie unter jedem Schritt der sie umdrängenden Menge unsägliche Qualen, als würde ihr Herz selbst durch die Straßen gezerrt und von tausend Füßen getreten. Unsere menschliche Natur jedoch schützt den Leidenden auf eine wunderbare und barmherzige Weise, denn er wird sich der Größe seiner Qual meist nicht durch die augenblicklichen Schmerzen bewußt, sondern erst später durch die Spuren, welche davon zurückbleiben. Mit fast übermenschlicher Gelassenheit schritt daher auch Hester Prynne durch diesen Teil ihrer Prüfung und erreichte endlich den Marktplatz, auf dessen westlichem Teil im Schutze der ältesten Kirche Bostons sich breit und fest eine Art Schaugerüst erhob, als wäre es dort für alle Ewigkeit errichtet.
Dieses Gerüst gehörte zu jener Strafvorrichtung, die wir heute nur noch aus der Geschichte und Überlieferung kennen, die jedoch in früherer Zeit als ebenso wirksames Mittel zur Förderung bürgerlicher Tugenden galt wie die Guillotine während der Französischen Revolution. Es war der Pranger mit seiner erhöhten Plattform und dem aufragenden Gerüst, welches den menschlichen Kopf genau umfaßte und festhielt, um ihn so dem Blick der Menge preiszugeben.
Diese ganze Vorrichtung aus Holz und Eisen war in der Tat eine Verkörperung des größten Schimpfes, den man der menschlichen Natur anzutun vermag. Denn welches Vergehen auch immer gesühnt werden sollte, der Verurteilte konnte nicht grausamer getroffen werden, als indem man ihm verwehrte, sein Gesicht vor Scham zu verbergen. Darin lag das Wesentliche dieser Strafe. In Hester Prynnes Fall jedoch forderte das Urteil bloß, daß sie drei Stunden lang auf der Plattform jener Schandbühne zu stehen habe, ohne daß dabei Hals und Kopf von der teuflischen Vorrichtung eingezwängt und festgehalten werden sollten. Da sie genau wußte, was sie zu tun hatte, stieg sie die hölzernen Stufen empor und stand nun etwa in Schulterhöhe über der Straße vor allem Volke da.
Wäre unter der Menge der Zuschauer ein Katholik gewesen, so hätte ihn diese schöne Frauengestalt in ihrer seltsam-malerischen Bekleidung und mit dem Kinde an ihrer Brust vielleicht an ein Bildnis der Gottesmutter erinnert, deren Darstellung schon so viele berühmte Meister ihre Kunst geweiht haben. Doch während dort die Idee der Mutterschaft so herrliche Verklärung findet, lag hier das Dunkel frevelhafter Sünde über diesem heiligsten Bezirke menschlichen Erlebens und die Schönheit dieser Frau sowie das Kind in ihren Armen verstärkten nur den düsteren Schatten, der erbarmungslos über ihr schwebte.
Die Situation war, wie jede Schaustellung menschlicher Schuld und Schande, von einem düsteren Ernste getragen, der sich auch auf den Gesichtern der Zuschauer deutlich widerspiegelte. Denn die Zeugen von Hester Prynnes Schmach hatten das ursprüngliche Empfinden und natürliche Zurückschaudern vor Unrecht und Schuld noch nicht verloren. Sie würden mit demselben Ernst in den Gesichtern auch den Tod der Verurteilten hingenommen haben, hätte das Urteil so gelautet, doch waren sie anderseits noch nicht von jener Herzlosigkeit einer späteren Zeit, welcher eine solche Schaustellung sicherlich nur zum Spotte gedient hätte. Auch wenn wirklich eine Neigung bestanden hätte, die Situation ins Lächerliche zu kehren, so wäre diese sofort unterdrückt worden durch die ernste Gegenwart keiner geringeren Persönlichkeiten als der des Gouverneurs und der gesamten Geistlichkeit der Stadt. Diese alle saßen oder standen auf einem balkonähnlichen Vorbau der Kirche, der sich unmittelbar über dem Pranger befand. Wenn solche Persönlichkeiten dem Schauspiele beiwohnten, ohne der Würde ihres Ranges oder Amtes etwas zu vergeben, so durfte man annehmen, daß die Vollstreckung dieses Urteils eine ernste und nachdrückliche Bedeutung habe. Und so herrschte denn in der Menge eine strenge, düstere Stimmung und tausende unbarmherziger Blicke richteten sich auf die unglückliche Sünderin und das Zeichen der Schande an ihrer Brust.
Sie hielt sich aufrecht, so gut es eine Frau in dieser Lage vermochte, doch die Last wurde ihr schier unerträglich. Von Natur aus empfindsam und leidenschaftlich, hatte sie sich innerlich gewappnet, um den giftigen Stacheln des Spottes und der öffentlichen Beschimpfungen zu begegnen. Doch in dem düsteren Ernst der Menge lag eine so furchtbare Anklage, daß sie sich förmlich danach sehnte, all diese unbeweglichen Gesichter in einem Lächeln der Verachtung aufleuchten zu sehen. Wären sie alle, Männer, Weiber und Kinder, in ein schallendes Hohngelächter ausgebrochen – Hester Prynne hätte ihnen mit einem bitteren, verächtlichen Lächeln antworten können. Doch unter der unerträglichen Last, die sie nun zu ertragen hatte, meinte sie in manchen Augenblicken, mit aller Kraft ihrer Lungen aufschreien und sich von ihrem Gerüst hinabstürzen zu müssen, wollte sie nicht wahnsinnig werden.
Doch es gab auch Augenblicke, in denen das ganze Schauspiel, dessen Mittelpunkt sie war, vor ihren Augen zu verschwinden schien oder wenigstens so verblaßte, daß sie nur noch wesenlose Schatten vor sich sah. Ihr Geist und besonders ihre Erinnerung waren unnatürlich tätig und brachten immer wieder andere Szenen in ihr Bewußtsein als diesen holprigen Marktplatz der kleinen Stadt am Rande der Wildnis, andere Gesichter als diejenigen, die sie unter den Rändern ihrer spitzen Hüte hervor so unverwandt anstarrten. Erinnerungen an ihre Kindheit und Schulzeit, an ihre Spiele, an kindlichen Streit und kleine häusliche Erlebnisse ihrer Mädchenjahre drangen auf sie ein und vermischten sich mit ernsteren Erlebnissen ihres späteren Lebens, ein Bild so lebendig wie das andere, als ob sie alle von gleicher Bedeutung wären oder alle zusammen nur Spiel. Es war eine Instinkthandlung ihres Geistes, sich durch das Versenken in diese Traumgebilde von der grausamen Last und Härte der Wirklichkeit zu befreien.
Sei dem wie immer, die Plattform des Prangers war für Hester Prynne wie ein Aussichtsturm, von dem aus sie den ganzen Weg überblicken konnte, den sie seit ihrer glücklichen Kindheit zurückgelegt hatte. Sie blickte zurück in ihren Geburtsort drüben im alten England und auf ihr Vaterhaus, ein von Armut gezeichnetes, verfallenes Gebäude aus grauem Stein, doch mit einem halb verwitterten Wappenschild über der Eingangspforte, das von altem Adel zeugte. Sie sah das Gesicht ihres Vaters mit seiner kahlen Stirne und dem ehrwürdigen, weißen Bart, der über die altmodische elisabethanische Halskrause herabwallte, sie sah auch das Antlitz der Mutter mit dem Ausdruck sorgsamer, ängstlicher Liebe, den es immer in ihrer Erinnerung trug und der sich schon oftmals, auch nach der Mutter Tod, der Tochter als sanfte Mahnung in den Weg gestellt hatte. Sie erblickte ihr eigenes Gesicht, wie es in mädchenhafter Schönheit aus dem trüben Spiegelglase leuchtete, in dem sie sich damals zu betrachten pflegte, und dann gewahrte sie ein anderes Antlitz, die Züge eines Mannes von vorgeschrittenem Alter, blaß, schmal und durchgeistigt, mit schwachen Augen, die bei trübem Lampenlicht allzulang über mächtigen Büchern gesessen waren. Doch diese schwachen Augen hatten eine seltsam durchdringende Kraft, wenn es die Absicht ihres Besitzers war, in der menschlichen Seele zu lesen. Die Gestalt dieses klösterlichen Gelehrten war etwas entstellt – wie Hester Prynnes weibliches Erinnerungsvermögen nicht vergaß –, er trug die linke Schulter etwas höher als die rechte.
Und wieder andere Bilder stiegen vor ihr auf: die winkeligen, engen Straßen, die hohen, grauen Häuser, riesigen Kathedralen und öffentlichen Gebäude einer Stadt des Festlandes, wo ein neues Leben auf sie gewartet hatte an der Seite des mißgestalteten Gelehrten. Ein neues Leben – doch auf absterbendem Boden, wie grünes Moos, das auf abbröckelndem Mauerwerk wächst. Endlich, nach all diesen wechselnden Bildern, kam wieder der schmucklose Marktplatz der puritanischen Ansiedlung zurück, die versammelte Menge, die ihre finsteren Blicke auf Hester Prynne richtete – ja, auf sie, die hier zur öffentlichen Schande am Pranger stand, mit einem Kind auf dem Arm und dem scharlachroten, golddurchwirkten Buchstaben an ihrer Brust!
War es denn möglich? Sie preßte das Kind so heftig an ihre Brust, daß es aufschrie. Sie richtete ihre Augen nieder auf den scharlachroten Buchstaben und berührte ihn mit ihrem Finger, um sich zu überzeugen, ob das Kind und die Schmach denn Wirklichkeit wären. Ja! – dies war nun ihre Wirklichkeit – alles übrige war verschwunden.
3. DAS ERKENNEN
Von diesem qualvollen Bewußtsein, der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit und Verachtung zu sein, wurde Hester Prynne mit einem Male befreit. Sie bemerkte plötzlich im Hintergrunde der Menge eine Gestalt, die all ihre Gedanken unwiderstehlich in Anspruch nahm. Ein Indianer stand dort in seiner einheimischen Tracht und ihm zur Seite – offenbar in seiner Begleitung – ein Weißer, dessen Kleidung ein seltsames Gemisch von bürgerlich-zivilisierter und indianischer Tracht war.
Er war klein von Gestalt und sein Gesicht, obwohl noch nicht ausgesprochen alt, zeigte tiefe Furchen. Seine Züge trugen unverkennbar den Stempel beachtenswerter intellektueller Fähigkeiten, wie bei einem Menschen, dessen geistige Kräfte auch sein körperliches Aussehen eindeutig bestimmen. Obwohl seine Gestalt durch den anscheinend sorglos zusammengewürfelten, seltsamen Anzug merkwürdig verhüllt war, bemerkte Hester Prynne doch deutlich, daß eine seiner Schultern etwas höher war als die andere. Als ihr dieser kleine Körperfehler bewußt wurde und ihr Blick daraufhin nochmals auf das schmale, scharfe Gesicht fiel, preßte sie ihr Kind mit so krampfhafter Gewalt an ihre Brust, daß dieses von neuem vor Schmerz aufschrie. Doch die Mutter schien es nicht zu hören.
Schon beim Betreten des Marktplatzes hatte der Fremde seinen Blick auf Hester Prynne gerichtet. Zuerst geschah dies gleichgültig, wie bei einem Manne, der gewohnt ist, hauptsächlich nach innen zu schauen, und für den die äußeren Dinge nur von geringem Wert und Interesse sind, wenn sie nicht gerade zu seinem Inneren in irgendeiner Beziehung stehen. Sehr bald aber wurde sein Blick scharf und durchdringend und ein qualvolles Entsetzen verzerrte seine Züge. Sein Gesicht verdunkelte sich unter dem Eindruck einer überwältigenden Gemütsbewegung, doch bezwang er diese durch eine Anstrengung seines Willens so schnell, daß er schon im Augenblick darauf wieder vollkommen ruhig schien. Die Zuckungen seines Gesichtes wurden fast unmerklich und versanken schließlich ganz in den Tiefen seines Wesens. Als er nun plötzlich Hester Prynnes Augen auf sich gerichtet sah und bemerkte, daß auch sie ihn erkannt hatte, hob er langsam und ruhig seinen Finger, machte ihr damit ein Zeichen und legte ihn dann an seine Lippen.
Darauf klopfte er einem neben ihm stehenden Bürger auf die Schulter und fragte ihn mit förmlicher Höflichkeit:
„Ich bitte Euch, werter Herr, wer ist dieses Weib? Und weshalb ist sie hier der öffentlichen Schande preisgegeben?“
„Ihr müßt wohl fremd sein in dieser Gegend, mein Freund“, antwortete der Städter, während er neugierig den Mann und den ihn begleitenden Indianer betrachtete, „sonst würdet Ihr sicherlich von Hester Prynne gehört haben und ihrem üblen Wandel. Sie hat schändliches Ärgernis erregt, das kann ich Euch versichern.“
„Ihr vermutet richtig“, antwortete der Mann, „ich bin fremd hier und war lange auf der Wanderschaft, gegen meinen Willen. Zu Lande und zur See hatte ich viel Mißgeschick zu erdulden und wurde zuletzt von den Eingeborenen im Süden gefangengehalten. Nun hat mich dieser Indianer hierher begleitet, damit ich mich aus meiner Gefangenschaft loskaufen kann. Erzählt mir daher, wenn es Euch beliebt, mehr von Hester Prynne – habe ich ihren Namen recht gehört? – von ihrem Vergehen und weshalb sie nun dort auf jenem Pranger steht!“
„Das will ich, Freund, und ich glaube, es wird Euch nach all den Fährnissen und der Gefangenschaft in der Wildnis erfreuen, wieder in einem Lande zu sein, wo das Unrecht verfolgt und angesichts von Richter und Volk bestraft wird, wie hier bei uns. Jenes Weib, müßt Ihr wissen, war die Gattin eines gewissen Gelehrten, der, obwohl Engländer von Geburt, lange Zeit in Amsterdam gelebt hatte, bis er sich vor geraumer Zeit entschloß, überzufahren und sich hier in Massachusetts niederzulassen. In dieser Absicht schickte er sein Weib voraus, während er zurückblieb, um noch einige notwendige Angelegenheiten zu ordnen. Doch in diesen nun fast zwei Jahren, während die Frau hier in Boston wohnte, kam keinerlei Nachricht mehr von dem Gelehrten, Herrn Prynne. Sein junges Weib aber, Ihr seht ja, kaum sich selbst überlassen …“
„Aha – ich verstehe!“ sagte der Fremde bitter lächelnd. „Ein so gelehrter Herr, wie Ihr ihn nennt, hätte allerdings auch das aus seinen Büchern lernen sollen! Doch wer, mit Verlaub, mag wohl der Vater jenes Kindes sein, das Frau Prynne in ihren Armen hält? Es ist etwa drei oder vier Monate alt, schätze ich.“
„Ja, mein Freund, diese Frage bleibt ein Rätsel“, antwortete der Bürgersmann. „Madame Hester verweigert darüber absolut jede Auskunft und die Richter haben sich schon umsonst die Köpfe zerbrochen. Wer weiß, ob der Schuldige nicht als Zuschauer dieses traurigen Schauspiels hier in der Menge steht, unerkannt von den Menschen, doch ebenso schuldig wie jenes Weib vor den Augen Gottes!“
„Der Gelehrte“, bemerkte der Fremde abermals lächelnd, „sollte eben selbst kommen, um das Geheimnis zu lüften.“
„Das stünde ihm wohl zu, wenn er noch am Leben ist“, gab der andere zurück. „Unsere Richter aber haben gedacht, daß dieses junge und hübsche Weib zweifellos starken Versuchungen erlegen ist und außerdem ihr Gatte höchstwahrscheinlich längst am Grunde des Meeres ruht. So haben sie nicht die ganze Strenge unseres Gesetzes gegen sie in Anwendung gebracht. Die Strafe für ihr Vergehen war der Tod. Doch in ihrer Barmherzigkeit und Milde haben unsere weisen Richter Hester Prynne bloß dazu verurteilt, drei Stunden lang zur öffentlichen Schande am Pranger zu stehen und dann für den Rest ihres Lebens ein Zeichen der Schmach an ihrer Brust zu tragen.“
„Ein weises Urteil!“ äußerte sich der Fremde und nickte ernst. „So wird sie eine lebendige Predigt gegen die Sünde sein, bis der schimpfliche Buchstabe dereinst in ihren Grabstein eingemeißelt wird. Nichtsdestoweniger, es ärgert mich, daß ihr Mitschuldiger nicht wenigstens auch an ihrer Seite am Schandplatze steht. Doch man wird ihn finden! – Er wird erkannt werden! – Er wird erkannt werden!“
Er verbeugte sich höflich gegen den gesprächigen Bürger und flüsterte seinem Begleiter einige Worte zu, dann bahnten sich beide einen Weg durch die Menge.
Indessen war Hester Prynne, die Augen unverwandt auf den Fremden gerichtet, in völliger Versunkenheit dagestanden. Alle Welt um sie schien ausgelöscht und nur er blieb übrig, er und sie. Doch ein solches Zusammentreffen wäre wohl noch schrecklicher gewesen als das gegenwärtige: mit der glühenden Mittagssonne über ihr, die auf ihr Gesicht herniederbrannte, um ihre Schmach zu beleuchten, mit dem scharlachroten Zeichen der Schande an ihrer Brust und dem in Sünde geborenen Kinde in ihren Armen, mit dem ganzen gaffenden Volk um sie, das wie zu einem Feste versammelt war, um in ihr Gesicht zu starren, ihr Gesicht, das sie doch nur in der glücklichen Geborgenheit ihres Heimes oder hinter dem züchtigen Schleier in der Kirche hätte zur Schau tragen dürfen. So furchtbar es war, fühlte sie sich in der Gegenwart dieser tausend Zeugen doch irgendwie beschirmt. Es war besser, so dazustehen mit der Menge zwischen ihm und ihr, als ihm allein von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Der öffentliche Schandpfahl war ihr eine Zufluchtsstätte und sie bangte vor dem Augenblick, wo ihr dieser Schutz entzogen würde.
In solche Gedanken eingesponnen, hörte sie kaum auf die Stimme, die hinter ihr schon mehrmals ihren Namen gerufen hatte und die sich nun mit lautem, ernstem Tone, hörbar der ganzen Zuhörerschaft, abermals an sie wandte:
„Hört auf mich, Hester Prynne!“
Wie schon erwähnt, befand sich unmittelbar über dem Podest, auf dem Hester Prynne stand, ein balkonähnlicher Vorbau der Kirche. Von dieser Stelle aus pflegten im Beisein der Ratsherren der Stadt und mit all dem feierlichen Zeremoniell jener Tage öffentliche Bekanntmachungen verkündet zu werden. Nun saß hier der Gouverneur Bellingham, von vier Wächtern mit Hellebarden umgeben, um in eigener Person dem Schauspiel beizuwohnen. Er trug eine dunkle Feder auf seinem Hute, einen Mantel mit breitem, gesticktem Saum und ein schwarzes Samtwams darunter, ein Mann von vorgeschrittenem Alter, dessen Züge die Spuren harter Lebenserfahrung trugen. Er war wohl geeignet, Oberhaupt und Vertreter dieses Gemeinwesens zu sein, welches seinen Ursprung und seine gegenwärtige, gedeihliche Entwicklung nicht so sehr der Kraft der Jugend, als der strengen und maßvollen Tätigkeit weisen Mannestumes und der ernsten Verständigkeit des Alters verdankte. Auch die anderen hohen Persönlichkeiten, die den Gouverneur umgaben, zeichneten sich durch eine würdevolle Haltung aus, wie sie jene Zeit forderte, welche die obrigkeitliche Gewalt völlig aus der Heiligkeit göttlicher Gesetzgebung herleitete. Es waren ohne Zweifel gute, gerechte und weise Männer; aber es wäre wohl nicht leicht gewesen, aus der ganzen menschlichen Familie noch einmal eine solche Auswahl weiser und tugendhafter Persönlichkeiten zu treffen, die weniger geeignet gewesen wären, über den Irrtum eines weiblichen Herzens zu Gericht zu sitzen und Gutes vom Bösen zu scheiden, als jene Richter, denen Hester Prynne nun ihr Antlitz zuwandte. Sie war sich dessen wohl auch bewußt, daß sie eher bei der gaffenden Menge auf ein warmes, mitfühlendes Hera rechnen dürfte als hier, denn als sie jetzt ihre Augen zum Balkon emporhob, erblaßte sie jäh und ein Zittern befiel sie.
Die Stimme, die sie gerufen hatte, war die des hochwürdigen und berühmten John Wilson, des ältesten Predigers der Stadt. Er war ein großer Gelehrter, wie die meisten seiner geistlichen Zeitgenossen, und dabei ein Mann von freundlicher, liebenswürdiger Gemütsart, jedoch glaubte er, diese letztere Eigenschaft weit weniger pflegen zu müssen als seine geistigen Fähigkeiten und hielt sie fast für eine tadelnswerte Schwäche. Da stand er, einen Kranz ergrauter Locken unter seinem Samtkäppchen, während seine grauen Augen, die an das gedämpfte Licht des Studierzimmers gewöhnt waren, in der grellen Sonne blinzelten wie die Augen von Hesters Kind. Er sah aus wie einer jener ehrwürdigen, dunklen Kupferstiche, die wir auf dem Titelblatte alter Predigtbücher sehen können, und hätte im Grunde genommen nicht mehr Recht gehabt als jene, sich in die Schuld, Qual und Leidenschaft eines lebendigen Menschenherzens einzumischen.
„Hester Prynne“, begann er, „Ihr hattet das Vorrecht, der kirchlichen Gemeinde meines jungen Amtsbruders hier anzugehören.“ Dabei legte er seine Hand auf die Schulter eines blassen, jungen Mannes, der an seiner Seite stand. „Ich habe ihn zu überreden versucht, Euch hier, angesichts des Himmels und im Beisein der weisen und gerechten Richter dieser Stadt sowie des versammelten Volkes die ganze Verworfenheit Eurer Sünde vorzuhalten. Er kennt Eure Gemütsart besser als ich und wird wissen, wie er, ob mit Milde oder Strenge, am ehesten Euren Trotz und Eure Verstocktheit zu überwinden vermag, so daß Ihr nicht mehr länger den Namen dessen verschweigt, der Euch in solche Schande gestürzt hat. In seiner übergroßen Milde jedoch entgegnete er mir, daß es der weiblichen Natur ein Unrecht antun hieße, wollte man Euch zwingen, Euer Geheimnis hier im hellen Tageslicht und vor dieser zahlreichen Menge preiszugeben. Doch die Schande liegt in der Begehung der Sünde, nicht in ihrem Bekenntnis! So frage ich noch einmal, Bruder Dimmesdale: wollt Ihr selbst Euch der Seele dieser armen Sünderin annehmen – oder soll ich es tun?“
Unter den würdigen Herren auf dem Balkon erhob sich ein Gemurmel, dem Gouverneur Bellingham alsbald Ausdruck verlieh, indem er sich mit gebieterischer, doch respektvoller Stimme an den jungen Prediger wandte:
„Euer Hochwürden“, sagte er, „die Verantwortung für die Seele dieser Frau liegt bei Euch! Euch geziemt es daher auch vor allen anderen, sie zur Buße zu bewegen und als deren Beweis und Folge zu dem Bekenntnis, das sie uns noch schuldet.“
Diese unmittelbare Anrede richtete die Augen der ganzen Menge nun auf den ehrwürdigen Bruder Dimmesdale, einen jungen Geistlichen, der, mit der ganzen Gelehrsamkeit seiner Zeit ausgerüstet, von einer der großen englischen Universitäten in dieses unwirtliche Waldland gekommen war. Seine Beredsamkeit und religiöse Glut hatten ihm bereits einen weit über sein Alter hinausgehenden Ruf gewonnen. Er war ein Mann von ungewöhnlichem Äußeren, mit einer weißen, hochgewölbten Stirn, dunkelbraunen, melancholischen Augen und einem Mund, dessen kaum merkliches Beben sowohl Tiefe des Empfindens wie Kraft der Selbstbeherrschung ausdrückte. Trotz seiner hohen, natürlichen Gaben und erworbenen Kenntnissen jedoch lag in dem Wesen dieses jungen Predigers etwas Ängstliches, Erschrecktes, Furchtsames – als fühle er sich im Irrgarten des menschlichen Lebens völlig verloren und könne sich nur in gänzlicher Abgeschiedenheit von der Welt wiederfinden. Soweit seine Pflichten es gestatteten, hielt er sich auf schattigen Nebenpfaden und blieb einfach und kindhaft. Trat er dann aber bei Gelegenheit hervor, dann strömte eine solche Frische, Klarheit und Reinheit der Gedanken aus seinen Worten, daß seine Zuhörer sich wie von einem Engel angesprochen fühlten.
Dies war der junge Mann, auf den Pastor Wilson und der Gouverneur nun so offen die allgemeine Aufmerksamkeit gelenkt hatten, indem sie ihn aufforderten, vor aller Ohren in das Geheimnis jener Frauenseele zu dringen, das selbst auf dem Pranger noch unantastbar war. Die peinliche Lage, in der er sich befand, trieb ihm das Blut aus den Wangen und ließ seine Lippen beben.
„Sprecht zu dem Weibe, Bruder!“ wiederholte Pastor Wilson. „Es geht um das Heil ihrer Seele und daher auch um Eures, dessen Obhut sie empfohlen ist. Ermahnt sie, die Wahrheit zu bekennen!“
Pastor Dimmesdale senkte seine Augen wie zu einem stillen Gebet, dann trat er vor.