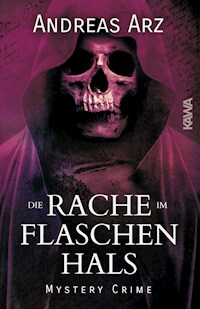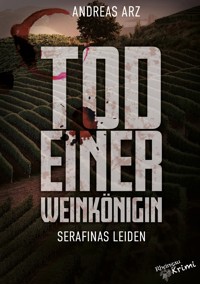Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1921 sind die Folgen des Ersten Weltkriegs noch allgegenwärtig. Auch im real existierenden Freistaat Flaschenhals im Rheingau ist man Ängsten vor den Besatzern der angrenzenden Gebiete, Versorgungsengpässen und der Furcht vor einer ungewissen Zukunft ausgesetzt. Dann geschieht ein grausames Verbrechen auf einem Rheinschiff vor den Toren des Städtchens Lorch. Der Winzer Peter Baum kommt mit seinen Freunden bei der Suche nach den Tätern in den Besitz eines wertvollen Schatzes, dessen Existenz die Begierde dunkler Mächte anfeuert und die Lage der Menschen noch verschlimmern könnte. Peter ersinnt mit seinen Mitstreitern einen klugen Schachzug, um seine Mitbürger und seine Familie zu schützen. Fast 100 Jahre später stößt der Jungwinzer Arnold Jäger auf Hinweise in seinem Weinkeller, die zu dem Schatz führen. Wieder geschieht ein Mord, der die Lorcher erschüttert. Was hat es mit den plötzlich auftauchenden dunklen Gestalten eines geheimnisvollen Ordens auf sich? Welche Rolle spielt die Inquisition im 21. Jahrhundert im lieblichen Rheintal? Zusammen mit dem schlagfertigen Kommissar Kießling, seiner Assistentin Ella Nilsson und dem Pathologen Dr. Berger begibt sich Arnold auf eine aufregende und gefährliche Jagd nach dem Schatz im Flaschenhals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke an alle Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben.
Ein besonderer Dank für fortwährende Inspiration geht an meine Frau Christin und Mutter Monika!
Nicht zu vergessen … unseren Vierbeiner Titus, der immer ganz genau wusste, wann es an der Zeit für eine Pause war.
Andreas Arz
Der Schatz
im
Flaschenhals
Zum Gedenken an die mutigen Menschen im Freistaat Flaschenhals!
1919 - 1923
Über dieses Buch
In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder prägende Zeiten. Wir entdeckten neue Länder und Völker, erkundeten die Natur und brachen ins Weltall auf. Wundervolle Errungenschaften, die uns miteinander verbanden und weiterentwickelten. Es gab auch dunkle Zeiten. Wir führten Kriege und töteten, um zu erobern und zu herrschen.
In diesen Tagen voller Elend und Leid gab es immer wieder Momente, in denen die Welt zu zerbrechen drohte – aber dann blitzte aus einem kleinen Spalt ein Funken Hoffnung auf, der ein Feuer des Zusammenhalts unter den Menschen entfachte. Einer dieser historischen Augenblicke schrieb sich tatsächlich als »Freistaat Flaschenhals« in die Geschichtsbücher ein.
Der Erste Weltkrieg mit seinen beispiellosen Grausamkeiten war gerade vorüber. Der Groll der Menschen war auf allen Seiten groß - bei den Siegern und den Besiegten. Die eine Seite pochte auf Rache und Entschädigung für das entstandene Leid, die andere hoffte auf ein baldiges Ende dieses Albtraumes und versuchte, ihre Unterlegenheit auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Nach einem Krieg derartigen Ausmaßes war es wohl unmöglich, einen Konsens zu finden.
Im Freistaat Flaschenhals gelang es mutigen und findigen Bewohnern, sich eine Welt zu erschaffen, die ihnen Gesicht, Hoffnung und ein Stück Freiheit zurückgab. Sie konnten den Schatten des Krieges verlassen und in eine neue Zeit aufbrechen, die irgendwo in weiter Ferne eine erstrebenswerte Zukunft versprach.
Dieser Roman begibt sich auf eine besondere Reise in den »Freistaat Flaschenhals«. Die kurz nach dem Ersten Weltkrieg angesiedelte Geschichte reicht bis in die Gegenwart.
Die Handlung ist fiktiv, aber den Freistaat Flaschenhals gab es wirklich. Reale, historische Persönlichkeiten und Begebenheiten aus dieser Zeit sind Teil dieser Geschichte und wurden zugunsten der Dramaturgie an mancher Stelle angepasst.
Ihr Andreas Arz
Kapitel eins
Die schicksalhafte Nacht im Rhein im Freistaat Flaschenhals 1921
Peter Baum warf einen letzten prüfenden Blick in seinen Weinkeller, bevor er die schwere Eichentür zum Eingang schloss. Das laute, knarrende Geräusch durchdrang die Gemäuer seines Felsenkellers, wo nun die neuen Weine der letzten Ernte in den Fässern ruhten. Erleichtert schritt Peter über seinen Hof. Die Traubenlese war in diesem Herbst gut ausgefallen, im Gegensatz zum 1920er-Jahrgang im vergangenen Jahr. Es kündigte sich ein Jahrhundertwein an. Volle Weinkeller waren für die Bewohner der Stadt Lorch am Rhein zu einer wichtigen Existenzgrundlage geworden. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Rund um Lorch hatten sich Besatzungszonen der amerikanischen und französischen Siegermächte gebildet. Bei der Einrichtung dieser Zonen war den alliierten Siegermächten allerdings ein Lapsus unterlaufen und das Gebiet um Lorch blieb unbesetzt und bildete den Freistaat Flaschenhals.
Die Freude, unbesetztes Gebiet zu sein, währte für die Bewohner des Freistaates nicht lange. Nur zu gern hätten die Franzosen das Gebiet für sich in Anspruch genommen und führten eine Isolationstaktik. So waren die Menschen einer ständigen Beobachtung, gepaart mit fortwährendem Säbelrasseln, ausgesetzt. Die Versorgung mit Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern war zu dieser Zeit sehr schwierig, deshalb wurde der Wein zu einem gern genutzten Tauschmittel. Peter konnte demnach in diesem Jahr beruhigt sein, denn er hatte mit dem guten Ertrag aus den Weinbergen auch Sicherheit für sich und seine junge Familie geerntet.
Es war spät geworden. Die Turmuhr der Sankt-Martins-Kirche schlug zur elften Stunde. Ein dichter Nebel tauchte Lorch in einen undurchdringlichen Schleier. Mit dem Glockenschlag wurden die letzten Lichter in den Häusern gelöscht und die Menschen gingen zu Bett. Ein harter Tag im Weinkeller lag hinter ihm und ihn trieb nur noch der Gedanke an die wohlige Nachtruhe neben seiner geliebten Frau Maria an. Er löschte die Laterne, die seinen Hof beleuchtete. Der Ruß stieg ihm mit einem beißenden Geruch aus der Lampe in die Nase. Durch einen Ausguck in der Hofmauer blickte er nochmals hinunter auf den Rhein. Der Fluss war in gespenstischen Nebel getaucht. Peter schauderte es bei dem Anblick. Während der Besatzungszeit konnten sich die Bürger nie sicher sein, wer sich, mit welchen Absichten, im Nebel verbarg. Kurz bevor er sich abwendete, blitzte ein Lichtstrahl auf dem Rhein durch. Es wird doch niemand so verrückt sein, bei so schlechter Sicht auf dem Fluss zu fahren, dachte Peter. Zu gefährlich waren die Tücken auf diesem Streckenabschnitt. Nicht einmal ein erfahrener Lotse würde das Risiko einer Nebelfahrt bei diesen Verhältnissen eingehen. Kaum hatte er diesen Gedanken beendet, durchfuhr wie aus heiterem Himmel ein lautes Krachen das Rheintal. Hastig wandte er sich wieder dem Ausguck in der Hofmauer zu und blickte zum Fluss. Das Licht im Nebel zuckte hin und her. Tatsächlich musste ein Schiff versucht haben, sich seinen Weg durch den Nebel zu bahnen und war auf einen Felsen aufgelaufen. Peter versuchte wie gebannt, etwas zu erkennen, doch es war unmöglich, einen klaren Blick durch die Schwaden zu erlangen. Er konzentrierte sich auf Geräusche, um einen Hinweis auf das Geschehen zu bekommen. Leise Stimmen waren durch den Nebel zu hören, aber Peter konnte keine klaren Worte verstehen. Die Stimmen wurden immer lauter und verwandelten sich in laute Schreie. Peter durchfuhr Angst. Was ging dort unten vor? Er konnte seinen Blick nicht abwenden und versuchte weiterhin, etwas zu erkennen. Es schien jemand um sein Leben zu kämpfen. Klingen von Messern oder Säbeln prallten auf stumpfe Gegenstände, als würde sich jemand mit allem, was ihm zur Hand war, verteidigen. Das Licht schwankte immer stärker, die Schreie wurden immer lauter, dann, mit einem lauten Schlag, erlosch das Licht. Das Rheintal fiel wieder in Stille, als die Schreie verstummten. Als hätte der Tod das letzte Wort gesprochen.
Peter rannte in Richtung Wohnhaus, das auf der anderen Seite des Hofes über dem Weinkeller lag. Er riss die Tür auf und rannte hoch ins Schlafzimmer, in dem seine Frau Maria bereits im Nachthemd auf dem Bett saß.
»Peter, was ist passiert?«
»Ich kann es dir nicht sagen. Es scheint, als sei ein Schiff auf einen Felsen gelaufen. Danach hat wohl an Deck ein Kampf stattgefunden. Aber es war nichts zu erkennen«, stieß er hervor.
Maria sah ihn nervös an. »O Gott, was wird da wohl passiert sein? Meinst du, die Franzosen haben etwas damit zu tun?«
Peter wog nachdenklich den Kopf hin und her. »In jedem Fall muss ich nachsehen, was passiert ist. Sollten es die Franzosen gewesen sein, könnten sie vielleicht die Besetzung von unserem Gebiet vorhaben. Das müssen wir verhindern. Ich muss auch die anderen warnen.«
Peter wandte sich zum Kleiderschrank und zog eine dicke, dunkle Jacke heraus. Maria sprang aus dem Bett und versuchte, ihren Mann zurückzuhalten. Sie griff fest an seinen Arm und zog Peter herum.
»Peter, das ist viel zu gefährlich. Du könntest getötet werden. Du weißt, wie viele Menschen bereits umgekommen sind, sobald sie sich den Franzosen in den Weg stellten.«
»Das ist mir bewusst, mein Herz«, sagte er in bemüht unbesorgtem Ton, um sie zu überzeugen. »Aber wenn die Franzosen wirklich mit dem Schiff versucht haben, in unser Gebiet einzudringen und im Schutz des Nebels ihre Truppen hierher zu bringen, müssen wir reagieren, sonst sind wir alle in Gefahr.«
»Aber es gab doch anscheinend schon Kämpfe auf dem Schiff. Vielleicht sind die Leute schon gewarnt?«
Maria wurde immer panischer, doch Peter ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen.
»Maria, wenn ich jetzt nicht da runter gehe und nachschaue, kann dies schlimme Folgen haben. Ich versuche doch nur, euch zu beschützen«, spielte Peter auf Maria und ihre gemeinsame Familie an. »Wir haben für uns und unsere Kinder eine große Verantwortung. Unsere Zukunft, unser ganzes Hab und Gut steht auf dem Spiel, wir müssen es verteidigen!« Dabei strich er ihr über den Bauch. Sie erwarteten gerade ihr zweites Kind.
Maria erkannte, dass sie ihn nicht umstimmen konnte. In diesen Nachkriegszeiten, inmitten der Besatzung der umliegenden Gebiete durch die Franzosen und die ständige Bedrohung einer Besetzung des Freistaat Flaschenhals, waren alle Menschen in Lorch zutiefst sensibilisiert und bereit, ihre Freiheit um alles zu verteidigen.
Peter zog sich die dunkle Jacke über und wandte sich Maria zu. Er fasste mit beiden Händen zärtlich ihren Kopf und presste seine Stirn gegen die ihre.
»Hab´ keine Angst, ich werde gesund zurückkommen. Bleib´ du im Haus. Wenn du etwas hörst, was auf Kämpfe hindeutet, nimm´ Loni und lauf schnell rüber zu meinen Eltern. Verbarrikadiert euch am besten im Weinkeller, bis ich zurück bin.«
Maria traten Tränen in die Augen. Diese rollten weniger aus Angst über ihre Wangen als aus Sorge, dass dieser Moment der letzte sein könnte, den sie mit ihrem Mann teilte. Peter wischte ihr zärtlich die Tränen aus dem Gesicht und schenkte Maria ein sanftes Lächeln. Er flüsterte: »Ich liebe dich und werde es immer tun. Ich bin bald zurück.«
Mit diesen Worten gab Peter seiner Frau noch einen eiligen Kuss auf die Lippen und verschwand im Dunkel des Flures. Maria schluchzte noch einmal tief und trat ein paar Schritte zurück. Sie setzte sich aufs Bett und das laute Knarren des Holzes verschmolz mit der Stille, die sich im Schlafzimmer ausbreitete. Ihre Blicke waren weiterhin in Richtung Tür gerichtet, in der Hoffnung, dass Peter durch diese bald zurückkommen würde.
Das gespenstische Schiff
Peter eilte durch die schmalen Gassen Lorchs in Richtung Rheinufer. Auf dem Weg dorthin blitzten durch die verdunkelten Fenster der Wohnhäuser immer wieder vereinzelt Augen und durch die Türen der Häuser schielten neugierige Gesichter. Die Verunsicherung war in allen Augen erkennbar.
Er kam am Backhaus vorbei. Aus dem Fenster der Backstube fragte eine Stimme im Flüsterton: »Peter, wo willst du denn hin?«
Peter drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Das mehlverstaubte Gesicht von Bäcker Hubert konnte er erkennen.
Er erwiderte in gedämpften Ton: »Irgendwas ist auf dem Rhein passiert. Ein Schiff ist wohl auf Felsen gelaufen.«
»Die Franzosen?«
»Keine Ahnung, ich sehe nach.«
»Pass bloß auf Peter, wenn’s die Franzmänner sind, nimm´ schnell die Beine in die Hand!«
Peter nickte in Richtung Hubert und setzte seinen Weg fort. Wie recht der Bäckermeister hat‹, ging es ihm durch den Kopf. Wie sollte er seine Familie beschützen, wenn er jetzt durch eine unüberlegte, törichte Aktion sein Leben verlöre? Andererseits könnte viel Unheil über das unbesetzte Gebiet abgewendet werden, wenn er und ein paar mutige Bürger das Überraschungsmoment der Franzosen jetzt zunichte und dadurch etwaigen Besetzungsplänen den Garaus machten. Auf diese Fragen gab es wohl keine allgemeingültige Antwort. So ließ sich Peter weiter von seinem patriotischen Gedanken und natürlich der Neugier antreiben, die ihm unentwegt unter den Nägeln brannte.
Am Ufer angekommen, fuhr Peter mit seinen Blicken den Rhein ab. Der Nebel erschwerte die Sicht, doch ein lautes Knarren ließ auf den Standort des Schiffes deuten. Die Strömung drückte das Wrack anscheinend immer wieder gegen den Unglücksfelsen, und dadurch entstand das gruselige Geräusch, das von der Mitte des Rheines durch den Nebel ans Ufer drang.
Peter trat näher heran und versuchte, etwas zu erkennen. Wie gebannt waren seine Blicke auf das Wasser gerichtet. Mit jedem knarrenden Geräusch schlug sein Herz schneller und sein Atem wurde kürzer. Dabei bemerkte er nicht, dass sich hinter ihm ein Schatten bewegte. Dieser kam immer dichter und war schon bald direkt hinter ihm. Eine Hand erhob sich und sauste herunter auf seine Schulter. Peter fuhr in sich zusammen und stieß einen Schrei heraus. Er drehte sich um und hob schützend den rechten Arm. Er blickte in das Gesicht von Bürgermeister Edmund Pnischeck.
»O Gott, Peter, es tut mir leid, ich dachte, du hättest meine Schritte gehört«, entschuldigte sich der Bürgermeister.
Peter atmete tief aus und ließ die Erleichterung in seinen Körper zurückkehren.
»Verdammt, Edmund! Hättest du nicht etwas sagen können?«
»Verzeih mir, ich dachte, meine Schritte wären zu vernehmen gewesen«, entgegnete Pnischeck.
Aus dem dunklen Hintergrund erschien eine zweite Person.
Die Aufregung kehrte in Peter zurück und er griff nach einem herumliegenden Stück Treibholz.
»Vorsicht, da ist noch jemand«, sagte Peter mit zittriger Stimme.
Die Gestalt aus dem Dunkel rief herüber: »Alles gut, ich bin es, Theodor.«
Bürgermeister Pnischeck legte Peter beruhigend die Hand auf die Schulter. »Keine Sorge Peter, Theodor hat mich begleitet, nachdem wir etwas Verdächtiges gehört haben. Er hat sich am Ufer umgesehen, ob Franzosen in Sicht sind.«
Peter ließ das Stück Treibholz, das er noch immer verteidigend in der Hand hielt, sinken.
»Na, dann sind wir ja jetzt wenigstens zu dritt«, stellte er fest.
Die Erleichterung war Peter deutlich anzusehen. Zwar waren weder er noch Bürgermeister Pnischeck sowie der Kauber Winzer Theodor ausgebildete Soldaten oder gar Kämpfer, doch zusammen ließ sich die Last der Angst besser tragen.
Ein leichter Wind kam auf und zog durch das Rheintal. Dieser vertrieb den Nebel etwas und erleichterte ihnen die Sicht. Aus den sich lichtenden Schwaden tauchte in der Mitte des Rheins ein Schiff auf. In der Tat war es auf einen unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen aufgelaufen. Ein ortskenntlicher Lotse hätte diesen leicht umfahren können, da ihm die Tücken des Rheins hinlänglich bekannt waren. Doch hier waren wohl Wagemutige am Werk gewesen und hatten versucht, diese Passage ohne die Navigation eines Lotsen zu durchdringen. Dazu kam der dichte Nebel, der das Vorhaben nicht einfacher gestaltete.
Die drei versuchten indes, zu lauschen, um den ein oder anderen Laut zu vernehmen, doch außer dem geisterhaften Knarren des Schiffes am Felsen und dem Rauschen des Rheins war nichts zu hören.
Bürgermeister Pnischeck blickte Peter und Theodor an und sagte: »Mir scheint es nicht, dass hier Franzosen am Werk waren. Hier ist wohl was anderes vorgefallen.«
Das Schiff ließ in der Tat nicht den Schluss zu, dass es sich hier um den ausgeklügelten Plan einer Invasion handelte. Es war ein kleiner Frachter mit überschaubarer Lademöglichkeit. Die Länge und Breite des Schiffes ließen darauf schließen, dass es sicherlich nicht wie ein trojanisches Pferd eine Schar Soldaten beherbergte, die den Boden für einen Einmarsch bereiten sollten. Aber woher kamen die Schreie und deutlichen Kampfhandlungen, fragten sich die drei Flaschenhalser.
Peter atmete tief durch. »Wir müssen rüber auf das Schiff, herausfinden, was dort stattgefunden hat«, sagte er entschlossen.
Wortlos nickten die beiden anderen. Alle waren sich bewusst, ein hohes Risiko einzugehen. Zum einen lag das Schiff in der Rheinmitte, die Sicht war weiterhin schlecht. Zum anderen war es noch nicht ganz ausgeschlossen, dass hier nicht doch französische Soldaten im Spiel waren. Einig waren sie sich in jedem Fall, dass sie dem nachgehen mussten. Auch wenn das alles nichts mit den Besatzern zu tun hatte, waren offensichtlich Menschen zu Tode gekommen, und dies muss einen Grund gehabt haben.
Beherzt gingen Peter, Edmund und Theodor zu einem kleinen Boot, das am Ufer befestigt war. Dieses hatte einen kleinen Motor, da sonst der Strömung des Rheins nicht beizukommen gewesen wäre.
Peter startete den Motor, während Theodor die Leine am Steg löste. Edmund entzündete eine kleine Öllampe am Bug, die ein kleines Licht nach vorne abgab. Sie legten ab und nahmen Kurs auf das unheimliche Schiffswrack.
Je näher sie kamen, desto stärker wuchs die Anspannung in ihnen. Alle drei fokussierten ihre Blicke auf das havarierte Schiff und versuchten, Bewegungen zu erkennen. Es war nichts zu erblicken, außer dem Dampf ihres Atems, der in der kalten Luft des Nebels aufstieg.
Nur noch wenige Meter hatten sie vor sich. Peter drosselte die Umdrehung des Motors, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Als erfahrener Angler wusste er, wie man bei Strömung an einem festen Objekt anlegt, ohne weggetrieben zu werden. Er tastete sich langsam an die Steuerbordseite des Schiffes heran. Das Knarren des Schiffes, das von der Felskante herrührte, war hier so laut, dass ihnen ein kalter Schauder über den Rücken lief.
Theodor warf die Leine des Bootes nach oben, um einen Schiffspoller zu erwischen, und das Boot an der Seite zu sichern. Trotz Dunkelheit und Nervosität behielt er eine ruhige Hand und ihm gelang das Manöver gleich im ersten Versuch. Edmund blickte in die Runde und erklärte: »Ich gehe als Erster. Peter, hilf mir hoch!«
Peter lehnte sich mit dem Rücken an die Schiffsseite und formte seine Hände zu einer Räuberleiter. Theodor versuchte, das Boot zu stabilisieren, damit es ruhig an der Seite lag. Es wäre fatal gewesen, wenn einer von ihnen an diesem Punkt des Rheins über Bord ging. Bei der Strömung und der Wassertemperatur waren die Überlebenschancen sehr gering.
Edmund griff an Peters Schultern und stieg in dessen Hände. Heldenmütig stieß er sich ab und hielt sich mit dem Schwung von unten an der Reling des Schiffes fest. Peter stemmte ihn mit aller Kraft nach oben. Edmund war darauf bedacht, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Schließlich war immer noch nicht klar, wer oder was sich auf dem Schiff befand. Im Hinterkopf hatten die drei immer noch die Szenen des Kampfes, der sich hier abgespielt haben musste. Waren es doch nur Geräusche, so war die Intensität der Schreie, die bis an die Mauern der Lorcher Häuser gereicht hatten, Grund genug, größte Achtsamkeit walten zu lassen.
Edmund hatte es an Bord geschafft. Oben angekommen, ließ er geschwind seine Blicke umherschweifen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Es war in der Dunkelheit schwer, mehr als nur Umrisse zu erkennen. Er drehte sich zur Reling und flüsterte den anderen beiden zu: »Ich kann kaum etwas sehen. Theodor, reich´ mir bitte die Lampe!«
Dieser gehorchte und streckte direkt seine andere Hand hinterher, damit Edmund ihn hochziehen konnte. Peter schob von unten nach. Nachdem er es an Bord geschafft hatte, zogen Edmund und Theodor gemeinsam den im Boot verbliebenen Peter hinauf.
Langsam tasteten sie sich Schritt für Schritt voran, um das Deck zu erkunden. Peter ging in der Mitte und hielt die Lampe vorneweg, um ein wenig Licht zu geben. Der Wellengang des Rheins ließ das Schiff leicht schaukeln, dazu das ständige Reiben am Felsen, das rief zur Vorsicht bei jedem Schritt. Das Gleichgewicht zu halten, war unter diesen Voraussetzungen nicht einfach. Mit jedem Meter, den sie an Deck voranschritten, stieg ihre Anspannung. Jedes Geräusch löste ein nervöses Kopfzucken bei den drei Männern aus. Plötzlich stieß Edmunds Fuß auf etwas am Boden und ließ ihn stolpern. Er konnte die Balance nicht mehr halten und stürzte der Länge nach auf die Planken. Peter richtete sofort den schwachen Lichtstrahl in seine Richtung. Edmund versuchte, sich hochzuhieven, indem er sich mit der rechten Hand abstützte. Mit der Linken fasste er nach und griff in etwas am Boden liegendes.
»Peter, komm mit dem Licht näher, hier ist etwas.«
Peter beugte sich hinunter zu Edmund. Das Licht erfasste Edmunds linke Hand und brachte ein Bein zum Vorschein. Edmund zuckte und zog seine Hand zurück. Peter näherte sich ganz langsam und zum Vorschein kam ein Männerkörper. Alle drei durchfuhr ein grauenvoller Schrecken. Edmund griff nach der Lampe und wollte noch näher heran, um festzustellen, ob der Mann noch lebte. Als er die Lampe ergriff und ins Licht sah, durchfuhr ihn blankes Entsetzen. Seine ganze Hand war voller Blut. Dieses verschmolz mit dem schummrigen Licht zu einem düsteren Schatten. Sie tauschten bestürzte Blicke.
Theodor erblickte eine weitere Öllampe. Mit einem Streichholz entzündete er den Docht. Das Licht vertrieb die Dunkelheit vom Deck und offenbarte einen grauenhaften Anblick. Peter und Edmund blickten nach unten und bemerkten, dass sie in einer Blutlache standen, die sich großflächig über das Deck ausgebreitet hatte. Theodor trat wieder in die Reihe zu den anderen und ihre Blicke richteten sich auf drei weitere Leichen, die an der Backbordreling sitzend aneinandergereiht waren. Damit sie in aufrechter Position blieben, waren ihre Hälse mit Stricken an die Reling gebunden worden. Ihre Hände waren ineinander gefaltet, und es schien, als würden sie beten. Auf den Stirnen waren Zeichen aufgetragen, ein Kreuz umschlossen von einer Pyramide. Die Zeichen schimmerten rot und schwarz im Licht der Lampe. Sie schienen mit dem Blut der Männer gezeichnet worden zu sein.
»Großer Gott, was ist hier nur passiert?« Edmund keuchte.
Peter erwiderte zögerlich: »Das weiß nur der Herrgott allein.«
»Ich glaube nicht, dass unser Herrgott irgendetwas hiermit zu tun hatte«, meinte Theodor.
Plötzlich knallte die Tür zum Gang, der unter Deck führte. Den drei Männern stockte einen Moment der Atem. Der Wind hatte die Tür aufgestoßen. Ihre Blicke waren wie festgenagelt. Sie verharrten in der Erwartung, dass sich jeden Moment etwas in der Dunkelheit regte. Aber es geschah nichts.
Theodor versuchte, nun die Stimme der Vernunft zu sein. »Lasst uns schnell hier verschwinden. Morgen bei Tagesanbruch können wir zurückkommen. Das ist hier zu gefährlich«, schlug Theodor vor.
»Das können wir nicht machen«, entgegnete Edmund. »Wir müssen jetzt herausfinden, was hier vorgefallen ist.«
Peter nickte. »Da stimme ich Edmund zu. Ich denke, diejenigen, die das getan haben, sind von Bord. Seht her, das Beiboot ist weg.«
Theodor war noch nicht vollends überzeugt. »Mag sein, dennoch können wir im Hellen zurückkommen.«
»Nein, können wir nicht. Sollte das hier etwas mit den Franzosen zu tun haben und die tauchen morgen hier auf und finden vier Leichen, was denkt ihr, was dann im Flaschenhals los ist!«, entgegnete Edmund energisch.
»Da geb´ ich Edmund recht«, sagte Peter. »Wir können nicht riskieren, dass die Franzmänner einen Grund bekommen, bei uns einzufallen und am Ende noch einen Schuldigen bei uns suchen.«
»So sei es denn«, gab sich Theodor geschlagen.
Sie gingen langsam auf die dunkle Öffnung zu. Die Tür schlug im Wind auf und zu. Trotz der Kälte bildete sich auf jeder Stirn Angstschweiß. Vorsichtig hielt Peter die Lampe in den Treppengang. Er ging voran, die anderen folgten ihm auf den Tritt. Die Decke war sehr niedrig und sie mussten die Köpfe einziehen. Es roch stark nach faulem, nassem Holz. Dieses Schiff hatte seine besten Zeiten hinter sich. Unten angekommen, betraten sie einen Gemeinschaftsraum. Ein Tisch mit zwei Bänken befand sich im hinteren Teil, vorne rechts waren zwei Hängematten befestigt, wo sich die Besatzung ausruhen konnte. Modriger Geruch, gepaart mit Alkoholdunst, drang ihnen in die Nase. Auf dem Tisch standen ein paar Gläser und auf dem Boden kullerten zwei ausgelaufene Weinflaschen.
»Hier ist nichts, lasst uns wieder hochgehen«, forderte Theodor sie auf. Peter ließ seinen Blick nochmals umherschweifen. Hier war anscheinend wirklich kein Hinweis auf den Hergang an Bord zu finden. Er blickte Edmund an, der ebenfalls andeutete, jetzt wieder an Deck zu gehen. Theodor ging die Treppe voran nach oben, Edmund folgte, während Peter seinen Blick nochmals auf den Boden richtete.
»Wartet! Hier ist etwas seltsam«, rief Peter die anderen zurück. Er deutete auf die Weinflaschen. »Die sind vom Tisch gefallen und ausgelaufen, doch wo ist der Wein hin?« Peter beugte sich herunter und tastete den Boden ab. Er spürte die feuchte Spur des Weines und folgte dieser mit seiner Hand bis zu einer kleinen Lederschlaufe, die an den Boden genagelt war. Er schaute hoch zu Edmund und Theodor, die mittlerweile wieder unten im Raum hinter ihm standen. Beherzt zog Peter an dem Lederriemen und es öffnete sich eine Klappe, die weiter in den Bauch des Schiffes führte. Peter legte sich bäuchlings und hielt die Lampe in das Loch. Etwas Staub war aufgewirbelt worden. Es schien aber niemand dort unten zu sein. Er reichte Edmund die Lampe und bat ihn: »Hier, halt fest und leuchte mir!«
»Du willst doch nicht ernsthaft da runter klettern?«, fragte Theodor entsetzt.
Ohne ein Wort zu erwidern, sprang Peter in das Loch.
»Gib mir die Lampe!«, sagte er zu Edmund.
Er tastete sich langsam voran und stand plötzlich vor etwas, das mit einem Laken abgedeckt war. Peter stellte die Lampe ab und zog das Laken weg.
»Peter, was ist das? Kannst du was erkennen?«, fragte Edmund.
»Es sind drei Truhen mit Scharnieren, die aussehen, als wären sie vergoldet.«
Die Truhen waren mit Vorhängeschlössern verschlossen. Peter sah sich um und suchte nach etwas, um die Schlösser aufzubrechen. Sein Blick fiel auf eine Eisenstange, die in der Ecke lag. Er griff danach und setzte diese bei einer der Truhen an. Die Stange war lang genug und durch den großen Hebel hatte er keine Mühe, das Schloss aufzubrechen. Er entfernte den Bügel und spürte bereits beim Anfassen des Scharniers, dass es sich hier nicht um ein billiges, vergoldetes Metall handelte. Es hatte ein unglaubliches Eigengewicht. Peter versuchte, den Deckel anzuheben. Mit aller Kraft zog er diesen nach oben. Mit einem lauten Schlag fiel der Deckel auf die andere Seite. Peter griff nach der Lampe und leuchtete den Inhalt aus und traute seinen Augen nicht. Goldmünzen, mit Edelsteinen besetzter Schmuck, Kelche aus schier purem Gold strahlten ihm entgegen. Dazwischen lagen alte Schriftrollen aus Pergament. Die Fassungslosigkeit war ihm ins Gesicht geschrieben.
Edmund rief hinunter: »Was hast du gefunden, was ist da?«
Peter zögerte einen Moment. »Ihr werdet es nicht glauben.«
Kapitel zwei
Der Traum vom Weingut - im Lorch der Gegenwart
Es war wie eine Befreiung, ein Traum, der in Erfüllung ging. Arnold Jäger stand vor den Hofmauern des Weingutes im Rheingauer Städtchen Lorch, das er gerade von seinem Ersparten gekauft hatte. Ein warmer Wind fuhr durch seine Haare, im Hintergrund war das Rauschen des Rheins zu hören. Die Sonne schien kräftig in das Rheintal und tauchte das wunderschöne ländliche Panorama in unverwechselbare, warme Farben.
Wie angewurzelt stand er vor der Mauer und blickte ehrfürchtig an den Steinen entlang. Arnold konnte es immer noch nicht glauben, dass sich sein lang gehegter Jugendtraum jetzt vor ihm erhob. Ein eigenes Weingut. Die Wehmut, dass er hierfür seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern verlassen hatte, wo er auf Usedom, auf dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen war, war wie weggeflogen. Viele Tränen waren geflossen, als er die Insel verließ. Seine Mutter schnaubte Unmengen von Taschentüchern voll, als Arnold aus dem Fenster seines Wagens winkend vom Hof gefahren war. Eine abenteuerliche Reise hatte für den 32-jährigen Norddeutschen begonnen. Sein Vater hatte bis zuletzt gehofft, ihn doch noch für den Beruf eines Milchbauern zu begeistern. Schließlich hatte er sein ganzes Leben auf dem Hof verbracht und war ein echtes Talent, was das Melken von Kühen anging.
Arnolds Interesse wurde allerdings bereits in Kindertagen in eine andere Richtung gelenkt. Schon früh hatte er gern seinen Großvater beobachtet, der jeden Abend den Tag mit einem Glas Wein beschloss. Pünktlich nach dem Abendessen holte Großvater eine Flasche Wein hervor, nahm ein Glas aus dem Schrank und schenkte ganz langsam ein. Dabei schien er jeden Tropfen, der aus der Flasche rollte, genauestens zu verfolgen. Anschließend hob er das Glas ins Licht und musterte die hindurchschimmernden Farben. Danach steckte er seine große Nase in den Kelch und genoss das Bukett des Weines, während er diesen gekonnt mit der Hand schwenkte. Mit diesem Ritual war es um Arnold geschehen. Er konnte es kaum erwarten, bis er alt genug war, um daran teilzunehmen. Als es endlich so weit war, führte ihn sein Großvater in die große Welt der Weine ein. Während sie abends zusammensaßen, philosophierten die beiden stundenlang über Jahrgänge, Weinbaugebiete und Rebsorten. Immer dazu gehörte ein Schwank aus Großvaters Jugendtagen in der Nachkriegszeit der ehemaligen DDR, wenn etwas über den Durst getrunken wurde und dabei die ein oder andere lustige Begebenheit stattfand.
Kurz vor Arnolds 18. Geburtstag verstarb sein Opa überraschend. Dieser Verlust hatte Arnold sehr schwer getroffen, bestärkte ihn allerdings umso mehr, sein Leben dem Weinbau zu verschreiben. Dies wollte er nicht nur, um das Andenken seines Großvaters zu ehren, denn er hatte eine wahre Passion zum Wein entwickelt.
Da auf der Insel Usedom Weinbaugebiete sehr rar waren, war schnell klar, dass er das elterliche Nest früher oder später verlassen würde. Arnolds Eltern liebten ihren Sohn sehr, und so wollten sie ihm auf keinem Fall im Weg stehen, wenn es um die Umsetzung seiner Träume ging. So kam es, dass Arnold nach seinem Abitur überlegte, wo er die große Kunst des Weinmachens erlernen konnte. Viele Optionen kamen für ihn nicht infrage, schon immer hatte sein Gaumen eine Vorliebe für den Rheingauer Riesling. Da die Reben schlecht zu ihm kommen konnten, entschied er sich für ein Studium an der Geisenheimer Forschungsanstalt für Weinbau. Sie war sein erster Anknüpfungspunkt mit der Region Rheingau. Schon häufig hatte er die Weine aus der Region gekostet, doch als er das erste Mal vor Ort war, entfachte eine neue Liebe, die ihn nicht mehr losließ.
Nachdem er das Studium des Weinanbaus erfolgreich abgeschlossen hatte, zog es ihn vorerst wieder nach Mecklenburg, wo er auf dem elterlichen Hof arbeitete und jeden Cent sparte, um sich den Traum eines eigenen Weingutes irgendwann zu erfüllen.
Jetzt war es soweit. Von einem alten Bekannten aus Studienzeiten hatte Arnold erfahren, dass in Lorch ein Weingut zum Verkauf stand. Die dazugehörigen Weinbergsflächen waren perfekt für ihn, um mit seinen überschaubaren Mitteln seinen Traum zu verwirklichen.
So stand er nun da, blickte auf sein Refugium und konnte die Gefühle der Freude kaum verbergen. Durch seinen Drei-Tage-Bart schimmerte ein ständiges Lächeln. Das kleine Anwesen war wie aus dem Bilderbuch. Das Haupthaus aus Stein bebaut mit einem Schieferdach. Der Hof mit Kopfsteinpflaster ausgelegt und überall rankte sich Wilder Wein die Wände hoch.
Er atmete tief ein und aus. Das kam von der Nervosität, denn jetzt ging es ans Eingemachte. Die vor ihm liegende Arbeit war nicht zu unterschätzen, denn seit vielen Jahren war das Weingut nicht mehr richtig bewirtschaftet worden. Eine riesengroße Unordnung galt es, in den Griff zu bekommen. Die Gerätschaften hatten ihre besten Zeiten hinter sich und der Traktor im Hof war wahrscheinlich das letzte Mal in den 50er-Jahren angesprungen. Die dicke Eichentür zum Weinkeller sah aus, als wäre sie seit Jahren nicht mehr geöffnet worden, so verrostet waren die schweren Scharniere. In allen Räumen des Wohnhauses roch es modrig und ein bisschen vergammelt. Aber dies störte Arnold recht wenig. Ein gesunder Enthusiasmus gehörte einfach dazu.
Arnold schritt durch den Torbogen der Hofeinfahrt und betrat sein neues Zuhause. Jeder Schritt fühlte sich an wie der Gang in eine unbekannte Zukunft und er war ängstlich und euphorisch zugleich. In der Ecke stand ein alter Strohbesen. Er schritt auf ihn zu, schnappte ihn sich und begann, den Hof zu fegen. Arnold spitzte die Lippen und begleitete sein Tun mit einem munteren Liedchen.
Dabei bemerkte er nicht, dass er plötzlich einen Zuschauer bekam. Nachbar Willi Laggei stand im Torbogen und verfolgte amüsiert sein Treiben.
»Des sieht gut aus, was Se do mache, abber ich denk´, wenn Sie mit dem klaane Bese´ des alles hier uffrahme wolle, komme´ Se sischer in de nächste Jahr´ nit zum Woi´ mache«, rief Willi mit unverwechselbarem Lorcher Akzent über den Hof.
Arnold, kurz überrascht einen Zuschauer zu haben, erwiderte: »Irgendwo muss ich ja anfangen. Ich habe jetzt so lange auf mein eigenes Weingut gewartet, da ist es nicht schlimm, wenn ich die nächsten zwei Jahre noch mit Fegen verbringe.«
Der Mann grinste und kam auf Arnold zu.
»Ich bin de´ Willi von nebe´ an.«
»Freut mich, ich bin Arnold aus Mecklenburg.«
»Melckleburg? Ei, was verschlägt Sie dann hier in de´ Rheingau? Habt ihr keine Küh´ mehr zum Melke?«
Arnold lachte. Ihm gefiel der direkte Humor des Einheimischen. Genauso hatte er die Menschen hier in seiner Studienzeit kennengelernt. Ehrlich, authentisch und immer mit einer Prise Humor. Der herrliche Dialekt untermalte den sympathischen Eindruck.
»Doch, doch, die Kühe sind uns in Mecklenburg noch nicht ausgegangen. Aber irgendwie hatte ich schon immer den Drang, durch die Weinberge zu klettern, anstelle Kühe zu melken.«
»Jo, des kann ich verstehe´ - do kimmt jo ach nur Milch naus und nit das gute Stöffche, was mir hier Riesling nenne´.«
Es war nicht zu übersehen und kein Zweifel, dass hier eine gute Basis für eine freundschaftliche Nachbarschaft entstand.
»Ei, komm´ Bub´, jetzt mach´ Paus´ und komm´ mit nübber bei misch. Do ziehe mir en´ schee Flasch´ Lorcher Woi uff und babbele en bissje.«
Obwohl Arnold gerade voll in seinem Element war und seine Energie jetzt gern für seinen Hof genutzt hätte, nahm er die Einladung dankend an. Ein Nachbarschaftsverhältnis sollte nicht damit starten, dass eine nett gemeinte Einladung auf ein Glas Wein ausgeschlagen wurde.
»Aber gerne. So ganz weiß ich eh noch nicht, wo ich anfangen, geschweige denn weitermachen soll. Da können wir auch zuerst eine gute Grundlage mit einem Glas Wein schaffen«, sagte Arnold und lächelte.
»So muss des sein … aber ein Glas is´ gut, zwei sin´ besser - uff einem Bein kann mer schließlich auch nit stehe«, sagte Wille und grinste dabei übers ganze Gesicht.
»Auf geht´s!«, rief er, drehte sich um und bog nach rechts zu seinem Haus ab. Arnold folgte den schnellen Schritten seines neuen Nachbarn.
Ein neuer Freund
Am Haus angekommen, zog Willi die alte, rostige Tür zum Vorgarten auf und bat seinen Gast hinein. Im Garten blieb er kurz stehen.
»So, do sind mir, willkommen auf Laggei´s Hof«, sagte er schmunzelnd.
»Schön habt ihr es hier«, erwiderte Arnold und blickte sich um. Der Garten war sehr geschmackvoll angelegt. Überall blühten Blumen und es roch nach frisch gemähtem Gras. In der Mitte des Gartens stand eine alte, stilvoll bepflanzte Weinkelter. Strauchgewächse rankten aus der alten Weinmacher Gerätschaft heraus, die ihren ursprünglichen Dienst wohl schon lange hinter sich gelassen hatte. Willis Haus war im Fachwerkstil gebaut und musste mehrere hundert Jahre alt sein. An der Hauswand drängten sich dezent zugeschnittene Sträucher. Es war ein richtiger Ort zum Wohlfühlen. Arnold spürte, dass hier jemand sehr viel Liebe in die Gestaltung seines Heims gesteckt hatte.
»Schee´ habe mir es hier?«
»Auf jeden Fall, ich bin beeindruckt. Steckt viel Liebe drin.«
»Jo, und vor allem Schweiß. Das ganze Kraut hier ringsrumm wächst wie blöd und will fast jed´ Woch´ geschnitte´ werde«, flachste Willi. »Auf komm´, ab in die Stub´, ich hab´ was Feines für uns!«
Arnold nickte. »Na dann, auf geht´s!«
Willi schritt wieder voran rechts am Haus vorbei in einen Hinterhof. Der Vorgarten hatte es Arnold schon richtig angetan und der Hinterhof stand dem in nichts nach, stellte er überrascht fest. Willi hatte hier eine kleine Weinlaube errichtet, an der sich Reben an verschiedenen Gestängen nach oben rankten. Der Anblick traf voll und ganz Arnolds romantische Ader. Hier konnte man viele schöne Stunden verbringen.
Willi zog eine Holztür auf, die offensichtlich in seinen Weinkeller führte. Sowie der Gang nach unten offenstand, drang der unverwechselbare Kellergeruch in Arnolds Nase. Wie sehr liebte er dieses Aroma. Diesen Duft gab es wirklich nur hier, wo der Wein tatsächlich wuchs und Keller in die Felsen geschlagen wurden.
»Auf, komm´ mit. Mir gugge mo´, was mir im Keller finde´!«, forderte Willi Arnold auf.
Er schaltete das Licht ein. Es war gedimmt und leuchtete den Treppengang gerade eben aus. Unten angekommen, bot sich Arnold ein wahres Mekka für Weinliebhaber. An allen Wänden waren Holzregale montiert und boten eine große Auswahl verschiedenster Weine. Man konnte Willi ansehen, dass er sehr stolz auf seine Sammlung war. Er schritt am Regal entlang und musterte die Flaschen mit seinem geschulten Blick. Er wollte seinem neuen Nachbarn schließlich ein besonderes Tröpfchen anbieten. Ein echter Lorcher ließ sich schließlich nicht lumpen.
Willi blieb am Ende des Regals stehen und zog eine Flasche heraus. Wieder musterte er das Etikett.
»Hier hab´ ich was für uns zwei Hübsche´.« Dabei grinste er bis über beide Ohren. »Ein feine´ Riesling von ´88.«
»Das hört sich gut an, kannst du diesen Jahrgang demnach empfehlen?«
»Lorcher Jahrgäng sin´ alle zu empfehle´«, scherzte Willi, »aber ich such´ immer gern´ ein Jahrgang aus, zu dem es ein bissje was zu erzähle´ gibt.«
»Okay, dann scheint es wohl zu dem Jahrgang einiges zu erzählen zu geben. Wie ich sehe, liegen hier jede Menge Flaschen aus dem Jahr?«