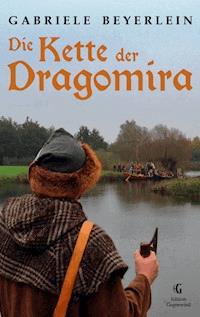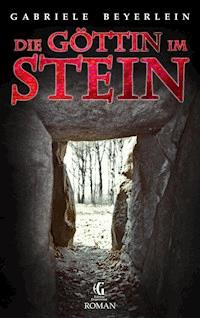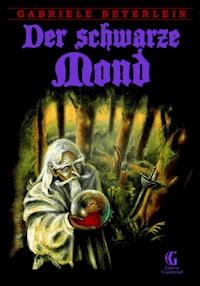Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Edition Gegenwind
- Sprache: Deutsch
Kai vermisst so sehr seinen Kater Felix. In einem Computerspiel über die Suche nach dem versunkenen Atlantis meint er dem Kater zu begegnen - und findet sich plötzlich in einer geheimnisvoll fremden Welt wieder. Dort soll er "seine Aufgabe" erfüllen. Aber worin besteht sie? Ein fantastisches Abenteuer beginnt. Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÜBER DIE AUTORIN
Gabriele Beyerlein ist seit 1987 freie Schriftstellerin und hat mehr als dreißig Bücher für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene veröffentlicht, darunter einige Fantasygeschichten und zahlreiche in der Vergangenheit spielende Jugendromane, in denen sie eine spannende Handlung mit historischer Genauigkeit verbindet. Ihre Bücher standen wiederholt auf Nominierungslisten für Literaturpreise. Sie erhielt den Heinrich Wolgast Preis 2008 und den Gerhard Beier Preis 2010.
Gabriele Beyerlein hat Psychologie studiert, promoviert und in der sozialwissenschaftlichen Forschung und Lehre gearbeitet. Nachdem sie ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckt hatte, machte sie sich als Autorin selbstständig. Sie lebt heute in Darmstadt.
www.gabriele-beyerlein.de
www.facebook.com/gabriele.beyerlein.autorin
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
1
Die ganze Woche habe ich es geschafft, nicht an die Flötenstunde zu denken, fast jedenfalls. Aber jetzt ist Donnerstagnachmittag und Donnerstagnachmittag muss ich in die Musikschule.
Sonst macht mir das nichts aus. Obwohl ich viel lieber Schlagzeug lernen würde als Blockflöte, aber meine Eltern sagen, ein Schlagzeug ist teuer, und bevor sie mir eines anschaffen, wollen sie sehen, ob ich überhaupt ein Jahr Musikunterricht durchhalte. »Durchhalte«, wie das schon klingt! Wenn ich ein Schlagzeug hätte, würde ich jeden Tag üben, so viel ist sicher. Vielleicht bekomme ich eines zum Geburtstag.
Letzte Woche hat Tim mich gesehen, als ich mit den anderen aus der Flötenstunde kam: vier Mädchen und ich. Kann ich doch nichts dafür, dass ich der einzige Junge in der Gruppe bin. Obwohl, blöd sieht das schon aus. Und als Tim dann so gegrinst hat und gesagt: »Flötenstunde, Mädchenstunde«, da habe ich geantwortet: »Hast du eine Ahnung, was ich hier für Sachen mache!« Natürlich hat er dann wissen wollen, was für Sachen, und mir ist so schnell nichts eingefallen und ich habe mit den Schultern gezuckt und gesagt: »Wirst schon sehen!« Und weil mir immer noch nichts eingefallen war, habe ich bei einem Fahrrad, das vor der Musikschule stand, die Ventile rausgedreht und in den Gully geworfen. Tim hat das gut gefunden und wie verrückt gelacht. Aber der große Junge mit dem roten Drachen auf der Jacke nicht. Dem gehört nämlich das Fahrrad und der kam ausgerechnet in diesem Augenblick aus der Musikschule.
Tim und ich sind weggelaufen. Aber der Junge hat uns gesehen. Was mache ich, wenn er mich wiedererkennt?
Er ist mindestens drei Jahre älter als ich. Und einen ganzen Kopf größer. Und er sieht aus, als ob er Sport macht. Vielleicht sogar Judo. Oder Karate.
Er hat auch Donnerstagnachmittag Musikschule.
Wenn ich die Ventile wenigstens nur auf den Gehsteig geworfen hätte und nicht in den Gully!
Vielleicht rufe ich die Flötenlehrerin an und sage, ich bin krank. Halsweh habe ich sowieso schon.
Doch Claudia blockiert seit Stunden das Telefon. So ist das mit großen Schwestern, wenn sie verknallt sind. Ich könnte sie ja bitten, kurz aufzuhören. Aber sie soll bloß nicht denken, ich rede wieder mit ihr. Das tu ich nämlich nicht mehr. Wegen Felix, meinem Kater. Da frage ich ja noch lieber meinen Bruder, ob er zufällig Lust hat, mich zur Musikschule zu begleiten. Thorsten ist fünfzehn und noch größer als dieser Junge.
Aus seinem Zimmer kommen so Geräusche: Ballern und Schießen und Kreischen. Das ist sein neuestes Computerspiel. Plötzlich schreit Thorsten: »Scheiße!« Jetzt ist er tot.
Wahrscheinlich ist seine Laune da gerade nicht am allerbesten. Aber die ist sowieso nie gut, jedenfalls nicht, wenn ich etwas von ihm will.
Schnell mache ich seine Tür auf. »Thorsten«, beginne ich, »würdest du vielleicht mit mir zur Musikschule gehen, da ist nämlich ...
»Bist du ein Baby, oder was?«, fragt Thorsten und startet mit einem neuen Leben. Auf dem Monitor ist ein dunkler Gang. Von Thorsten, ich meine von seinem Helden, sieht man nicht mehr als den rechten Arm mit der Pistole in der Hand.
»Verschwinde«, sagt Thorsten, »das Spiel hier ist nichts für Kinder.«
Na ja, hätte ich mir denken können, dass Thorsten mich nicht begleitet.
Claudia telefoniert immer noch. Ich nehme meine Jeansjacke und die Flötentasche und gehe los.
Draußen regnet es. Ich halte mir die Tasche über den Kopf und renne. Bis zu der Ecke, von der aus man die Musikschule sieht. Hier halte ich vorsichtshalber erst mal an. Da steht er, der Junge. Genau im Eingang.
An dem komme ich nicht vorbei, ohne dass er mich sieht, so viel ist sicher.
Ein paar Kinder gehen aus der Schule weg in die andere Richtung. Sonst ist kein Mensch da.
Wäre ich nicht so spät dran, könnte ich hier auf die Mädchen aus meiner Gruppe warten und mit ihnen reingehen. Warum ist mir das nicht eher eingefallen!
Ich ziehe mich hinter die Hausecke zurück. Inzwischen regnet es nicht mehr, es schüttet. Meine Turnschuhe sind schon ganz durchweicht.
Wenn der Junge auch um drei Unterricht hat, muss er doch längst reingehen. Ich schaue um die Ecke. Sehe die Jacke mit dem roten Drachen. Verdrücke mich wieder.
Der Wind peitscht mir den Regen ins Gesicht. Es ist schrecklich kalt.
Der Junge steht immer noch im Eingang unter dem Dach. Er wird nicht nass.
Jetzt ist es schon zehn nach drei. Da kann ich sowieso nicht mehr in die Flötenstunde, die haben längst ohne mich angefangen, und geübt habe ich auch nicht. Ich muss eben nächstes Mal sagen, ich bin krank gewesen, zu krank, um anzurufen. Wenn der Junge nicht wieder auf mich wartet ...
Ich drehe um und laufe zurück. Ich renne richtig, trotzdem friert mich. Vor der Haustür fällt mir ein, dass ich noch nicht ins Haus kann, falls Claudia auf die Uhr schaut und an meine Flötenstunde denkt. Vielleicht rächt sie sich ja dafür, dass ich nicht mehr mit ihr rede, und sagt Papa, dass ich nicht in der Flötenstunde war. Und Papa soll jedenfalls nichts davon erfahren. Wegen dem Durchhalten und dem Schlagzeug. Und überhaupt. Weil es ziemlich unangenehm werden kann, wenn Papa schimpft.
Ich gehe an unserem Haus vorbei und biege in die nächste Straße ein. Bei Meiers sitzt wieder die schwarze Katze hinter dem Flurfenster und schaut heraus. Sehr vornehm hat sie die Vorderpfoten nebeneinander gestellt und schaut mich reglos an, wie eine Porzellankatze. Oder wie eine Göttin. Die Ägypter früher haben geglaubt, die Katzen seien heilig, es gab sogar eine Göttin in Katzengestalt, Bastet hieß die, ich kenne mich aus mit den Ägyptern, ich habe mal ein Buch gelesen über die Pyramiden und die Pharaonen und so, und da stand das von der Katzengöttin, und wie die Katze von Meiers da im Fenster sitzt und so unbeweglich schaut, da finde ich, sie haben Recht gehabt, die alten Ägypter.
Ich gehe hin und tippe mit dem Zeigefinger gegen die Glasscheibe. Da schlägt die Katze mit ihrer Pfote aus, als wolle sie meinen Finger durch das Glas fangen. Dann, damit ich nicht denke, sie hätte mit mir gespielt, leckt sie sich ausgiebig ihre Pfote, setzt sich wieder elegant zurecht und tut, als würde sie mich nicht sehen. Ich würde sie gerne kraulen, an der Kehle auf ihrem weißen Fleck.
Mein Felix hat auch einen weißen Fleck gehabt. Und ein schwarzes Fell. Nur kleiner war er, auch wenn er ein Kater war, aber eben ein sehr junger. Er konnte einen wunderschönen Buckel machen. Und seinen Schwanz fangen. Und im Luftsprung nach Sonnenstrahlen jagen. Wenn ich ihn im Arm gehalten habe und er ganz laut geschnurrt hat und mich mit seiner kühlen Schnauze ins Gesicht gestupst, dann war ich ungefähr der glücklichste Junge auf der ganzen Welt. Es hat mir fast nichts ausgemacht, dass Mama nicht da war, wenn ich aus der Schule kam, weil sie jetzt auch nachmittags arbeitet und nicht mehr nur vormittags. Weil sie mit einer Halbtagsstelle nicht Abteilungsleiterin werden kann, hat sie gesagt, und weil große Kinder große Ansprüche haben.
Ich habe keine Ansprüche, nur Felix, sonst nichts. Felix habe ich lieb gehabt, lieber als alles.
Ich habe ihn ja immer noch lieb.
Aber er ist nicht mehr bei uns. Und daran ist Claudia schuld. Meine Schwester ist nämlich krank geworden, ihre Augen waren rot, dauernd sind ihr die Tränen gelaufen und die Nase, und nachts hat sie uns alle wachgehustet. Meine Mutter hat Claudia von Arzt zu Arzt geschickt und dann hat einer behauptet, dass Claudia eine Katzen-Allergie hat und dass sie wegen Felix krank geworden ist. Ich glaube das nicht, ich bin ja auch nicht von Felix krank geworden, und Felix war schon Monate bei uns, bevor das angefangen hat mit Claudias roten Augen und ihrem Husten und allem, und daran sieht man doch schon, dass es nichts mit Felix zu tun hat. Aber Papa hat Felix in irgendein Tierheim gebracht.
Mir haben meine Eltern es erst gesagt, als es schon geschehen war. Sonst hätte ich das nie zugelassen. Ich hätte mich vor das Auto gestellt, so dass Papa nicht hätte losfahren können. Oder ich hätte Felix versteckt. Oder –
Ach, ich weiß auch nicht.
Ich habe Papa gesagt, dass er das nicht hätte tun dürfen. Weil Felix in einem Tierheim unglücklich ist. Er konnte nichts anderes machen, hat Papa behauptet, weil Claudia so schrecklich krank war und es für sie so gefährlich war, dass sie keinen Tag länger mit Felix unter einem Dach leben durfte, und weil so schnell keine Familie für Felix zu finden war, und Felix kommt bestimmt wieder zu einer Familie, die ihn ganz lieb hat. Ich habe Felix aber noch viel mehr lieb, habe ich gesagt, und außerdem gehört er mir und man darf nicht etwas weggeben, was einem anderen gehört, das ist gemein, und ich will Felix zurück, und wenn er ihn nicht aus dem Tierheim zu uns holt, dann hole ich ihn heim. Da ist Papa wütend geworden. Angebrüllt hat er mich, dass ich egoistisch bin und nur an mich selbst denke, und was ich denn überhaupt für ein Bruder bin, ob ich will, dass meine Schwester ihr Leben lang krank bleibt, nur weil ich mich von einer Katze nicht trennen kann, und er will so was von mir nie wieder hören.
Da habe ich nichts mehr gesagt. Nie mehr habe ich etwas von Felix gesagt.
Vielleicht sitzt er in einem Käfig, der so eng ist, dass er seinen Schwanz nicht fangen kann. Oder in den kein Sonnenstrahl fällt, nach dem er springen kann ...
Jetzt läuft mir auch die Nase. Und die Augen tränen. Ich glaube, ich habe eine Katzen-Verlust-Allergie, und die ist viel schlimmer, als eine Katzen-Allergie überhaupt sein kann.
Die Katze von Meiers dreht mir den Rücken zu und springt in den Flur.
Ich gehe nach Hause. Meine Hände und Füße sind eiskalt. Ich zittere richtig. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so gefroren.
2
Ich friere immer noch. Dabei habe ich schon zwei Pullover übereinander gezogen. Und die Heizung so hoch gedreht, dass Mama gestöhnt hat: »Was ist denn hier für eine Hitze?«, als sie aus ihrer Bank nach Hause gekommen ist. »Hast du an die Flötenstunde gedacht?«, hat sie dann gefragt. »Klar«, hab ich gesagt und mich in mein Zimmer verzogen. Dran gedacht hab ich ja auch, das ist nicht einmal gelogen.
Wir sitzen um den Abendbrottisch. Es gibt Pilz-Lasagne, die mag ich eigentlich, aber heute habe ich keinen Hunger. Obwohl es schon spät ist, Papa ist heute noch später aus seinem Büro gekommen als sonst, und Mama besteht darauf, dass wir alle gemeinsam essen. »Damit wir merken, dass wir eine Familie sind«, sagt sie. Aber ich glaube nicht, dass Thorsten das merken will.
Im Fernsehen läuft Werbung. Eine Familie macht eine ganz weite Fahrt in einem schönen Auto und alle sind lieb zueinander und freuen sich.
Wenn wir mit dem Auto irgendwohin fahren, boxt Thorsten mich immer, weil ich mich angeblich zu breit mache, aber ich muss in der Mitte sitzen und habe sowieso kaum Platz, und ich möchte Spiele machen, aber keiner spielt mit, und Claudia mault, weil ich sie nicht schlafen lasse, und Papa brüllt, wir sollen endlich Ruhe geben und jetzt hat er sich unseretwegen verfahren, und Mama ist sauer, weil wir uns streiten.
Claudia hat auch die Werbung gesehen. Jetzt tut sie so, als wisse sie nicht ganz genau, dass ich nicht mehr mit ihr rede, und flüstert mir zu: »Wir haben wohl das falsche Auto!« Claudia weiß oft, was ich denke. Und wenn wir uns dann anschauen, müssen wir lachen.
Ich schau weg. Und gebe keine Antwort.
»Ich muss noch Hausaufgaben machen«, murmelt mein Bruder, nimmt seinen Teller und steht auf.
»Du bleibst!«, befiehlt Papa.
Thorsten verzieht das Gesicht und setzt sich wieder. »Familienidylle«, motzt er. »Hier wird man sogar an der Erfüllung seiner schulischen Pflichten gehindert. Trautes Heim, Glück allein.«
»Wenn dir was nicht passt«, beginnt Papa gereizt, bestimmt sagt er gleich: Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, tust du gefälligst, was ich dir sage! Und wenn Thorsten ihm dann eine patzige Antwort gibt, zum Beispiel, dass er die Füße ja auch auf den Tisch legen kann, dann brüllt Papa ihn an.
Thorsten sagt immer, es ist ihm doch gleich, wenn Papa brüllt, das geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus, und außerdem beruhigt der sich schon wieder. Aber ich mag das nicht, wenn Papa brüllt. Vor allem nicht, wenn es mir gilt.
»Wie geht es eigentlich deinem Auftrag?«, fragt Mama dazwischen und sieht Papa an.
Papa hält kurz die Luft an. Eben hat er noch wütend ausgesehen, aber plötzlich grinst er. »Den habe ich bekommen!«, verkündet er stolz.
Den Auftrag. Seit Tagen redet er von nichts anderem, aber ich habe mir trotzdem nicht genau gemerkt, worum es geht. Irgendwie um Autobahnbrücken. Papa ist nämlich Bauingenieur und hat ein eigenes Büro, in dem er den ganzen Tag sitzt und nachrechnet, ob andere Bauingenieure sich nicht verrechnet haben. Und wenn er viele Aufträge zum Nachrechnen kriegt, verdient er viel, und wenn er wenig kriegt, verdient er wenig.
»Ist ja toll!«, ruft Mama. »Herzlichen Glückwunsch! Damit bist du aus dem Schneider!«
Was das mit einem Schneider zu tun hat, wenn man einen Auftrag bekommt, weiß ich nicht.
Papa grinst und dann hebt er sein Glas und prostet uns allen zu, obwohl nur Wasser in seinem Glas ist und man das doch eigentlich nur mit Wein macht, glaube ich jedenfalls.
»Stark!«, sagt Claudia. »Gratuliere!« Sie stößt mit ihrem Milchbecher mit Papa an. »War mir klar, dass du den Auftrag kriegst. Du bist halt der Beste. Na ja, mein Vater eben!«
Papa lacht. »Da bin ich aber froh, dass ich mich deiner würdig erwiesen habe! Übrigens – heute ist eine gute Gelegenheit, um Wünsche anzumelden!«
Ich hätte schon einen Wunsch. Einen mit vier Pfoten und einem weißen Fleck an der Kehle. Aber den darf ich nicht sagen. Weil Papa den nie wieder von mir hören will.
»Klasse!«, meint Claudia. »Ich brauche dringend neue Klamotten.«
»Also hör mal«, erhebt Mama Einspruch, »dein Kleiderschrank quillt doch jetzt schon über!«, aber Papa blinzelt Claudia zu. Bestimmt kriegt sie das Geld für neue Kleider von ihm. Das ist mal wieder typisch. Claudia kann sich überall einschleimen, am meisten bei Papa, der tut einfach alles für sie. Sogar meinen Felix in ein Tierheim bringen. Wenn sie gesagt hätte, Felix muss bei uns bleiben, sonst wird sie vor lauter Sehnsucht nach ihm noch viel kränker, dann hätte er Felix bestimmt nicht weggegeben. Oder wenn sie gesagt hätte, ihre Krankheit kommt von der Umwelt. Und außerdem gehört Felix mir.
»Denkst du noch an einen neuen PC?«, fragt Thorsten. »Du weißt doch, meiner hat einfach nicht mehr genug Speicherkapazität, ich hab mich da schon mal informiert und ...«
Ich höre nicht mehr zu. Wenn Thorsten über Computer redet, kapiert sowieso keiner was. In meinem Kopf ist irgendwie Watte. Ich glaube, ich werde krank.
Vielleicht sitzt Felix doch in einem Käfig und sein Fell ist schon ganz stumpf vor lauter Traurigkeit.
»Mit dem neuen Auftrag rückt auch für Kai ein Schlagzeug zum Geburtstag in den Bereich des Möglichen«, erklärt Papa und schaut zu mir. »Allerdings, wie du weißt, nur dann, wenn du bis dahin regelmäßig Flöte übst.«
Flöte. Muss er mich daran erinnern!
Was mache ich, wenn der Junge auch nächste Woche vor der Musikschule auf mich wartet?
»Was ist denn mit dir, Kai?«, fragt Mama und streicht mir durch die Haare. »Du hast ja Schweiß auf der Stirn! Und du isst gar nicht. Du wirst doch hoffentlich nicht krank?«
3
Ich bin doch krank geworden. Die ganze Nacht habe ich nicht richtig schlafen können, sondern lauter wirres Zeug geträumt, und jetzt brennt mein Hals wie ein Sonnwendfeuer, ich kann kaum mehr schlucken und meine Beine tun so seltsam weh.
Mama sitzt am Bettrand. »Auch das noch! Du hast Fieber!« Sie seufzt und schaut ratlos. »Hör mal, Kai, ich kann mir in der Bank nicht schon wieder freinehmen. Als du die Windpocken hattest, bin ich schon drei Tage daheim geblieben, und zwei bei deiner Blinddarmreizung. Du musst das verstehen, es geht dieses Jahr einfach nicht mehr.«
»Ich komm schon zurecht«, krächze ich, »ich bin doch kein Baby mehr!« Vielleicht liest Claudia mir ja vor, jetzt, wo ich krank bin. Ach nein, das geht ja nicht, weil ich mit der nicht mehr ...
Mama zupft an meinem Kissen.
»Ich stelle dir eine Thermoskanne mit Tee her und was zu essen. Und ich bring das Telefon an dein Bett. Wenn was ist, rufst du mich an, ja? Ich schau, dass Thorsten am Nachmittag da ist. Claudia kann nicht, die hat Handball-Training.«
Ich drehe mich zur Wand. Irgendwie will ich nur schlafen.
Draußen im Flur streitet Mama mit Thorsten. Er will nicht mittags heimkommen, weil er sich mit seinem Freund verabredet hat. Papa kommt dazu und macht Thorsten zur Schnecke. Wenn Papa mit mir so schimpfen würde, fände ich das gar nicht witzig, aber Thorsten macht sich nichts draus und motzt zurück, und dann knallt die Tür und Thorsten ist einfach gegangen.
Bestimmt kommt er mittags nicht nach Hause. Ist mir doch gleich. Wenn ich noch ein bisschen geschlafen habe, gehe ich in sein Zimmer und mache seine Computerspiele, den ganzen Tag. Ich schieße Monster ab, bis der Bildschirm voll von grünem Blut ist, denn Monsterblut ist nun mal grün und nicht rot.
Wenn Mama endlich weg ist, kann ich Felix in mein Bett lassen. Sie will nicht, dass er in meinem Bett schläft, aber es ist so schön, wenn er sich auf meine Füße kuschelt und ganz laut schnurrt ...
Ich muss wohl geschlafen haben.
Ich bin total nass, meine Haare kleben mir im Gesicht und mein Schlafanzug am Körper, und das Kissen, das ich im Arm halte, ist auch ganz verschwitzt. Aber es geht mir viel besser.
Komisch, irgendwie habe ich das Gefühl, Felix war da. Aber das ist ja Schwachsinn. Leider.
Auf meinem Nachttisch stehen das Telefon, eine Thermoskanne, ein Becher, ein Fruchtquark und ein Teller mit Mandarinen und Bananen und meinen Lieblings-Keksriegeln, und an der Kanne lehnt ein Zettel: »Du hast so fest geschlafen, da bin ich gegangen ohne dich zu wecken. Schlaf dich gesund und bleib schön im Bett! Ich ruf dich später mal an. Gruß und Kuss, Mama.«
Ich trinke einen Becher Pfefferminztee. Er ist noch heiß und es tut weh, wenn ich ihn schlucke, aber das Trinken ist trotzdem gut. Dann stehe ich auf und ziehe mich an. Sweatshirt und meine bequemste Jeans, an der vom Lagerbauen im Wald noch mein Messer am Gürtel hängt. Und dann auch noch meine Jeansjacke, weil die gerade auf dem Fußboden rumfliegt. Ich decke sogar mein Bett auf, damit es trocknen kann, während ich in Thorstens Zimmer Computerspiele mache.
Thorsten mag nicht, dass ich an seinen Computer gehe, wenn er weg ist. Er bringt mich um, wenn ich es tue, hat er gesagt. Aber wenn er da ist, sitzt er selber dran. Also wann soll ich dann spielen?
Und das mit dem Umbringen, das ist nur so eine Redensart.
Ich lege die Scheibe mit seinem neuesten Spiel ein und rufe es auf. Ich fange bei der leichtesten Stufe an, bewege mich mit den Tasten durch den dunklen Felsengang, die Hand mit der Pistole vorgestreckt. Überall im Fels sind Nischen und Vorsprünge, hinter denen sich Monster verstecken können. Jeden Augenblick kann eines hervorspringen und mich angreifen. Und natürlich können die auch von hinten kommen und deswegen muss ich mich immer wieder schnell umdrehen, das mache ich, ist doch klar.
Ich muss eine bessere Waffe finden. Oder eine Schutzrüstung. Sonst sieht es schlecht für mich aus, wenn sich ein Monster auf mich stürzt.
Der Gang gabelt sich. Links geht ein ganz finsterer Gang ab, aus dem rechten kommt ein schwaches rotes Licht. Ich gehe nach rechts, plötzlich sind Schlangen am Boden, ich kann gerade noch über sie drüberspringen, und dann komme ich in einen Höhlensaal.
Ich sehe eine große Holztruhe. Sie sieht fast aus wie ein Sarg. Vielleicht ist da ein Maschinengewehr drin, eine Laserpistole oder ein Schutzschild. Also gehe ich genau auf die Truhe zu und drücke die Aktionstaste. Der Deckel schlägt auf – und ein Monster springt heraus. Ich schieße, aber ich treffe es nur in den Bauch, grünes Blut spritzt, aber es kommt trotzdem auf mich zu, ich schieße noch einmal, und da sinkt es endlich in die Truhe zurück und der Deckel fällt zu.
Mit den Tasten bewege ich mich von der Truhe weg. In einer dunklen Nische der Höhlenwand entdecke ich eine schwere Tür und öffne sie. Dahinter ist wieder ein dunkler Gang. Und ganz plötzlich ist da ein großer Drache mit einem schuppig gepanzerten Körper und einem starken Schweif mit spitzem Stachel und mit vielen Köpfen, mindestens acht oder zehn.
Ich schieße, aber der Drache zuckt nicht einmal, eine Pistolenkugel kann dem nichts anhaben, was mache ich jetzt, plötzlich ist der eine Kopf des Drachen ganz dicht vor mir, er öffnet das Maul mit den furchtbaren Zähnen, ein glühender Feuerstrahl schießt heraus, ganz rot wird es auf dem Bildschirm und dann auf einmal schwarz.
Ich bin tot.
Schweiß läuft mir den Rücken hinunter. Ich habe bestimmt wieder Fieber.
Ich könnte noch mal von vorn anfangen, aber ich habe keine Lust mehr. Früher hat Thorsten andere Spiele gespielt, richtige Abenteuer, die waren viel besser.
Ich wische meine Hände an meinem Sweatshirt ab und suche seine Spiele durch, aber ich finde nur Ballerspiele oder Strategiespiele, bei denen man Krieg führen muss. Danach ist mir jetzt gerade nicht. Dann sehe ich eins, dessen Name mir gefällt: »Der Schatz von Atlantis«.
Schatzsuche, das ist bestimmt spannend und dabei muss man nicht immer nur schießen und kämpfen.
Ich rufe das Spiel auf. Es kommt eine schöne Musik und ich sehe aus der Höhe eine Insel in einer Meeresbucht, die Insel kommt immer näher und man sieht, dass sie einen Hügel hat, der von einer glänzenden Mauer und drei kreisrunden Wasserkanälen umgeben ist, ein Palast steht mitten auf dem Hügel, ein breiter Kanal führt von dem Hügel weg zum Meer, und dort sind ein Hafen und eine große Stadt. Die Kamera zoomt in die Stadt, dort gibt es altmodische Häuser und Pferdewagen und Esel und Ochsenkarren wie bei Asterix, aber keine Autos, und daran erkennt man gleich, dass es um eine Zeit geht, die schon ewig lange vorbei ist.
Dann sieht man einen großen Platz in der Stadt mit einer Menge Leute, Männer mit Lanzen oder Schwertern und Frauen mit Körben. Die Kamera geht noch näher heran und zeigt Händler und verschiedene Handwerker, und dann sieht man auch noch Sklaven, die man an dem Aufseher mit der langen Peitsche erkennt.
Die Kamera zeigt noch viel mehr, einen König auf seinem Thron und Tänzerinnen und einen Priester im weißen Kleid, der die Sterne beobachtet, und eine Schatzkammer voller Gold und Silber und Edelsteine, und die ganze Zeit erklärt eine Stimme, was man sieht und dass das Basileia, die Königsinsel von Atlantis, ist, die vor langer Zeit der Mittelpunkt eines großen Reiches war. Und dann sieht man zehn Könige, die um eine glänzende Säule herumstehen, während ein Priester einen Stier schlachtet, und die Stimme sagt: »Jeweils zehn Könige regierten gemeinsam das Reich von Atlantis und sie übten ihr Amt mit Weisheit, Güte und Vernunft aus und gehorchten den Gesetzen, die der Meeresgott Poseidon ihnen gegeben hatte und die auf einer Säule aus Bernstein in der Mitte des Heiligtums in ihrem Palast eingraviert waren. Und die Atlanter lebten lange Zeit in Frieden, Tugend und Ehrfurcht vor den Göttern.«
Jetzt ändert sich die Musik und wird irgendwie bedrohlich und die Stimme fährt fort: »Doch dann bekamen niedrige menschliche Gesinnung, Habsucht und Machtgier die Oberhand unter ihnen und sie verloren den Blick für die wahren Werte.«
Jetzt schwenkt die Kamera zum Himmel, man sieht einen Palast auf den Wolken, darin liegen die Götter auf goldenen Sofas und einer von ihnen hat eine Waffe, die so ähnlich aussieht wie eine Heugabel, in der Hand und sagt zornig: »Diesen frevlerischen Atlantern ist ihr Reichtum zu Kopf gestiegen! Sie verehren mich nicht mehr, mich, Poseidon, der ich sie mit meiner Gnade überhäuft habe! Sie gehorchen meinen Gesetzen nicht mehr, sie opfern mir keine Stiere mehr, ja, sie lästern mich sogar!« Da schleudert der größte der Götter mit Blitzen um sich und erklärt: »Ich werde die Atlanter furchtbar bestrafen, ihre Insel werde ich versenken, so wahr ich der Gott der Götter bin!«
Vom Himmel herunter sieht man nun wieder auf die Insel im Meer, da kommt plötzlich eine riesige Flutwelle und rollt auf die Insel zu, und dann sieht man nur noch Wasser und Wellen auf dem Bildschirm und die Stimme sagt: »So versank Atlantis im Meer, und mit ihm aller Reichtum.« Ich kriege richtig eine Gänsehaut. Aber vielleicht ist das auch nur das Fieber.