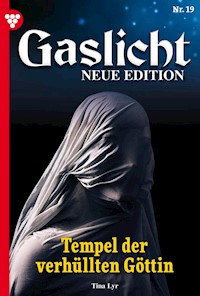Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gaslicht
- Sprache: Deutsch
In dieser neuartigen Romanausgabe beweisen die Autoren erfolgreicher Serien ihr großes Talent. Geschichten von wirklicher Buch-Romanlänge lassen die illustren Welten ihrer Serienhelden zum Leben erwachen. Es sind die Stories, die diese erfahrenen Schriftsteller schon immer erzählen wollten, denn in der längeren Form kommen noch mehr Gefühl und Leidenschaft zur Geltung. Spannung garantiert! Am Morgen wurde Braen Salruan tot in einem Waldstück beim Dorf aufgefunden. Erdrosselt. Der Mörder hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihn gründlich zu verstecken. Die Leiche des alten Hirten war einfach in der Erde verscharrt worden. Reiner Zynismus? Oder ein erneuter Versuch, den Verdacht auf die Aspens zu lenken? Die Gegend geriet in hellen Aufruhr. Noch heute träume ich oft von Aspen Hall. Es sind schreckliche Träume, aus denen ich schweißgebadet erwache. Aber meine Träume sind harmlos, weil ihnen die Substanz fehlt; sie können mir keinen Schaden zufügen. Sie sind nichts weiter als der schwache Nachhall einer vergangenen Realität. Vielleicht werden meine Erinnerungen an das Schloß eines Tages verblassen, doch vergessen kann ich es wohl nie. Zu ungeheuerlich sind die Erfahrungen, die ich bei den Aspens gemacht habe. Bei ihnen habe ich das Böse kennengelernt; das Böse in Reinkultur. Es geht dabei um weit mehr als um unsere menschliche Doppelnatur, um unsere positiven wie negativen Eigenschaften. Ich spreche von einer charakterlichen Verderbtheit, die selbst für die Liebe unüberbrückbar ist; von einer abgrundtiefen Schlechtigkeit, die für die Hölle selbst steht. Natürlich ist mir bewußt, daß es auf Erden nichts Absolutes gibt. Doch die Annäherung daran liegt durchaus im Bereich unserer Möglichkeiten. Zu allen Zeiten haben unter uns Menschen gelebt, die bestrebt waren, sich im Guten zu vervollkommnen, und solche, die Perfektion im Bösen suchten. Beide Extreme sind selten, doch sie treten auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaslicht – 50 –Der schreckliche Verdacht
Tina Lyr
Am Morgen wurde Braen Salruan tot in einem Waldstück beim Dorf aufgefunden. Erdrosselt. Der Mörder hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihn gründlich zu verstecken. Die Leiche des alten Hirten war einfach in der Erde verscharrt worden. Reiner Zynismus? Oder ein erneuter Versuch, den Verdacht auf die Aspens zu lenken? Die Gegend geriet in hellen Aufruhr. Welch grauenhafter Auftakt zu meiner Hochzeit …
Noch heute träume ich oft von Aspen Hall. Es sind schreckliche Träume, aus denen ich schweißgebadet erwache. Aber meine Träume sind harmlos, weil ihnen die Substanz fehlt; sie können mir keinen Schaden zufügen. Sie sind nichts weiter als der schwache Nachhall einer vergangenen Realität. Vielleicht werden meine Erinnerungen an das Schloß eines Tages verblassen, doch vergessen kann ich es wohl nie. Zu ungeheuerlich sind die Erfahrungen, die ich bei den Aspens gemacht habe. Bei ihnen habe ich das Böse kennengelernt; das Böse in Reinkultur. Es geht dabei um weit mehr als um unsere menschliche Doppelnatur, um unsere positiven wie negativen Eigenschaften. Ich spreche von einer charakterlichen Verderbtheit, die selbst für die Liebe unüberbrückbar ist; von einer abgrundtiefen Schlechtigkeit, die für die Hölle selbst steht. Natürlich ist mir bewußt, daß es auf Erden nichts Absolutes gibt. Doch die Annäherung daran liegt durchaus im Bereich unserer Möglichkeiten.
Zu allen Zeiten haben unter uns Menschen gelebt, die bestrebt waren, sich im Guten zu vervollkommnen, und solche, die Perfektion im Bösen suchten. Beide Extreme sind selten, doch sie treten auf. Die einen verehren wir als Heilige, die anderen gelten als Sadisten und Satanisten. Während ein Heiliger wegen seines beispielhaften Lebenswandels oft bald als solcher erkannt wird, ist ein Satanist imstande, seine Umwelt lange Zeit über sein wahres Wesen hinwegzutäuschen. Er muß sich verstellen, um seine Opfer fest in seine Gewalt zu bekommen. Die Tarnung ist nicht nur zweckdienlich, sie bedeutet für ihn auch einen erheblichen Lustgewinn. Für die bedauernswerten Menschen, die nichtsahnend in seine Fänge geraten, wirkt sich die Unvereinbarkeit von Schein und Sein oft fatal aus.
Manchmal wandere ich den Hügel zum Schloß empor und durchquere wie früher den steinernen Torbogen mit den beiden mächtigen Steinlöwen, die scheinbar sprungbereit eine rauchgeschwärzte Ruine bewachen. Aspen Hall ist niedergebrannt. Rußige, mit Unkraut überwucherte Mauerfragmente künden vom Untergang eines glanzvollen Herrensitzes, der noch fünf Jahre zuvor zu den stolzesten der Insel zählte. Erhalten sind bloß die monströsen Statuen in den Gärten.
Wie immer liegt eine intensive Stille über der Szenerie. Schon zu Lebzeiten der Aspens pflegten Vögel und andere Tiere diesen Ort zu meiden, und es ist fraglich, ob sie je zurückkehren werden. Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, sondern mit dem Gespür freilebender Geschöpfe für Unheil. Der Eindruck drohender Gefahr wirkt in der Natur sehr nachhaltig.
Fröstelnd reiße ich mich von dem gespenstischen Anblick los und betrete den unversehrt gebliebenen Familienfriedhof, der an den südlichen Park grenzt. Das gesamte Geschlecht der Aspens liegt in diesen Gräbern, angefangen bei Roderick, dem Ahnherrn der Sippe, bis hin zu Ronald, dem jüngsten Sproß. Sie sind tot, erloschen. Und mit ihnen das Böse, das von ihnen ausging. Übrig sind nur noch ihre Namen und ihre letzten Ruhestätten. Die Erinnerung an die Herren von Aspen Hall wird allerdings noch lange lebendig bleiben und eines Tages zur schaurigen Legende werden. War es das, was sie bezweckten? Ich weiß es nicht.
Vor dem Grab jener außergewöhnlichen Frau, die Aspen Village und nicht zuletzt auch mich vor einer endlosen Kette von Leid bewahrte, lege ich einen Strauß weißer Rosen nieder. Es ist eine Geste der Versöhnung. Auf diesem Grab liegen noch andere Blumengebinde; es ist das einzige, das hingebungsvoll gepflegt wird. Der ganze Ort trägt zu seinem Schmuck bei. Die Leute wissen, warum sie es tun.
Behutsam streiche ich mit den Fingerkuppen über die Inschrift auf dem schlichten schwarzen Marmorkreuz. Es sind nur vier Worte: Sie ruhe in Frieden.
Ich hoffe es aus ganzem Herzen.
*
Dampfend und pfeifend fuhr der Zug durch eine flache, nebelverhangene Moorlandschaft und rollte am frühen Nachmittag im Bahnhof von Bodmin ein. Hastig suchte ich mein Gepäck zusammen und verließ das Abteil, in dem ich seit nahezu fünf Stunden allein gesessen hatte. Es gab wenige Leute, die es Ende Februar nach Cornwall zog. Auch ich fand die Aussicht, die nächsten Monate oder gar Jahre in diesem entlegenen Teil Englands zu verbringen, nicht gerade verlockend, doch Bettler dürfen bekanntlich nicht wählerisch sein.
Ächzend kam der Zug zum Stehen.
Ich knöpfte meinen Umhang bis zum Hals zu, nahm meine Koffer und kletterte etwas steif das Trittbrett hin-ab. Dann stand ich verloren auf dem Bahnsteig und sah mich suchend um. War niemand gekommen, um mich abzuholen? Ich hatte meine Ankunftszeit doch telegrafisch durchgegeben.
»Miß Duclerque?« sagte hinter mir eine schnarrende Stimme, die einen entschieden unwirschen Beiklang hatte.
»Ja?«
Ich drehte mich um. Vor mir stand ein knochiger, klapperdürrer alter Mann in einer verschlissenen Kutscheruniform. Sein hageres, mit unzähligen Narben und Falten zerfurchtes Gesicht unter der verbeulten Mütze zeigte einen griesgrämigen Ausdruck. Verkniffene braune Augen mu-sterten mich voll intensiver Abneigung. Die schmalen Lippen wölbten sich grimmig nach unten, wie bei einem zähnefletschenden Straßenköter. Fast erwartete ich, ein bösartiges Knurren zu hören.
»Sind Sie Miß Duclerque, Master Ronalds Gouvernante?« forschte der Mann herrisch. Fast schien es, als hege er Zweifel an meiner Identität.
»Ja, ich bin Sheila Duclerque.« Herausfordernd fügte ich hinzu: »Guten Tag.«
Der Alte rümpfte die spitze Nase und erwiderte meinen Gruß mit einem angedeuteten Kopfnicken. »Ich heiße Breward Lenthcarrow«, verkündete er mürrisch und bückte sich schwerfällig nach meinen Koffern. »Wenn Sie die Person sind, die ich abholen soll, dann trödeln Sie nicht. Wir haben eine lange Fahrt vor uns.« Mit diesen Worten stapfte er los. Widerstrebend folgte ich ihm. Höflichkeit gehörte offenbar nicht zu seinen Stärken. Trotzdem wagte ich einen Versuch, ihn für mich zu gewinnen.
»Mr. Lenthcarrow?«
Der Kutscher stieß einen grollenden Laut aus, der wie eine Verwünschung klang. Offenbar war er nicht gewillt, sich mit mir auf eine Unterhaltung einzulassen.
Ich riskierte einen zweiten Vorstoß. »Wie weit ist es zum Schloß?«
»Warten Sie’s ab«, lautete die unverbindliche Antwort.
Ich gab es auf. Gegen soviel Mißmut kam ich nicht an.
Das war kein vielversprechender Auftakt für mein neues Leben als Angestellte. Hoffentlich waren die übrigen Einheimischen liebenswerter als dieser unsympathische Patron, der den Auftrag hatte, mich nach Aspen Hall zu befördern. Ein Jammer, daß Breward Lenthcarrow so wortkarg war. Sein Verhalten verbot es mir, ihm die Fragen zu stellen, die mir auf dem Herzen lagen. Fragen in bezug auf die Aspens. Ich wußte so gut wie nichts über meine zukünftigen Arbeitgeber und hätte meinen Begleiter gern etwas ausgehorcht, bevor ich in die Höhle des Löwen ging. Wie die Dinge lagen, mußte ich meine Wißbegier leider bezähmen.
Eine Information hatte der Kutscher mir allerdings doch gegeben, nämlich, daß mein Zögling Ronald hieß. Das war wenig genug.
In einer Aufwallung von Trotz schnitt ich dem Rücken des Alten eine Grimasse. Zugegeben, es war eine kindische Reaktion, doch sie tat mir wohl, weil sie den dumpfen Druck in meinem Magen löste.
Vor dem Bahnhof wartete eine altertümliche Reisekutsche, auf deren Dach der Alte meine Koffer verlud. Eine brüske Kopfbewegung forderte mich zum Einsteigen auf. Ich gehorchte wütend. Nie zuvor war ich einem so ungehobelten, sprechfaulen Menschen wie Breward Lenthcarrow begegnet. Wenn sich schon der Kutscher so ruppig benahm, wie mochte es dann um die Aspens selbst bestellt sein? Ein Herr ließ sich am besten an seinen Dienstboten messen, hieß es immer. Falls diese Binsenwahrheit zutraf, dann standen mir dornige Zeiten bevor. Mir war gar nicht wohl in meiner Haut.
Während der Wagen in südwestlicher Richtung durch eine ursprüngliche, mit Hecken und Buschwerk durchzogene Landschaft fuhr, hatte ich genügend Muße zum Nachdenken. Meine Zukunft bereitete mir Sorgen. Ob der Kutscher für die Bewohner Cornwalls beispielhaft war? Was sollte ich tun, wenn es mir bei den Aspens nicht gefiel? Was, wenn mein Zögling mich ablehnte? Weshalb mußte ein zwölfjähriger Junge überhaupt daheim unterrichtet werden? Warum besuchte er keine öffentliche Schule wie andere Kinder? Es gab doch überall hervorragende Institutionen, die selbst den höchsten Ansprüchen gerecht wurden. Man schrieb das Jahr 1897, und Gouvernanten waren mehr oder minder aus der Mode gekommen. Ob Ronald krank war? Lady Aspen hatte nichts in dieser Hinsicht erwähnt, aber was hieß das schon? Weder ihre Annonce noch ihr Telegramm waren sehr aufschlußreich gewesen.
Hauslehrer/in für 12jährigen Jungen gesucht, hatte die Anzeige in der Gazette gelautet. Darunter war Lady Aspens Adresse vermerkt gewesen. Auf diese dürftigen Angaben stützte sich im gewissen Sinne meine Existenz. Daß es einen Adelskalender gab, der über alle blaublütigen Familien des Landes Auskunft erteilte, war mir leider erst nachträglich während der Bahnfahrt eingefallen. Allerdings, so entschuldigte ich mein Versäumnis, sagte der Adelskalender nichts über den Charakter der einzelnen Aristokraten aus.
Lady Aspens Telegramm auf meine Bewerbung war ebenso knapp wie ihr Inserat gewesen. Erwarte Sie zum frühestmöglichen Termin. Bitte telegrafieren Sie Tag und Zeit Ihrer Ankunft in Bodmin. R. Aspen.
Ob die Schloßherrin nun mit Worten oder mit Geld oder mit beidem geizte, vermochte ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls hatte sie mir einen angemessenen Scheck zur Dekkung meiner Reisekosten zugesandt. Meiner optimistischen Natur entsprechend, war ich geneigt gewesen, darin ein gutes Vorzeichen zu sehen.
Im Augenblick allerdings haderte ich mit meinem Schicksal, das mich dazu zwang, mein Brot bei fremden Leuten zu verdienen. Gewiß, ich hätte auch bei Onkel Charles, Vaters ältestem Bruder, ein Obdach gefunden, doch eine mittellose, unverheiratete junge Frau, die bei Verwandten Zuflucht suchte, mußte damit rechnen, von ihrer Sippe schamlos ausgenutzt zu werden. Um ihre Dankbarkeit zu beweisen, war sie zu unermüdlichem Diensteifer verpflichtet, und natürlich wurde ihr Einsatz nicht entlohnt. Wenn ich schon einer Arbeit nachgehen mußte, die mir nicht gefiel, dann wollte ich es zumindest gegen Bezahlung tun.
Die Fahrt nach Aspen Hall zog sich fast endlos in die Länge. Die feuchtkalte Winterluft drang in den ungeheizten Wagen ein. Frierend kuschelte ich mich in die einzige Decke, die zum Schutz gegen das Wetter bereitlag. Ich konnte nicht gerade behaupten, daß sich die Aspens durch übertriebene Fürsorglichkeit gegenüber ihrem Personal auszeichneten.
Ernste Bedenken keimten in mir auf. Ich verwünschte meine Unbedachtheit, die mich zu diesem voreiligen Schritt veranlaßt hatte. Im Bestreben, rasch eine sichere Bleibe zu finden, bevor Vaters geringe Hinterlassenschaft gänzlich aufgebraucht wäre, hatte ich mich spontan auf die erstbeste Stelle gestürzt, die mir angeboten wurde. Eine Tätigkeit als Gouvernante lag durchaus im Bereich meiner Fähigkeiten, fand ich. Vater hatte mich in alle gängigen Wissensgebiete eingeführt und meine Fortschritte peinlich genau überwacht. Über praktische Unterrichtserfahrung verfügte ich allerdings nicht. Das war auch der Grund gewesen, weshalb ich mich nicht um einen Posten in oder bei London beworben hatte. Im Umkreis der Hauptstadt war das Angebot an Privatlehrern groß; nur wer über ausgezeichnete Referenzen verfügte, durfte auf eine Anstellung hoffen.
»O Dad, ich wünschte, du wärst bei mir geblieben«, sagte ich seufzend. Wie immer trieb mir die Erinnerung an meinen geliebten, vor zwei Monaten verstorbenen Vater heiße Tränen in die Augen. Alles hatten wir gemeinsam unternommen, seine Ausgrabungen in Palästina, seine Reisen quer durch den Nahen Osten, die Recherchen für seine alt- und neutestamentlichen Studien. Die Vorstellung, daß ich einmal heiraten könnte, war mir stets absurd erschienen. Ich hatte meinen Vater, wir gehörten zusammen. Einen Gatten brauchte ich nicht.
Die jahrelangen Auslandsaufenthalte zehrten natürlich an Dads ererbtem Vermögen, doch wir lehnten es ab, mit unseren Finanzen zu knausern. Wozu auch? Wieso sollte ich für eine Mitgift sparen, wenn ich keinen Gedanken an eine mögliche Ehe verschwendete? Sollte ich aus Versorgungsgründen das Heimchen am Herd spielen? Nie und nimmer. Das Leben mit Vater war viel abwechslungsreicher, viel interessanter. Der Orient übte einen geradezu magischen Reiz auf mich aus. Obwohl ich mich den arabischen Sitten anpassen mußte, genoß ich doch mehr Freiheiten, als sie einer wohlerzogenen jungen Frau in Europa zugestanden wurden. Ich meine Freiheiten im intellektuellen Sinn. Ich durfte an jeder gelehrten Diskussion teilnehmen und meine Ansichten offen kundtun, ohne daß ich sogleich abwertend als Blaustrumpf eingestuft wurde. Vater und seine Kollegen akzeptierten mich und mein Urteil – eine hohe Auszeichnung in einer reinen Männerwelt. Vor allem in theologischen Fachkreisen.
Als Vater aus gesundheitlichen Gründen nach England zurückkehrte und in einem kleinen Dorf in Berk-shire eine Pfarrgemeinde übernahm, war es für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen, ihm den Haushalt zu führen und seine Schreibarbeiten zu erledigen. Ich war es auch, die ihn während seines langen Siechtums pflegte. Für ihn kam sein Tod als Erlösung, für mich hingegen bedeutete es größtes Leid und das Gefühl völliger Hilflosigkeit. Auch heute noch stand ich meinem schmerzlichen Verlust fassungslos gegenüber.
Das Schicksal selbst hatte alle unsere kühnen, hochfliegenden Pläne vereitelt. Vaters jüngstes Werk, das Ergebnis einer aufwendigen dreijährigen Forschungsarbeit in Syrien und anderen arabischen Ländern, war wegen seines Leidens nicht mehr so weit gediehen, daß ich es für ihn kompetent zu Ende schreiben konnte. Da das erwartete Honorar dafür ausbleiben würde, mußte ich mich nach einem neuen Broterwerb umsehen. Dieser Umstand hatte mich dazu bewogen, mich als Gouvernante zu bewerben.
Die Nacht war bereits hereingebrochen, als die Kutsche das zum Herrenhaus gehörige Dorf Aspen Village erreichte und in eine breite Allee einbog. Die Wipfel der hohen Bäume bildeten ein dichtes Dach, das kein Licht durchsickern ließ. Am Ende der Auffahrt, auf der Kuppe eines Hügels, inmitten einer terrassenförmig angeordneten Gartenanlage, erhob sich das Schloß. Ich drückte die Nase ans Fenster, um einen ersten Eindruck von meiner zukünftigen Wirkungsstätte zu gewinnen.
Der Anblick trug nicht dazu bei, meine Laune zu heben.
In der mit Nebelschwaden verschleierten Finsternis sah ich nur die Silhouette eines wuchtigen Bauwerks mit einem langgestreckten Mitteltrakt und zwei klobigen Seitenflügeln. Hinter einigen der hohen, in kleinere Rechtecke unterteilten Fenster schimmerte Licht, doch die meisten waren dunkel. Alles in allem hatte die Fassade etwas Düsteres, Abweisendes. Überhaupt schien es mir, als strahle das Haus eine gewisse Feindseligkeit aus, doch dieser Eindruck mochte auf Einbildung und Übermüdung beruhen. Ich durfte mich von meinen traurigen Erinnerungen und der Angst vor einer ungewissen Zukunft nicht beherrschen lassen.
»Brrr!«
Mit einem Ruck hielt das Gefährt vor dem beleuchteten Frontportal an. Zwei riesige Steinlöwen mit aufgerissenem Rachen flankierten die Vortreppe, die zum Eingang führte. Da Breward Lenthcarrow sicher nicht zu den Menschen gehörte, die einer schlichten Gouvernante zuvorkommend beim Aussteigen halfen, öffnete ich selbst die Tür und kletterte unbeholfen aus dem Wagen. Ich war bis in die Knochen durchgefroren. Meine Glieder schmerzten wie nach einer übermäßigen Anstrenung. Ich dehnte und reckte mich, um mein Blut wieder in Zirkulation zu bringen.
Dann stand ich unschlüssig in dem gepflasterten Hof und fragte mich, wie ich mich zu verhalten hatte. Sollte ich forsch den Türklopfer betätigen oder abwarten, bis der Kutscher mich anmeldete?
Die Entscheidung wurde mir abgenommen, denn in diesem Augenblick ging die Portaltür auf. Eine mollige grauhaarige Frau trat heraus und lief eilfertrig auf mich zu.
»Willkommen auf Aspen Hall, Miß Duclerque«, sagte sie freundlich und streckte mir zur Begrüßung beide Hände entgegen. »Herrje, Sie sind ja ganz klamm vor Kälte«, stellte sie erschrocken fest. »Rasch hinein mit Ihnen, damit Sie sich keine Lungenentzündung holen. Hätte uns gerade noch gefehlt, wenn Sie krank würden.«
»Keine Sorge, ich bin zäh«, erwiderte ich, der Wahrheit entsprechend.
»Blanke Aufschneiderei, Miß. Schmächtig, wie Sie sind, kann ein Windhauch Sie umpusten.«
Ich lächelte. Das Vorurteil, daß ein geringes Körpergewicht gleichbedeutend mit Hinfälligkeit sei, war weit verbreitet, vor allem unter stämmigen Menschen.
Die Frau schob mich die Stufen hin-auf und ins Haus. Neugierig schaute ich mich um.
Ich stand in einer kreuzförmig gewölbten Halle aus grauem Sandstein. An den Wänden hingen mittelalterliche Waffen und farbenprächtige Gobelinteppiche, auf denen Jagd- und Kampfszenen dargestellt waren. Von seiner Architektur her wirkte der Raum kalt und deprimierend, ein Eindruck, der durch seine kriegerische Ausstattung noch verstärkt wurde. Nur einem riesigen Kristallüster, der nach allen Seiten strahlende Helligkeit spendete, war es zu verdanken, daß die düstere Atmosphäre nicht überwog. Eine Andeutung von Luft und Höhe vermittelte außerdem eine breite Steintreppe, die zu einer Galerie im ersten Stock führte und dort eine Biegung nahm.
Ich entspannte mich etwas. Von innen sah das Schloß weniger unnahbar aus als von außen. Dennoch empfand ich eine ganz unerklärliche Bedrückung, die mich nicht mehr losließ.