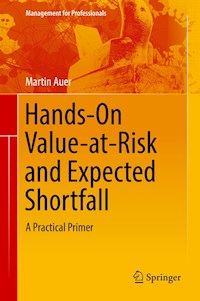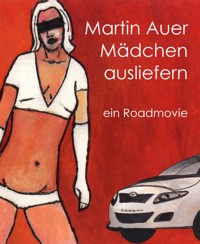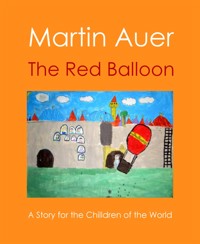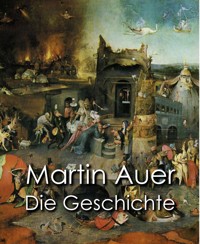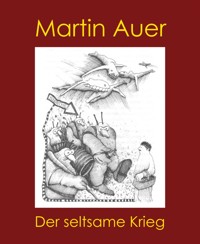
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wie funktionieren Krieg und Frieden? Diese Geschichten für die Friedenserziehung wurden 2000 bei Beltz & Gelberg erstveröffentlicht, Im Druck erschienen sie weiters auf Koreanisch, Persisch und Arabisch. Im Internet können sie in mehr als 30 Sprachen gelesen werden. Diese eBook Ausgabe enthält zu den ursprünglich 15 noch 11 weitere Geschichten. Das Buch erschien auf der Auswahlliste für den Gustav Heinemann Friedenspreis. Martin Auer, 1951 in Wien geboren, hat mehr als 45 Bücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht und ist unter anderem drei Mal mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden. "Mir scheint, dass es nicht genügt, den Kindern zu erzählen, dass Krieg schrecklich und Frieden viel schöner ist", meint der Autor. "Um künftige Kriege zu vermeiden müssen sich 7 Milliarden Menschen - und bald werden es 8 und 9 Milliarden sein - auf neue Formen des Wirtschaftens und des Zusammenlebens einigen. Nicht mehr die ständige Steigerung der Produktivität darf das Ziel sein - mit immer weniger Arbeit immer mehr zu erzeugen; nicht der Austausch von Dingen darf der Hauptinhalt zwischenmenschlichen Handelns sein; die Tatsache, dass die Dinge mit immer weniger Arbeit hergestellt werden können, darf nicht dazu führen, dass immer mehr Dinge hergestellt werden, sondern dass die Menschen die freiwerdende Zeit dazu benutzen können, soziale („Dienst“-)Leistungen miteinander auszutauschen: Kunst, Unterhaltung, Pflege, Heilung, Unterricht, Forschung, Sport, Philosophie..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Der seltsame Krieg
Geschichten zum Verständnis von Krieg und Frieden
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Martin AuerDer seltsame KriegGeschichten zum Verständnis von Krieg und Frieden
Copyright 2000 - 2014 Martin Auer
Die Erstausgabe erschien 2000 im Verlag Beltz & Gelberg
Der seltsame Krieg von Martin Auer steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Unported Lizenz.
In mehr als 30 Sprachen auf www.peaceculture.net
Der Träumer
Es war einmal ein Mann, der war ein Träumer. Er dachte sich zum Beispiel: Es muss doch möglich sein, zehntausend Kilometer weit zu sehen. Oder er dachte sich: Es muss doch möglich sein, Suppe mit der Gabel zu essen. Er dachte: Es muss doch möglich sein, auf dem eigenen Kopf zu stehen, und er dachte sich:
Es muss doch möglich sein, ohne Angst zu leben.
Die Leute sagten zu ihm: ,,Das alles geht doch nicht, du bist ein Träumer!" Und sie sagten: ,,Du musst die Augen aufmachen und die Wirklichkeit akzeptieren!" Und sie sagten: ,,Es gibt eben Naturgesetze, die lassen sich nicht ändern!"
Aber der Mann sagte: ,,Ich weiß nicht... Es muss doch möglich sein, unter Wasser zu atmen. Und es muss doch möglich sein, allen zu essen zu geben. Es muss doch möglich sein, dass alle das lernen, was sie wissen wollen. Es muss doch möglich sein, in seinen eigenen Magen zu gucken."
Und die Leute sagten: ,,Reiß dich zusammen, Mensch, das wird es nie geben. Du kannst nicht einfach sagen: Ich will und deswegen muss es geschehen. Die Welt ist, wie sie ist, und damit basta!"
Als das Fernsehen erfunden wurde und die Röntgenstrahlen, da konnte der Mann zehntausend Kilometer weit sehen und auch in seinen eigenen Magen. Aber niemand sagte zu ihm: ,,Na gut, du hast ja doch nicht ganz Unrecht gehabt." Auch nicht, als das Gerätetauchen erfunden wurde, so dass man problemlos unter Wasser atmen konnte. Aber der Mann dachte sich: Na also. Vielleicht wird es sogar einmal möglich sein, ohne Kriege auszukommen.
Der blaue Junge
Weit draußen hinter den Sternen ist alles ganz anders als hier. Und noch weiter draußen ist alles noch ganz anders als dort, wo alles ganz anders ist als hier.
Aber wenn man ganz weit fliegen würde, ganz weit, ganz fern, dorthin, wo alles ganz anders ist als überall, dort wäre es vielleicht dann wieder fast genauso wie hier.
In dieser fernen Gegend ist vielleicht ein Planet, so groß wie unsere Erde, und auf diesem Planeten leben vielleicht Leute, die fast genauso aussehen wie wir, nur dass sie blau sind und ihre Ohren zuklappen können, wenn sie nichts hören wollen.
Und auf diesem fernen Planeten war vielleicht einmal ein großer Krieg ausgebrochen, und viele der blauen Leute waren gestorben. Viele Waisenkinder waren zurückgeblieben, und auf den Trümmern eines Hauses, das die Bomben zerstört hatten, saß ein kleiner blauer Junge und weinte um seinen Vater und seine Mutter. Er saß lange Zeit so da und weinte, aber dann hörte er auf, denn er hatte alle Tränen geweint, die er gehabt hatte. Er klappte seinen Kragen in die Höhe, steckte die Hände in die Taschen und ging davon. Wenn er einen Stein sah, kickte er ihn fort, und wenn er eine Blume sah, trat er darauf.
Ein kleiner Hund kam ihm entgegen, sah ihn an und wedelte mit dem Schwanz. Dann drehte er um und ging neben dem Jungen her, so, als hätte er sich entschlossen, ihn zu begleiten.
»Geh weg!« sagte der Junge zu dem Hund. »Du musst weggehen. Wenn du bei mir bleibst, muss ich dich lieb haben, und ich will in meinem ganzen Leben niemanden mehr lieb haben.«
Der Hund sah ihn an und wedelte lustig mit dem Schwanz. Da fand der Junge ein Gewehr, das neben einem toten Soldaten lag. Er hob das Gewehr auf und zeigte es dem Hund. »Dieses Gewehr kann dich erschießen!« sagte er böse. Da lief der Hund fort.
»Dich nehme ich mit!« sagte der Junge zu dem Gewehr. »Du wirst mein guter Kamerad sein.« Und er schoss mit dem Gewehr auf einen toten Baum.
Dann fand er in einem Feld einen verlassenen Flugroller. Er setzte sich hinein und versuchte ihn zu starten. Der Flugroller funktionierte.
»Jetzt habe ich ein Gewehr und einen Flugroller«, sagte der Junge. »Die sollen jetzt meine Familie sein. Ich hätte auch einen Hund haben können, aber er wird vielleicht getötet werden, und dann werde ich vor Weinen sterben müssen.«
Er flog mit dem Flugroller, bis er ein Haus sah, aus dem Rauch kam. »Dort lebt noch jemand«, sagte der Junge. Er flog um das Haus herum und schaute durch die Fenster. Es war nur eine alte Frau da, die etwas kochte.
Der Junge stellte seinen Flugroller vor dem Haus ab, nahm sein Gewehr und ging hinein. »Ich habe ein Gewehr!« sagte der Junge zu der alten Frau. »Du musst mir etwas zu essen geben!«
»Ich würde dir auch so etwas geben«, sagte die alte Frau, »du kannst dein Gewehr ruhig wegstellen.«
»Du sollst nicht nett sein zu mir!« sagte der Junge böse. »Mein Gewehr kann dich erschießen!«
Da gab die alte Frau ihm etwas zu essen, und er flog weiter.
So lebte der Junge nun. Er richtete sich ein Versteck ein in einem verlassenen Haus. Wenn er hungrig war, flog er irgendwohin, wo es Leute gab, und zwang sie mit seinem Gewehr, ihm etwas zu essen zu geben.
Sonst flog er über die verlassenen Schlachtfelder und sammelte Teile von Waffen und Fahrzeugen, die dort liegengeblieben waren. Das brachte er alles in sein Versteck.
»Ich werde mir einen Riesenpanzerroboter bauen!« sagte er zu sich selbst. »Er wird hundert Meter groß sein und hunderttausend Tonnen schwer, und ganz oben in seinem Kopf werde ich meine Lenkkabine haben. Dann bin ich mächtig, und niemand kann mir etwas tun.«
Eines Tages kam an seinem Versteck ein Mädchen vorbei. Der Junge ging mit seinem Gewehr hinaus und sagte: »Du musst weggehen! Mein Gewehr kann dich erschießen !
»Ich will doch gar nichts von dir«, sagte das Mädchen. »Ich bin nur schauen gegangen, ob die Pilze wieder wachsen.«
»Du musst weggehen!« sagte der Junge. »Ich will niemanden bei mir haben!«
»Bist du denn ganz allein?« fragte das Mädchen.
»Nein«, sagte der Junge, »ich habe ein Gewehr und einen Flugroller, die sind meine Familie. Und eines Tages werde ich einen Riesenpanzerroboter haben!«
»Hast du denn niemand Lebendiges'?« fragte das Mädchen.
»Ich hätte einen Hund haben können. Aber wenn man ihn getötet hätte, hätte ich vor Weinen sterben müssen.«
»Ich habe auch niemand Richtiges«, sagte das Mädchen. »Wir könnten zusammenbleiben.«
»Ich will niemand haben, den ein Gewehr erschießen kann!«
»Dann musst du dir eben jemand suchen, den kein Gewehr erschießen kann!« sagte das Mädchen und ging fort.
Der Junge aber baute sich einen Riesenpanzerroboter und setzte sich hinein. Ganz oben in den Kopf setzte er sich, dort, wo er die Lenkkabine eingebaut hatte.
Dann machte er sich auf und fuhr in seinem Riesenpanzerroboter durch das Land. Überall schrien die Leute, wenn sie ihn kommen sahen, und wollten davonlaufen. Aber dem Riesenpanzerroboter konnten sie nicht entkommen.
Der Junge hatte oben in seiner Lenkkabine ein Mikrofon, und alles, was er da hineinsagte, kam brüllend aus dem Mund des Riesenpanzerroboters. »Ist hier jemand, den ein Gewehr nicht erschießen kann?« brüllte der Roboter. Aber wo immer er hinkam, liefen die Leute nur vor ihm davon, und nie fand er jemanden, den ein Gewehr nicht erschießen kann.
Eines Tages aber sah er von seiner Lenkkabine hoch oben, dass da unten jemand nicht weglief vor ihm, sondern stehen blieb und etwas hinaufrief. Er war aber so hoch oben, dass er es nicht hören konnte.
»Vielleicht ist das jemand, den ein Gewehr nicht erschießen kann?« dachte der Junge und kletterte hinunter. Es war aber die alte Frau, die ihm damals Essen gekocht hatte. »Wolltest du mir etwas sagen?« fragte der Junge.
»Ja«, sagte die alte Frau. »Ich habe von jemandem gehört, den ein Gewehr nicht erschießen kann. Ich dachte, das muss ich dir sagen.«
»Und wer ist das?« fragte der Junge.
»Es ist ein alter Mann, der oben auf dem Mond wohnt. «
»Dann muss ich ihn suchen«, sagte der Junge ,»denn ich will niemanden haben, den ein Gewehr erschießen kann.« Und er legte einen Hebel um, und sein Riesenpanzerroboter verwandelte sich in eine Riesenpanzerrakete und flog mit ihm zum Mond.
Oben auf dem Mond musste der Junge lange suchen. Aber schließlich fand er den alten Mann. Der saß hinter einem Fernrohr und schaute auf den blauen Planeten hinunter.
»Bist du der, den kein Gewehr erschießen kann?« fragte der Junge den alten Mann.
»Ich glaube schon«, sagte der alte Mann.
»Und was siehst du da in deinem Rohr'?«
»Ich studiere die Leute auf dem Planeten unten.«
»Kann ich vielleicht bei dir bleiben?« fragte der Junge.
»Vielleicht«, sagte der alte Mann. »Warum willst du denn gerade bei mir bleiben?«
»Weil ich bei niemandem bleiben will, den man erschießen kann. Als meine Eltern gestorben sind, habe ich alle Tränen geweint, die ich hatte. Ich hätte einen Hund haben können, aber wenn man ihn getötet hätte, hätte ich vor Weinen sterben müssen. Ich hätte auch bei einer alten Frau bleiben können oder bei einem kleinen Mädchen. Aber sie waren nicht gepanzert gegen Gewehrkugeln, und wenn man sie getötet hätte, hätte ich vor Weinen sterben müssen.«
»Es ist gut«, sagte der alte Mann, »du kannst bei mir bleiben. Mich kann niemand erschießen, denn hier gibt es keine Gewehre.«
»Ist es nur das?« fragte der Junge.
»Ja, nur das«, sagte der alte Mann.
»Ich habe aber mein Gewehr mitgebracht.«
»Schade«, sagte der alte Mann, »jetzt kannst du nicht bei mir bleiben. Dein Gewehr könnte mich erschießen. «
»Dann muss ich also wieder gehen«, sagte der Junge.
»Ja«, sagte der alte Mann.
»Schade«, sagte der Junge.
»Tut es dir leid?« fragte der alte Mann.
»Ja«, sagte der Junge, »ich wäre gern hier geblieben.«
»Du könntest vielleicht dein Gewehr wegwerfen?« sagte der alte Mann.
»Vielleicht«, sagte der Junge.
»Und dann könntest du doch bei mir bleiben«, sagte der alte Mann.
»Vielleicht«, sagte der Junge. »Und was würde ich dann tun?«
»Du könntest durch dieses Fernrohr schauen. Dann könntest du vielleicht herausfinden, warum die Leute da unten Kriege führen.«
»Und warum führen sie Kriege?«
»Ja, ich weiß es auch nicht. Es hat wohl damit zu tun, dass sie nicht genug voneinander wissen. Dass sie so viele sind und ihr Leben so kompliziert ist, dass keiner weiß, was seine Taten für Folgen haben. Dass sie nicht wissen, woher das Fleisch kommt, das sie essen, und wohin das Brot geht, das sie backen. Dass sie nicht wissen, ob aus dem Eisen, das sie aus der Erde holen, Bagger gemacht werden oder Kanonen. Dass sie nicht wissen, ob sie das Fleisch, das sie essen, nicht anderen wegessen. Wenn sie sich so von oben sehen könnten, würden sie vieles vielleicht besser verstehen. «
»Dann müsste man es ihnen zeigen?« sagte der Junge.
»Vielleicht«, sagte der alte Mann, »aber ich bin zu alt und zu müde dazu.«
Da erst ließ der Junge sein Gewehr fallen, und es fiel durch den Weltraum hinunter, bis auf den Planeten, und dort zerbrach es.
Der Junge aber blieb lange, lange Zeit bei dem alten Mann auf dem Mond und schaute durch das Fernrohr und studierte die Leute da unten. Und eines Tages ist er vielleicht hinuntergeflogen und hat ihnen erklärt, was sie falsch gemacht haben.
Auf dem Karottenplaneten
Auf einem winzigen Planeten, da lebten einmal welche, die waren fleißig, und andere, die waren weniger fleißig. Dann gab es noch ein paar ganz Fleißige und ein paar ganz Faule. Mit einem Wort - es war so wie überall im Universum.
Nur dass die Faulen und die Fleißigen alles, was sie erzeugten - es waren hauptsächlich verschiedene Sorten Karotten -, auf einen Haufen schmissen und dann gemeinsam davon aßen. Das war nicht so wie überall.
Eines Tages aber sagten ein paar ganz Fleißige:
„Jetzt reicht's aber. Wir schuften und schuften, und dann kommen die andern daher, die den ganzen Tag auf dem Rücken liegen und in die Sonne pfeifen, und wollen unsere Karotten essen." Und sie schmissen ihre Karotten nicht mehr auf den gemeinsamen Haufen, sondern behielten sie zu Hause und fraßen sich dicke Wänste an.
Die ganz Faulen zuckten nur die Achseln und aßen weiter vom großen Haufen, und natürlich aßen sie mehr davon weg, als sie selber hinbrachten.
Da merkten die Mittelfleißigen und die Mittelfaulen, dass jetzt doch auf jeden weniger kam; denn die ganz Fleißigen hatten ja immer besonders viele Karotten gebracht, mehr, als sie selber aßen.
Also sagten die Mittelfleißigen: „Dann wollen wir aber auch unsere Karotten selber behalten", und sie schmissen sie nicht mehr auf den großen Haufen, sondern machten sich jeder ein kleines Häuflein bei sich zu Hause.
Und die Mittelfaulen machten es ebenso. „Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig", sagten sie zu den ganz Faulen.
Und jetzt hatte jeder seinen eigenen Karottenhaufen vor seiner Hütte, und wenn er Lust auf eine Karottensorte hatte, die nicht in seinem Haufen vorkam, dann musste er sehen, ob er sie bei jemand anderem eintauschen konnte.
Da fing bald ein Kommen und Gehen an, und nach der Arbeit hatten die Leute noch stundenlang zu tun mit Karottentauschen, bis jeder alle Karottensorten im Hause hatte, die er brauchte oder zu brauchen glaubte.
„Das sind ja ganz neue Sitten!" sagten die ganz Faulen unter sich. Für sie gab es jetzt keinen gemeinsamen Haufen mehr, von dem sie hätten schmarotzen können. Daraus zog aber jeder eine andere Lehre. Einige sagten sich: „Na schön, da muss ich eben doch mehr arbeiten." Das war allerdings nicht so einfach, denn wenn so ein bekehrter Fauler auf ein Feld kam, um dort Karotten zu pflanzen, war da meistens einer, der sagte: „He, hier habe doch immer ich Karotten gepflanzt, das ist mein Feld!"
Andere aber gingen einfach zu den Hütten der Reicheren und nahmen sich dort von den Karottenhaufen, worauf sie gerade Lust hatten. „Wir haben immer vom gemeinsamen Haufen genommen. Und wenn es jetzt viele Haufen gibt, dann sind das eben viele gemeinsame Haufen. Wir nehmen uns jedenfalls davon", sagten sie.
Das war natürlich den Reicheren nicht recht, und einige fingen an, Zäune um ihre Karottenhaufen zu bauen. Da mussten bald alle Zäune um ihre Haufen bauen. Denn je mehr Leute Zäune um ihre Haufen hatten, um so mehr holten sich die ganz Faulen, die an den alten Sitten festhielten, von den Haufen ohne Zäune.
Über kurz oder lang hatten alle, die einen Haufen hatten, auch einen Zaun darum. Jetzt hatten sie nach der Arbeit nicht nur mit dem Tauschen, sondern auch noch mit dem Flicken und Ausbessern ihrer Zäune zu tun und mit dem Aufpassen, dass keiner drüberkletterte.
Bald murrten einige: „Früher haben wir uns nach der Arbeit alle beim großen Karottenhaufen getroffen und Witze erzählt und Bockspringen veranstaltet. Jetzt hocken wir nach der Arbeit nur noch zu Hause, bewachen unsere Karotten und bessern unsere Zäune aus. Und am Morgen sind wir todmüde und können gar nicht gescheit Karotten pflanzen. Irgendwie haben wir jetzt viel mehr zu tun als früher, aber die Karotten werden davon nicht mehr."
Und einige schlugen vor, man sollte doch wieder zur alten Sitte mit dem großen gemeinsamen Haufen zurückkehren. „Lieber füttern wir doch ein paar ganz faule Schmarotzer mit, als dass wir uns dauernd mit dem Tauschen und Aufpassen und Zäuneflicken abplagen!"
Aber die Reichsten sagten: „Nein, wenn wir zur alten Sitte zurückkehren, dann heißt das, das Schmarotzen zu erlauben. Dann werden alle schmarotzen wollen, und keiner wird mehr Karotten anpflanzen, und wir werden alle verhungern!"
„Aber so doch nicht", sagten die anderen. „Den meisten ist es zu langweilig, den ganzen Tag auf dem Rücken zu liegen und der Sonne was vorzupfeifen. Es gibt doch nur ganz wenige, die wirklich so faul sind. Karottenpflanzen macht doch in Wirklichkeit Spaß."
„Nein", sagten die Reichsten, „Karottenpflanzen macht keinen Spaß. Nur Karottenhaben macht Spaß.
Ihr könnt ja eure Karotten mit den Faulenzern teilen, wenn ihr wollt. Wir jedenfalls reißen unsere Zäune nicht mehr ab!"
„Tja", sagten da einige von den Mittelreichen, „wenn die Ganzreichen nicht mitmachen, dann wollen wir unsere Zäune lieber auch behalten, wir haben ja nicht soviel, dass wir es mit den Faulenzern teilen könnten."
Und die Mittelarmen sagten: „Ja, wenn nur wir teilen sollen, dann haben alle zu wenig, da können wir nicht mitmachen. Wir müssen unsere Zäune leider behalten. „
Und so wurde diesmal nichts daraus. Und obwohl eigentlich die meisten wussten, dass jetzt alle mehr Arbeit hatten, ohne dass es deswegen mehr Karotten gab, schafften sie es einfach nicht, zur alten Sitte zurückzukehren.
Dafür passierten einige andere interessante Dinge. Einige von denen, die keine großen Karottenfelder hatten, gingen zu einigen Reicheren und sagten:
„Hört einmal, wenn ihr mir jeder jeden Tag ein paar Karotten gebt, dann pass ich dafür auf eure Haufen auf."
Und andere kamen auf die Idee und boten an: „Wer mir Karotten gibt, dem flicke ich dafür seinen Zaun!"
Und wieder andere gingen von Haus zu Haus und sagten: „Gebt mir ein paar von euren Karotten, ich gehe sie für euch eintauschen, wenn ich dafür jede fünfte Karotte behalten darf."
Das ging so eine Weile, und dann kratzten sich einige am Kopf und sagten: „Eigentlich sollte ich jetzt mehr Zeit haben, aber jetzt muss ich wieder mehr Karotten anpflanzen, damit ich den Zäuneflicker und den Nachtwächter und den Karottentauscher bezahlen kann!"
Angst
Warum sieht mich der da so misstrauisch an? Hat er Angst vor mir? Warum hat der da wohl Angst vor mir? Glaubt er, ich will ihm was tun? Warum glaubt der da, ich will ihm was tun? Ich tu doch keinem was! Ich tu keinem was, außer, es will einer mir was tun! Wenn der also glaubt, ich will ihm was tun, dann nur, weil er weiß: Ich tu jedem was, der mir was tut. Also: will der mir was tun! Da geh ich wohl besser gleich hin und hau ihm eins in die Fresse, damit er mir nichts tun kann. Autsch! Seine Faust war schneller als meine. Jetzt liege ich da. Aber ich hab's ja gleich gewusst, dass der mir was tun will!
Noch einmal Angst
Wir sind ein friedliches Land und greifen niemanden an. Es sei denn, wir würden angegriffen. Wer nicht vorhat, uns anzugreifen, braucht keinerlei Angst vor uns zu haben. Wer sich vor uns zu schützen versucht, beweist dadurch, dass er Angst vor uns hat. Wer vor uns Angst hat, beweist dadurch, dass er vorhat, uns anzugreifen. Also ist doch klar, dass wir jeden angreifen müssen,