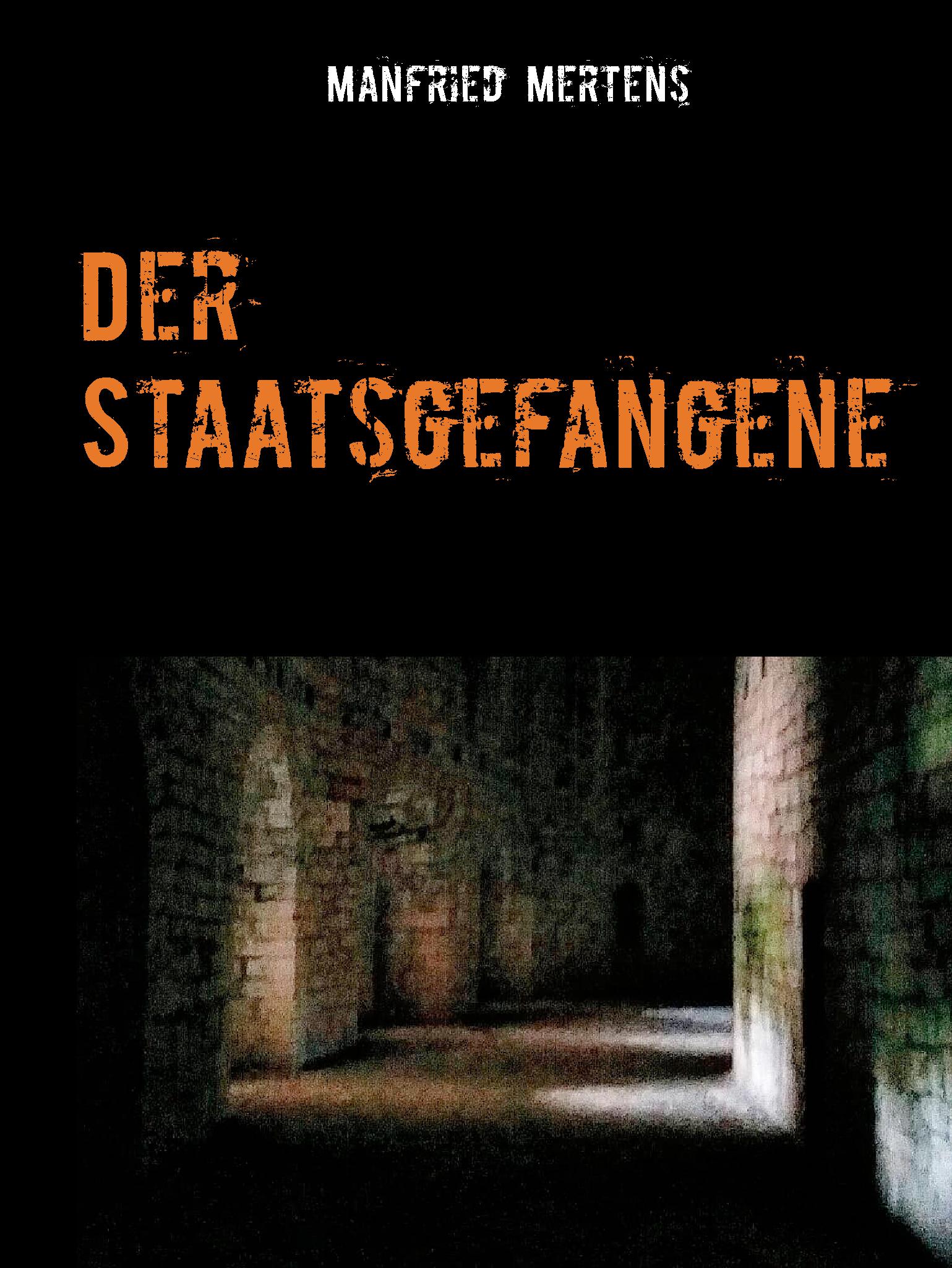
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach politischen Unruhen im Jahre 1832, die ein Todesopfer fordern, verhaftet man in Nürnberg einen freiheitlich denkenden Journalisten. Für historisch und politisch Interessierte wird in einer dokumentarischen Erzählung der Fall des in Brüssel geborenen Dr. Victor A. Coremans aufgerollt, der im Königreich Bayern unter Ludwig I. zunächst erfolgreicher Publizist, dann unliebsamer Journalist und schließlich ein unerwünschter Ausländer war. Sein von Nürnberg aus leidenschaftlich geführter Kampf für die Pressefreiheit ist bis heute nicht gewonnen, saßen doch zum Jahresende 2019 weltweit 389 Medienschaffende aus politischen Gründen im Gefängnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Staatsgefangene
Der StaatsgefangeneIm Namen der PressefreiheitDie Festung RothenbergSchöne AussichtenDer RezatkreisIm Hause GauderTage der BelagerungDie MaiexzesseAuf WanderschaftInfanterie und ArtillerieVergissmeinnicht und DenkanmichDie KatzenmusikDunkelhaftAufenthalt in AscalonDer DiamantärDie Armee aus Stein und FelsAnkunft in SchnaittachWirtshausgesprächeDie sechs BastionenSchwarze MelancholieAuf zum Rothenberg!Die Sage vom kleinen TambourVor dem FestungsportalIn der Laufer GasseDer HeimwegDie Schnaittacher SynagogeDas Ende der HaftCadolzburger FantasienIn Coremans’ eigenen WortenImpressumDer Staatsgefangene
Nach politischen Unruhen im Jahre 1832, die ein Todesopfer forderten, verhaftete man in Nürnberg einen freiheitlich denkenden Journalisten. Für historisch und politisch Interessierte wird hier in einer dokumentarischen Erzählung der Fall des in Brüssel geborenen Dr. Victor A. Coremans aufgerollt, der im Königreich Bayern unter Ludwig I. zunächst erfolgreicher Publizist, dann unliebsamer Journalist und schließlich ein unerwünschter Ausländer war. Sein von Nürnberg aus leidenschaftlich geführter Kampf für die Pressefreiheit ist bis heute nicht gewonnen, saßen doch zum Jahresende 2019 weltweit 389 Medienschaffende aus politischen Gründen im Gefängnis.
Zum Autor: Manfried Mertens hat in Mainz Germanistik, Anglistik und Ethnologie studiert. Ursprünglich Lyriker, schreibt er seit 2016 auch Erzählungen. Er ist verheiratet, im westlichen Niedersachsen beheimatet und mit einem zweiten Wohnsitz in der Nähe von Nürnberg vertreten.
Im Namen der Pressefreiheit
Immer wieder haben Regierungen versucht, Kontrolle über die Medien zu erlangen. So ist es bis heute geblieben. Wie „Reporter ohne Grenzen“ melden, saßen Ende 2019 weltweit 389 Medienschaffende aus politischen Gründen in Haft. 1832, im Jahr seiner Verhaftung, schrieb der Publizist Coremans sinngemäß, dass die Einschränkung der Pressefreiheit ein Rückschritt zur Sklaverei sei. Bereits am 26. Mai 1818 bekam Bayern eine liberale Verfassung. Kaum hatte Ludwig I. (1786–1868) dann im Jahre 1825 den Thron bestiegen, hob er sogar die bisherige Pressezensur auf. Fortschrittlich Denkende im Lande setzten große Hoffnungen auf den jungen Monarchen, der in den Augen vieler Liberaler ein Gleichgesinnter zu sein schien. Nach der Pariser Julirevolution 1830 änderte sich das allerdings grundlegend. Bereits ab 1831 wurde die Presse wieder zensiert. Das Oppositionsblatt „Freie Presse“, herausgegeben von dem radikal-liberalen belgischen Publizisten Coremans, der in Nürnberg lebte und wirkte, wurde verboten. Daraufhin verbreitete der Nürnberger Journalist Flugblätter kritischen Inhalts, die ihn in den Augen der Obrigkeit zum Anstifter oder gar Rädelsführer machten. Seine zahlreichen Veröffentlichungen, man sprach von einer regelrechten „Coremans-Presse“, führten letzten Endes zu seiner Verhaftung. Während der Festungshaft des Publizisten auf dem Rothenberg in Schnaittach dichtete ein junger Nürnberger namens Feuerstein Verse für ein Lied, das von den Coremaniern, so nannten sich die Anhänger des inhaftierten Journalisten, gesungen wurde. Es folgen nun drei ausgewählte Strophen aus der von mir als „Coremanierlied“ bezeichneten Dichtung: Das Coremanierlied Zurückkehren wird der Mann, Liebend Tugend, liebend Recht; Zurückkehren wird der Mann, Der nie ward Despotenknecht! Zurückkehren wird der Freund Wieder schreiben frank und frei; Zurückkehren wird der Freund, Bleiben seinen Brüdern treu. Zurückkehren wird der Mann, Wenn die Freiheit Blüthen trägt, Zurückkehren wird der Mann, Wenn die große Stunde schlägt. nach: Feuerstein et al., Nürnberg 1832
Die Festung Rothenberg
Östlich von Markt Schnaittach in Mittelfranken thront auf einem 588 Meter hohen Bergkegel die mächtige Festungsanlage Rothenberg und blickt hinab auf die kleine Ortschaft im Tal. Schon lange bevor in den Jahren 1729 bis 1741 das heutige Rokokobauwerk nach französischem Vorbild entstand, gab es bereits im Mittelalter bedeutende Burganlagen auf diesem Berg, der sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wesentlich weniger bewaldet zeigte als heute, weil seine Hänge damals zu großen Teilen landwirtschaftlich genutzt wurden. Während zum Beispiel die auf dem Stand des Jahres 1742 wieder aufgebaute Festung Bourtange in den Niederlanden den Grundriss eines fünfzackigen Sterns aufweist, dessen Spitzen an den Ecken des regelmäßigen Fünfecks zu Bastionen ausgebaut sind, mussten die Schnaittacher Bauten der unregelmäßigen Form des Berggipfels angepasst werden. Bourtange hingegen liegt in einem ebenen Sumpfgelände. Als breite Front präsentiert sich der Rothenberger Eingangsbereich mit dem Torhaus in der Mitte, wobei das Festungsportal durch das Überqueren einer Brücke über den Festungsgraben vom nie ganz fertiggestellten Vorwerk, dem Ravelin, aus erreicht wird. Links vom Eingang liegt die Bastion Karl, wo in der Karlskaserne Schanzer und Staatsgefangene untergebracht wurden, rechts davon die Bastion Amalie, hinter der Amalienkaserne befindet sich die Kommandatur. Die Seitenmauern der gesamten Anlage verjüngen sich auf der linken und rechten Seite, bis drei weitere Bastionen, Kersbach, Nürnberg und Schnaittach, den Abschluss bilden. Als kleines Kuriosum gibt es in die linke Mauer integriert noch die Bastion Glatzenstein, so dass sich auf dem Rothenberg sogar sechs Bastionen befinden. Die Festung Rothenberg hatte damals, gemeint ist das Jahr 1832, ihre militärische Bedeutung weitgehend verloren und diente als Gefängnis. Da waren zum einen die Schanzsträflinge, welche den größten Teil der Gefangenen ausmachten. Die einfachen Schanzer wurden zu Arbeiten an den Festungsbauten und der Festungsstraße herangezogen. Zum anderen gab es auch einige bayerische Staatsgefangene aus der Oberschicht, die in Einzelzimmern wohnen durften. Soldaten wurden eigens dazu abgestellt, sich um deren Bedürfnisse zu kümmern.
Schöne Aussichten
Im ersten Stock der Karlskaserne hatte man dem Staatsgefangenen Coremans ein Zimmer zugewiesen. Tagsüber war ihm auf dem Festungsgelände der Aufenthalt im Freien gestattet, allerdings musste Sergeant Galini ihn auf Befehl des Kommandanten dabei begleiten und beaufsichtigen. Zu jener Zeit residierte im Kommandaturgebäude der Oberstleutnant von Regnier. An diesem heißen Julitag im Jahre 1832 brannte die Sonne gnadenlos nieder und es war kaum Schatten zu finden. Lediglich die beiden Holunderbäume luden den Häftling dazu ein, sich darunter niederzulassen. Die dunklen Augen in Coremans‘ rundlichem Gesicht waren weit geöffnet und verrieten den aufmerksamen Beobachter. Auffällig war der lange Nasenrücken, der den ansonsten eher weichen Zügen etwas Entschlossenes verlieh. Stark gekräuselte Kopfhaare mündeten an beiden Seiten in lang nach unten gezogene Favoris, also trug der Belgier einen modischen Backenbart. Hellwach und fern jeder Resignation nahmen die großen Augen des Staatsgefangenen während seines unter strenger Bewachung gestatteten Rundgangs über die Bastionen alle Details der ländlichen Umgebung wahr. Dichte Wälder kontrastierten mit Ackerflächen und Wiesen, tief unten winkte der Marktflecken Schnaittach, unerreichbar und dennoch ein tröstender Anblick. An den Hängen des Rothenberges baute man Hopfen an, den berühmten Hersbrucker Gebirgshopfen. Die aufrecht stehenden Hopfenstangen waren einen halben Meter tief in den Boden gerammt und im Monat Juli grün berankt. Dr. Viktor Amadeus Coremans wusste, dass der Stadt Hersbruck bereits 1731 das Hopfensiegel verliehen worden war und man Schnaittach als wichtigen Anbau- und Handelsort des grünen Goldes kannte. Für dessen Vermarktung spielten die jüdischen Einwohner Schnaittachs eine wichtige Rolle. Durch das Bayerische Judenedikt von 1813 war die Zahl ihrer Haushalte in dem Marktflecken auf 58 begrenzt. Dokumente aus dem Jahre 1825 belegen allerdings 61 in Schnaittach ansässige jüdische Familien, die etwa zwanzig Prozent der Einwohnerschaft von etwa fünfzehnhundert Seelen stellten. Neben Hopfen wurden auch Pferde und Vieh gehandelt, Geld verliehen und Kleingewerbe betrieben. Dabei wohnten die Schnaittacher Juden über den gesamten Ort verteilt. An der Universität Erlangen hatte Coremans promoviert. Das Thema seiner Dissertationsschrift lautete: „Das Genie in den bildenden Künsten“. Bei dem Gedanken daran musste er schmunzeln, angesichts der genialen Lage, in der er sich im Augenblick befand. Immerhin war es ihm gestattet, in den Abendstunden bei Kerzenschein zu schreiben, oft bis spät in die Nacht hinein, was ihm ein Trost war. Schaute er hinüber zu einem benachbarten Berg, dem Glatzenstein, konnte Dr. Viktor Amadeus Coremans die hell leuchtenden Felsformationen auf dessen Gipfel bestaunen und für einen Moment seine missliche Lage als Gefangener auf der altbayerischen Festung Rothenberg vergessen. So genoss Coremans immerhin eine schöne Aussicht, ansonsten waren seine Aussichten ja nicht so gut: „Anstifter und Rädelsführer beim Tumult des höchsten Grades sollen mit dem Tod bestraft werden, wenn Mord, Totschlag, Raub oder Brandlegung vorgefallen sind, sie selber mögen zu solchen Verbrechen ausdrücklich aufgefordert haben oder nicht.“ (Bayerisches Strafgesetzbuch von 1813, Artikel 322)





























