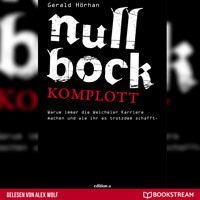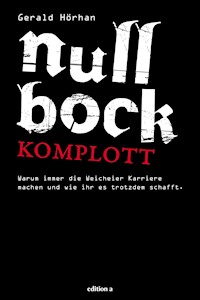Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Binnen weniger Jahre wird die digitale Revolution die Gesellschaft komplett verändern. Wenige werden reich, viele arm, und die Mittelschicht wird es nur noch in den Geschichtsbüchern geben. Gerald Hörhan, Harvard-Absolvent, Investmentbanker und Internet-Unternehmer, zeigt, was die künftigen Gewinner der digitalen Revolution jetzt tun müssen und warum alle anderen untergehen. In provokantem Ton lässt Hörhan, der an Wirtschaftsuniversitäten lehrt und mit seiner Online-Akademie einen MBA (Master of Business Administration) anbietet, hinter die Kulissen der digitalen Wirtschaft blicken. Ein Buch, das erschreckt, und zugleich die neuen Chancen zeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerald Hörhan: Der stille Raub
Alle Rechte vorbehalten© 2017 edition a, Wienwww.edition-a.at
Cover: JaeHee LeeGestaltung: Lucas ReisiglLektorat: Lena Schulze Frenking
1 2 3 4 5 — 20 19 18 17
ISBN 978-3-99001-225-3
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
INHALT
Milchgesichter in Business-Jets
Die dicken Hunde von Las Vegas
Meetings mit Burgern
Kämpfen und Lernen
Nachrichten aus der Google-Universität
Das große Verdrängen
Das Olympia-Prinzip
Die schwindenden Steuereinnahmen
Die neue Weltkarte
Die große Verblödung
Die exponentielle Beschleunigung der digitalen Revolution
Wie die digitale Elite tickt
Die hilflose Politik
Der beste Ausweg
Wirtschaftstrends für digitale Aufsteiger
Schlusswort
MILCHGESICHTER IN BUSINESS-JETS
Das Seminar hieß Business Mastery, dauerte fünf Tage und fand im Januar 2014 in Palm Beach, Florida, statt. Die Teilnahme kostete 10.000 Euro, aber Luxus boten die Veranstalter nicht. Ich hatte stets eine Jacke dabei, um mir in der zu stark gekühlten Halle keine Erkältung zu holen, und das Essen war typisch amerikanisch: fettige Double-Burger, Nachos und übelriechende Pizzen. Am ersten Tag kaufte ich deswegen am Obststand vor der Halle zur Freude des Verkäufers alle Bananen auf, für drei Dollar das Stück.
Es war ein Seminar von Anthony Robbins, einem amerikanischen Bestsellerautor und NLP-Trainer. Als Berater war er für prominente Politiker wie Bill Clinton und Profisportler, unter anderem Andre Agassi, tätig. Freunde und Kollegen hatten ihn mir als weltweit bekanntesten Mann seines Fachgebiets empfohlen, weshalb ich wissen wollte, was er zu sagen hatte.
Robbins spricht bei seinen Vorträgen unter anderem darüber, dass viele Menschen ihre Träume ihren Lebensumständen anpassen würden, weil sie Angst vor Enttäuschungen und Kummer hätten. Tatsächlich verlaufe der Weg zum Erfolg aber genau umgekehrt. Wer aufsteigen wolle, müsse seine Lebensumstände seinen Träumen anpassen und so seine inneren Kräfte befreien.
Ich hörte diese Dinge gerne, weil sie mich bestärkten und inspirierten, neu waren sie für mich allerdings nicht. Ich habe mich selbst als Kind der Mittelschicht von deren Denkmustern befreit und bin dadurch aufgestiegen. Deshalb wählte ich ein Robbins-Seminar mit konkreterem Inhalt. Es ging darum, wie aus kleinen Unternehmen große werden. Nur ein Hundertstel aller Unternehmen setzt mehr als fünf Millionen Dollar im Jahr um, aber das muss nicht so sein, lautete die Ansage.
Robbins hielt nicht alle Vorträge selbst. Es gab Gastredner, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Einer von ihnen, ein Mann mit Südstaatenakzent, erklärte uns am Beispiel der Hotellerie, wie wichtig das Internet für das Wachstum eines Unternehmens sei.
Hotels einer Preisklasse würden in Sachen Lage, Zimmerausstattung und Services ungefähr das Gleiche anbieten, erklärte der Vortragende. Dennoch verdienten manche von ihnen mehr als andere, und das liege an derem digitalen Auftritt.
Ich bin seit zehn Jahren im Hotelgeschäft als Investmentbanker tätig und kenne die Branche deshalb gut.
»Warum macht ein Hotel Nacht für Nacht um 15 bis 20 Prozent mehr Umsatz als ein anderes, obwohl beide das Gleiche anbieten, die gleichen Zimmerpreise verlangen und sogar die Auslastung vergleichbar ist?«, fragte der Redner.
Er zeigte uns die digitalen Auftritte verschiedener Ketten der gehobenen Kategorie. Bei Marriott oder Hilton bestanden die Internetseiten vor allem aus Fotos von Zimmern, die hübsch eingerichtet waren, aber doch nur das Erwartbare boten.
Er führte uns vor, wie umständlich das Buchen eines Zimmers bei manchen dieser Unternehmen war: Das Buchungssystem leitete von Seite zu Seite weiter und verlangte trotzdem immer wieder die gleichen Informationen.
Als Nächstes präsentierte er uns den digitalen Auftritt eines Hotels in der Karibik, dessen Seite einfach zu bedienen war und einen gewissen Wow-Effekt auf den Besucher hatte. Sie rief nicht nur: »Ich bin ein Hotel, bitte buche mich«. Sie zeigte Impressionen von der umliegenden Landschaft und bot einen Blog mit Berichten über das Hotel, über regionale Gerichte und interessante Ausflugsziele. Wie ein Reiseführer stellte sie eine Anleitung zum Erleben der Region bereit.
Dieses Hotel hatte 99 Prozent Auslastung im Vergleich zu 60 bis 70 Prozent bei vergleichbaren Hotels. Es war für zehn Prozent der Besucher der Region verantwortlich und stiftet damit einen Wert.
Außerdem war es unabhängig von Buchungsmaschinen wie booking.com, excite.com oder hotels.com. So zahlte sich der gute Internetauftritt für das Hotel aus, denn bei einer Direktbuchung bleibt den Hotels der ganze Bruttoumsatz, während ihnen die Buchungsplattformen 15 bis 25 Prozent davon abnehmen.
Die Botschaft des Redners im Anthony-Robbins-Seminar lautete: Unternehmen, egal welcher Branche, die rechtzeitig die Bedeutung der laufenden Digitalisierung der Wirtschaft erkennen, gewinnen, die anderen hingegen verlieren. Der Prozess sei im vollen Gange, berichtete er, nur würden viele das noch nicht sehen.
Die Branchen, in denen ich arbeite – Investmentbanking, Immobilien und Corporate-Finance-Beratung – sind wie die Hotellerie klassische Old Economy, hatte ich lange gedacht. Technologie war mir deshalb immer egal gewesen. Ich hatte nie verstanden, warum sich Menschen stundenlang für ein neues iPhone anstellten, das vielleicht etwas dünner und etwas schneller als das Vorgängermodell war.
Mir hatte es gereicht, wenn ich meine Stereoanlage und mein Navigationssystem bedienen und mit meinem Handy E-Mails und SMS-Nachrichten schreiben konnte. Was darüber hinausging, hatte mich ein wenig genervt. Das gesamte Internet hatte mich ein wenig genervt. Ich hatte es für überbewertet und die sozialen Medien für eine Modeerscheinung gehalten. Ich hatte diese Dinge stets meinen Mitarbeitern überlassen.
Doch während dieses Seminars in Palm Beach, bei dem ich nichts anderes tat, als mich mit der Zukunft zu beschäftigen, fing ich zu zweifeln an. Was, wenn ich eine entscheidende Entwicklung übersah, genau wie all die anderen Unternehmer, Manager und Angestellten, die sich in ihrer alten Welt für unschlagbar hielten und sich gerade zu Verlierern entwickelten?
Mir fielen Hinweise darauf ein, die ich bisher ignoriert hatte. So erreichten mich wegen meiner Bücher über Geld und Erfolg laufend Anfragen über Facebook, aus denen sich häufig Geschäftsbeziehungen und Freundschaften entwickelten.
Gleichzeitig fiel mir eine Reihe junger Internet-Nerds ein, die Millionen verdienten und durch die Welt jetteten. Da Geldverdienen schon immer meine Lieblingsbeschäftigung gewesen war, hatte ich mich bereits gefragt, wo genau sie das Geld herhatten. Wie machten diese Milchgesichter ihre Vermögen?
Mit dem Aufstieg von Firmen wie YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram und Snapchat hatten noch halbe Kinder die großen Bühnen der Wirtschaft betreten – und nicht nur der Wirtschaft. Chris Hughes, einer der Mitbegründer von Facebook und mehrere Jahre Sprecher dieser Firma, war 2007 ins Wahlkampfmanagement Barack Obamas gewechselt. Er war maßgeblich für den ersten Wahlsieg Obamas verantwortlich, bei dem die sozialen Medien eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Hughes war damals gerade einmal 25 Jahre alt gewesen, und seine blonde Bubenfrisur hatte ihm in die blasse Stirn gehangen. Doch er hatte bereits über ein Vermögen von rund 450 Millionen Dollar verfügt und in den obersten Machtzirkeln mitgemischt.
Ich selbst hatte kurz vor dem Seminar mit einem 24 Jahre alten Unternehmer zu tun, der sich bei mir nach Anlagestrategien erkundigt hatte. Er war stets in zerrissene Jeans und alte Pullover gekleidet, doch er fuhr einen nagelneuen Jaguar F-Type mit 500 PS, und als ich ihn fragte, wie viel er anlegen wolle, gab er 3,5 Millionen Euro an.
Er hatte mit 16 zu programmieren begonnen, mit Domains gehandelt, Werbeplätze verkauft und war diversen anderen digitalen Geschäftsmodellen nachgegangen. Er machte das inzwischen acht Jahre lang, was in dieser Branche eine kleine Ewigkeit ist, und kannte sich in einer Welt aus, zu der ich keinen Zugang hatte.
Ich war Mitte 30 und hatte nach meinen Studien der angewandten Mathematik und der Betriebswirtschaft auch schon einiges erreicht Ich besaß knapp 200 Wohnungen, vor allem in Frankfurt, und Vermögenswerte wie Aktien, die mir ein passives Einkommen ermöglichten. Ich hätte nicht mehr arbeiten müssen, um ein gutes Leben zu führen, aber ich arbeitete gerne, was meinen Besitz weiter mehrte. Ich hatte Ziele, zu denen – neben der Anschaffung eines kleinen Privatflugzeugs und einiger anderer Spielsachen – die Gründung einer privaten Wirtschaftsuniversität gehörte. Ich führte dabei ein gutes Leben. Ich ging gern auf Partys und machte an schönen Orten wie Miami oder Gstaad Urlaub.
Doch wenn mich diese kaum der Pubertät entwachsenen Nerds, die jeder Türsteher eines Nachtclubs abgewiesen oder nach ihrem Ausweis gefragt hätte, locker mit mir mithalten oder mich sogar überholen konnten, stimmte etwas nicht. Der Typ da vorne auf der Bühne hat recht, dachte ich. Wenn sogar eine altmodische Branche wie die Hotellerie so unmittelbar von der Digitalisierung betroffen ist, muss auch ich mich damit beschäftigen.
Ich machte mir von nun an Notizen, während der Mann auf der Bühne weitersprach. »Der größte Konkurrent eines jeden Hotels wird in Zukunft kein Hotel mehr sein, sondern eine digitale Plattform«, sagte er. »Einige von Ihnen kennen sie vielleicht. Sie vermittelt Unterkünfte in Privatwohnungen an Reisende und heißt Airbnb.«
Ich hatte mit den Managern mehrerer Hotelketten bereits über Airbnb gesprochen. »Was soll der Blödsinn? Das ist illegal und wird früher oder später verboten werden«, war damals ihr Tenor gewesen. Ich dachte ähnlich über Airbnb. Doch nun belehrte mich der Redner eines Besseren. »Airbnb wird in absehbarer Zeit mehr wert sein als die größten Hotelketten der Welt zusammen«, erklärte er. »Man nennt das ›digitale Revolution‹. Sie wird unsere Zukunft bestimmen.«
Jetzt liegt die Marktbewertung von Airbnb bei etwa 30 Milliarden Dollar, von Hilton bei etwa 19 Milliarden Dollar und von Accor bei etwa 12 Milliarden Euro. Doch damals glaubte ich, mich verhört zu haben. Immerhin besaßen die größten Hotelketten Häuser in den Zentren der wichtigsten Städte der Welt. Eine damals, im Jahr 2014, noch relativ obskure digitale Plattform sollte eines Tages einen größeren Wert ausmachen als diese prachtvollen und teilweise unbezahlbaren Immobilien in den besten Lagen Londons und New Yorks?
Am Abend befasste ich mich näher mit Airbnb. Die klassischen Hoteliers und ihre Verbände kämpften für Regulierungen, die der Plattform das Leben schwermachen sollten. Warum eigentlich? Auf den ersten Blick waren ihre Geschäfte stabil. Daraus ließ sich ableiten, dass Airbnb ihnen keine Gäste wegnahm. Doch bei näherem Hinsehen stimmte das nicht. Die ganze Hotellerie profitierte von einer sich globalisierenden Welt, in der ständig mehr Menschen reisen mussten oder wollten. Ein neuer Konkurrent fiel da kaum ins Gewicht. Doch dieser Aufwärtstrend der Branche würde einmal seinen Zenit erreichen, und von da an würde es eng für die klassischen Hoteliers werden.
Ich las weiter und dachte darüber nach, wie die Digitalisierung die klassischen Hotels verändern könnte, und in welche Richtung die Hotelketten, mit denen ich als Investmentbanker eng zusammenarbeitete, denken mussten. Abgesehen von dem digitalen Auftritt und der Buchung fielen mir noch weitere Abläufe in Hotels auf, die nur deshalb menschliches Wirken zu erfordern schienen, weil es alle so gewöhnt waren.
Etwa beim Check-in. Musste wirklich ein Mensch hinter einem Tresen stehen, der Daten entgegennahm und eine Plastikkarte mit anderen Daten darauf aushändigte? Nahm ich für den Vorteil, von einem vielleicht schlecht gelaunten Menschen bedient zu werden, wirklich so gerne Wartezeiten an einer Rezeption in Kauf? War der menschliche Faktor wirklich so wertvoll, wenn ich nachts, müde von einem Flug, in einem Hotel ankam und nichts anderes als Ruhe wollte?
Für die Luxushotels mochten diese Fragen mit »Ja« zu beantworten sein. Ihre Gäste legten Wert auf persönlichen Service. Doch die Hoteliers vieler anderer Gasthäuser warteten vermutlich schon auf eine digitale Lösung für den Check-in, die ihnen Personalkosten ersparen würde.
Lange würden sie sich nicht mehr gedulden müssen. Programmierer arbeiteten bereits an Schlüsselcodes für Smartphones. Hotelgäste würden dann zu ihren Zimmern gehen, das Mobiltelefon dort an den Türgriff halten, wo ein kleines Licht leuchtet, und eintreten. Ein Prozess ganz ähnlich jenem, der beim Check-in auf Flughäfen üblich geworden ist.
Noch am gleichen Abend sah ich mir die Internetseiten meiner Firmen an und bemerkte, was ich schon im tiefgekühlten Vortragssaal vermutet hatte: lauter benutzerfeindliche Hürden, dazu umständlich aufzufindende Inhalte, die weder informativ noch unterhaltend waren. Da ließ sich einiges verbessern.
Als nächstes sah ich mir meine Social-Media-Präsenz an. Dort gab es bisher keinen einzigen aktiven Post. Ich hatte nur beantwortet, was gekommen war. Zum ersten Mal postete ich jetzt selbst ein Status-Update auf Facebook. Es dauerte, bis ich das mit meinem Handy geschafft hatte.
Beste Grüße aus Palm Beach vom Tony-Robbins-Seminar.
Daneben stellte ich einige Fotos vom Strand, von Palmen und vom Seminar. Für diesen Post bekam ich meine ersten 100 Likes.
Die wichtigste Information, mit der ich von dem Seminar nach Hause flog, lautete: Eine neue Trennlinie wird sich durch die Gesellschaft ziehen, die wichtiger sein wird als die zwischen Arm und Reich oder die zwischen Jung und Alt. Auf der einen Seite werden Menschen stehen, die sich mit der digitalen Welt befasst haben, sie verstehen, sich ihr anpassen und sie gestalten. Auf der anderen Seite werden sich jene befinden, die das neue technisch Machbare höchstens als Konsumenten nutzen.
Teilweise wird sich diese Trennlinie mit jener zwischen Arm und Reich decken, weil die digitalen Verweigerer sozial absteigen werden. Teilweise wird sie sich mit der zwischen Jung und Alt überschneiden, wobei es auch junge Menschen geben wird, die ihre Rolle in der digitalen Welt auf die von Konsumenten beschränken, und alte, die erstaunlich behände im Umgang mit ihr sein werden.
Doch insgesamt wird diese Trennlinie die gesellschaftlichen Hierarchien ganz neu strukturieren. Ein verrückter Hacker, der Gras raucht und jetzt vielleicht noch Hartz-IV-Empfänger ist, kann dann zur Elite gehören. Umgekehrt kann einem digitalen Bummler, der nach jetzigen Maßstäben eine Eliteausbildung genossen hat, der soziale Abstieg in die unteren Schichten drohen.
Wie viele Follower jemand in den sozialen Medien hat, wird zu einem der wesentlichen Statussymbole werden. Es wird wichtiger sein als die Frage, über welche Statussymbole oder welche Titel jemand verfügt.
Ich begriff: Wenn ich mich nicht rasch an die Digitalisierung anpasste und mir das nötige Wissen dazu aneignete, würde ich in zehn Jahren ein langweiliger Investmentbanker mit einer Menge Eigentumswohnungen sein. Während ich in der ersten Klasse einer Linienmaschine sitzen würde, würden Menschen, die meine Kinder sein könnten, mich in ihren Privatjets überholen. Womöglich war selbst das noch eine optimistische Perspektive.
DIE DICKEN HUNDE VON LAS VEGAS
Ich ging vor wie immer, wenn ich mir etwas aneignen will. Zuerst hielt ich nach Menschen Ausschau, die sich mit dem Thema besser auskannten als ich. Deshalb fiel mir eine Nachricht auf, die mir ein junger Mann auf Facebook geschickt hatte. »Du brauchst einen Social-Media-Manager«, hatte er geschrieben.
Statt seine etwas kecke Ansage einfach zu ignorieren, wie ich es früher getan hätte, antwortete ich ihm. »Du hast recht«, schrieb ich. »Wir sollten reden.«
Wir trafen uns noch am Freitag der gleichen Woche in der Bar des Frankfurter A&O-Hotels in der Mainzer Landstraße. Es war 1.30 Uhr morgens. Ich hatte zuvor einen Termin in Wiesbaden gehabt, der sich verzögert hatte. Christos, ein in Hannover lebender Deutscher mit einem griechischen Vater, hatte deswegen bereits eine halbe Stunde auf mich gewartet und war trotzdem motiviert. Er erklärte mir, wie wichtig mein digitaler Auftritt für mich sei und was ich dabei bisher falsch machte. »Du musst mehr und regelmäßiger Beiträge posten und die Fotos müssen von besserer Qualität sein«, sagte er. »Außerdem reicht Facebook nicht. Du solltest auch Plattformen wie YouTube, Twitter und Instagram ernst nehmen.«
»Das ist alles?«, fragte ich.
»Du solltest ein digitales Geschäft aufbauen«, empfahl Christos. »Ganz egal, was es sein wird, es wird dein traditionelles Geschäft bald überholen.«
Das war ebenso simpel wie sein Hinweis auf mein noch immer mangelndes Engagement in den sozialen Medien, doch ich vermutete, dass er auch damit recht hatte. Womit sich die Frage stellte, was für ein digitales Geschäft ich entwickeln sollte.
Als Investmentbanker beschaffe ich Geld für Unternehmen. Als Immobilieninvestor kaufe ich nach dem stets gleichen Schlüssel aus Preis, Mieterlösen und erwartbarer Standortentwicklung Wohnungen und Mietshäuser. Als Berater sitze ich beispielsweise in Verwaltungsräten. Was ließ sich daraus machen?
Christos schlug vor, dass ich zunächst den digitalen Auftritt meiner Firmen verbessern solle. Die Idee für mein digitales Geschäft würde ich haben, wenn ich mit den Möglichkeiten der digitalen Welt vertrauter wäre.
»Wann kannst du bei mir anfangen?«, fragte ich Christos, als bereits der Morgen dämmerte.
Wir buchten noch in der Nacht seinen Flug nach Wien.
Zunächst brachten wir die Internetseiten meiner Firmen in Ordnung. Wir sorgten dafür, dass sie gut aussahen und benutzerfreundlich sowie mit Google leicht zu finden waren. Anschließend beschäftigten wir uns mit meiner digitalen Identität. Dank meiner Bücher hatte ich als Ratgeber für Geld und Erfolg die Marke Investment Punk aufgebaut. Ich hatte sogar einige Freunde in den sozialen Medien, denen ich aber digital nichts bot. Wofür konnte ich diese Ausgangsbasis nutzen?
Ich flog nach Berlin, um dort Gründer erfolgreicher Startups zu treffen. Ich wollte wissen, wie und woran diese neue Unternehmergeneration arbeitete.
Ich besuchte eine Party in der Wohnung einer jungen Internetunternehmerin. Sie fand in einem typischen Berliner Altbau in Kreuzberg statt, der außen mit Graffiti beschmiert war, während die Wohnung aus schönen, hohen Räumen bestand und zwei Balkone hatte. Drinnen tranken 40 bis 50 Gäste Wodka Orange, Bacardi Cola und Gin Tonic aus Plastikbechern. Sie sahen aus wie Studenten, doch in Wirklichkeit waren sie Software-Unternehmer, Programmierer oder Spezialisten für digitales Marketing und redeten dementsprechend unaufhörlich über Programmierungsfragen, Reichweiten und Marketingbudgets.
Dort lernte ich einen jungen Mann kennen, der gerade mit einem Partner an einem digitalen Kassensystem arbeitete, das Lagerhaltung, Bestellsystem und Buchhaltung miteinander verknüpfte. Er erklärte mir das gemeinsame Ziel dieser digitalen Generation in zwei Sätzen. »Die etablierten Systeme sind klobig, umständlich, veraltet und teuer«, urteilte er. »Dazu suchen wir Alternativen.«
Doch wofür sollte ich eine Alternative suchen? Ich wusste noch immer nicht, welches digitale Geschäft ich aufbauen sollte.
Nach einigen Wochen war mir klar, dass Berlin im deutschsprachigen Raum das Zentrum der digitalen Wirtschaft ist, dass ich aber, wenn ich von den Besten lernen wollte, hier noch nicht am Ziel war. Ich musste in die USA, ins Silicon Valley, denn dort saßen die Pioniere der digitalen Wirtschaft. Also bat ich Christos, eine Vorauswahl amerikanischer Social-Media-Konferenzen zusammenzustellen, aus der ich dann eine in Las Vegas wählte.
Kurz vor meiner Reise dorthin trat ich als Jurymitglied bei der im österreichischen Privatfernsehen ausgestrahlten Start-up-Show »Querdenker« auf. Jungunternehmer konnten dort ihre Geschäftsideen präsentieren und, wenn sie überzeugend waren, Investorengelder akquirieren. Unter den Bewerbern dieser Ausgabe der Sendung war ein Start-up namens teachme, eine App zur Vermittlung von Nachhilfeunterricht. Paul, der Betreiber des Start-ups, wurde in der Show Zweiter, und ich lud ihn ein, mit mir ins Silicon Valley zu reisen.
Digitale Vermittlung von Nachhilfeunterricht. Im Flugzeug nach Las Vegas dachte ich, etwas unbequem sitzend, obwohl ich mir für 2.500 Euro ein Business-Class-Ticket geleistet hatte, darüber nach. Dabei wurde mir klar, was mein digitales Geschäft sein würde. Warum war ich nicht früher darauf gekommen?
Ich unterrichtete an Universitäten, hielt Vorträge und bot Seminare zu Themen wie finanzielle Unabhängigkeit, Immobilienkauf und Unternehmensbeteiligungen an. Mein Ziel, meine eigene Wirtschaftsuniversität zu leiten, war mir trotzdem eben noch fern erschienen. Jetzt begriff ich, dass es Zeit war, mit ihrer Verwirklichung anzufangen, und zwar in digitaler Form. Damit konnte ich ein digitales Geschäftsmodell aufbauen. Mit dieser Idee im Hinterkopf kam ich bei der Konferenz in Las Vegas an.
Es ging dort zu wie bei allen amerikanischen Konferenzen: Die Hallen waren überfüllt, die Temperaturen eisig und das Essen schrecklich. Doch ich hörte mir die Vorträge aufmerksam an.
»Früher konnte ein Opernsänger, selbst wenn er berühmt war, nur das Gebäude füllen, in dem er auftrat«, beschrieb einer der Redner. »Heute kann ein Musiker, selbst wenn er nicht berühmt ist, Menschen auf der ganzen Welt erreichen und Geld in Regionen verdienen, in denen er noch nie war. Wie erfolgreich er ist, hängt dabei vor allem von der Qualität seines digitalen Auftrittes ab.«
Mir fiel die Geschichte des kanadischen Provinzmusikers Dave Carroll und seiner Band Sons of Maxwell ein, die mich bereits einige Jahre zuvor beschäftigt hatte. Bei einem Flug mit United Airlines ging seine Gitarre zu Bruch und seine Interventionen bei der Fluglinie wegen Schadenersatzes blieben erfolglos. Für einen Song über dieses Ereignis erhielten Carroll und seine Band auf YouTube mehr als 16 Millionen Klicks und verdienten in der Folge viel Geld. Sein Nettovermögen stieg von null auf mehrere Millionen Euro, und Universitäten luden ihn als Gastdozenten zu diesem Thema ein. Selbst der Hersteller der zu Bruch gegangenen Gitarre hatte die Gunst der Stunde genutzt und Rekordverkäufe erzielt, während der Chef von United Airlines wie ein begossener Pudel dastand und mit dem Entschuldigen gar nicht mehr fertig wurde.
»Die meisten Berufsgruppen, nicht nur Musiker, können mit einem guten digitalen Auftritt in Regionen Geld verdienen, in denen sie noch nie waren«, betonte der Redner. Er zeigte ein Foto von einem Tierarzt. »Wie viel Prozent seines Umsatzes macht dieser Mann Ihrer Meinung nach dank seines digitalen Auftrittes?«, fragte er.
Die Schätzungen des Publikums lagen bei 20 bis 30 Prozent. Doch der Mann auf der Bühne des Las Vegas Convention Centers, einer schmucklosen Halle mit weitläufigen Parkplätzen davor, schüttelte den Kopf. »90 Prozent«, sagte er. »90 Prozent seines Umsatzes erzielt dieser Tierarzt aufgrund seines Internetauftrittes. Und warum ist das so? Weil er eine Idee hatte, die er professionell verwirklicht hat. Was war seine Idee? Ganz einfach: Hier bei uns in Amerika sind nicht nur viele Menschen zu dick. Selbst viele Hunde sind es. Deshalb hat er einen Hunde-Parkour entwickelt, mit Bällen und Würstchen zur Belohnung, auf dem die Tiere wieder lernen, ihren Instinkten zu folgen und zu laufen.«
Er zeigte uns Fotos und Videos von der Internetseite des Tierarztes. Darauf waren Exemplare der drei beliebtesten amerikanischen Hunderassen, Labrador Retriever, Yorkshire Terrier und Schäferhunde, zu sehen. Vor dem Eingreifen