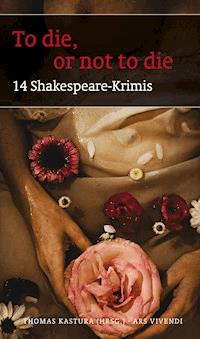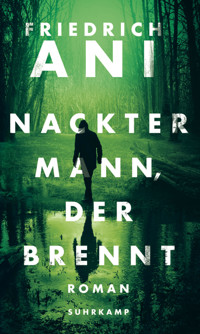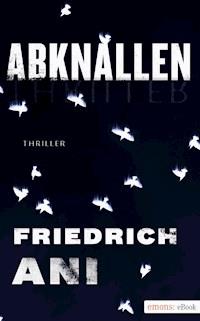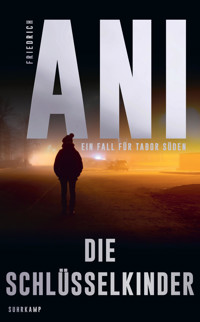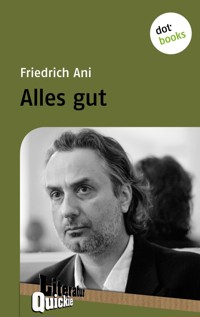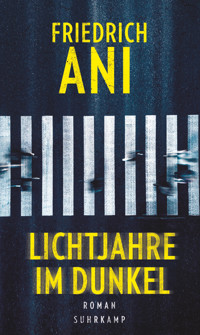11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Tabor Süden hat Urlaub, baut Überstunden ab und tut wenig anderes, als sich durch München treiben zu lassen. Doch dann wird er überraschend ins Dezernat 11 gerufen: Dort nervt ein Mann alle Kommissare, und sie werden ihn nicht mehr los. Jeremias Holzapfel kam auf die Vermisstenstelle, um mitzuteilen, er sei wieder da. Kurios daran ist nur: Niemand hat ihn als vermisst gemeldet! Und so nimmt sich Süden dieses seltsamen Rückkehrers an – und tritt mit ihm eine Reise in eine schmerzhafte Vergangenheit an ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Titel
Friedrich Ani
Der Straßenbahntrinker
Ein Fall für Tabor Süden
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Der hier vorliegende Text erschien zunächst 2002 unter dem Titel Süden und der Straßenbahntrinker bei Droemer Knaur, München.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5297.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagfoto: mauritius images/Michael Gilmore/Alamy/Alamy Stock Photos
eISBN 978-3-518-77427-4
www.suhrkamp.de
Der Straßenbahntrinker
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Der Straßenbahntrinker
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quellennachweis
Informationen zum Buch
Der Straßenbahntrinker
Ich arbeite auf der Vermisstenstelleder Kripo und kann meinen eigenenVater nicht finden.
Tabor Süden
1
Der Mann sah mich an und gleichzeitig an mir vorbei oder durch mich hindurch. Merkwürdigerweise hatte ich nicht den Eindruck, er würde schielen. Anscheinend stimmte mit seinen Augen etwas nicht, sie bewegten sich alles andere als synchron, und die Pupillen wirkten außerdem ungewöhnlich groß.
Der Mann stand vor mir, die Hände in den Taschen seiner Cordhose, und schwitzte. Es war heiß an diesem dritten September, und die Luft in der Halle des Hauptbahnhofs, wo wir uns getroffen hatten, schmeckte klebrig. Und doch kam es mir vor, als schwitze der Mann nicht deswegen. Als schleppe er vielmehr einen glühenden Körper mit sich herum.
Der Mann schien gleichermaßen hochgradig verwirrt und sich seiner Sache vollkommen sicher zu sein. Es war, als stünden zwei Personen vor mir. Und hätte der Mann mich gefragt, wie ich zu dieser Einschätzung komme – er selbst sehe sich nämlich keineswegs doppelt –, ich hätte keine plausible Antwort gewusst.
Aber ich war überzeugt, dieser Mann, der sich mit dem Namen Jeremias Holzapfel vorgestellt hatte, log mich die ganze Zeit über an. Und zwar nicht, weil er mich bewusst täuschen wollte, sondern weil er nicht anders konnte. Weil er selbst nicht die geringste Ahnung hatte, was mit ihm vorging, warum er sich so verhielt, was genau er eigentlich von mir erwartete.
»Ich hab Urlaub, Herr Holzapfel«, sagte ich.
Das erklärte ich ihm bereits zum vierten Mal.
»Können Sie was für mich tun?«, fragte er.
Ich wusste nicht, was. Und meine Kollegen wussten es auch nicht. Bevor Volker Thon, der Leiter der Vermisstenstelle im Dezernat 11, wo ich als Hauptkommissar arbeite, mich anrief, hatte er zwei Tage lang versucht den Mann zu beruhigen. Er war Dienstagmorgen plötzlich aufgetaucht und ließ sich nicht wieder abschütteln. Zunächst hatte Thon vorschriftsgemäß die Angaben des Mannes notiert, um einen Vermisstenwiderruf für das Computersystem des Landeskriminalamtes zu verfassen. Bald aber merkte er, dass die Aussagen des Mannes auf keinerlei vorhandenen Daten basierten und seine Beteuerungen offenbar Hirngespinste waren.
Jeremias Holzapfel war mit der Absicht auf die Vermisstenstelle in der Bayerstraße gekommen, seine Rückkehr kundzutun. Nachdem er, wie er sagte, vier Jahre und sechs Monate verschwunden gewesen sei, teile er offiziell mit, dass er nicht länger vorhabe, seine Verwandten und Freunde über seine Lebensumstände im Unklaren zu lassen, und beabsichtige, von nun an in seiner Heimatstadt zu bleiben.
»Löschen Sie meine Daten«, hatte er zu den Hauptkommissaren Thon und Weber gesagt. »Es gibt keinen Grund mehr, mich zu suchen.«
Eine Stunde später war meinen Kollegen klar: Dieser Mann ist nie vermisst worden. Kein Mensch hatte in den vergangenen vier Jahren und sechs Monaten nach ihm fahnden lassen, weder in Bayern noch in einem anderen Bundesland. Über Jeremias Holzapfel existierte keine Akte, in den Systemen von LKA, BKA und unserer eigenen Direktion gab es für sein Verschwinden keinen Anhaltspunkt.
Natürlich hatten meine Kollegen ihn nach Hause geschickt, angeblich wohnte er in einem Hochhaus mit der Adresse Theresienhöhe 6c, das war im Westend, oberhalb der Theresienwiese, auf der jedes Jahr das Oktoberfest stattfindet.
Unter dieser Anschrift war Jeremias Holzapfel, wie meine Kollegen schnell herausfanden, tatsächlich gemeldet. Ihr Angebot, ihn dort hinzubringen, lehnte er ab.
Drei Stunden später klingelte er erneut an der Eingangstür im Parterre des Dezernats. Er nannte einen anderen Namen und gelangte bis vor die verschlossene Glastür im vierten Stock. Dreist behauptete er gegenüber der jungen Freya Epp, die erst kurz zuvor ihren Dienst angetreten hatte, er habe einen Termin bei Volker Thon. Daraufhin blieb meinem Vorgesetzten nichts anderes übrig, als sich noch einmal mit Holzapfels Geschichte zu beschäftigen, was ihm, wie ich mir gut vorstellen konnte, ein Höchstmaß an Disziplin abverlangte. Leute, die ihm den Nerv töteten, würde er jedes Mal am liebsten wegen Lebenszeitdiebstahls anzeigen. Dennoch gelang es ihm, Holzapfel einzureden, seine Angaben seien selbstverständlich gespeichert worden und man werde der Tatsache, dass die Vermisstenanzeigen allem Anschein nach verschludert wurden, auf den Grund gehen und ihn über die Recherchen auf dem Laufenden halten.
Holzapfel, sagte mir Thon am Telefon, habe sich bedankt und sei gegangen. Am nächsten Morgen um zehn rief er an und fragte, was es Neues in seiner Sache gebe. Im Laufe des Tages meldete er sich dann fünf weitere Male, was Thon schließlich derart aus der Ruhe brachte, dass er Holzapfel beschimpfte und ihm riet, zum Arzt zu gehen. Danach wartete Holzapfel bis kurz vor sieben Uhr abends, ehe er wieder anrief. Thon war schon gegangen und so landete er bei Sonja Feyerabend, die ihm geduldig zuhörte. Wie Thon konnte sie es nicht ausstehen, wenn Leute ihr mit ihrem Gerede die Zeit raubten. Im Gegensatz zu ihm jedoch war sie empfänglich für Stimmen. Gefiel ihr eine Stimme, entwickelte sie enorme Geduld, die in krassem Gegensatz zu ihrer sonstigen Ungeduld gegenüber Menschen stand, die nicht wussten, was sie wollten.
Und Jeremias Holzapfel zählte zu denjenigen, die nicht im Mindesten wussten, was sie wollten.
Das jedenfalls war Sonjas Meinung, als sie mich heute Nacht anrief und mir die Einzelheiten berichtete. Sie fragte mich, ob ich bereit sei, mit dem Mann zu sprechen, und ich sagte Nein. Natürlich schaffte sie es, mich zu überreden. Allerdings stellte ich die Bedingung, dass ich das Dezernat nicht zu betreten brauchte.
Ich hatte Urlaub. Resturlaub. Von insgesamt achtundsiebzig freien Tagen, die sich im Lauf eines Jahres angesammelt hatten, wollte ich einundzwanzig in diesem September nehmen. Und auch wenn ich nicht vorhatte zu verreisen und auch sonst nichts Spezielles oder Wichtiges geplant hatte, kam es für mich nicht in Frage, auch nur einen Fuß in mein Büro zu setzen, noch dazu wegen einer Vermissung, die keine war.
Mit Worten, die sie mir nicht verriet, überzeugte Sonja Jeremias Holzapfel sich mit mir im Hauptbahnhof zu treffen, gegenüber dem Dezernat 11. Der Mann brauchte also nur über die Straße zu gehen, bevor er noch einmal auf die Idee kam, im vierten Stock zu klingeln.
Dank Sonjas Beschreibung hatte ich ihn schon von weitem erkannt. Er hatte graues struppiges Haar und trug ein hellbraunes, ausgewaschenes Hemd unter einem blassblauen Blouson und Wildlederschuhe ohne Socken. An seinem linken Ohr baumelte ein kleiner goldener Ring. Holzapfel hinkte und wankte ein wenig, auf den ersten Blick hätte man meinen können, er sei angetrunken und habe seit Tagen kein Bett gesehen.
Dann, als er wenige Meter vor mir stand, ohne dass ich ihn schon begrüßt hatte, fiel mir sein seltsamer Blick auf und die Art, wie er den Mund bewegte. Er schob die Kiefer hin und her, rieb die Lippen aufeinander wie manche Frauen, wenn sie neuen Lippenstift aufgetragen haben, und blickte starr in die Ferne, als konzentriere er sich auf einen bestimmten Punkt.
Ich nannte meinen Namen. Er sah mich an, zumindest wandte er mir den Kopf zu, und streckte mir die Hand hin.
»Sie können mir helfen«, sagte er.
Und ich sagte: »Eigentlich habe ich Urlaub.«
»Urlaub sehr gut«, sagte er, und seine Blicke huschten an mir vorbei oder durch mich hindurch oder beides zur gleichen Zeit.
»Meine Frau war damals sogar im Fernsehen wegen mir«, sagte Holzapfel. Er trank seinen dritten Kaffee, alle schwarz, was ich bewunderte, da das Getränk, das an diesem Kiosk vor den Gleisen ausgeschenkt wurde, ungesüßt und milchlos praktisch ungenießbar war. Doch Holzapfel verzog keine Miene. Er leckte sich die Lippen und drehte den Pappbecher in den Händen, als würde er sich genüsslich daran wärmen. Dabei lief ihm der Schweiß noch immer übers Gesicht.
»Woher wissen Sie das?«, fragte ich. Ich trank schwarzen Tee mit Milch, der nach nichts schmeckte, vielleicht nach Pappe.
»Ich hab sie gesehen.«
»Wo haben Sie Ihre Frau gesehen?«
»Im Hotel.«
»In welchem Hotel?«
»Im Hotel Post in Österreich.«
»Wo in Österreich?«
»In Salzburg.«
»Sie fuhren also von München nach Salzburg an diesem Tag…«
»Am vierzehnten Februar«, sagte er schnell. Wieder starrte er auf etwas hinter mir. Ich drehte mich um. Da war nichts Ungewöhnliches. Leute mit und ohne Koffer eilten durch die Halle, an den Ständen kauften Reisende belegte Semmeln und Getränke, an der Metalltreppe, die zur Balustrade hinaufführte, hatte ein Verkäufer einen langen Tisch mit hunderten von Uhren aufgestellt, zwei Bahnpolizisten gingen mit einem Schäferhund Streife.
Ich folgte Holzapfels Blick, aber es war mir nicht möglich zu erkennen, was ihn faszinierte. Auf mein Umschauen reagierte er nicht. Vielleicht stand er unter Drogen. Auch wenn ich da meine Zweifel hatte. Wie er redete, wie er die Hände hielt, wie er nachdachte, wirkte er nicht abwesend oder unsicher, sein Gesicht war leicht gebräunt, er hatte keine Augenringe und wenn er trank, zitterte seine Hand nicht.
Allerdings schwankte er gelegentlich, wie am Anfang, als er auf mich zugekommen war. Ob dieses sanfte Hin und Her seines Oberkörpers von chemischen Substanzen oder Medikamenten ausgelöst wurde, war allerdings unmöglich zu beurteilen. Und Sonja hatte Recht: Der Klang seiner Stimme war klar und angenehm, manchmal hörte er sich an wie jemand, der eine Sprechausbildung absolviert hatte, selten verhaspelte er sich und wenn er sich korrigieren musste, setzte er in der gleichen Tonlage an wie zuvor. Als achte er darauf, dass ein Techniker den Tonschnitt so unauffällig wie möglich hinbekam.
Herauszufinden, ob der Mann früher beim Rundfunk oder Fernsehen gearbeitet hatte, würde nicht schwierig sein. Viel komplizierter erschien mir die Frage, was er mit seiner Vorstellung bezweckte und wieso er beharrlich damit weitermachte?
Was zu der Frage führte, wieso ich mich weiter damit beschäftigte und nicht nach einer halben Stunde zu ihm sagte, er möge sich ein anderes Publikum für seine Geschichte suchen, rund um den Bahnhof gebe es garantiert eine Menge Zuhörer, die sonst nichts zu tun hätten.
Genau wie ich. Und genau das waren Sonjas Worte gewesen: »Sie haben doch nichts zu tun, hören Sie ihn sich wenigstens mal an.«
Woher wollte sie wissen, dass ich nichts zu tun hatte?
Und bedeutete, nur weil ich nichts tat, dass ich auch nichts zu tun hatte?
Ich war kein Verreiser, meine Form des Urlaubs bestand darin, nicht ins Büro zu gehen, nicht auf die Uhr zu schauen, nicht zu telefonieren, still zu sein. Ich übte Schweigen. War das Nichtstun?
»Meine Frau hat mich als vermisst gemeldet.«
Diesmal sah mir Holzapfel direkt ins Gesicht. Jedenfalls kam es mir so vor.
»Wo ist Ihre Frau jetzt?«, fragte ich.
»Zu Hause.«
»Auf der Theresienhöhe?«
»Wo?«
Jetzt schaute ich ihm direkt ins Gesicht.
»Wohnen Sie nicht Theresienhöhe 6c?«
»Das ist möglich«, sagte er.
Ich schwieg. Ein älteres Ehepaar stellte sich neben uns, sie mit einem großen Pappbecher voll heißer Milch, er mit einem Kaffee. Auf einem Gepäckkuli hatten sie ihre Koffer gestapelt.
»Hoffentlich hat der Zug nicht Verspätung«, sagte die Frau.
»Der Zug hat immer Verspätung«, sagte der Mann.
»Hoffentlich nicht.«
»Wenn wir den Anschluss verpassen, gibts Ärger«, sagte der Mann.
»Wir haben noch nie einen Anschluss verpasst«, sagte die Frau.
»Weil ich immer schon vorher Ärger gemacht habe.«
Als sie losgingen, hakte sich die Frau bei ihrem Mann unter und er schob den Kuli zum Gleis. Sein Gang war aufrecht und entschlossen.
»Sie hat eine Anzeige aufgegeben«, sagte Jeremias Holzapfel wieder.
»Ja«, sagte ich. Wir drehten uns im Kreis. Oder wir drangen immer tiefer in den Tunnel ein, in den uns dieser Mann seit seinem ersten Auftauchen hineinzog.
»Und ich bin gekommen, um zu sagen, dass man mich nicht länger suchen muss. Können Sie das veranlassen, Herr Süden? Es ist mir… Ich möchte, dass die Dinge geregelt sind und die Polizei nicht nötiger… und die Polizei nicht unnötig Aufwand mit meiner Person hat. Ich bin hier, und die Sache ist damit erledigt.«
»Wo waren Sie vier Jahre lang?«
Darüber hatte er noch kein Wort verloren. Sowohl Thon als auch Weber und Sonja hatten ihn danach gefragt, und er hatte ihnen keine Antwort gegeben. Sonja sagte mir am Telefon, es sei gewesen, als habe er die Frage überhört oder nicht verstanden.
»Jetzt bin ich wieder da«, sagte er.
»Wo waren Sie?« Ich warf meinen Becher in den Abfalleimer und krempelte die Ärmel meines weißen Hemdes runter. Dann strich ich mir die Haare aus dem Gesicht und legte die Hand auf meinen Bauch. Ich hatte Hunger. Und ich hatte das Bedürfnis, allein zu essen.
»Ich möchte dabei sein, wenn Sie meine Akte vernichten«, sagte er.
»Warum?«
»Bitte?«
Endlich schien er direkt auf eine Frage zu reagieren.
»Warum wollen Sie dabei sein, wenn ich Ihre Akte vernichte?«
»Ich möchte nicht, dass meine Angehörigen weiterhin Schwierigkeiten wegen mir kriegen.«
»Haben Sie Kinder?«
»Ich habe sie lange allein gelassen, bin ihnen… Ich konnte ihnen bei meiner Abreise keine Erklärung geben, das war nicht möglich…«
»Warum war das nicht möglich?«
»Ich hab mir von einem Streifenbeamten den Weg zur Vermisstenstelle erklären lassen.«
Ich kam nicht näher an ihn heran.
»Ich werde Sie jetzt hier stehen lassen«, sagte ich. »Und ich bitte Sie, meine Kollegen nicht mehr zu belästigen. Wir haben Ihnen zugehört, Sie haben uns Ihre Geschichte erzählt, wir haben Ihnen erklärt, dass es keine Vermisstenakte über Sie gibt, wir sind nicht zuständig für Sie. Gehen Sie nach Hause, sprechen Sie mit Ihrer Frau, schlafen Sie sich aus, vielleicht sind Sie übermüdet, ich kenne Sie nicht, Herr Holzapfel.«
»Bitte?«, sagte er.
»Bitte?«, sagte ich.
»Sie haben Herr Holzapfel zu mir gesagt.«
»Ja.«
»Ich heiße nicht Holzapfel.«
Für einen Moment dachte ich, da war einer auf Rache aus, da wollte jemand der Polizei etwas heimzahlen und es war ihm gelungen, eine ganze Abteilung drei Tage lang in Atem zu halten.
Doch dann tat er etwas, das mich schlagartig von diesem Verdacht abbrachte.
Er drehte sich um und rannte davon. Er ging nicht, er rannte. Quer durch die Halle, vorbei am Informationsschalter, am Uhrenverkäufer unter der Metalltreppe, am Zeitungsladen. Er lief zickzack zwischen den Leuten hindurch, die aus dem Untergeschoss von den U- und S-Bahnen heraufkamen, und weiter in Richtung der Taxis, die vor dem Nordeingang warteten.
Ohne nachzudenken, stürzte ich hinter ihm her.
Nach zwanzig Metern war ich außer Atem. Als ich die Halle verließ, sah ich das blassblaue Blouson hinter dem Rückgebäude eines Gasthauses verschwinden.
Aus unerfindlichen Gründen folgte ich dem Mann, keuchend und hustend und im Wissen, dass ich als Beschatter nicht viel taugte. Schon als junger Kommissar hatte ich bei solchen Aktionen ständig das mulmige Gefühl gehabt, mehr beobachtet zu werden, als selbst zu beobachten. Vor allem bei Observationen mit dem Auto kam ich mir unbeholfen und dilettantisch vor.
Freilich schien die Verfolgung von Jeremias Holzapfel – oder wie immer er heißen mochte – keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu erfordern. Etwa dreihundert Meter vor mir hastete er dahin, sah nicht nach rechts und links, wich niemandem aus und bog schließlich gegenüber der Pension Asta von der Hirtenstraße nach links ab.
Es war das erste Mal, dass ich mit meinen alten Turnschuhen tatsächlich rannte.
Durch die Paul-Heyse-Unterführung gelangten wir zur Bayerstraße. Nachdem er sie überquert hatte, blieb Holzapfel abrupt stehen, sah hinüber zum Pressehaus und schwankte sekundenlang mit dem Oberkörper hin und her. Er hatte die Hände in die Hosentaschen gesteckt und schien über etwas nachzudenken.
Ebenso ruckartig, wie er stehen geblieben war, setzte er seinen Weg fort.
An der nächsten Ampel wartete er auf Grün, ging dann auf die andere Seite und von dort die Schwanthalerstraße hinauf zur Theresienhöhe. Wieder schien er niemanden und nichts wahrzunehmen, behielt sein Tempo die ganze Zeit gleichmäßig bei, und ich hatte Mühe, an ihm dranzubleiben. Mein Hemd war schweißverklebt, und ich fing an, mich zu fragen, ob ich verrückt geworden sei. Was wollte ich von dem Mann? Wieso hatte ich mich auf das Gespräch im Bahnhof eingelassen? Hing mein Verhalten mit Sonja Feyerabend zusammen? Wollte ich ihr einen Gefallen tun, weil die heimliche Zuneigung, die ich für sie empfand, weniger heimlich werden sollte?
Ich blieb stehen. Ich war doch nicht wegen meiner Kollegin hier. Wenn sie davon erfahren würde, würde sie mich auslachen, und mein Vorgesetzter Thon würde sich wieder einmal in seiner Meinung bestätigt sehen, ich sei ein absolut unberechenbares, stures und verwirrtes Mitglied seiner Abteilung, für Teamarbeit unbrauchbar.
Weit vor mir näherte sich Holzapfel dem Karstadt-Gebäude, und sein Ziel war eindeutig: Das Kaufhaus befand sich in den unteren Etagen des Hochhauskomplexes, in dem er wohnte. Warum sollte ich ihm also weiter hinterherrennen?
Warum?
Warum rannte ich ihm weiter hinterher? Ich beeilte mich sogar. Vielleicht hatte ich einen Sonnenstich. Vielleicht hatte ich gerade einen Anfall von kindischer Abenteuerlust, die, so lächerlich sie für einen Mann von vierundvierzig Jahren auch sein mochte, nur zu überwinden war, indem ich ihr nachgab, egal was passierte. Wenn mein Schatten ein Eigenleben hätte, würde er sich an den Kopf greifen und nach einem anderen Körper, der ihn werfen könnte, Ausschau halten.
Beim Einbiegen in die Schießstättstraße, die an der Westseite des Kaufhauses vorbeiführt, begriff ich, dass ich Holzapfel verloren hatte. Vermutlich war er in seine Wohnung zurückgekehrt, trank Tee und beruhigte sich wieder.
Trotzdem kontrollierte ich das Klingelschild von Num-mer6c, das pro Stockwerk sechs und im dreizehnten Stock zwei Namen aufwies. Auf einem der weißen Schild-chen im achten Stock stand in schwarzen Buchstaben: »Holzapfel«.
Also waren die Eintragungen beim Einwohnermeldeamt, die meine Kollegen überprüft hatten, richtig. Was immer den Mann bewogen hatte uns aufzusuchen, es spielte keine Rolle mehr.
Ich beschloss, im Karstadt-Restaurant etwas zu essen.
Warum ich nichts bemerkte, ist mir bis heute ein Rätsel.
2
Am Abend wartete ich bis zehn Uhr auf Martin Heuer, dann trank ich mein Bier aus, bezahlte und ging.
Wir waren in einem vietnamesischen Lokal nicht weit von seiner Wohnung entfernt verabredet gewesen, und ich hatte vier Stunden auf ihn gewartet. Dazusitzen, zu schauen und für mich zu sein inmitten redender, essender, flirtender Gäste war ein wachsendes Vergnügen, das nur zum Teil daher rührte, dass ich andere beobachtete und mich an ihren kleinen Tricks und Marotten erfreute. Was mich, je länger ich allein in einem Gasthaus saß, geradezu ermunterte, noch etwas zu bestellen, war die Gewissheit, hinterher niemandes Anhang zu sein und niemanden in ein fremdes Zimmer begleiten zu müssen. Wie der Dichter sagt, hatte ich die Freiheit aufzubrechen, wohin ich wollte.
Allerdings ärgerte ich mich maßlos, wenn mich jemand wohin bestellte und dann nicht auftauchte. Dabei spielte es keine Rolle, ob ich denjenigen kaum kannte oder ob es sich um meinen besten Freund handelte.
»Heuer. Eine Nachricht wäre nett.« Zweimal hatte ich auf seinen Anrufbeantworter gesprochen, als wüsste ich nicht, dass ich ebenso gut an eine Wand hätte hinreden können. Wenn Martin in der Stadt gewesen wäre, hätte er sich längst gemeldet.
Wegen der Fahndung nach einem jugendlichen Geschwisterpaar hatte er nach Berlin fliegen müssen, dem Mekka aller jungen Ausreißer, und nach zwei Tagen Suche mit den dortigen Kollegen sollte er heute Abend mit dem Flugzeug zurückkommen.
Aber er kam nicht. Also bestellte ich die übliche Suppe, das übliche Hühnergericht, die üblichen Biere, wünschte heimlich einem streitenden Paar eine schnelle Trennung und hörte mir am Nebentisch eine Abhandlung über das Golfspielen an, die die Partnerin des Monologisierenden souverän ertrug, indem sie regelmäßig lächelte und nickte und ihm allen Ernstes die Hand streichelte, wenn er sie ihr gestenreich entgegenstreckte. Das Lokal war klein, und die Tische waren eng gestellt, so dass ich dem Gebrüll einer Frau hinter mir zuhören musste, die ihrem Begleiter ununterbrochen vorwarf, er sei ein Schwein und Lügner und Lügner und Schwein. Sofort wünschte ich, Bärbel Schäfer käme herein und böte den beiden einen Exklusivauftritt in ihrer Talkshow an.
Später atmete ich vor der Tür die Stille ein. Die vorbeifahrenden Autos, Linienbusse und Straßenbahnen hörte ich nicht. Ich streckte die Arme in die Höhe und schloss die Augen. Sekunden grandioser Unabhängigkeit. Auch wenn ich froh war, dass niemand mich fragte, wovon oder von wem ich eigentlich unabhängig sei.
Eine gewisse Menge Bier versetzte mich manchmal in einen Zustand innerer Überlegenheit, die unser Polizeipsychologe vermutlich als destruktive Aggression definiert hätte, auf die ich mir nichts, aber auch gar nichts einzubilden bräuchte.
Der Nachteil von zu langem Alleinsitzen in überfüllten Gasthäusern war, dass mich auf dem Heimweg Stimmen überfielen, die durch meinen Kopf rasten wie von der Leine gelassene Hunde. Dann machte ich Umwege, weil ich ahnte, ich würde im Bett nicht einschlafen können.
Da Martin in Neuhausen wohnt und ich in Giesing, musste ich quer durch die Stadt. Ich benutzte zuerst den Bus, dann die Tram, stieg aber bereits am Mariahilfplatz aus und ging zu Fuß den Nockherberg hinauf. Es war eine laue Nacht, und in den Biergärten saßen immer noch Gäste.
»Guten Abend, Herr Süden.«
Fast wäre ich über die Stimme im Dunkeln erschrocken.
»Frau Schuster«, sagte ich.
Die alte Frau, die im selben Haus wie ich wohnt, kam mir im Innenhof mit einer Gießkanne entgegen.
»Ich hab Sie schon gesucht«, sagte sie. Sie hatte eine Strickjacke über ihrem braunen Kleid an und Filzpantoffeln an den nackten Füßen.
»Hier bin ich«, sagte ich.
»Sie haben Besuch gehabt, Herr Süden. Ein Mann.«
»Ein dünner Mann mit struppigem Haar, in meinem Alter?«
»Ich hab ihn nicht gefragt, wie alt er ist.« Sie stellte die Kanne ab und blickte zum Himmel.
Ich schaute ebenfalls hinauf. Nach einer Weile bemerkte sie es.
»Manchmal sind Sie sehr kindisch, Herr Süden«, sagte sie.
Ich sagte: »Ich sehe mir auch gern Sterne an.«
Elsa Schuster legte die Hand in den Nacken. »Ich guck mir doch keine Sterne an! Wissen Sie nicht, dass einige von denen schon längst erloschen sind, aber das Licht bloß so lange braucht bis zu uns?«
»Na und?«
»Na und? Was soll ich da extra hinschauen, wenn das alles bloß Bluff ist.«
»Das ist doch kein Bluff!«, sagte ich. »Das sind physikalische Gesetze, die…«
»Ja, ja«, sagte sie und klopfte mit der flachen Hand auf ihren Nacken. »Ist mir egal, ich bin verspannt. Ich war den ganzen Abend bei Frau Gerber, die hat ein Sofa, das ist so durchgesessen, da sitzen Sie praktisch auf dem Teppich. Ich musste Scrabble mit ihr spielen, stundenlang, sie gewinnt dauernd. Na ja… Ich hab ihre Blumen gegossen, die Frau Gerber sitzt ja im Rollstuhl zur Zeit, Sie wissen doch, wegen dem Fahrradunfall…«
»Wie geht’s ihr?«
»Besser als sie tut«, sagte Frau Schuster, warf einen Blick zum Wohnblock auf der anderen Seite der Wiese und senkte die Stimme. »Sie lässt sich verwöhnen, sie hat das gut raus, sie denkt, wir merken das nicht. Na ja… Ich hab jedenfalls zu ihr hochschauen müssen, stundenlang, ich glaub, ich nehm jetzt erst mal ein Entspannungsbad.«
»Gute Idee«, sagte ich.
Ich holte den Schlüssel aus der Tasche.
»Der Mann war nicht dünn«, sagte Frau Schuster. »Aber so genau gesehen hab ich ihn nicht, ich war ja drüben bei Frau Gerber. Ich stand am Fenster, da hab ich ihn hier an der Tür gesehen.«
»Und woher wissen Sie, dass er zu mir wollte?«
Ich hielt ihr die Haustür auf, und sie ging hinein.
»Das hat mir Frau Rinser gesagt, die ist nämlich grad rausgegangen, als der Mann da stand, und sie hat ihn gefragt, und er hat gesagt, er wollt nur sehen, ob ein gewisser Herr Süden hier wohnt…«
»Hat er seinen Namen genannt?«
»Das weiß ich nicht, ich hab Frau Rinser nicht gefragt.«
Elsa Schuster sperrte ihre Wohnungstür im Parterre auf.
»Gute Nacht«, sagte ich. »Und gute Besserung.«
»Na ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich setz mich schon nicht gleich in einen Rollstuhl deswegen.«
Zum Gruß hob sie die grüne Plastikkanne hoch. »Nacht, Herr Süden. Ach ja… Gibts eigentlich keine Friedhofspolizei? Andauernd klaut mir jemand meine Gießkannen, ich hab mir die jetzt von Frau Gerber geliehen…«
»Auf dem Friedhof können Sie doch welche ausleihen«, sagte ich.
»Da sieht man, dass Sie nie hingehen«, sagte sie. »Dort kriegen Sie keine. Die sind ständig weg. Und die Leute bringen sie nie zurück, die lassen die einfach stehen. Oder sie nehmen sie mit nach Hause. Können Ihre Kollegen da nicht mal auf Streife gehen?«
»Auf dem Friedhof?«
»Warum denn nicht? Die laufen ja sonst auch überall rum.«
»Gute Nacht, Frau Schuster.«
»Manchmal denk ich ja, Sie sind gar kein richtiger Polizist, Herr Süden.«
»Was soll ich sonst sein?«
»Na ja