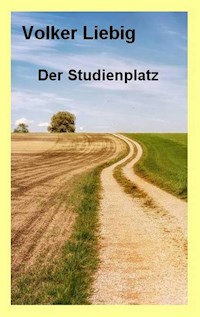
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem sechsten Schuljahr beschloss Gilbert Wehnert, der die Schule mit wenig Enthusiasmus besuchte, den Wünschen seiner Eltern (Abitur, Studium und ein besseres Leben für ihren Sohn) mit möglichst geringem Aufwand gerecht zu werden. Widerwillig trat er der FDJ bei und glaubte, damit die wichtigste Hürde genommen zu haben. Dem war nicht so. Eingebettet in und zwischen vielen Episoden wird erstmals ein realistisches Bild vom Leben in der DDR über einen Zeitraum von 25 Jahren gezeichnet. Der Protagonist beeindruckt durch sein Festhalten an gefassten Vorsätzen und durch seine Art, die Missstände auf ein erträgliches Maß abzumildern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 – Schulzeit und Jugend
Kapitel 2 – Die Armeezeit
Kapitel 3 – Das Berufsleben
Nachwort
Einleitung
In der Vergangenheit wurde ich, nachdem ich hin und wieder eine kleine Geschichte aus meiner Schulzeit, dem Dienst in der NVA oder meinem Berufsleben zum Besten gegeben hatte, oftmals gebeten, diese doch für die Allgemeinheit aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Derartige Aufforderungen wurden sicherlich nur aus Höflichkeit gegenüber dem Erzähler geäußert. Deshalb lehnte ich das immer freundlich, aber entschieden ab. Sicherlich erheiterten einige Anekdoten oft die Zuhörer, aber für eine Veröffentlichung fand ich sie nicht gut genug. Ein weiterer Grund bestand darin, dass ich für viele der Begebenheiten keine Beweise für deren Wahrheitsgehalt vorlegen konnte. Von vielen Beteiligten wusste ich nichts über deren Verbleib. Vielleicht lebten auch einige nicht mehr, und es gab noch einen guten Grund. Einige meiner Erlebnisse würden sicherlich die Leser vermuten lassen, dass meine Phantasie die Feder geführt hat. Ebenso befürchtete ich, von den Lesern als Schwindler oder Lügner bezeichnet zu werden.
In der Abgeschiedenheit und Stille meiner eigenen vier Wände beschlichen mich dennoch regelmäßig Zweifel an meiner Einstellung.
Um Ihnen den langen Weg bis zum Studium verständlich beschreiben zu können, muss ich weit in der Zeit zurückgehen, denn ansonsten können Sie die Zustände, die Lebensumstände, die aus der gegenseitigen Bespitzelung erzwungene Zurückhaltung in der Meinungsäußerung, die Versorgungsschwierigkeiten, das Leben in der DDR allgemein und meine Wandlungen und Entscheidungen im Besonderen nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall sollten Sie darauf achten, dass das Buch nicht in die Hände Ihrer schulpflichtigen Kinder gelangt. Die geschilderten Streiche sind nicht nachahmenswert. Die meisten unserer Unternehmungen habe ich mich gar nicht getraut, zu erwähnen, denn sie bewegten sich zum Teil außerhalb der Legalität. Allerdings darf ich Ihnen versichern, dass es an meiner polytechnischen Oberschule nur eine derart fürchterliche Schulklasse gab. Selbst mir fiel es während der Niederschrift manchmal sehr schwer, mich gefühlsmäßig in die damalige Zeit zu versetzen. Weshalb gerade die Mädchen und Jungen aus meiner Klasse anfänglich aus dem Rahmen fielen, konnte ich nie ergründen. Jedenfalls wurden in einem Jungen, der sich lieber seinen Hobbys als der Erledigung seiner Hausaufgaben widmete, nach einem Gespräch mit seinen Eltern, eine besondere Kraft, ein entschlossener Wille und ein Talent freigesetzt.
Die Zeit am Gymnasium bezeichne ich gern als Druckphase, in der die Jungen reihenweise ihren Einstellungen und sich selbst gegenüber untreu wurden.
Der Zwangsdienst in der NVA beschleunigte in gewisser Weise die Festigung meiner Lebensmaxime.
Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die immer jammern, heulen und unzufrieden sind. Aus diesem Grund überwiegt die Schilderung besonderer und teilweise lustiger Geschehnisse in diesem Buch.
Bevor ich die Einleitung abschließe, möchte ich betonen, dass es sich bei meinem Büchlein nicht um eine freie Erfindung handelt. Alles wurde inhaltlich korrekt geschildert und nicht das Geringste verzerrt oder verfälscht. Auf wortreiche Schilderungen emotionaler Begebenheiten habe ich als vorwiegend rational handelnder Mensch verzichtet. Alle vorkommenden Personen haben gelebt oder leben noch heute. Mein Dank gilt den ehemaligen Schülerinnen und Schülern beider Schulen sowie einigen Kommilitonen, die mich während unzähliger Telefonate mit ihren Erinnerungen unterstützten.
Auch für das vorliegende Buch bat ich meinen Schulfreund Volker Liebig um die Übernahme der Hauptarbeit und stellte ihm die Telefonnotizen, meinen Entwurf und meine Mitarbeit zur Verfügung. Sie werden sehr schnell erkennen können, welche der Passagen von meinem Freund oder von mir in den Rechner eingegeben wurde.
Kapitel 1 – Schulzeit und Jugend
Mein vollständiger Name ist Gilbert Reinhold Wehnert. Geboren wurde ich in S.. Mein Vater übte auf der dortigen Werft den Beruf eines Schlossers aus. Meine Mutter beschäftigte sich mit der Erziehung dreier Kinder und der Bewältigung des Haushaltes. Meine ältere Schwester besuchte bereits die Schule.
Ab September 196. nahm ich an der sogenannten Vorschule teil. Als Sohn einer Hausfrau ging ich nicht in den Kindergarten. In der Vorschule sollten meine geistigen Fähigkeiten als Vorbedingung für den Schulbesuch festgestellt und gefördert werden. An die bunten Holzstäbchen, mit denen wir rechneten, und an die Spiele, die das logische Denkvermögen und die Geschicklichkeit prüften, erinnere ich mich noch heute. Wir zeichneten viel und bastelten mit verschiedenen Materialien. Letztendlich genügte ich wohl allen Anforderungen und wurde eingeschult.
An der Schule gab es eine sogenannte Hausfrauenklasse, in welcher ich meinen Platz fand. Jeder Schüler stellte sich kurz vor. Einige Namen hörte ich zum ersten Mal, obwohl ich die Gesichter vieler Kinder von der Vorschule her bereits kannte. Meine schulischen Leistungen bewegten sich bis zur zweiten Hälfte der zweiten Klasse im Bereich um die Note 2. Das lag besonders daran, dass ich, anstatt meine Hausaufgaben zu erledigen oder für den nächsten Tag zu lernen, viel lieber mit meinen Legosteinen, den Indianer- und Cowboyfiguren und meiner Rakete spielte.
Auf das Lernen verwandte ich dagegen wenig Zeit. Natürlich überprüfte meine Mutter mich ständig hinsichtlich der Erledigung der Hausaufgaben. Das Leben verlief in gleichförmigen, ruhigen Bahnen.
Nach der ersten Hälfte der zweiten Klasse wechselte ich in eine andere Schulklasse. Es war eine Hortklasse. Meine Mutter, Gott sei ihrer Seele gnädig, hatte sich entschlossen, eine Tätigkeit als Erzieherin in einem Kindergarten aufzunehmen. Mit dem ersten Schultag in der neuen Klasse begann die Umformung und Prägung eines ruhigen, idealistischen Schülers aus einer Hausfrauenklasse in einen materialistischen Hortschüler. Anfangs versuchte ich, mich dem entgegenzustellen, aber nach einigen Jahren in diesem Umfeld vollendete sich jene Entwicklung und erwies sich in der Folge als irreversibel. Allein die Eindrücke der ersten Unterrichtsstunde wirkten desillusionierend auf mich. Daran kann ich mich so deutlich erinnern, als ob es erst gestern geschehen wäre. Als ich das Klassenzimmer betrat, blieb ich wie angewurzelt stehen. Die Schülerinnen und Schüler standen in kleinen Gruppen zusammen. Ein enormer Lärm erfüllte den Raum. Jeder schien mit jedem zu sprechen. Das Eintreten der Lehrerin änderte auch nichts daran. Auffordernd sah sie auf den diensthabenden Schüler hinab.
„Hoffentlich ist hier bald Ruhe im Stall!“, schrie unvermittelt dieser Schüler. Eine solche Aufforderung hörte ich zum ersten Mal. Langsam, ganz langsam lösten sich die Gruppen auf. Sich noch unterhaltend, stellten sich die Schülerinnen und Schüler neben ihren Sitzplätze auf. Es folgte die Meldung an die Lehrerin, in der auch ich erwähnt wurde.
„Den kenne ich nicht. Der muss neu sein“, meldete der Schüler der Lehrerin und wies mit dem Finger auf mich. Alle durften sich setzen, nur ich blieb stehen. Auf Aufforderung der Lehrerin nannte ich meinen Namen. Neben einem Mädchen wies sie mir einen noch freien Platz, in der dritten Reihe an der Wand, zu. Zum Beginn der folgenden Stunde, allerdings in einem anderen Klassenzimmer, stand ich neben genau dem Platz in der dritten Reihe an der Wand. Ein Mädchen stellte sich neben mich.
„Das ist mein Platz“, erklärte sie mit schriller Stimme.
„Aber auf diesem Platz habe ich doch in der ersten Stunde gesessen“, stammelte ich verdutzt.
„Ja, das war in Deutsch, aber jetzt haben wir Mathe. In Mathe sitze ich immer hier.“
Also stellte ich mich wieder neben die Tafel und ließ mir einen Platz zuweisen. Weitere Erinnerungen an diesen Schultag sind verblasst. Dafür ist der erste Nachmittag im Hort bestens in meinem Gedächtnis gespeichert. Von allen Seiten umgab mich der Lärm des Gezeters und des Herumschreiens. Jeder, ob Mädchen oder Junge, wollte gerade mit dem Spielzeug spielen, das sich jemand anderes vor einer Minute aus dem Regal genommen hatte. Die Betreuerin stand hilflos daneben und schien, ebenso wie ich, auf den Feierabend zu warten. Ihre schwachen, gelegentlichen Versuche ein wenig Ordnung und Ruhe herzustellen, scheiterten. Als ich endlich nach Hause gehen durfte, fühlte ich mich erlöst. Wochen vergingen, ohne dass ich mich an das Umfeld und den Umgang untereinander gewöhnen konnte.
Innerlich verfluchte ich häufig den Tag, an dem meine Mutter mit ihrer Arbeit im Kindergarten begonnen hatte. Freundschaft mit einem meiner Mitschüler schloss ich nicht. Die Freunde aus meiner alten Klasse zogen sich indessen auch immer mehr zurück, denn die „b - Klasse“ genoss einen denkbar schlechten Ruf. Der Zusammenhalt, wenn es gegen Schüler anderer Klassen ging, die ruhig auch mal älter sein durften, erstaunte mich dagegen tatsächlich. Einmal im Monat erlebte ich das mindestens. Geriet einer von ihnen während einer Pause auf dem Schulhof in einen Streit mit einem Schüler einer anderen Klasse und die anderen bekamen das mit, setzten sie sich in Bewegung. Nur der Klassenprimus, zwei oder drei andere Jungen und einige Mädchen blieben zurück. Die meisten Mädchen folgten den Jungen. Zwei der Mädchen konnten allerdings auch als Jungen durchgehen. Selbst von den Jungen der Klasse trauten sich nur wenige, sich mit einer von den beiden anzulegen. Sie prügelten sich wie Jungen, traten, kratzten und bissen sogar ihre „Feinde“. Am Ort des Geschehens angekommen, umringten alle umgehend den oder die vermeintlichen Gegner. Nutzten Palaver und Obszönitäten nichts, begann die Balgerei. Wer sich nicht prügelte, feuerte die eigenen Leute an. Es wurde mit allen Mitteln auf den Gegner eingedroschen. Fäuste und Füße flogen bis zum Rückzug oder der Aufgabe des Feindes. In jedem Fall folgten noch einige „nette“ Worte. Mit Gejohle begann dann eine kurze Siegesfeier. Jeder, der aktiv am Kampf teilgenommen hatte, versuchte seinen Einsatz gegenüber den der anderen hervorzuheben. Eine Niederlage von ihnen, später von uns, habe ich nie erlebt. Stand kein Gegner zur Verfügung, kehrten sie zu den alltäglichen Streitigkeiten untereinander zurück. Meine anfängliche Begeisterung für die Schule verringerte sich täglich.
In der vierten Klasse, nach einer schweren Erkältung und mehreren Tagen im Bett, wollte ich überhaupt nicht mehr zur Schule gehen. An die Umgangssprache- und formen gewöhnte ich mich zwar langsam, aber der ständige Zank und Streit ging mir auf die Nerven. Kündigen durfte ich leider nicht. Meine Mutter selbst übergab mich der Klassenleiterin. So ging ich eben weiterhin zur Schule.
Unsere Ausflüge vom Hort aus führten uns auch häufig in den Stadtwald. Dort befand sich am Rand des Waldes, umgeben von Bäumen und Sträuchern, eine große Lichtung. Nicht nur wir hatten Kenntnis von der Lichtung, denn gelegentlich besuchte auch eine Gruppe von Hortkindern aus dem Neubaugebiet, das weit von den alten Gartensparten entfernt errichtet wurde, unsere Lichtung. Selbstverständlich betrachteten wir diese Kinder als Eindringlinge. Aus Ästen von Holunderbäumen und den Stacheln von wilden Kirschen bauten wir uns kleine Waffen und verjagten immer wieder die unerwünschten Gäste. Unsere Betreuerinnen konnten uns nie davon abhalten. Überhaupt empfand ich die Zeit im Hort nicht mehr als so schlimm. An meiner Abneigung gegen den Lärm und das Gezeter hatte sich nichts geändert, aber der gemeinsame Mittagsschlaf, das gemeinsame Erledigen der Hausaufgaben, unabhängig von der Qualität, die Ausflüge von April bis in den Oktober hinein und die große Menge an Spielzeug gefielen mir ausnehmend gut.
Einige Veranstaltungen an der Schule sagten mir dagegen überhaupt nicht zu. Die sich halbjährlich wiederholenden Fahnenappelle vor der Schule oder die Pionierversammlungen gehörten dazu.
Die Spartakiaden, die einmal im Jahr stattfanden, besuchte ich nie mit besonderer Begeisterung. Bis zur achten Klasse zählte ich ohnehin nicht zu den guten Sportlern. Geländespiele, bei denen wir durch rote oder blaue Wollfäden am Oberarm in zwei Parteien geteilt wurden, gefielen mir dagegen sehr gut.
In den ersten Schuljahren an die ich mich erinnere, lag es wahrscheinlich an den widrigen Witterungsbedingungen am ersten Mai, dass mir das vorherige Aufstellen und das folgende Vorbeimarschieren an der Tribüne nicht gefielen. Mit fortschreitendem Alter empfand ich immer mehr Abneigung gegenüber dieser Veranstaltung. An diesen Tagen fühlte ich mich immer wie eine Marionette und versuchte, oftmals erfolgreich, mich mit allen möglichen Entschuldigungen dieser unangenehmen Erniedrigung zu entziehen.
Wir wurden, wie ich fand, ziemlich häufig zum Sammeln von Altstoffen angehalten. Altpapier, Flaschen und Gläser standen an unserer Schule im Mittelpunkt dieser Aktionen. Von der Tochter einer mit meinen Eltern bekannten Familie erfuhr ich, dass an ihrer Schule auch Spraydosen und Kronkorken im Blickpunkt standen. Gegen das Sammeln hatte ich in den ersten Jahren auch nichts einzuwenden, sondern beteiligte mich immer daran. Den eigentlichen Text des Liedes kannte keiner von uns, aber den Refrain „Hab'n Se nicht noch Altpapier, liebe Oma, lieber Opa? Klingelingeling ein Pionier, klingelingeling steht hier, ein roter...“, sangen wir bei solchen Gelegenheiten schon ab und zu mit. Die gesammelten Altstoffe lieferten wir im Heizungsgebäude, das sich unweit der Schule befand, ab. Im Gegenzug erhielten wir Marken, die später mit Geld vergütet wurden. Dadurch füllten wir die Klassenkasse auf.
Mit dem Beginn des zweiten Halbjahres der vierten Klasse begannen vier Jungen, darunter auch ich, mit ihren eigenen Altstoffsammlungen. Ausgestattet mit unseren Pionierhalstüchern und einem Handwagen, klapperten wir die Häuser, die nördlich des Einzuggebietes unserer Schule lagen, ab. Auf dem Rückweg erhielten wir für die Ausbeute unserer Streifzüge in der SERO Annahmestelle an der Moordorfer Straße etwas Geld. Von dem Geld kauften wir uns beim Bäcker, dessen kleines Geschäft nur zwei Häuser von der Annahmestelle entfernt lag, auch hin und wieder eine Kugel Speiseeis. Nach einigen Wochen stellten wir unsere Streifzüge ein, denn das benachbarte Wohnviertel setzte sich aus vielen Ein- und Zweifamilienhäusern zusammen, was lange Wege und eine geringe Ausbeute mit sich brachte. In nur einem Wohnblock in unserem Viertel lebten 24 Familien. Das lohnte sich wenigstens, aber der Bäcker war, unserer Meinung nach, der Bäcker mit dem wohlschmeckendsten Eis in der Stadt. Jeder von uns hatte schon Eis, das im Stadtzentrum, am Stand, in den Konditoreien oder in der Milchbar angeboten wurde, von den Eltern spendiert bekommen. Unsere Eltern, die natürlich unsere Expertenmeinung teilten, bevorzugten allerdings mehr die morgendlichen, noch warmen Brötchen, deren Kauf auch immer lange Wartezeiten mit sich brachte. Meistens musste ich mich sonnabends beim Bäcker anstellen. Den langen Weg zur Bäckerei konnte ich nur über den alten Friedhof abkürzen. In der Nähe des Hauptweges stand im Schatten der großen Bäume ein kleines, heruntergekommenes Fachwerkhäuschen, über das gruselige Geschichten erzählt wurden. Aus unserem Wohnblock war ich nicht der einzige Junge, der schnell an dem Häuschen vorbeirannte. Lag das Gespensterhaus hinter mir, trennten mich noch 350 Meter vom Ausgang. Das verschaffte mir die Zeit, mich auf den Endspurt vorzubereiten, denn 50 Meter vor dem Ausgang bog der Weg nach rechts ab, und ich spurtete an den dortigen Grabkapellen vorbei. Besonders eine Gruft verängstigte mich. Durch ein schmiedeeisernes Tor konnte ich deutlich drei zerfallene Särge und auch einige Knochen erkennen. Zur Belohnung für das Einkaufen durfte ich mir immer eine Kugel Eis genehmigen. Obgleich ich den Weg, zumindest in der ersten Zeit, nicht gern zurücklegte, gefiel er mir besser als der tägliche Gang mit der Milchkanne zur Kaufhalle. Bereits seit dem Beginn des Schuljahres begleitete ich meine Mutter nicht mehr nur einfach so, sondern als Träger der Einkaufsnetze. Zuerst fiel es mir nicht auf, aber irgendwann bemerkte ich, dass im Fleischerladen viel gemogelt wurde. Bevor das Geschäft am Nachmittag öffnete, bildete sich für gewöhnlich schon eine beachtliche Warteschlange. Nach dem Einlass „holten“ sich immer einige Frauen angeblich zurückgelegte Ware vom Vormittag ab. Als ich meine Mutter befragte, denn ich wusste, dass die Verkäuferinnen offiziell keine Bestellungen annahmen, erhielt ich meine erste Lektion im Fach Bestechung und Tauschhandel. Meine Mutter setzte ihre Nähkünste ein, um uns gelegentlich ein Stück Kassler, Koteletts oder sogar Rouladen vorsetzen zu können.
Ungefähr acht Wochen vor der Zeugnisvergabe und den Sommerferien verbrachte ich neun langweilige Wochen im Kinderkrankenhaus. Das Gebäude, im Stadtzentrum und im Bereich der Stadtmauer gelegen, ein alter Klinkerbau mit hohen Fenstern und einem Turm, wirkte schon von außen bedrohlich. Auf dem Gelände befand sich auch eine schwarze Baracke, in der man Kinder mit ansteckenden Krankheiten wie zum Beispiel den Pocken und den Masern behandelte. Meine Diagnose lautete: Nierenbeckenentzündung und Blutungen. Fast täglich erschien eine Krankenschwester zur Blutentnahme. Meine Arme wiesen in der Armbeuge mit der Zeit schon so viele Einstiche auf, dass auch die Schwestern nicht mehr wussten, wo sie die Spritze platzieren sollten. Obwohl ich mich dessen schämte, begann ich nach einigen Wochen während der Blutentnahme leise zu weinen. Die Zeit vertrieben wir uns unter anderem mit dem Aufschreiben der Kennzeichen vorbeifahrender Autos. Vom Fenster aus konnten wir die Straße gut einsehen. Meine Eltern durften mich nur zweimal in der Woche, mit einer Ausnahme, für eine oder zwei Stunden besuchen. Die Ausnahme diente allein der Maßregelung eines anderen Jungen und mir, weil wir Passanten mit kleinen Plastikbausteinen beworfen hatten. Die Besuchszeit reduzierte sich für diesen Tag auf zehn Minuten. Zwei Tage vor meiner Entlassung bezog ein Junge aus dem sogenannten „Russenviertel“ das Bett neben mir. Mir fielen sofort die großen Pusteln, die seinen Körper bedeckten, auf. Meine Abschlussuntersuchungen, an die ich mich lieber nicht erinnern will, blieben ohne Befund und meine Eltern holten mich umgehend ab. Kathederuntersuchungen sind unangenehm.
Nach einem ganz kurzen Aufenthalt zu Hause fuhren wir in Richtung Thüringen. Mein Vater hatte, dass wusste ich bereits, einen Urlaubsplatz erhalten. Im Fall der Verlängerung meines Krankenhausaufenthaltes sollte sich Tante Lili um mich kümmern. Sie war nicht wirklich meine Tante, denn unsere Verwandtschaft lebte im anderen Teil Deutschlands. Meine rechtzeitige Entlassung verdankte ich dem ständigen Vorsprechen meiner Mutter bei den Ärzten. Das Glück stand auf unserer Seite, denn nach dem Urlaub stellte ich mich einer Nachuntersuchung zur Verfügung. Nebenbei erfuhren wir, dass das Kinderkrankenhaus am Tag nach meiner Entlassung unter Quarantäne gestellt worden war. Die äusserst schmerzhaften Blutentnahmen verfolgten mich noch einige Zeit in meinen Träumen.
Der Urlaub im Thüringer Wald wirkte entspannend. Wir übernachteten in einem einfachen und mit Schieferplatten verkleideten Haus. Zum Frühstück begaben wir uns fast täglich zu Fuß in ein FDGB Heim. Das Mittagessen und das Abendbrot nahmen wir meistens irgendwo unterwegs zu uns. Mit den Kindern unserer Gastgeber verstand ich mich sofort. Verplanten meine Eltern den Tag nicht komplett, erkundete ich mit dem älteren Sohn, der Georg hieß, die Umgebung. Bis heute verstehe ich nicht, warum sich die Mücken immer an den für uns interessanten Orten besonders gern aufhielten. Mich nahmen die Mücken häufiger als Georg ins Visier.
Einen Höhepunkt für mich stellte der Besuch der Wartburg dar. Einige Mosaikhefte nannte ich mein Eigentum. Ritter Runkels Abenteuer gefielen mir. Die Darstellung von Ritter Runkels Burg diente mir als Vorbild, um aus Pappe, Papier und mit Klebstoff mühsam sogar eine kleine Ritterburg zu basteln. Farblich hielt ich mich an die Vorlage. Mein Vater half mir, die spitzen Dächer für die Türme anzufertigen, denn von Abwicklungen verstand ich damals noch nichts. Leider bot der Zeitungskiosk die Hefte nicht immer an. Oft waren sie wohl auch schon ausverkauft. Das änderte sich auch nicht mit dem Erscheinen der Abrafaxe im Mosaik. Von den Dampfern auf dem Mississippi träumte ich häufig. Dann stand ich am Ruderrad, und immer galt es, ein Wettrennen zu gewinnen. Den Weg hinauf zur Wartburg legten wir zu Fuß zurück. Wenn ich auch vieles von dem, dass der Führer unserer Gruppe auf dem Rundgang erzählte, nicht verstand, beeindruckten mich vor allem ein Mosaikfußboden und die Schlichtheit einiger Räume. Von Luther und der Lutherbibel hatte ich bis dahin noch nie etwas gehört, aber ich fragte mich, wie sich der Luther in so einer schäbigen Stube wohlfühlen konnte. Die Architektur, die unwahrscheinlich viele Möglichkeiten bot, sich zu verstecken, gefiel mir sehr gut. Wir Kinder aus unserem Wohnblock spielten sehr oft Verstecken. Für den Rückweg setzte man mich auf den Rücken eines Esels. Ob die Zügel auch einer Funktion dienten, interessierte mich nicht, denn der Esel selbst schüchterte mich durch seine Größe ein. Es schien ein ruhiges Tier zu sein. Die Eselkarawane setzte sich in Bewegung. Die Tiere schritten, von den Eltern der Kinder und einem Treiber begleitet, langsam den Berg hinab. Voraus konnte ich schon eine Straße erkennen, auf der ein lebhafter Verkehr herrschte. Ohne jeden Grund beschleunigte der Esel plötzlich, überholte zwei andere Esel und rannte auf die Straße zu. Dabei wurde ich kräftig durchgeschüttelt und Angst überfiel mich. Der Esel lief vielleicht einen Meter weit auf die Straße und bog dann scharf nach rechts ab. Vor lauter Angst zog ich, wie ich es in den Indianerfilmen gesehen hatte, die Zügel auf der rechten Seite mit aller Kraft an. Ob der Esel von sich heraus oder durch mich beeinflusst die Richtung änderte, konnte uns der Treiber später auch nicht erklären. Der Esel lief sehr schnell wieder auf den Fußweg und stoppte ganz von selbst vor einem überdachten Gestell. Mein Vater und der Treiber, beide außer Atem, erreichten den Stand und zogen mich vom Esel herunter. Es handelte sich um keinen Esel, sondern um eine Eselin, deren Nachwuchs wohl Hunger gehabt und nach der Mutter gerufen hatte. So lautete zumindest die Erklärung des Treibers.
Mein Vater, der häufig die Skisprungveranstaltungen im Fernsehfunk verfolgte, und ich wollten uns selbst einen Eindruck vom Skispringen verschaffen. An einem eher trüben Vormittag standen wir dann auf der Schanze in Oberhof und waren zutiefst beeindruckt. Unter keinen Umständen, das stand fest, würde ich jemals den Platz eines Athleten einnehmen wollen. Seitdem leistete ich meinem Vater vor dem Fernsehgerät Gesellschaft.
So sehr uns die Landschaft Thüringens auch bezauberte, aber die Saalfelder Feengrotten wollten wir Kinder gar nicht mehr verlassen. Am Ende des Urlaubs verzierten viele Schildchen zum Aufnageln unsere Wanderstöcke.
Die folgenden Ferientage verbrachte ich vornehmlich mit meinen Büchern, meinem Freund und den anderen Kindern des Wohnblocks. Vom vierten bis zum sechsten Schuljahr spielten wir gern Peitschenkreiseln, wobei der Kreisel zu einem Ziel und unter Umgehung von Hindernissen gepeitscht werden musste. Die Mädchen spielten immer mit. Verstecken, Schattenfangen und Rollschuhfahren erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit. Gummitwist begeisterte nur die Mädchen. Murmeln spielten nur die Jungen meines Alters. Wessen Tonkugel (Glaskugeln waren viel zu kostbar) am wenigsten oft angestoßen, im Loch landete, gewann. Ein bisschen Taktik gehörte also auch dazu. Fußball spielten auch nur die Jungen. Am Federballspiel beteiligten sich dann wieder alle Kinder. Sogar gemischt wurde gespielt. Mehrere Jungen und Mädchen, bis zu zwei Jahre älter, beteiligten sich gelegentlich an einigen Spielen.
Die Ferien hatten mich psychisch und physisch wieder aufgebaut. Die Anzahl und Schwere meiner häufigen Erkrankungen, die zumeist mit starken Ohren- und Halsschmerzen einhergingen, sollte durch die Entfernung der Mandeln deutlich abgesenkt werden. Mir wurde das als ein wirklich simpler Eingriff geschildert, der auch noch einen Vorteil in sich barg. Nach der Operation könnte ich so viel Speiseeis essen, wie ich nur wollte.
Ohne irgendwelchen Argwohn saß ich dann zwei Wochen vor dem Schuljahresbeginn in einem Operationsraum. Nach der örtlichen Betäubung spürte ich, wie sich eine Art Zange um die linke Mandel legte. Die Augen hielt ich geschlossen und die Hände geballt. Dann hörte ich ein sonderbares Geräusch (wie ein Knacken), aber verspürte keinen großen Schmerz. Auf der rechten Seite trat dann ein kleines Problem auf. Der Arzt, sich selbst beschimpfend, wandte sich an die Schwester. Er hatte zu wenig abgeknipst. Der folgende Versuch zog ein weiteres Schimpfen nach sich. Jetzt hatte er zu viel abgeknipst und verlangte nach Nadel und Faden. Das war meine erste unangenehme Begegnung mit einem schlechten Arzt. Während der folgenden Tage durfte ich tatsächlich viel Eis essen.
An einem Sonntag im August, kurz vor dem Schuljahresbeginn, lagen wir am Stand von M.. Es wehte ziemlich heftig, und die Fahnen standen auf Badeverbot. Mein Vater hatte diesen Strand ausgewählt, weil hier der Wind auflandig war. Andere Familien lagen wahrscheinlich aus demselben Grund hier. Den Strand fand ich schon deshalb hässlich, weil ungeheure Mengen an Steinen ihn bedeckten - eigentlich verdeckten. Die Wellen schlugen manchmal sehr hoch. In das Wasser durfte ich nicht gehen, sondern nur am Ufer spielen. Mein Vater passte genau auf.
„Papa, der Mann kann aber lange tauchen!“, rief ich meinem Vater zu. Schon seit einiger Zeit beobachtete ich einen Mann, der in ungefähr fünfzehn Meter Entfernung im Wasser tauchte. Mein Vater und einige andere Männer sprangen, durch meinen lauten Ruf alarmiert, auf. Eine Frau brachte mich zu meiner Mutter. Sie war gerade erst aufgewacht und wusste nicht Bescheid. Die Männer gingen ins Wasser und zogen einen Mann an Land. Mehr konnte ich leider nicht sehen, denn eine Menschentraube, die sich um diesen Mann gebildet hatte, verdeckte mir die Sicht. Der Mann, den ich mir nicht angucken konnte und durfte, war tot. Er galt bereits seit dem Vortag als vermisst. Damit endeten die Ferien.
Meine zweiundsiebzig Fehltage im vierten Schuljahr gefährdeten glücklicherweise nicht meine Versetzung in die fünfte Klasse. Jetzt hatte ich mich an das Umfeld gewöhnt und mich auch etwas mit einigen Schülern aus der gemäßigten Fraktion angefreundet. Mein bester Freund besuchte allerdings eine der Parallelklassen und wohnte im dritten Aufgang unseres Wohnblocks. Meine Freizeit verbrachte ich meistens mit ihm.
Das Ergebnis meiner schulischen Unlust bestand darin, dass ich in der fünften und sechsten Klasse fast gar keine Hausaufgaben mehr erledigte. In meinem Hausaufgabenheft häuften sich dafür die Seiten, die von der roten Farbe der Einträge und Tadel gezeichnet, sofort auffielen. Dafür konnte ich wunderbar Schiffe versenken und Käsekästchen spielen.
Morgens, vor dem Unterrichtsbeginn, traf sich ein Drittel der Jungen unserer Klasse regelmäßig vor dem Haupteingang der Schule. Damals führte ich nicht richtig ein Tagebuch, aber es erwies sich als günstig, wenn ich mich wegen einer Eintragung oder eines Tadels vor meinen Eltern rechtfertigen musste, auf die „schlimmen“ Taten der anderen Schüler verweisen zu können. Solche Ereignisse hielt ich fest. Von diesen Aufzeichnungen trennte ich mich erst vor kurzer Zeit. Am Morgen des 11.4.197. trafen wir uns wie gewöhnlich vor der Schule. Die ersten vier von uns setzten sich immer wie Hühner auf den waagerechten Bereich des rechten Geländers, das die Stufen und das Podest von dem tieferliegenden Bereich trennte. Die Füße ruhten auf dem Knielauf. Wie gewöhnlich erschien ich sehr früh. Als ich eintraf, saßen Bernhard, Jürgen und Klaus bereits auf dem Handlauf des Geländers. Klaus lauschte dem Gespräch zwischen Bernhard und Jürgen. Schnell nahm ich neben Klaus Platz.
„Klaus“, fragte ich ihn sogleich, „hast du eigentlich die Hausaufgaben für Deutsch gemacht?“
Klaus drehte seinen Kopf in meine Richtung. Bernhard und Jürgen unterbrachen sofort ihre Unterhaltung.
„Nicht wirklich“, antwortete er.
„Egal. Gib sie mir. Ich gehe sofort rein und schreibe sie ab. Ist es viel?“
„Nein, aber schreib nicht wieder alles Wort für Wort ab. Beim letzten Mal hat die alte Struckner es voll mitgekriegt, dass wir voneinander abgeschrieben hatten. Mensch Leute, fünf Hausaufgabenhefte mit demselben Text!“
Ohne seine Rede fortzusetzen, schüttelte er seinen Kopf, als würde er dadurch die Erinnerung an diese peinliche Situation loswerden. Frau Struckner hatte sich vergeblich bemüht, festzustellen, von wem abgeschrieben worden war und honorierte unsere Leistung mit einer Fünf für jeden von uns.
„Ja, ja. Ich schreibe alles um. Gib her!“
„Gilbert, wenn du fertig bist“, mischte Bernhard sich ein, „dann kannst du mir gleich dein Heft geben. Ich hatte ganz vergessen, dass wir heute Deutsch haben.“
Jörg schlenderte langsam heran und gesellte sich zu uns. Er musste die letzten Sätze wohl gehört haben und mischte sich jetzt auch ein.
„Ich glaube, ihr macht euch ganz umsonst Gedanken. Wenn Hendrik wieder einen seiner Ausraster bekommt, ist der Unterricht doch sowieso gelaufen. Ihr wisst doch, dass die Struckner ein rotes Tuch für ihn ist.“
Jürgen, der wie wir ebenfalls nicht mit Frau Struckner auskam, sah Jörg nur mitleidig an.
„Gut, du hast also die Hausaufgaben gemacht. Du hast nur vergessen, dass die Struckner immer zum Beginn der Stunde die Hausaufgaben einsammeln tut und einige durchgeht. Und wenn sie das nicht tut, dann sammelt sie alle Hefte ein.“
Jörg nutzte die Vorlage.
„Ja, und ich tue mir eine Tute kaufen und tue so lange auf der Tute tuten, bis die Tute nicht mehr tuten tut. Mann, wir haben doch schon erlebt, dass Hendrik, wenn er seine Hausaufgaben vorlesen oder abgeben sollte, komplett ausgerastet ist, oder?“
Jürgens Gesicht lief bei dieser Stichelei rot an.
„Wir werden ja sehen.“
Deutsch stand erst in der vierten Stunde vor der großen Pause auf dem Stundenplan. Für uns gab also keinen Grund, deshalb in Hektik zu verfallen, aber die Uhr zeigte mittlerweile fünf Minuten vor halb acht an. Es war höchste Zeit für uns, die Schule zu betreten. Der normale Schulalltag begann. Die Pausen nutzten wir zum Abschreiben der Hausaufgaben. Frau Struckner fand uns in bester Stimmung und gut gerüstet vor. Am Beginn der Stunde forderte sie einige Schülerinnen und Schüler auf, ihre Hausaufgabenhefte auf dem Lehrertisch abzulegen. Uns betraf das zum Glück nicht. Ungefähr zwanzig Minuten vor dem Klingelzeichen zur Pause ließ sie uns einen Text aus dem Lehrbuch laut vorlesen. Nach einigen Sätzen forderte sie immer eine andere Schülerin oder einen anderen Schüler auf, mit dem Vorlesen fortzufahren. Wir warteten auf das Ende der Stunde, doch dann kam Hendrik an die Reihe.
„Hendrik, du liest uns bitte die letzten Sätze vor.“
Hendrik hob langsam seinen Kopf und sah sich kurz um. Sein Blick richtete sich auf Frau Struckner, während sein Gesicht an Farbe gewann.
„Das geht nicht.“
„Weshalb geht das nicht?“
„Ich habe mein Buch vergessen.“
„Dann wird dir Kerstin ihr Buch geben.“
„Das will ich nicht. Entweder lese ich aus meinem eigenen Buch vor oder gar nicht.“
„Wenn du dich weigerst, werde ich dir einen Tadel geben müssen. Überlege dir das, Hendrik!“
Ihr Ton wurde deutlich schärfer. Hendrik, der in der mittleren Bankreihe ganz hinten und circa ein und einen halben Meter von der Wand entfernt saß, sprang auf. Der Stuhl krachte scheppernd gegen die Wand. Hendrik, dessen Gesichtsfarbe einen dunkelroten Ton angenommen hatte, schrie Frau Struckner an. Gleichzeitig ergriff er sein Hausaufgabenheft.
„Sie wollen mir einen Tadel verpassen! Sie wollen mein Hausaufgabenheft haben? Hier hast du's.“
Damit holte er ordentlich aus und warf das Heft in Richtung von Frau Struckner. Den Flug verfolgend, sah ich aus dem Augenwinkel, wie Frau Struckner erschrocken zusammenfuhr und das Heft flatternd in der zweiten Sitzbankreihe zu Boden fiel. In diesem Moment ertönte die Schulklingel. Niemand erhob sich. Hendrik atmete schwer, und Frau Struckner bat Petra, das Heft aufzuheben und es ihr zu geben. Alle, außer Hendrik, durften auf den Schulhof gehen. Ein Wort noch zu Hendrik. Uns Schülern gegenüber verhielt sich Hendrik völlig normal. Er war ein Einzelgänger. Seine Mutter arbeitete als Lehrerin an einer anderen Schule der Stadt. Auf jeden Fall schien es, als wäre Hendrik absolut antiautoritär erzogen worden. Wie auch immer - ich habe ihn nicht mehr gesehen. Man verwies ihn der Schule.
Wenn ich mich an diese Zeit erinnere, dann muss ich auf meinen Vater zu sprechen kommen. Mein Vater war nicht nur überaus handwerklich begabt, sondern auch sehr fleißig und starrköpfig. Mit aller Energie setzte er seine Ideen um. Als passionierter Ruderer gehörte er einem Sportklub an. Irgendwann ergab es sich, dass ein kleines, stählernes Boot ausgemustert wurde. Mein Vater erwarb das Boot. Damals besuchte ich noch die dritte Klasse. Über zwei Jahre lang arbeitete mein Vater an der Umsetzung seiner Idee. Eines Tages stellte er uns das Ergebnis vor. Aus dem kleinen Beiboot hatte er ein großes Segelboot geschaffen. Die Segelberechtigung erwarb er noch nebenbei.
In den Sommerferien nach dem fünften Schuljahr segelte mein Vater mit meiner großen Schwester und mir nach V. auf der Insel H.. Es berührte ihn peinlich, wenn wir uns später bei Familienfeiern an diese Begebenheit erinnerten, denn unser Segelboot erreichte vor unserem Vater den Anlegesteg. Unser Vater ging beim Einholen der Segel über Bord und schwamm dem Boot hinterher. Auf jeden Fall, so stellten wir es oft bei den Feiern dar, hatte sich das diesbezügliche Training im Frühjahr ausgezahlt. Der „Sprung“ in das Wasser sah schon viel besser aus. Mein Vater fiel wirklich beim Anlegen an einem kleinen Steg mit nur drei Liegeplätzen in der Nähe von G. von Bord. Sonderbarerweise lagen keine Boote am Steg – es gab keine Zeugen, aber einige Wochen darauf legten wir im Baggerloch an. Einige hübsche Segel- und Motorboote ankerten dort bereits. Bis auf einen ganz schmalen Bereich am Ufer fielen die Wände steil ab. Die Anker wurden deshalb am Ufer eingegraben. Mein Vater bugsierte unser Boot wunderschön nahe an das Ufer heran. In meinen Gedanken bezog ich schon die Höhle, die ich mir mit Heike, der Tochter von Tante Lili, gegraben hatte. Mein Vater, der sich mit dem Anker beschäftigte, bemerkte nicht, dass sich das Boot wieder vom Ufer entfernte. Er setzte seine Brille ab, ergriff den Anker, nahm etwas Anlauf und sprang, ohne sich nochmal umzusehen, in Richtung des Ufers. Er landete im Wasser und entschwand unseren Blicken. Bald tauchte er wieder auf, erklomm die schmale Strandzone und zog das Boot an das Ufer zurück. Zum Glück verlor er nicht den Anker.
Unser Boot machte vor dem Anlegen in V. kaum noch





























