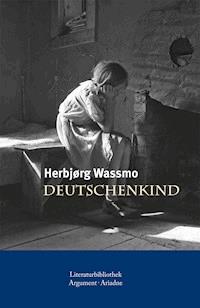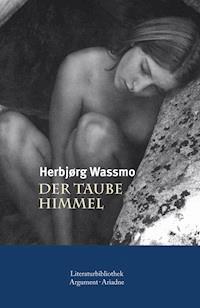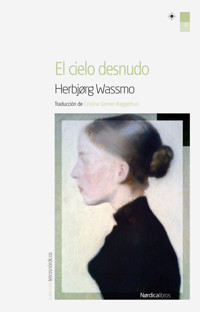Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tora-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Norwegen in den 1950ern. Die heranwachsende Tora lebt mit ihrer Mutter Ingrid im Tausendheim, und "die Gefahr" ist nicht mehr bei ihnen: Stiefvater Hendrik sitzt vorerst wegen Brandstiftung im Gefängnis. Doch der Existenzkampf auf der Fischerinsel ist beinhart. Ein Sturm fegt durch die winzige Gemeinde an der Küste, zerstört die Boote, die große Mole, ganze Häuser. Tora aber erlebt das Unwetter wie einen Befreiungsschlag: In Blitz und Donner spürt sie, vielleicht zum ersten Mal, die Gewissheit, dass sie wirklich lebt. Sie gehört sich selbst! Sie ist Tora! Aber der Sturm ist zugleich eine Katastrophe. So viel wurde zerstört. So viel ist verloren. Die Gemeinschaft rückt zusammen und packt an. Dann kommt der Herbst. Tora soll in der nahen Kleinstadt Breiland auf die Oberschule gehen, sie finden ein Zimmer für sie. Ein Stück Welt öffnet sich für Tora, aber sie ist ganz allein mit den Folgen früheren Missbrauchs … Herbjørg Wassmo fasziniert mit eindrucksvollen, fast mystischen Naturschilderungen und nuancenreichen Bildern aus dem kargen Leben eines norwegischen Fischerdorfs. Ihre sinnliche Sprache, in der sich auch das Nonverbale bestens ausdrückt, gipfelt in den Beschreibungen des Seelenzustands eines jungen Mädchens, das sich, sexuell missbraucht vom Stiefvater, mühsam in ein neues, eigenes Leben zu retten versucht: herzzerreißend und herzerwärmend in gleichem Maße.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbjørg Wassmo
Der stumme Raum
Tora-Trilogie Band 2
Diese Neuübersetzung entstand mit finanzieller
Unterstützung von NORLA.
Titel der norwegischen Originalausgabe:
Det stumme rommet
© Gyldendal Norsk Forlag AS 1983. All rigths reserved
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 2014
Umschlaggestaltung: Martin Grundmann
Foto: © Francesca Woodman, Space2,
Providence, Rhode Island 1975–1978,
courtesy George and Betty Woodman
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-86754-868-7
Erste Auflage 2014
Herbjørg Wassmo
Der stumme Raum
Tora-Trilogie Band 2
Deutsche Neufassung von Gabriele Haefs
Literaturbibliothek
Argument · Ariadne
1
Es hämmerte! Hämmerte und hämmerte. Das Herz war ein Ungeheuer, das sie verschlang.
Sie versuchte sich aufzusetzen. Wollte das Kissen hinter den Rücken stopfen, um aufrecht sitzen zu können. Aber sie fand kein Kissen. Luft! Sie beugte sich zum Kopfende des Bettes zurück, um besser atmen zu können.
Sie glaubte, in der Dachstube von Bekkejordet zu liegen, bei Tante Rakel und Onkel Simon. In dem weißen Bett. Mit der rosa Nachttischlampe daneben. Bestimmt. Sie erkannte das alles ja wieder. Aber nein …
Sie riss den Mund weit auf. Sie keuchte. Es half ein wenig. Seltsam, wie unruhig die rosa Nachttischlampe an diesem Abend brannte. Sie flackerte wie das Nordlicht – oder …
Wo war sie jetzt? Das Gesicht und der Hals. Schweiß. Scharfer, stickiger Geruch. Dann war es doch nicht Bekkejordet. Auch nicht die Nachttischlampe. Es war die Truhe. Die Truhe an der Wand von der Tobiashütte. Sie war in die Truhe geglitten. Und dort hinten auf der Tür war sein Gesicht. Es wuchs ihr entgegen. Sickerte in ihr klopfendes Herz hinein. Wurde größer und größer. Sie spürte, dass sie nahe daran war aufzugeben. Einfach aufzugeben. Aber nein, das durfte sie nicht.
Dann war er also tot? Ja! Sie wippten ihn mit der Tür, die sie aus den Angeln gehoben hatten, auf und nieder und versuchten ihn ins Leben zurückzuholen. Versuchten das Salzwasser aus ihm herauszupressen. Aber sie schafften es nicht! Niemand schaffte das. Denn Tora hatte ihn in den Tangbüscheln gelassen. Sie hatte ihn ertrinken lassen. Sie würde niemals mehr im Meer baden. Wenn sie nur Luft bekäme. »Lieber Gott, ich hatte doch nur die Strümpfe an, das weißt du vielleicht noch. Es ging so langsam … deshalb konnte ich erst dort sein, als …«
Er hatte ein Gesicht bekommen. Es leuchtete ihr blau entgegen, mit alten dunklen Bartstoppeln. Die Augen waren geschlossen und doch offen. Sie sah deutlich die großen weißen Zähne zwischen den halboffenen bläulichen Lippen. Er war also tot! Jetzt stand sie ganz oben auf dem Gerüst von Onkel Simons Baustelle. Der Wind strich über ihre Haut. Über alles. Und die Stiefel fielen und fielen. Fielen sie wirklich? Nein, sie selbst fiel. Sie fiel in den Regenbogen, in die Flötentöne, in das Feuer. Aber er war tot.
War es nicht so, dass die Menschen, wenn sie jemanden sterben sahen, das Böse abschütteln konnten, das sich zwischen ihnen abgespielt hatte? Dann konnte er doch nicht tot sein!
Endlich konnte sie sein Gesicht ansehen, ohne sich abzuwenden. Es war ein ganz normales Männergesicht, wie sie es in Været jeden Tag sah. Eines, wie es alle Männer hatten. Ein ganz gewöhnliches – man brauchte sich davor nicht in Sicherheit zu bringen. Und endlich bekam sie wieder Luft. Langsam beruhigte sich ihr Herz. Alles versank in einer wirbelnden nebligen Dunkelheit.
Sie kam am Küchenschrank wieder zu sich. Die Mutter hielt ihr einen nassen Lappen ans Gesicht. Die Übelkeit war nicht schlimm. Die erlebte sie nicht zum ersten Mal. Sie nahm Mutters Hand und hielt sie fest. Sie spürte, dass viele Wörter im Raum hingen, die keine ausgesprochen hatte. Die Dunkelheit stand in dem offenen Fenster wie eine Wand. Es zog wohltuend. Kühl. Frisch.
Die Mutter war blass, aber nicht ratlos. Es gab etwas für sie zu tun. Sie war schon mit schwierigeren Dingen fertiggeworden als mit einer Ohnmacht.
Es war an dem Tag, als Henrik Toste abgeholt und wegen Brandstiftung in Simon Bekkejordets Fischereibetrieb und den Fischerhütten ins Gefängnis gebracht worden war. Es war an dem Tag, als Tora zu Ingrid gesagt hatte, dass jetzt wohl die Preiselbeeren oben am Veten reif seien.
Jetzt brannte es nicht, weder in Simons Fischerhütten noch in der Dachstube von Bekkejordet, wohl aber an dem alten Küchenschrank, an den Tora sich lehnte. Rund um die Griffe der Schranktüren sah man keine Farbe mehr. Denn die Mutter fand abgebeizte Farbe und nacktes Holz besser als alten Schmutz.
Erst jetzt begriff Tora, was geschehen war. Die Wirklichkeit war wie durch eine Explosion aus den Fugen gerissen worden. Erst nach einer halben Stunde sagte sie endlich etwas. Ingrid blieb ganz ruhig und machte sich an allem Möglichen zu schaffen.
Dreimal holte sie frisches kaltes Wasser aus der Leitung und gab der Tochter zu trinken, ohne dass diese darum gebeten hätte. Gegen sechs Uhr machte sie sich für die Abendschicht in der Fischfabrik fertig. Suchte in aller Ruhe ihre Sachen zusammen. Ihre Stimme war wie immer, als sie Tora bat, so lange liegen zu bleiben, bis sie zurückkäme. Und Tora nickte. Sie hatte Farbe bekommen. Aber Ingrid beunruhigte diese Farbe. Sie passte gar nicht zu Tora. Vielleicht sollte sie doch den Arzt holen? Ob sie in der Fabrik Bescheid sagte, dass sie heute Abend eine Aushilfe für sie kommen lassen mussten? Aber nein. Nicht heute Abend. Sie musste da durch. Da half gar nichts. Tora musste allein zurechtkommen. Sie war zäh.
»Haste etwa Fieber?«
»Fieber? Wieso das denn?« Toras Stimme war matt, aber wiederum auch nicht so, dass man auf eine ernstliche Erkrankung hätte schließen können.
»Nein, denn sonst bleib ich lieber zu Hause.«
»Nein, ich hab kein Fieber.«
Tora hatte verstanden.
Elisif, die unter dem Dach wohnte, hatte Sol mit einem Zettel zu Ingrid hinuntergeschickt. Darauf stand, dass Ingrid, falls sie geistlichen Trost brauche, um sechs Uhr an diesem Abend im Gebetshaus zusammen mit den anderen das Knie beugen könne. Ingrid antwortete nicht. Sondern ging zur Abendschicht.
Unten im Dorf beeilte sie sich so sehr, dass ihr der Schweiß ausbrach. Aber es gab keinen anderen Ort, nach dem sie sich weniger gesehnt hätte. Sie band sich die weiße Schürze und das Kopftuch um. Ihre Hände zitterten ein wenig, als sie sich an den Tisch mit den Schachteln und dem Cellophan setzte. Sowie die drei anderen Frauen auf ihrem Platz saßen, richteten sie ihre Augen auf Ingrid. Dann kamen die Männer. Auch sie hatten Augen. Ingrid blickte nicht auf. Wartete nur. Starrte auf die Stahlplatte. Ihr Gesicht war wie eine Maske.
Hätte sie aufgeschaut – dann hätte sie vielleicht so manchen Blick eingefangen, der weder feindselig noch schadenfroh war. Aber Ingrid saß wie in einer Kapsel.
Sie saß vornübergebeugt und wartete. Dann kam der Fisch. Und sie legte ein unglaubliches Tempo vor und schuftete wie ein Teufel. Bereits in den ersten fünf Minuten wurde ihr gereizt mitgeteilt, dass sie ihr Tempo herunterschrauben solle. Da saß eine junge ungeübte Frau an Gretes Stelle. Anlaug. Aber Ingrid dachte: Soll die doch sehn, wie sie zurechtkommt. Soll sich die Zähne ausbeißen. Soll lernen, sich nach den Gesetzen in Været zu richten.
Nach fünf Stunden Schicht holte Ingrid zusammen mit den drei anderen ihren Mantel. Hansine schwankte ein wenig, als sie sich die Gummistiefel anzog. Sie war ganz blass. »Biste krank?«, fragte Anlaug. Ingrid merkte, dass Frieda sie schief ansah. Sie band ganz schnell die Schürze ab und drehte mit steifen Fingern den Deckel der Thermosflasche zu. Es lag etwas in der Luft.
»Nein, nicht grad krank. Nur müde.« Hansine lehnte sich gegen die Wand. Dann sah Ingrid, dass Tränen über die grauen Wangen liefen. Sie schien jetzt erst aufzuwachen. Es bewegte sich etwas in ihr. Etwas, auf dem sie so lange herumgetrampelt hatte. Sie hatte sehr wohl Hansines kleinen, runden Bauch gesehen. Vierter, fünfter Monat etwa. Hansine hatte schon drei Kinder. Sie waren dicht hintereinander gekommen. In der Fischfabrik arbeitete sie erst seit einem Jahr. Seit sie das Jüngste nicht mehr stillte. Ingrid erinnerte sich noch, dass sie in der ersten Zeit in den Fünf-Minuten-Pausen Milch abgepumpt hatte. Hansine weinte.
»Komm, ich fahr dich aufm Fahrrad nach Hause«, sagte Frieda, suchte Hansines Sachen zusammen und stopfte sie in das Netz. Die harten Blicke trafen Ingrid in den Nacken. Sie spürte, wie sie brannten. Wollte sich umdrehen und sagen, dass sie tatsächlich das Tempo ganz unnötig so hochgeschraubt hatte. Wollte die Hand hinstrecken. Aber sie brachte es nicht fertig. Sie hatte nie richtig zu ihnen gehört. Drängte sich auch nicht auf. Wollte ihnen beweisen, dass sie außerhalb stehen konnte und trotzdem zurechtkam. Dann ging ihr auf, dass man ihre kleine Gruppe leicht entzweien könnte. Das taten die, die am Ende an allem verdienten. Solche wie Dahl. Sie klappten die Brieftaschen zu, wenn die Schiffe mit so und so viel Tonnen Fischfilets vom Kai ablegten. Es war richtig, was Grete predigte: Man arbeitete für einen Dreckslohn, auch wenn man bis zum Umfallen schuftete.
Das war der Grund, warum keine Freundschaft überlebte in dem engen, verräucherten Pausenraum mit dem nüchternen Resopaltisch und dem brandfleckigen Metallaschenbecher, auf dem »Bodø-Aktienbrauerei« stand. Das war der Grund, warum keine Zeit für ein freundliches Wort blieb, kein Raum für etwas anderes als die Hetzerei, um das Tempo zu halten! Nein, Ingrid, sagte ihr eine innere Stimme. Ist es denn heute Abend darum gegangen? Bist du ehrlich? Ist es nicht so, dass du dich in deine eigene prächtige Verbitterung einschließt und es die anderen büßen lässt? Hättest du das Tempo nicht so hochgeschraubt, dann wäre der Fisch vielleicht in den Kühlraum gestellt und auf zwei Schichten verteilt worden, und Hansine wäre nach Hause gegangen, hätte ihre Wäsche waschen und hinterher ihren Rücken ausruhen können.
Es brachte so wenig, dass sie das Tempo forcierte. So wenig … Ingrid machte sich auf den Heimweg. Sie blickte nicht zurück – wie es mit den drei anderen ging. Sie wusste, dass sie redeten. Mit leisen, rauen Nachtstimmen voll müder Ohnmacht. Ein einsilbiges Gespräch. Mit Seitenhieben. Härte. Heftiger Abneigung. Gegen sie, Ingrid. Aber sie würde gutes Geld in der Lohntüte haben. Sie konnte in diesem Monat die Verantwortung für sich übernehmen. In jeder Hinsicht! Sie würde Rakel den Kleiderstoff bezahlen, den sie damals in Breiland von ihr bekommen hatte.
Die Zahlen standen in Ottars Laden dicht wie ein Heringsschwarm unter ihrem Namen. Sie würde die Schulden bezahlen! Und sie würde noch genug übrig haben, um nach Bodø zu fahren und Henrik zu besuchen, wenn sie nicht in der Nacht, die sie für die Reise brauchen würde, irgendwo übernachtete.
Ingrid verspürte einen gewaltigen Trotz. Und der machte es für sie möglich, hocherhobenen Hauptes über die Hügel zu gehen. Sie kam gar nicht auf die Idee, sich darüber zu wundern.
Sie ging schnell. Aber es machte ihr nichts aus. Sie hatte sich von der Umwelt abgekapselt. Als sie zu Hause die Türklinke in die Hand nahm, war sie noch genauso blass wie in der Frosterei, als sie die Schürze zusammengefaltet hatte.
Sie schaute bei Tora herein und wechselte ein paar Worte mit ihr. »Ich bin … müd, ich leg mich jetzt hin«, sagte sie schließlich. Vor allem, um nicht mehr sagen zu müssen.
Ingrid ging ins Zimmer zu dem großen, leeren Bett. Sie wusste nicht, ob sie etwas vermisste. Sie war wohl auch zu müde. Dann zog sie die Gardinen vor und wusch sich mit kaltem Wasser. Um den schlimmsten Fischgeruch zu tilgen. Sie glaubte, dass ihr das gelang.
Tora lag in der Kammer und wunderte sich, dass die Mutter kein heißes Wasser aus der Küche geholt hatte. Eine schreckliche Angst um die Mutter überfiel sie. Aber an diesem Abend war sie wohl nicht mehr stark genug für so viel Angst. Ihr Herz drohte wieder wie wild loszuhämmern. Sie drehte sich zur Wand um, versuchte die Astlöcher getrennt von der restlichen, glatten Fläche zu sehen. Aber das war ihr auch keine Hilfe.
2
Henrik wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ihm wurden zwei Brandstiftungen an Simons Kai und den dazugehörigen Gebäuden zur Last gelegt. Die erste Brandstiftung wog angeblich schwerer. Bei den Vernehmungen hatte sich herausgestellt, dass Henrik gewusst hatte, dass zu der fraglichen Zeit Menschen in den Fischerhütten schliefen. Insgesamt hätten sieben Männer den Tod finden können. Als bekannt wurde, dass Rakel als Zeugin über ihren Schwager nur Gutes gesagt hatte, obwohl es doch gerade Simon gewesen war, der ihn angezeigt hatte, war das Erstaunen groß. Leise und augenzwinkernd wurde darüber getuschelt.
Als mildernde Umstände war geltend gemacht worden, dass der Brandstifter seit langem an Depressionen litt und deshalb auch über längere Zeit hinweg stark getrunken hatte. Und dass er das Verbrechen unter Alkoholeinfluss begangen hatte.
Die Leute auf der Insel murrten und wussten nichts von Henriks Depressionen. Entschuldigungen würden immer gefunden, wenn es galt, den Abschaum der Menschheit zu retten. Depressionen! Henrik! Ein Narr und ein Schmarotzer. Das war er. Ein Parasit. Die Männer standen in Ottars Laden und erinnerten sich daran, wie großspurig Henrik gewesen war, als davon gesprochen wurde, dass Simon nach dem Brand in der Webstube saß und jammerte. Die Männer winkten verächtlich ab. Und es war, als ob Ingrid in ihren Augen wuchs, je mehr sie sich über den Faulenzer ausließen, über diesen Henrik – und seine Meriten. Die Geschichten waren lang und verwickelt und wurden in ihrer ganzen breiten Vielfalt aus der Zeit ausgegraben, als Henrik und Ingrid noch nicht zusammen gewesen waren. Einige wussten auch zu berichten, dass es vor der Heirat eine Art Tausch gegeben habe. Ob Simon und Ingrid früher ein Paar gewesen waren – oder Rakel und Henrik, darüber war man sich nicht einig. Aber es hatte einen Tausch gegeben! Es konnte passieren, dass einer von ihnen ernstlich wütend auf einen anderen wurde, weil der etwas Falsches erzählte. Und die Übrigen fuhren dazwischen, und der Vormittag ging vor lauter Diskutieren schnell herum. Über eines waren sich alle einig: Henrik war und blieb ein Taugenichts. Und niemand verstand, wie Ingrid es mit so einem aushielt. Denn was Recht war, musste Recht bleiben. Auch wenn Ingrid ein Verhältnis mit einem Deutschen gehabt und sich ein Kind zugelegt hatte, so war sie jetzt doch eine anständige Frau. Rakel war gescheit. Aber zugunsten dieses Herumtreibers auszusagen? Depressionen! Ja, ja. Nur Simons Frau konnte mit so feinen Worten alle anderen in ihre Schranken weisen.
Simon machte sich allerlei Gedanken und wusste nicht, dass er der große Held der Insel war. Er hatte den Eindruck, dass er den letzten Kredit gegen zu hohe Zinsen aufgenommen hatte. Außerdem machte er sich Sorgen um Rakel. Es ging ihr nicht gut. Er merkte es an vielen Kleinigkeiten. Sie lachte nicht mehr so gern und herzlich. War am liebsten allein. Ging kaum ins Dorf hinunter. Entschuldigte sich mit Müdigkeit oder zu viel Arbeit. Simon schob alles auf den Prozess gegen Henrik. Denn für Rakel war es ebenso sehr ein Prozess gegen Ingrid. Das tat weh. Simon wusste von dem, was sich zwischen den beiden Frauen abgespielt hatte, nicht mehr, als was er selbst gesehen und gehört hatte. Das war nicht viel. Und Tora hatte er nicht mehr gesehen, seit er den Mann und sie gerettet und mit dem zitternden Mädchen im Arm in der Tobiashütte gestanden hatte. Immer noch überkam ihn ein ganz sonderbar weiches Gefühl, wenn er daran dachte, wie fest sie sich an ihn geklammert hatte. Vielleicht lag es daran, dass er selbst keine Kinder hatte.
Es wäre besser gewesen, wenn ihnen die Gerichtsverhandlung erspart geblieben wäre. Aber jetzt, wo das Ganze durchgestanden war, mussten sie alles nehmen, wie es eben kam. Rakel hatte also doch recht gehabt, als sie einmal sagte: »Genau so sind die Leute. Legen einfach ein Feuer.«
So war jedenfalls Henrik. Die meisten waren nicht so. Trotzdem war es schlimm genug. Simon hätte gerne etwas für Ingrid und das Mädchen getan. Aber immer stand er vor verschlossener Tür, wenn er mit Ingrid reden wollte.
Er konnte deutlich sehen, dass sie zu Hause war. Und da half es ihm nichts, dass er keinerlei Schuld fühlte, weil er die Anzeige nicht Henrik zuliebe zurückgenommen hatte. Er konnte und wollte einen solchen Menschen nicht frei herumlaufen lassen. Im tiefsten Herzen verachtete Simon solche Taten und distanzierte sich von ihnen. Er konnte diese Leute einfach nicht verstehen. Der sonst so sanftmütige Simon war unnachgiebig gewesen. Die Wahrheit sollte ans Licht.
Der Mann war schließlich selbst schuld. War er nicht mit einer großartigen Frau verheiratet? Konnte er sich nicht anständig benehmen wie andere Leute auch? War das Leben für Henrik so viel schwieriger als für andere? Henrik hatte Simons Überzeugung ins Wanken gebracht, dass dort, wo Simon war, keine bösen Taten möglich seien. Die gab es für Simon nur irgendwo in weiter Ferne. Er hatte Rakel einen langen und wütenden Vortrag darüber gehalten. Hatte nicht gemerkt, dass sie ungewöhnlich still blieb – für ihre Verhältnisse. Am Ende hatte er Zustimmung von ihr verlangt. Aber sie hatte ihn nur angesehen und gesagt, dass er selbst wissen müsse, was er zu tun habe. Dann hatte sie in wütendem Tempo angefangen zu spülen.
Simon war mitten im Raum stehen geblieben. Es war ihm aufgegangen, dass Rakel es nicht richtig fand, dass er seinen Schwager wegen Brandstiftung angezeigt hatte. Und er begriff nicht, dass sie das anders sehen konnte. Hatte der Mann sich vielleicht nicht selbst für schuldig erklärt? Sogar mit einem Grinsen – und das vor Gericht! Vor den Augen von Simon und den Richtern und dem ganzen Saal. Hatte der Mann nicht ganz abgebrüht gewirkt bei dem Geständnis, gewusst zu haben, dass in den Hütten sieben Männer schliefen? Er wurde aus Rakel nicht klug. Sie hatte ihre eigenen Gesetze und ihre eigene Gerechtigkeit. Simon musste immer daran denken. Er wusste gar nicht, dass er ein großer Held auf der Insel war. Dass er der solide und ehrgeizige Simon war, der sich in all seiner Majestät erhob und den Schwager ins Gefängnis schickte – weil die Gerechtigkeit schließlich ihren Lauf nehmen musste. Er war in den Augen der Leute so einzigartig, dass sie für eine Zeitlang Gesprächsstoff hatten und der Herbst ihnen deshalb nicht so grau und kalt vorkam.
Simon ging auf die Baustelle und kontrollierte und kommandierte ein wenig. Vielleicht würde er in der nächsten Saison wieder voll in Gang kommen. Die Männer hatten unbegrenztes Vertrauen zu ihm und trauten ihm zu, das Unmögliche zu schaffen.
3
Wie sie sich verhalten hatte, das musste doch einfach richtig gewesen sein. Musste es sein! Außerdem hatte Onkel Simon ja begriffen, wer den Brand gelegt hatte, auch wenn sie es ihm nicht gesagt hatte. Scham? Warum schämte sie sich nicht, weil er im Gefängnis saß? So wie sich ihrer Meinung nach ihre Mutter schämte? Lag es daran, dass sie irgendwo einen Vater hatte? Tot und unter der Erde, schon vor ihrer Geburt. Aber trotzdem. Oder schämte sie sich nicht, weil sie so froh war, dass sie sich in der Kammer sicher vor der Gefahr fühlen konnte? Mit diesem Mann hatte sie nichts zu schaffen.
Tora schlenderte an Ottars großem neuem Schaufenster vorbei. Ottar hatte seinen Laden erweitert. Die Straße musste jetzt einen großen Bogen machen. Die Leute redeten darüber, dass Ottar so protzig geworden war und nur deshalb angebaut hatte, damit er ein Schaufenster bekam und man seine Waren sehen konnte – und er hatte es so unpraktisch gemacht, dass der Weg jetzt einen Bogen um den Anbau machen musste. Aber sie fanden es eigentlich ganz schön. Waren stolz auf das Fenster, als ob es ihr eigenes wäre. Ottar führte jetzt auch Kleider. Er hatte Baumwollpullover ausgestellt, mit einem hohen Kragen und einem Gürtel um die Taille. Die Pullover waren gestreift, »in delikaten Farben«, wie Ottar sagte.
Ja, und dann waren Teddyjacken eingetroffen. Die auf beiden Seiten getragen werden konnten. Ottar strich sich die Haare glatt und drehte die Jacken um, so dass die rote Seite innen saß und die graue, flauschige außen. Er drückte die Knöpfe auf der verkehrten Seite wieder zu – und alles war ein Wunder.
Tora presste die Stirn an die Scheibe und starrte hinein. Wer doch eine solche Jacke haben könnte.
Sol und sie hatten es eines Tages gewagt, in den Laden zu gehen und eine Jacke anzuprobieren. Sie war wunderschön und warm und roch so gut.
Sol passte sie nicht, und sie war froh darüber – denn dann brauche sie nicht länger daran zu denken, sagte sie. Aber Tora hatte die wasserblauen Augen gesehen. Sie waren unnatürlich groß gewesen. Ohne Grenzen.
Der plumpe Körper von Sol aus dem Tausendheim. Sie machte sich selbst darüber lustig. Dann ließen es die anderen sein. Alles, was sie mit Putzen verdiente, gab sie zu Hause ab. Tora wusste es, auch wenn Sol es nie erwähnte. Elisif, die eigentlich die Mutter hätte sein sollen, hatte genug damit zu tun, ihren Gott zu verehren, so dass alle Arbeit an Sol hängen blieb.
Tora glaubte, Sols Hand zu sehen, wie sie sich liebevoll mit der Teddyjacke im Schaufenster befasste, wie an dem Nachmittag beim Anprobieren. Der kräftige große Daumen wirkte seltsam fehl am Platze auf dem neuen Kleidungsstück. Es war dieselbe Hand, die Tora unzählige Male bei der Arbeit gesehen hatte. Sie hatte abgeknabberte Bleistiftstummel festgehalten, wenn Sol mit ihren Aufgaben am Küchenschrank saß – und alle Stühle weggeschoben waren, damit die Kleinen nicht an ihr hochklettern konnten. Deutliche schwarze Ränder unter den Nägeln. Es lag nicht daran, dass Sol unsauber war. Aber bevor sie sich an die Aufgaben setzte, wischte sie meist noch den Boden auf. Um sie herum musste es ordentlich sein, wenn sie ihre Schularbeiten machte. In dieser Beziehung ähnelt sie meiner Mutter, dachte Tora.
Treppe putzen setzt sich unter den Nägeln ab. Asche ausleeren. Setzt sich auch unter den Nägeln ab. Kohle schaufeln. Heizen. Alles setzt sich wie ein Trauerrand unter den Nägeln einer Arbeitshand ab. Wie unermüdlich Sol auch an ihren Nägeln kaute, es waren doch immer Ränder da.
Sie waren noch intensiver rot geworden, ihre Hände – seitdem Sol mit der Schule fertig war und den ganzen Tag putzen ging. Hellbraune Sommersprossen schmückten die Arme oberhalb der Handgelenke. Aber sie waren hier eigentlich fehl am Platz. Die Hände waren trocken und rissig. Runzelig und zerknittert auf der Oberseite, glatt wie vom Meer abgeschliffene Steinen auf der Unterseite. Hie und da kleine Wunden und Schrammen. Nicht der Rede wert. Nicht groß genug, um einen Lappen oder ein Pflaster aufkleben zu müssen. Sie waren einfach da … Sol trug sie mit sich, wo sie auch hinging. Und die Jacke passte nicht. Weder zu dem Körper noch zu den Händen. Tora empfand plötzlich eine unerklärliche Zärtlichkeit für Mutters und für Sols Hände. Es war wie das Gefühl, das sie ab und zu hatte, wenn sie einen kleinen Fisch vom Haken losmachte und ein oder zwei Sekunden zögerte, ehe sie ihn wieder ins Meer warf, weil sie überlegte, ob er wohl zu schwer verletzt sei, um zu überleben. Und der Gedanke beschäftigte sie noch lange danach. Sie glaubte, den Fisch dort unten zu sehen. In Schräglage, mit unkontrollierten, kraftlosen Schwanzschlägen. Sah, dass der Kieferknochen quer abgerissen war. Sah, dass ein Knochensplitter aus der grauen Fischhaut ragte. Aber es war ein so kleiner Fisch – ein so kleiner Knochen. Es gab so viele Fische im Meer. So viele Hände. So viele Wunden. Die größer waren.
Auf dem Heimweg ging Tora an der Hütte von Frits und Randi vorbei. Drinnen war alles dunkel. Da waren sie wohl nicht zu Hause.
Er war auch wie eine Wunde, unter der Haut. Frits. Nicht so sehr, weil er taub war und nicht sprechen konnte. Eher, weil sie immer an die Gefahr dachte, wenn sie ihn sah. An dem Morgen, als sie unter dem Fischgestell von ihm fortgelaufen war, hatte sie ihn verloren. Weil er nicht wusste. Niemals wissen durfte, dass er der Erste war, der sie angefasst hatte, nachdem … er …
Später ging sie ungern in die Nähe des Kais und der Hütte, wo Frits wohnte. Den Sommer über hatte sie am Strand auf den Steinen gesessen und über die kleinen Inseln hinweggestarrt, während der feuchtkalte Wind sich ungebeten unter die schäbige Strickjacke geschlichen und ihr das Wasser aus den Augen getrieben hatte. Und es gab etwas, wofür sie keinen Namen finden konnte.
Sie wusste nicht, was ihr am meisten fehlte: Randi, die Bücher, die Musik – oder Frits.
Später dachte sie nicht mehr darüber nach. Es war etwas Fremdes in ihre Gedanken gekommen, soweit es ihn betraf. Es war eine Art gefühllose Erwartung. Den ganzen Sommer über hätte sie ihn gern getroffen. Und sie wollte es auch wieder nicht. Sie wollte zu ihm gehen. Dort sitzen mit der roten Decke über den Beinen und lesen. Wollte ihn anschauen – sein Gesicht erforschen, wenn er es nicht merkte. Aber gleichzeitig – wollte sie es nicht. Nun lag Mutters Schande wie ein Deckel über dem Ganzen. Er saß im Gefängnis. Tora konnte nicht mehr zu Frits gehen. Wäre am liebsten nirgendwo mehr hingegangen.
Trotzdem schlich sie oft bei Frits vorbei, wenn sie allein war. In der letzten Zeit hatte es sich ergeben, dass sie immer allein war. Nun war er in seine Taubstummenschule gefahren. Frits … Er würde erst zu Weihnachten wieder nach Hause kommen. Randi hatte Sol getroffen und nach Tora gefragt. Hatte ihr einen Gruß ausrichten lassen und dass sie doch herunterkommen solle, bevor Frits wegfuhr. Es würde Kuchen geben – ein Fest. Aber das war an dem Donnerstag gewesen, an dem die Mutter mit der Fähre allein aus der Stadt zurückgekommen war, und Tora brachte es nicht über sich, zu Frits und Randi zu gehen.
Später gab es so viel, womit sie nicht fertigwurde. Sie kam gleichsam nicht von der Stelle. Drückte sich nur im Dorf herum und nickte, wenn jemand grüßte. Tora wunderte sich, dass alle sie grüßten. Ihr ging plötzlich auf, dass es wohl daran lag, dass sie ihnen leidtat. Und schon krochen ihr die Ameisen über den Rücken und den Hals. Sie konnte glühend rot werden – auch wenn niemand sie ansah.
Und dann war da noch die Mutter. Sie wollte offenbar nicht, dass Tora zu irgendjemandem ging. Und Tora konnte sich auch nicht vorstellen, nach Bekkejordet zu gehen.
Die Küchendecke, die sie für die Tante sticken sollte, war fertig geworden, während die Mutter bei der Arbeit war, aber Tora hatte sie unter der Matratze versteckt und sich nicht aufraffen können, sie nach Bekkejordet zu bringen. Natürlich hätte sie es tun können, ohne dass die Mutter davon wusste. Aber es stand jetzt schon genug zwischen ihnen.
An diesem Tag hatte die Mutter sie auf die Post geschickt, um zwei Postanweisungen zu holen, und als Tora zurückkam, hatte die Mutter sich gleich hingesetzt und die eine ausgefüllt. Dabei schien sie in sich zusammenzusinken. Sie sah ganz grau aus. Gebeugt. Dann ging sie zum Ofen und warf die Postanweisung ins Feuer. Machte ein Gesicht, das deutlich jede Frage abwehrte. Darauf füllte sie das zweite Formular aus. Schnell, als ob sie Angst hätte, dass sie es sich anders überlegen könnte: »Für den Kleiderstoff. 32 Kr. An Rakel Bekkejordet.« Und Tora ging damit zur Post und senkte den Kopf, als Turid hinter dem Schalter die Postanweisung um- und umdrehte und Tora komisch ansah, bevor sie den Stempel aufdrückte. Sie schien Tante Rakel für alle Zeiten wegzustempeln.
Tora schlich davon. Es war schlimmer, als wenn sie bei Ottar Waren anschreiben oder beim Milchverkauf im Notizbuch quittieren lassen musste. Ja, es war viel schlimmer. So, als ob die Leute in die Mutter und sie hineinsehen könnten. Durch Mantel und Kleid hindurch sehen könnten, dass sie schmutzige Wäsche anhatten. Das Metall, das auf das Papier schlug. Der Stempel, der die Tante aus den Tagen herausschlug, die noch kommen würden. Toras Schritte klangen hohl auf den Fliesen. Ihr wurde klar, dass sie sich auf dem Weg nach draußen befand. Es roch nach Leim und Staub und Geld. Dicke, schmierige Bündel zwischen Turids Fingern. Nun lagen Mutters Zehnkronenscheine hinter den Gitterstäben. Und die zwei Kronenstücke waren kalt und tot und blank. In jedem Kronenstück ein Loch.
Als ob jemand Löcher in Tante Rakel gebohrt hätte. Als ob die Mutter es selbst getan hätte. Begriff sie das nicht? Die Tür dröhnte hinter ihr. Sie hatte eine Scheibe, die von der Meeresgischt und vor lauter Dreck ganz blind war. Tora schlenderte durch den Ort und dachte die ganze Zeit, dass die Gefahr aus der Kammer herausgefegt worden war. Und eine kleine Freude wuchs in ihr. Tora dachte angestrengt nach. Und Rakel und Simon und ihre Mutter wurden dadurch zu Freunden.
Ehe sie nach Hause ging, war der Tag schön.
Es waren viele Spatzen in den Pfützen.
Im Hof stand ein rotes Fahrrad mit einem roten Netz und einer glänzenden Lenkstange.
4
Eines Nachmittags, als Sol und Tora zum Milchholen unterwegs waren, tauchten hinter ein paar Steinen zwei Jungen aus dem Ort auf. Sie hatten sich an der einzigen Stelle versteckt, wo es weder Häuser noch Menschen gab. Da konnte kein Fenster geöffnet werden, und keine Mutter konnte den Kopf herausstrecken und sich einmischen. Keine Zeugen, alle Möglichkeiten. Ole und Roy. Ole hatte wohl noch nicht seine Niederlage in der Schule bei Gunn vergessen, auch wenn es schon lange her war. Sie standen breitbeinig und mit den Händen in den Taschen da. Grinsten forsch. Besonders Ole. Fühlte sich bereits als Sieger. Niemand war da, der petzen konnte.
»Ist das nicht das Goldkind von der Deutschenmutter, das hier rumspaziert und mit der Milchkanne schlenkert, he? Wie viel Brände haste denn heut schon gelegt?«
Ole trippelte wie eine Dame vor Tora her. Sie hatte diese alten Sticheleien schon lange nicht mehr gehört. Sie taten weh. Sie hatte das Gefühl, als ob jemand einen Stein geworfen hätte. An den Kopf. Ins Gesicht. In die Augen. Aber sie kniff den Mund zusammen. Schwieg mit jeder Faser ihres Wesens.
»Halt’s Maul, du Scheißfischer!«, schrie Sol und ging auf ihn los.
»Was sagt die da, kommt vom Tausendheim und spielt sich hier auf, wie? Du fette Sau. Wie steht’s denn mit deiner Mutter, ist die nach Hause gekommen und immer noch verrückt?«
Sol sah rot. Sie war ein erwachsenes, konfirmiertes Mädchen mit einem großen, heiligen Zorn. Sie ging mit erhobener Milchkanne auf den Bengel los. Ein Glück, dass die Kanne noch leer war. Sie schlug sie mit voller Wucht auf den Schädel von Ole, der einen halben Kopf kleiner war als sie. Tora machte große Augen. Sie hatte Sol noch nie handgreiflich werden sehen, wie schlimm es auch gewesen sein mochte. Im Gegenteil, Sol war es, die immer bei klarem Verstand blieb und zwischen die Streithähne ging, bevor die Nasen bluteten. Jetzt war sie wie ein wild gewordener Stier. Die kurzgeschnittenen Haare sträubten sich, ähnlich dem Bild von dem Igel, das im Schulflur hing. Sie hatte Schaumflöckchen in den Mundwinkeln.
Nachdem Ole sich von dem Erlebnis mit der Milchkanne so weit erholt hatte, dass er begriff, was hier vor sich ging, erfasste der Wahnsinn auch die Jungen.
Tora sah deutlich, das die Sache kein gutes Ende nehmen würde. Sie waren zu zweit gegen Sol. Starke Übermacht.
Tora rief, dass sie Schluss machen sollten, aber niemand hörte oder sah. Die Jungen hatten Sol jetzt auf dem Schotterweg unter sich liegen. Der eine hielt ihre Arme, der andere saß auf ihrem Bauch und boxte sie in die Brüste, so dass sie jammerte.
Nachdem Ole diesen Teil der Arbeit erledigt hatte, zog er den dünnen, kurzen Baumwollrock bis über Sols Schultern hinauf und zeigte seinem Kumpel die ganze Herrlichkeit.
Tora, die währenddessen am Wegrand gestanden hatte, ohne den Mut, irgendetwas zu unternehmen, sah plötzlich nur noch einen roten Nebel. Er hüllte sie vollständig ein. Schreiend hob sie ihre Kanne hoch und prügelte drauflos.
Die Kanne war noch eine von der altmodischen, soliden Sorte. Mit einer harten Kante unten.
Dumpfes Stöhnen und raue Schluchzer. Tora vertraute darauf, dass die Jungen zuoberst lagen. Ging von einer einfachen Logik aus: je mehr Schläge, desto mehr Schaden. Je schneller sie schlug, desto mehr Schläge.
Sie hatte nicht geahnt, dass es ein so gutes Gefühl sein könnte, einfach loszuschlagen.
Da legte sich eine Hand auf ihre Schulter. Eine starke Faust übernahm das Kommando über die Kanne, und eine gebieterische Stimme sagte: »So, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Und dann wollen wir mal sehen, ob noch jemand am Leben ist … Ist noch jemand am Leben, ja?« Frits’ Vater!
Aber er lächelte ein bisschen! Oder nicht? Er half den Jungen auf die Beine. Ole hatte eine üble Schnittwunde über dem einen Auge. Das andere war dick verklebt. Er weinte bitterlich und rau. Rotz und Tränen landeten in Monsens Taschentuch.
Roy war es ein wenig besser ergangen. Sol hatte eine hässliche Schramme auf dem einen Knie. Aber der Triumph leuchtete ihr aus den Augen. Sie konnte noch nicht aufhören. Stellte Roy ein Bein, und er schlug der Länge nach hin, während er sich schon gerettet und sicher gewähnt hatte. Er fiel auf die Nase. Die sah schlimm aus. Er wollte sich sofort rächen, aber Monsen nahm den Schlingel fest in den Griff, und Sol schrie in blinder Wut:
»Komm nur, du Dreckskerl, komm nur, du Scheißfischer! Ich werd’s dir geben, dass du nicht mehr im Zweifel bist, wer hier im Dorf wirklich verrückt ist!! Komm nur, komm nur …« Sie schluchzte verbissen.
Die Jungen schlichen hinauf zu der Häusergruppe oben am Hang. Gingen wie geprügelte Hunde, langsam und beschämt. Der Kampf war beendet. Monsen nahm die Mädchen mit nach Hause, alle Treppen hinauf und hinein in die Wohnung. Er verband ihre Wunden und rief mehrmals »Pfui«, als ihm die Geschichte erzählt wurde. Aber als Randi fragte, welche Schimpfwörter die Jungen gebraucht hätten, wurde es still. Trotzdem ergriff Monsen Partei für die Mädchen und sagte, dass den »Teufelsbraten« nur recht geschehen sei.
Tora hatte vergessen, dass sie hier bei Frits war. Bis er plötzlich in der Türöffnung stand. Er war in seine Taubstummenschule gefahren. Das wusste sie ja. Und doch stand er da und starrte sie an.
Und da begriff sie, wie sehr sie ihn vermisst hatte. Dass sie ihn verletzt hatte. Dass der stumme Junge in vieler Hinsicht einsamer war als sie selbst. Sie begriff, dass sie ihn gar nicht als richtigen Menschen angesehen hatte, weil er nicht sprechen konnte.
Sie wollte ihn nie mehr verleugnen, die Gefahr sollte ihn nie mehr verjagen! Niemals! Frits war Frits. Und für sie war er viel mehr als nur Frits.
Sie sah es klar und deutlich. Weil er nicht da war. Weil eine große, schmerzliche Leere im Raum war.
Und der Nachmittag stieg über die Fensterbank, das Fenster stand offen gegen den kühlen, nachdenklichen Herbst. Randi buk gelbe, duftende Pfannekuchen, auf die sie eine Menge Zucker streute. Frits’ Vater bekam für Tora und Sol einen Namen. Er hieß Gunnar und spielte Ziehharmonika, dass die undichte und nicht gestrichene Holzdecke abzuheben schien! Und der blutige Verband an Sols Knie, der so schlecht zu einem großen Mädchen passte, das konfirmiert war (und vorhatte, am nächsten Samstag tanzen zu gehen, ob Elisif nun weinte oder nicht), dieser blutige Verband war Anlass genug, um die Geschichte von der Prügelei immer wieder zu erzählen. Randi schlug die Hände zusammen und war ganz entsetzt, lachte und versetzte ihnen Rippenstöße.
Tora machte es nichts aus, dass Sol dabei war. Sie kroch nach alter Gewohnheit auf Frits’ Bett. Zog die Strickdecke über die Beine, obwohl es im Raum wirklich warm war.
Sie nahm Frits mit nach Berlin. Die Großmutter stand mit offenen Armen vor ihnen beiden. Der Farn war saftig grün, und das Tor stand offen. Und die Rosen …
»Frag einen Menschen, was die Liebe ist, und sie ist nichts anderes als ein Wind, der durch die Rosen säuselt …« Sie hatte das irgendwo gelesen. Es war zu schön, um wirklich zu sein.
Sie dachte daran, wie sie sich früher mittwochs gefühlt hatte. Da war sie kleiner – ganz klein gewesen, aber konnte schon lesen. Es musste vor der Gefahr gewesen sein. (Dass sie so denken konnte! Genauso wie die Leute, wenn sie sagten: Vor dem Krieg …) Also vor der Gefahr: Die Mutter kam jeden Mittwoch mit einer Illustrierten nach Hause. Darin gab es eine Bilderserie von einem kleinen Burschen, der Pünktchen hieß. Er war so klein, dass er Platz in einer Streichholzschachtel hatte. Und Tora mochte diesen Jungen schrecklich gern. Denn es gab nur diesen einen auf der ganzen Welt, der so klein war … Sie wollte ihn immer bei sich haben. Immer. Er war ein Teil der schönen Spannung, die man sich leisten konnte, wenn es Mittwoch war. Und sie fragte die Mutter einmal, als die unten in der Waschküche mit den Armen tief im Seifenschaum stand – ob sie das Pünktchen nicht haben könne. Ob die Mutter nicht an die Illustrierte schreiben und ihn für Tora erbitten könne. Sie bettelte und flehte – obwohl sie wusste, dass sie sich genauso gut den Mond hätte wünschen können. Sie fühlte bereits den leichten Druck in ihrer Hand. Sie fühlte ein Kitzeln auf der Haut, vor lauter Zuneigung und Freude. Das musste die Liebe sein. Wie ein warmer Wind? Oder Blumen? Berühren …
Sie hob die Hand und strich Frits ganz schnell über die Wange. Ganz schnell. Und er begriff und verzieh ihr und trug ihr nichts nach. Er fragte nicht nach dem Grund. Dann glitt er fort.
Und Randi unterhielt sich mit Sol, die mit dem Rücken zu Tora saß, und Gunnar spielte Ziehharmonika. Es brauste zum Himmel hoch. Das ganze Haus schien abzuheben.
Tora war erfüllt von Musik und Liebe zur ganzen Welt. Sie hielt dieses Gefühl mit beiden Händen fest. Als ob sie im tiefsten Herzen wusste, dass es nicht von Dauer war.
Sol und Tora kamen diesmal mit ihren Kannen sehr spät zum Milchverkauf. Es gab nur noch Magermilch. Aber sie kicherten trotzdem, als sie die Deckel auf die Kannen drückten.
5
Der Morgenkaffee roch bitter und angebrannt. Tora hatte ihn überkochen lassen und wagte kaum, mit der Mutter zu reden. Deren Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt, seit sie die Postanweisung ausgefüllt hatte. Tora wartete darauf, dass es vorüberging. Sie hatte sich der Mutter gegenüber eine besonders große Geduld angewöhnt. Solange sie ihr nicht im Wege war oder versuchte, die Mutter zum Reden zu zwingen, ging es meist gut.
Sie hatten sich gerade hingesetzt, um die elende Kaffeeplörre zu trinken, als plötzlich wie ein kleines Meeresunwetter Rakel in der Tür stand. Sie war knallrot im Gesicht und hielt die Postanweisung in der rechten Hand. Als eine böse Drohung.
Ingrid sprang vom Stuhl auf und stand mit geschlossenem Mund und mit geschlossenen Augen da. Unmerklich ballte sie die Fäuste.
Rakel machte zwei Schritte in den Raum hinein, nachdem sie die Tür fest hinter sich geschlossen hatte.
Sie sah nur Ingrid an. Tora schien gar nicht dabei zu sein. Sie war unsichtbar und verschmolz mit der Wachstuchdecke auf dem Tisch. Es war eine Abrechnung zwischen den beiden Frauen. Toras Rücken überzog sich mit Gänsehaut. Sehr bald war sie triefnass unter den Armen. Tora hatte »herein« gesagt, als es geklopft hatte. Nun standen die zwei Frauen da wie angewachsen. Keine sagte guten Morgen, keine machte eine Bemerkung über das Wetter. Es regnete draußen in Strömen. Keine bot Rakel einen Stuhl an. Keine sagte etwas über den durchnässten Wollmantel und das Kopftuch, das wie ein nasser Putzlappen um Rakels Kopf lag. Die Wörter waren auf eine schlimme Weise von der Erde fortgeflogen. Es war, wie wenn Frits nicht sagen konnte, was er meinte, und die anderen seine Zeichen nicht verstanden. Nein, das hier war doch ganz anders. Es vergiftete die Luft. Tropfte rhythmisch von Rakels Mantelsaum. Beschrieb einen unregelmäßigen Kreis um sie. Sie war in dem Kreis. Sie war nicht außerhalb … Alle drei waren in sich selbst eingeschlossen. Der Käse auf dem Tisch war schief abgehobelt, an dem einen Ende hatte er eine Erhöhung, das war wohl sie, Tora, gewesen, die … Komisch, dass die Mutter nichts gesagt hatte. Rakel stand noch immer da.
Elisifs Kinder polterten die Treppe herunter, sie waren auf dem Weg zur Schule. Mit den Schuhen war es jetzt besser bestellt, seitdem Sol arbeitete. So polterten sie jeden Morgen alle zusammen herunter. Das Krepppapier um die Blumenbüchsen auf dem Fensterbrett war verblasst und hatte Ränder. Das Wasser war aus der Untertasse in das Papier gezogen. Es sah armselig aus. Das tat auch die emaillierte Schüssel, die im Ausguss lag. An drei Stellen war die Emaille abgeschlagen. Der Rand war schmutzig und verrostet.
Bei Tante Rakel hatten sie ein Steingutbecken in einem eigenen Raum neben der Küche, wo man sich richtig waschen konnte.
Tora ergriff Partei, ohne es zu wissen, für die Mutter. Sie machte sich stark. Es war richtig, was Ingrid getan hatte. Dass sie das Geld geschickt hatte. Sonst könnte sie das Kleid ja nicht anziehen. Jetzt nicht mehr. Und es war das einzige gute Kleid, das sie besaß. Es war richtig! Warum kam Tante Rakel also her und machte so ein böses Gesicht? Sie waren arm, die Mutter und sie. Aber nicht so arm. Sie bezahlten ihre Schulden.
»Was soll das bedeuten – das hier?« Rakels Stimme war ein heiseres Flüstern. In jedem Mundwinkel saß eine kleine Falte, die ihr Gesicht fremd und unfreundlich machte. Aber widerwillig musste Tora zugeben, dass es so aussah, als ob Rakel weinte. Deshalb stand sie so da. War so.
Die Mutter stand nur da. Sie hatte die Augen geöffnet. Aber sie schaute nach unten. Schaute auf die Tischdecke. Auf die gelben und orangefarbenen Blumenmotive. Die Stiele gingen in Kreisen ineinander über. Hielten sich aneinander fest …
»Wozu soll das gut sein, Ingrid?« Rakels Stimme krächzte noch einmal durch den Raum. Ebenso heiser und weit entfernt. Wie wenn man das Radio anmacht und den Sender nicht sauber einstellt.
Ingrid schien jetzt den Absprung zu wagen: »Das schulde ich dir für den Stoff, den du … in Breiland gekauft hast.«
Es war nur geflüstert, trotzdem warf es in den Ecken ein Echo.
»Den Stoff hab ich dir geschenkt, Ingrid. Du hast mir so oft mit so vielen Dingen geholfen … Ich hab dir den geschenkt! Hör zu, was ich sage!! Und du schickst mir Geld … mit der Post! Ich glaub, du bist verrückt geworden. Wohnste in Amerika? Oder wohnste hier? Biste meine Schwester? Oder biste nicht meine Schwester? Hörst du?!«
Ingrid stand noch immer am Tisch. Sie hatte die Fäuste geballt und verbarg sie hinter der Tischplatte. Endlich blickte sie auf. Die Tränen liefen Rakel die Wangen hinunter. Sie war feuerrot, und Schweiß und Regen perlten auf ihrer Unterlippe. Perlen.
»Simon hat die Postanweisung vor mir versteckt. Er, als Mann, hat verstanden … Aber du kapierst überhaupt nichts … ich habe sie trotzdem gefunden – heute Morgen – an meinem fünfunddreißigsten Geburtstag! Du, die du in all den Jahren meine große Schwester gewesen bist. Die mir immer geholfen hat, als wir klein waren. Du lässt den ganzen Dreck zwischen uns kommen. Du bist bereit, alles kaputt zu machen. Und was haben wir dann, Ingrid? Kannste mir erzählen, was wir dann haben? Wohin sollen wir uns retten, wenn du es zulässt, dass die Männer, wenn sie ihre Rechnung untereinander begleichen, das sichere Wissen zerstören: dass wir Schwestern sind?« Es klang wie ein Schluchzen. Sie stand unverändert da, weder in ihrem Gesicht noch in ihrem Körper war eine Bewegung zu sehen. Die Tante weint, dachte Tora verwundert.
Es war wie damals bei dem Unwetter, auf der Ladeluke, da hatte sie die Mutter für sehr stark gehalten, weil Tante Rakel seekrank gewesen war, und es hatte die Mutter in ihren Augen noch viel größer gemacht, dass sie nicht seekrank gewesen war. Nur ruhig und stark. Aber diesmal wurde die Mutter nicht stark, weil die Tante schwach war. War es unbedingt notwendig, stark zu sein? Wer war jetzt stark? War es die Mutter, die mit geballten Fäusten dastand und den Kleiderstoff bezahlt hatte, oder war es Tante Rakel, die mit rotem Gesicht und durchnässtem Mantel dastand und weinte, so dass die anderen es sahen? Lag mehr Stärke darin, sich abseits zu halten und alles allein zu schaffen, oder lag mehr Stärke darin, herzukommen und daran zu erinnern, dass sie eigentlich Schwestern waren?
»Tora, du musst in die Schule – sonst kommste zu spät …« Die Stimme der Mutter klang hohl und kraftlos. Heute war keine stark …
Tora holte ihren Ranzen aus der Kammer. Sie musste an Rakel vorbeigehen, um nach draußen zu kommen.
Ihr fiel ein, dass sie die Frühstücksbüchse auf dem Tisch vergessen hatte. Die hatte ein ziemlich abgewetztes Bild von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Der kleinste Zwerg stand ganz hinten – nahe an der Kante –, von ihm war fast nichts mehr übrig. Ein Meer musste Tora jetzt wieder überqueren. Als sie zum zweiten Mal an Rakel vorbeiging, streckte die einen Arm aus und hielt Tora an. Sie weinte noch immer. Zögernd streifte sie Toras Haar und Gesicht. Sie schien Tora jetzt erst zu sehen. Und zu glauben, dass sie etwas Verbotenes tat, wenn sie Tora anfasste. Tora schaute schnell zur Mutter hin. Drehte den Kopf zum Tisch. Blitzschnell. Dann berührte sie Rakels Hand mit ihrer. Nur mit den Fingerspitzen. Nur für eine Sekunde. Trotzdem hatten sie dieses gemeinsam, die Tante und Tora, dass sie etwas Unerlaubtes getan hatten. Sie hatten eine andere verraten. Einer anderen etwas weggenommen. Es tat weh, aber zugleich tat es auch gut, weil Tora mit ganzem Herzen fühlte, dass endlich eine war, die Verständnis hatte, die Brücken bauen wollte. Ohne sich darum zu kümmern, was die Leute taten oder sagten oder entschieden. Ohne darauf zu achten, was geschah. Brücken zwischen ihnen, die am Ende ja aus eigener Kraft stark sein mussten. Stark genug! Rakel wollte nicht allein dastehen und stark sein, wie die Mutter es wollte. Rakel wollte Menschen um sich haben, die sie gern hatte. Gegen all das Schlechte. Auch wenn es schwierig werden könnte, so dass sie das eine Mal stark sein und ein anderes Mal weinen musste. Menschen, die sie gern hatte? Ja. Aber wollte das die Mutter nicht auch? Hatte sie ihn … nicht gern? War das der Grund? War das der Grund für alles? Liebte die Mutter ihn mehr, als sie Rakel und Tora liebte? Ja!
So musste es sein.
Tora schlich hinaus und nahm den schwarzen Regenmantel, bei dem das unterste Knopfloch ausgerissen war. Sie hatte den Riss mit einem Pflaster zugeklebt. Aber das Pflaster fiel jedes Mal ab, wenn es nass wurde. Und nass wurde es ja immer wieder.
Tora lieferte dem »Konfirmanden« ihr Aufsatzheft ab. Den Spitznamen hatte der junge neue Lehrer von Almar bekommen. Er teilte seine Erziehertätigkeit und die Kinder mit Gunn. Almar fand es gar nicht gut, dass er gekommen war und aus Oslo stammte und so eigenmächtig handelte. Almar hatte den Eindruck, dass er sich der verehrten Lehrerin Gunn geradezu aufdrängte. Außerdem war er kein richtiger Mann. Farblos – und schmächtig, wie ein Konfirmand. Piepsstimme, bartlos.
Tora hatte einen Aufsatz über die Frage geschrieben, was sie später werden wollte. Vierundzwanzig Zeilen hatte sie in einer ganzen Stunde zuwege gebracht. Dieser Tag war nicht irgendein Tag. Er hatte nichts, woran sie sich festhalten könnte.
Tora ging erst spät am Nachmittag nach Hause, sie trödelte im Dorf herum, bis sie sicher sein konnte, dass die Mutter in die Frosterei gegangen war.
Sie bummelte noch am Strand entlang und war schließlich ganz durchnässt. Als sie durch die zwei Eingangspfosten kam, die weder einen Zaun noch ein Tor hatten, sah sie, dass die Lampen im Tausendheim bereits brannten.
In allen Treppenaufgängen roch es nach gebratenem Hering. Die Haustüren standen offen. Drei schlagende Türen im Regen. Geruch nach Hering und Kartoffeln. Also waren die Männer zu Hause. Der Hof war leer. Tora konnte sie alle drinnen im Haus sehen. Ihre Schatten. Vater und Mutter und Kinder. Oder einsame Gebeugte … In Toras Fenster war es dunkel.
Kein Heringsgeruch in der Küche. Aber noch Glut im Ofen und die Wände wohlig warm.
Vom Morgen keinerlei Spur mehr zu sehen.
Sie streifte ihre Kleider ab und zwang sich zu dem Gedanken, dass sie der glücklichste Mensch von der Welt sei, der sich Wasser heiß machen und sich in der Küche vor dem Ofen waschen konnte. Den Nelkengeruch und alles, was schlimm war, entfernen. Es kam niemand. Die Gefahr war nicht da. Da würde sie auch alles andere schaffen. Denn sie war Tora – allein mit sich.
Manche vergaßen, die Plane über ihre alten, halbmorschen Boote zu ziehen, andere vergaßen, mit dem Handrücken über den Mund zu fahren, wenn sie gegessen hatten, einige brachten es nicht fertig, ihr wahres Ich hinter ihrem Gesicht zu verbergen.
Tora war glücklich. Niemand sah sie. Sie saß über ihren Schulbüchern. In braunen Schutzumschlägen aus dem Einwickelpapier von Ottars Laden. Sie hatte das Papier mit Zeichnungen verschönert. Aber das Papier hatte Rillen, die nicht zu verdecken waren. Sie verliefen quer durch die Zeichnungen. Es sah aus, als ob man mit den Nägeln darübergekratzt hätte.
Sie hatte das Aufsatzheft vom »Konfirmanden« sofort zurückbekommen. Er hatte gesagt, dass er enttäuscht von ihr sei. Ja, sicher. Sie war auch enttäuscht.
Was wollte sie werden, wenn sie erwachsen war? Sie würde wohl Treppen putzen, in die Frosterei gehen, Kinder hüten und Milch holen.
Nein! Sie würde Decken sticken, in einem Büro sitzen und einen Mann anlächeln, wenn sie die von der Haushaltshilfe gekochte Mahlzeit verzehrten. Dann würden sie sich mit einer Serviette den Mund abwischen und die ganze Zeit lächeln. Nein! Sie wollte reich sein! Sie wollte hinaus in die Welt ziehen und eine berühmte Schauspielerin oder Schriftstellerin werden. Königen und Königinnen begegnen und in einem großen Schloss wohnen oder in schönen Hotels, wo es Kronleuchter gab, die von Millionen von Kristallen funkelten. Sie wollte Flöte spielen, vor vollen Sälen mit gepolsterten Wänden und einem roten Licht über der Tür, wie sie es einmal im Kino gesehen hatte. Sie wollte das Klatschen hören, wenn die letzten Töne noch wie eine dünne Haut über den Menschen unten in der Dunkelheit lagen. Dann wollte sie lange Briefe und glitzernde Postkarten nach Hause schicken, an Mutter, Onkel und Tante, an Gunn und Frits und Sol – und von allem erzählen. Und sie würde ihnen Schallplatten schicken, die sie eingespielt hatte. Manchmal, wenn der Mond schien, würde sie alle Einladungen ablehnen und allein bleiben. Dann würde sie nur für sich selbst spielen. Oder ganz still dasitzen und Heimweh haben. Sie wollte hohe Kerzen in goldenen Leuchtern haben, wie in der Kirche, und Sol würde ihr leidtun, weil sie es nie so gut haben würde wie – Tora, obwohl Sol es verdient hätte, sie, die so lieb war. Nur selten würde Tora nach Hause fahren. Die Leute sollten bei Ottar im Laden stehen und für Weihnachten einkaufen und sich fragen, ob Ingrids Tochter zu den Feiertagen wohl nach Hause kommen werde. Und sie sollten darüber reden, wie glücklich Ingrid sei, dass ihre Tochter es so weit in der Welt gebracht hatte. Und sie sollten darüber reden, dass es wohl das Beste gewesen sei, dass er im Gefängnis gestorben war. Aber das alles konnte sie dem »Konfirmanden« nicht im Aufsatz schreiben.
Es zischte in dem Wasserkessel, den Tora warm hielt, bis die Mutter aus der Frosterei kam. Die Frikadellen vom Vortag lagen bereit. Die vier übrig gebliebenen kalten Kartoffeln hatte sie in Würfel geschnitten. Die Pfanne stand mit einem Klecks Butter auf dem Küchenschrank und brauchte nur auf das mittlere Herdloch gestellt zu werden.
Sie hatte den Geruch schon in der Nase. Er war weder schlecht noch gut. Aber sie wollte der Mutter sagen, dass sie bereits gegessen habe. Sie wollte in ihrer Kammer bleiben und die Mutter allein lassen, wenn sie sich wusch und aß. Wollte sich abseits halten – damit die Mutter mit ihren Gedanken zur Ruhe kam. Nachher konnte sie den Tisch abräumen, wenn die Mutter sich auf der Couch ausruhte. Heute wollte sie besonders nett sein, denn sie wusste nicht, was die Mutter für ein Gesicht machen würde, wenn sie heimkam. Das wusste sie sonst immer. Die Mutter war immer gleich. Besonders jetzt, wo er fort war. Seit vielen Wochen war es nur das eine Gesicht gewesen. Grau, aber wunderbar ruhig. Kein hartes Wort, kein Schatten, kein ängstliches Lauschen auf seine Schritte auf der Treppe. Aber an diesem Morgen hatte Rakel in der Küche gestanden und geweint. Und es war nicht sicher, dass die Mutter heute die Gleiche war. Vielleicht hatte sie ein ganz anderes Gesicht, als Tora sich das vorstellen konnte. Vielleicht würde alles noch viel schlimmer … Oder besser! Sie stellte sich vor, wie Tante Rakel die Mutter dazu gebracht hatte, sich wieder zu vertragen. Wie Tora und die Mutter wieder wie früher nach Bekkejordet gingen. Dass sie den Küchenläufer mitnehmen könnte … Sie hatte ihn gewaschen und gebügelt und ihn um die Illustrierte gerollt. Damit er schön glatt blieb. Aber der Mutter hatte sie ihn nicht gezeigt. Sie hatte ihn nur gewaschen und gebügelt, so vorsichtig wie möglich, weil sie Angst hatte, dass die Ränder zu sehr ausfransten. Die Tante würde wohl die schone goldene Borte daran nähen. Sie hatte sie ihr gezeigt und gefragt, ob sie nicht gut passte, und Tora hatte Ja gesagt. Das hätte noch gefehlt, dass sie den Läufer verdorben hätte – wo er so schön war. »Was ich werden will, wenn ich erwachsen bin …« Tora sollte jetzt einen neuen, besseren Aufsatz schreiben. Sie sah auf die Uhr. Fünf Minuten nach sechs. Dann schrieb sie zwei Seiten, dass sie gerne in einem Büro arbeiten würde. Sie schrieb, dass sie sich ein Haus und ein Fahrrad kaufen würde. Erwähnte nichts von Flötespielen oder Kronleuchtern, von Bühne oder Glanz. Das wäre zu dumm. Der »Konfirmand« würde es nicht verstehen. Er würde nur wieder enttäuscht sein.
Sie schrieb den Aufsatz mit ihrer schönsten Schrift ins Reine. Schrieb nicht schnell, damit sie genügend Zeit hätte, gründlich nachzudenken und jedes Wort richtig zu schreiben. Dann brauchte sie nichts zu verbessern.
Als sie fertig war, zeichnete sie eine schöne Dame auf die halbe Seite, die noch frei war, weil sie die Überschrift mit so großen Buchstaben geschrieben hatte, dass der Aufsatz mitten auf der Seite endete. Die Dame hatte eine schmale Taille und gelockte Haare. Der Rock war genau wie der in Ottars Fenster blau, mit einer glatten Passe und mehreren tiefen Falten. Die Schuhe hatten hohe Absätze und sahen verkehrt und blöd aus. Tora konnte keine Füße und keine Schuhe zeichnen. Es war schwierig. Am besten ging es mit den Gesichtern. Sie zeichnete die Nasen und Stirnen und Münder von der Seite. Sie hatte die Bilder in den Zeitschriften studiert und herausgefunden, wie man es machen musste.
Alle Damen, die sie zeichnete, waren schön. Sie wusste nicht, warum. Denn sie sah fast nie eine schöne Dame. Jedenfalls nicht hier im Dorf. Sie neigte den Kopf zur Seite und stattete die Dame noch mit einer Handtasche aus. Speziell für den »Konfirmanden«! Sie würde die Zeichnung Sol zeigen. Da hätten sie was zu lachen.
Aber Sol war nicht da, als sie nach oben ging. War zusammen mit einem Mädchen aus dem Ort fortgegangen. Mit einer, die viel älter war als Tora.
Elisif sagte, dass es keine göttliche Fügung sei, dass sie sich draußen in der Dunkelheit herumtrieben, wo die Versuchungen überall lauerten – und sie ermahnte Tora zu einem sauberen Leben und dass sie ihrer Mutter keine Sorgen und schlaflosen Nächte bereiten solle wie Sol. Tora lief mit ihrem Aufsatzheft unter dem Arm schnell wieder nach unten. Sie spürte den Durchzug von der offenen Haustür her und hörte die Mutter die Treppe heraufkommen. Mit leichten, langsamen Schritten. Es waren Mutters Schritte. Tora sah es sofort, als sie die Küche betrat: Das Gesicht war wie immer.
Die Mutter fragte, ob sie mit den Aufgaben fertig sei. Zerstreut. Wie gewöhnlich.
Tora sagte: »Ja.« Wagte nicht, ihre Freude in dieses kleine Wort zu legen. Noch konnte alles Mögliche passieren.
Dann wärmte sie das Essen auf und die Mutter zog sich aus und hängte die Kleider auf.
Sie wusch sich drinnen in der Stube mit warmem Wasser. Mit warmem Wasser! Sie blieb ganz lange da drinnen. Als sie herauskam, hatte sie glatte Wangen, und die Augenbrauen und Wimpern waren noch ganz feucht. Auch die Haare um das Gesicht. Sie hatte sich fein gemacht und einen sauberen Pullover angezogen und den alten guten Rock. Den sie als guten getragen hatte, bevor sie sich das Kleid genäht hatte … Tora hielt die Luft an.
»Ich hab gedacht …« Ingrid schnitt sich vorsichtig ein Stück von der Fischfrikadelle ab. »Ich hab gedacht, wir könnten heut Abend einen Spaziergang nach Bekkejordet machen … Es ist der 27., weißt du … Die Tante hat Geburtstag …«
Die Stimme kam von einem verletzten, aber geborgenen Seevogel. Tora flog. Merkte kaum, was sie tat. Sie flog zum Tisch hin und warf sich in Ingrids Schoß, Arme und Beine weit von sich gestreckt.
Der Teller mit den Frikadellen und den Bratkartoffeln rutschte über die Wachstuchdecke. Das Wasserglas fiel um. Tora merkte, wie sie zwischen Pullover und Hosenbund nass wurde. Aber gleichzeitig merkte sie es auch nicht.
Ingrid stellte mit der einen Hand das Glas hin und strich mit der anderen Tora über den Rücken. Das Mädchen hatte einen ganz nassen Rücken. Es rieselte und tröpfelte auch in Ingrids Schoß. Aber sie blieb sitzen. Hatte etwas in ihrem Gesicht … etwas Nacktes, Hilfloses. Niemand sah es.
Tora hatte den Kopf an Mutters Brust vergraben. Sie nahm die seltsame Mischung von Fischgeruch und Seife wahr. Diesen Geruch kannte sie von klein auf. Konnte sich auf einmal erinnern, dass sie früher auch schon so gesessen hatte. So gesessen, wenn die Mutter ihre Schürfwunden auswusch. Und das Weinen war leiser geworden. Oder wenn sie kein Geld hatten, um etwas Neues für Weihnachten zu kaufen. Das letzte Mal hatte sie so gesessen, als sie Masern und Fieber gehabt hatte. Das war wirklich lange her.
6
Rakel deckte im Wohnzimmer festlich den Tisch. Der schwere Messingleuchter mit sieben roten Kerzen thronte mitten auf der selbstgewebten Decke – und das beste Service hatte sie hervorgeholt. Sie deckte für vier.
Simon hatte seinen blauen Anzug an und schenkte drei Gläser Schnaps ein, die er auf das blankgeputzte Silbertablett stellte. Er war gut erzogen, dieser Simon. Die Tante, die sich um ihn gekümmert hatte, seit er als Baby seine Mutter verloren hatte, war wohlhabend gewesen. Simon war trotzdem Simon. Und da sie ein wenig auf die Gäste warten mussten, ging er hinaus in die Küche und fragte, ob das mit dem Jackett unbedingt nötig sei. Es sei doch mitten in der Woche …
»Ich werd heut fünfunddreißig!« Rakel reckte sich und stemmte die Hände in die Seiten. »Ich pfeif auf einen Mann, der an einem solchen Tag nicht die Jacke anbehalten kann, auch wenn’s mitten in der Woche ist.«
Simon stieß einen langen Pfiff aus und ging ins Wohnzimmer zurück. Er nahm einen gierigen Schluck aus einem Schnapsglas und füllte nach. Sonst war er vorsichtig mit Alkohol.
»Wie hat sie’s aufgenommen – eigentlich?« Er rief es zu Rakel in die Küche hinaus.
»Das hab ich dir doch gesagt.«
»Du hast gesagt, dass sie kommen soll. Und dass sie das auch versprochen hat. Aber ihr habt doch noch mehr geredet …«
Rakel erschien in der Tür, während sie die Schürze auszog. Das kleine Gesicht war ernst, beinahe puppenhaft. Ganz verändert, seit er wegen der Jacke gefragt hatte.
Simon wurde niemals schlau aus Rakels verschiedenen Ansichten und Reaktionen. Sie war wie ihre gewebten Stoffe, wenn sie schnell über den Fußboden ausgerollt wurden. Die Farben und die Muster wechselten so rasch, dass man nicht folgen konnte. Er half ihr, so gut er konnte. Setzte vorsichtig rohe Muskelkraft ein. Im Übrigen mischte er sich nicht in ihre Arbeit ein, wenn sie ihn nicht darum bat.
Aber jetzt wollte er sich einmischen. Glaubte, dass er erfahren müsste, wie Ingrid es aufgenommen hatte, damit er ihr an der Tür nicht wie ein Narr entgegenzutreten brauchte und nicht wusste, ob da Freund oder Feind kam.
»Sie hat’s wohl sehr schwer gehabt …«
Rakel setzte sich in den Schaukelstuhl, hinten bei dem alten lackierten Klapptisch. Strich mit schmalen, behutsamen Händen über die Tischplatte. Glättete die Decke – immer wieder, ohne zu wissen, was sie tat.
»Ja, aber das hast du doch auch.«
»Für mich ist das nicht schlimm. Ich hab doch dich …«
»Nun … das ist ja wahr … aber … Ja, hat sie nichts gesagt?«