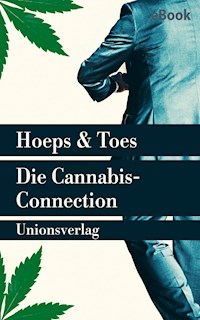12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Erst ein Jahr arbeitet Marie Vos bei der Anti-Betrugseinheit der EU in Brüssel, aber ihre Erfolge bringen ihr schon einen Karrieresprung ein: Die Security-Abteilung rekrutiert sie für einen Spionagefall in der hart umkämpften Wasserwirtschaft, der den Abschluss eines Vertrags in Tallinn gefährdet. Wirtschaftsspionage, außereuropäische Geheimdienste, ein Inside-Job? Schon die erste Festnahmeaktion wird auf rätselhafte Weise vereitelt, und in Estland tauchen skrupellose Gegner auf. Undercover reist Marie Vos mit dem internationalen Verhandlungsteam nach Tallinn, während ihr Geliebter in Brüssel heimlich auf eigene Faust ermittelt. Ein Thriller über ein gefährdetes Europa am Rande eines zweiten Kalten Krieges und das verhängnisvolle Zusammentreffen politischer und persönlicher Interessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
In Brüssel wird Marie Vos von der Security–Abteilung der EU zu Ermittlungen in einem Spionagefall angefordert, der den Abschluss eines wichtigen Vertrags in Tallinn gefährdet. Undercover fliegt Marie als Mitglied des internationalen Verhandlungsteams nach Estland. Wer spielt hier falsch?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Thomas Hoeps (*1966) promovierte über Terrorismus in der deutschen Literatur. 1997 veröffentlichte er seinen Debütroman Pfeifer bricht aus, es folgten Gedichte, Erzählungen und ein Theaterstück. Er erhielt u. a. den Literaturförderpreis der Stadt Düsseldorf und den Nettetaler Literaturpreis.
Zur Webseite von Thomas Hoeps.
Jac. Toes (*1950 in Den Haag) lebt und arbeitet als freier Gerichtsreporter in Arnheim. Nach dem Studium der Niederländischen Literatur war er als Lehrer tätig, bis er sich ganz dem Schreiben widmete. Er wurde u. a. mit dem niederländischen Krimipreis Gouden Strop ausgezeichnet.
Zur Webseite von Jac. Toes.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Englische Broschur, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Hoeps & Toes
Der Tallinn-Twist
Thriller
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Das Autorenduo Hoeps & Toes arbeitet seit Jahren Hand in Hand. Thomas Hoeps schrieb seine eigenen Kapitel auf Deutsch und übersetzte die von Jac. Toes auf Niederländisch geschriebenen Kapitel ins Deutsche.
Lektorat: Susanne Gretter
Niederländische Ausdrücke und Redewendungen sind im Anhang erläutert.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: SunFlowerStudio (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31108-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 04:10h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER TALLINN-TWIST
1 – Taxi!«2 – Marie kannte Söderberg kaum. Er war nur einen …3 – Marie und Söderberg stiegen in den Lkw der …4 – Als Marie nach kaum vier Stunden Schlaf und …5 – Route 102«, lautete die ultrakurze Antwort der Rezeptionistin …6 – Am nächsten Morgen hatte Söderberg ihren Bericht zum …7 – Im Herenhuis herrschte eine wohltuende Stille. Sie verdankte …8 – Der Taxifahrer musste denken, dass sie etwas geraucht …9 – Mann, er hätte natürlich einen Ring dazu packen …10 – In Tallinn herrschte heftiges Schneetreiben bei fünf Grad …11 – Am nächsten Morgen saß Marie um halb acht …12 – Draußen stoben nur noch vereinzelte Schneekristalle durch die …13 – Bevor sie begriff, was sie aus dem Schlaf …14 – Die Bank mit den abgeschabten rostbraunen Hartplastikschalen …15 – Die zwei Männer mussten sich hinter einem Transporter …16 – Der Rotwein sorgte immer noch für ein wohliges …17 – Estland ist ein großes Dorf, Tallinn der Dorfplatz …18 – Hey Mann, wenn mich nicht alles täuscht …19 – Hatte sie zu bitchy reagiert? Vielleicht. Aber es …20 – Marie war ihm schon wieder entwischt21 – Kurz vor der Mittagspause legte Söderberg Maries Bericht …22 – Marie hatte es sich nicht so leicht vorgestellt …23 – Das »La Table de Mo« im angesagten und …24 – Alles okay, Beatriz?«, rief Marie, als sie den …25 – Sie hatte es so lange wie möglich hinausgezögert …26 – Irgendwann war es ihm zu viel geworden …27 – Einige Minuten lang war in Laars guter Stube …28 – Am Sonntagmorgen erhielt Marie einen Anruf von Söderberg …29 – Marie, Giuliani und Kiisler warteten schon seit über …30 – Didi war ein echter Freund. Ein Pfundskerl …31 – Eine halbe Stunde später bog Berend auf die …32 – Und wieder erwies sich Didi als ein echter …33 – Und wenn jetzt auch wir zur Zielscheibe einer …34 – Der muss es sein«, sagte Berend35 – Marie zog unwillkürlich den Kopf zwischen die Schultern …36 – Auf der Pritsche hockten zwei gedrungene Gestalten mit …37 – Die frostige Atmosphäre in dem Konferenzraum, in dem …38 – Marie war früh aufgestanden, um noch einmal in …39 – Henrik Laar hatte sich im Foyer zwischen zwei …40 – Gegen Mittag wurde sie von lauten Rufen aus …41 – Sie musste raus aus dem Hotel, weg von …42 – Hallo! Hallo!«, rief eine Stimme immer wieder …43 – Die Taskforce war nur noch ein Schatten ihrer …44 – Was Arroganz und Machtgehabe betraf, stand Artur Jalakas …45 – Giuliani hatte ihren Zorn im Zaum gehalten …46 – Hatte er Marie schon verloren? Oder schlimmer …47 – Sie blieb eine Weile wie betäubt liegen …48 – Vielleicht ist es ja meine Henkersmahlzeit«, kommentierte Christian …49 – Sie hocken natürlich alle zusammen. In einer ihrer …50 – Es war kurz vor halb neun abends …51 – Nein, mein Herr, Mr Nachtwey ist nicht auf …52 – Manchmal haben eben auch Arbeitstiere Massel, stellte Berend …53 – Der Bildschirm tat ihr nicht den Gefallen …54 – Es hatte sie zehn verzweifelte Minuten gekostet …55 – Marie war wohl doch ordentlich geschockt gewesen von …56 – Die Stella Grande hatte acht Decks, von denen …57 – So ein Mist, dass er Nachtwey aus den …58 – Es war hoffnungslos. Sie war pausenlos herumgelaufen …59 – Sie zitterte, und sie schämte sich. Sie hatte …60 – Sie standen im hintersten Winkel des großen Festsaals …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Hoeps & Toes: Ein kompensierendes Autorenduo
Über Thomas Hoeps
Über Jac. Toes
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Thomas Hoeps
Bücher von Jac. Toes
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Niederlande
1
Taxi!«
Marie Vos hatte die Drehtüren des Flughafens Zaventem kaum hinter sich gelassen, da winkte sie schon hektisch. Vom Gate an hatte sie sich eine Dreiviertelstunde lang eingezwängt in einer Kolonne von Reisenden vorangequält, um endlich nach draußen an die frische Luft zu kommen.
Deutlich zu frisch. Am Aeroporto Salento in Brindisi hatte sie auf der Terrasse bei Cappuccino und einem honigsüßen Cornetto noch die Februarsonne genießen können, doch in Belgien machten sich eiskalte Windböen sofort daran, ihr den dünnen Regenmantel vom Leib zu zerren.
Über eine Woche lang hatten sie im Süden Italiens in einer Betrugssache ermittelt. Mit Erfolg. In ihrer Tasche steckten die Haftbefehle und Vernehmungsprotokolle von drei Universitätsdozenten aus Bari. Sie hatten eine EU-Subvention in Höhe von 3,8 Millionen Euro für ein Softwareprogramm namens »Volare« an Land gezogen, mit dem man unter Einsatz von Drohnen den Befall von Olivenbäumen mit dem Xylella-Bakterium im Frühstadium erkennen wollte. Danach sollten rund fünfzig Wissenschaftler aus mehreren EU-Ländern mit einer tiefgreifenden Bodenbehandlung den Kampf gegen diesen Killer aufnehmen.
Unzählige Bauern in Süditalien, die hilflos zusehen mussten, wie ihre jahrhundertealten Olivenhaine zugrunde gingen, sahen in dieser Rettungsaktion ihre letzte Hoffnung. Allerdings war das ganze Projekt von Anfang bis Ende ein einziger Schwindel, und die drei Dozenten hatten die Fördermittel vor allem in eine besonders ausgeprägte Version des dolce vita investiert.
Es war schon der dritte große Fall, den Marie erfolgreich abschließen konnte, seit sie vor kaum einem Jahr den Job als freie Politikberaterin hingeworfen und bei der Europäischen Kommission in Brüssel angeheuert hatte. Mit ihren Erfahrungen, die sie beim niederländischen Inlandsgeheimdienst AIVD gesammelt hatte, war sie im Office Européen de Lutte Antifraude, kurz OLAF, mit Kusshand genommen worden. Seitdem beschäftigte sie sich im Direktorat C, Abteilung 3, mit Korruption und Subventionsbetrug.
Der Glamourfaktor ging gegen null, es war viel Puzzlearbeit, und sie hatte auch schon schmerzhaft erfahren müssen, wie langsam die Mühlen der Verwaltung im Anschluss an ihre Ermittlungen mahlten.
Als sie endlich im Taxi saß, rief sie sofort ihren Ansprechpartner in der Abteilung Media & Publicity an, einen jungen Italiener, dem sie schon einige Scoops verschafft hatte. »Hey ragazzo!«, begann sie jovial. »Ich habe da ein hübsches Goldnugget für dich, kommt sogar aus deiner kriminalitätsfreudigen Heimat. Du kannst es gerne an die Agenturen rausschicken. Mit Erfolgsgarantie, Signor.«
»Nur die Kurzfassung, bitte«, antwortete er mit einem tiefen Seufzer.
Er klang so lustlos, dass sie vermutete, er schäme sich wirklich wegen der ständigen Mafia-Vorwürfe. Trotzdem informierte sie ihn in aller Ausführlichkeit über die Erfolge, die das OLAF in Lecce und Umgebung erzielt hatte.
Einen Moment lang herrschte Stille in der Leitung.
»Komm schon«, sagte sie. »Das ist ein First-Class-Scandalo. Damit bringst du es in die italienische Presse.«
»Hast du das schon mit deiner Abteilungsleiterin besprochen?«
»Du bist der Erste.« Sie wunderte sich über seine Zurückhaltung.
»Dann haben wir ein Problem. Pressemitteilungen sind neuerdings exklusive Domäne der Abteilungsleitung.«
Marie dachte kurz nach. Ging es darum, dass ihre Chefin die Lorbeeren für den Erfolg einheimsen sollte? »Und wer hat das veranlasst?«, fragte sie.
»Neue Hausregel, ist nicht persönlich gemeint. Also hol dir erst ein Go von der Abteilungsleitung. Danach geht der Text zum Übersetzungsbüro. Und von dort natürlich rapidamente weiter zu Republica, Corriere, Raiuno …«
»Welcher Text?«, unterbrach sie ihn.
»Der, den deine Vorgesetzte uns dann schickt«, sagte er. »Scusa, Marie, aber ich muss wieder an die Arbeit. Hier herrscht Ausnahmezustand. Überall in der Stadt tanzen Demonstranten aus halb Europa in Teichen und Springbrunnen umher, und selbst hier jagen sie gerade mit Feuerwehrschläuchen Wasser auf unsere Fenster. Eine Reverenz an den ›Protest der zwölf Bürgermeister‹ heute vor einem Jahr, bei dem zwei Demonstranten ums Leben kamen. Der Protest richtete sich gegen die Profitgier bei der Privatisierung der Wasserversorgung, und jetzt wollen die wissen, was die EU seitdem dagegen unternommen hat. Die Journalisten in ihrem Schlepptau legen mir mit ihren Anrufen alle Leitungen lahm. Ich muss weiter! Arrivederci, Marie.«
Noch bevor sie etwas sagen konnte, hatte er die Verbindung unterbrochen.
Es war lächerlich, dass die Früchte ihrer Arbeit plötzlich auf den langen Weg durch die Institutionen geschickt werden sollten, aber so war das nun mal mit der EU. Damit nicht noch mehr Zeit verloren ging, beschloss sie, die Pressemitteilung noch heute zu schreiben. So ein Mist, es war schon nach sechs, ihren faulen freien Abend konnte sie vergessen.
Mit einem Mal ruckte sie abrupt nach vorn, der Sicherheitsgurt schnitt sich schmerzhaft in ihre Schulter. Der Fahrer hatte eine Notbremsung eingelegt und murmelte fluchend vor sich hin. Weil die Autos vor ihm nicht wieder in Gang kamen, stieg er aus, um nachzusehen, was da los war.
»Wir kommen hier nicht weiter«, sagte er, während er sich auf seinen Sitz zurückfallen ließ. »Da blockieren ein paar Irre den Kreisverkehr. Sie sind schon seit heute Mittag unterwegs. Überall dort, wo es Springbrunnen gibt, legen sie den Verkehr lahm. Idiotenpack!«
»Shit.« Marie öffnete nun ihrerseits die Tür und schaute sich um.
Der Mann hatte recht. Am Kreisverkehr herrschte das blanke Chaos. Die Autos standen dicht an dicht und blockierten die Bürgersteige. Von allen Seiten gingen Schimpfkanonaden über ein gutes Dutzend junger Leute nieder, die auf dem Kreisel rund um den Springbrunnen eine Art Tanzperformance aufführten. Einige von ihnen entfalteten große blau gefärbte Tücher und zogen sie durch die Luft wie Wellen, in die einige der Tänzer eintauchten. Zwei Demonstranten waren auf den Sockel zu einem fröhlichen Wasserspeier geklettert und hielten ein Transparent hoch, auf dem zwischen Fotos von einem alten Mann und einem Mädchen der Spruch »Our Water – Our Right« geschrieben stand.
Ihr Handy klingelte. Sie warf einen schnellen Blick auf das Display. Es war Niklas Söderberg, ihr früherer Chef bei OLAF. »Moment«, meldete sie sich und stieg wieder ein.
Er fragte gar nicht erst, ob sein Anruf ungelegen kam. »Deine Erfolge haben sich bis zu unserer Security-Abteilung bei Human Resources herumgesprochen«, fing er an. »Wir hätten dich darum gerne bei einem neuen Fall im Team. Ich hab schon mit deiner Chefin gesprochen. Sie gibt dich dafür frei. Widerstrebend natürlich.«
»Die Security-Abteilung?«, wiederholte sie.
Was wollte Söderberg von ihr? Sie war keine Agentin, auch wenn sie beim Niederländischen Geheimdienst das Basisausbildungsprogramm und pflichtgemäß ein paar Selbstverteidigungskurse absolviert hatte. Aber sonst hatte sie nur am Schreibtisch gearbeitet. Und auch in ihrer Freelancer-Zeit, in der sie für Politiker die Kastanien aus dem Feuer holte, hatte sie sich tunlichst von Polizei, Geheimdienst und dergleichen ferngehalten.
»Deine Chefin war mir noch einen Gefallen schuldig«, sagte Söderberg ungeduldig, weil er ihr Schweigen als ein Zweifeln interpretierte.
»Worum gehts denn?«
»Hast du mitbekommen, was heute in der Stadt los ist? Unser Fall hat damit zu tun. Die EU hat vor ein paar Monaten eine Taskforce eingesetzt, um in Estland in Sachen Wasserversorgung ein Pilotprojekt zu starten. Sie soll in Tallinn dazu beitragen, dass ein privatisierter Wasserbetrieb wieder in städtische Hände gelangt. Aber jetzt ist dort ein massives Sicherheitsproblem aufgetaucht … Details folgen später.« Er nannte ihr eine Adresse und forderte sie auf, sich sofort auf den Weg zu machen.
»Kein Problem«, sagte sie. »Ich bin in fünfzehn Minuten da.«
»Neues Ziel«, ließ sie den Chauffeur wissen. »Ecke Rue du Bailli und Rue de Livourne.«
»Ist da nicht eine Polizeistation … Sechstes Revier?«, antwortete er plötzlich misstrauisch.
»Absolut. Aber solange Sie mich da schnell genug abliefern, wird Ihnen nichts geschehen«, sagte sie und grinste.
2
Marie kannte Söderberg kaum. Er war nur einen Monat lang ihr Chef gewesen, gleich zu Beginn ihrer EU-Karriere. Sie hatte sich ziemlich zusammenreißen müssen, um sich an einen Job im öffentlichen Dienst und insbesondere an das Arbeiten unter einem Vorgesetzten zu gewöhnen. Söderberg hatte sie durch das Brüsseler EU-Labyrinth gelotst, bis er OLAF verließ, um die Operations-Abteilung im Direktorat Sicherheit zu übernehmen.
Er stand vor dem Eingang zum Sechsten und zog an einer Zigarette, die er wegwarf, als er sie aussteigen sah.
»Bien étonnées de se retrouver …«, begann sie, aber Söderberg unterbrach sie sofort.
»Die Leitsprache heute Abend ist Englisch«, sagte er. »Steig ein, die Operation läuft bereits.«
Während der Fahrer sich durch den dichten Verkehr kämpfte, weihte Söderberg sie in den Fall ein. »Heute Abend wird eine Spezialeinheit der belgischen Polizei einen gewissen Dennis Bahr festnehmen. Er hat jahrelang für verschiedene Parlamentsmitglieder als Assistent gearbeitet, aber seit ein paar Monaten gehört er dieser Taskforce für die Neuordnung der Wasserwirtschaft an. Vor Kurzem hat er die Seiten gewechselt. Die Gründe dafür kennen wir nicht. Und wir wissen auch noch nicht, zu wem er übergelaufen ist. Aber unsere Cyberabteilung hat entdeckt, dass er eine Backdoor zum internen Netz aktiviert hatte, durch die alle Geheimnisse der Taskforce nach draußen geschleust wurden. Daraufhin haben sie ihm mithilfe einiger manipulierter Protokolle eine digitale Falle gestellt, und Bahr ist brav hineingetappt. Wir werden ihn gleich im Parc de Pede verhaften und mit ihm zum Sechsten zurückrasen, wo du ihn verhören wirst.«
»Warum ich?«, fragte sie überrascht.
»Du hast für den niederländischen Geheimdienst gearbeitet, bist eine spezialisierte Juristin und hast hinreichend Erfahrung im Umgang mit delikaten politischen Angelegenheiten. Reicht das nicht? Eigentlich wollte ich dich ja schon letztes Jahr fragen, ob du mit mir zur EU-Security wechseln willst, aber damals warst du noch vollauf damit beschäftigt, dich bei OLAF umzuschauen. Ich schätze aber, du hast dort inzwischen alles gesehen, was von Interesse ist.«
»Bin ich damit offiziell abgeordnet?«
»Betrachte die Mission als Assessment. Hinterher kannst du immer noch ablehnen.«
»Und wo ist der Haken bei der Sache?«
Über Söderbergs Gesicht glitt ein müdes Lächeln. »Wenn wir Bahr heute Abend die Handschellen anlegen, können wir das wohl trotzdem nicht als Erfolg verbuchen. Wir haben ihn wochenlang als Lockvogel eingesetzt, aber bis jetzt hat niemand den Köder schlucken wollen. Seit wir ihn observieren, konnten wir keinen einzigen verdächtigen Kontakt feststellen. Heute Mittag haben wir den Druck noch einmal erhöht. Wir informierten Francesca Giuliani, die Leiterin der Taskforce, per Mail, dass wir Bahr heute Abend verhaften werden. Damit wir sicher sein konnten, dass Bahrs fremde Dienstherren die Mail auch lesen, haben wir sie als ›streng vertraulich‹ markiert. Wir gingen davon aus, dass sie ihren Mann ganz schnell von der Front abziehen würden. Aber leider folgt er immer noch seinen üblichen Routinen; vollkommen ahnungslos, welches Schicksal ihn in der nächsten Viertelstunde erwartet.«
Als sie endlich die Place de l’Albertine passiert hatten, stellte der Fahrer die Scheibenwischer auf die höchste Stufe und gab Gas. Söderberg klappte sein Laptop auf.
»Warum sollte Bahr gerade mir anvertrauen, an welchen Teufel er seine Seele verkauft hat?«
Söderberg wischte ihre Frage mit einer Handbewegung beiseite und tippte mit dem Fingernagel auf das Display. »Dieser weiße Punkt, das ist Bahr, sie haben ihm einen Peilsender verpasst. Er ist ein passionierter Läufer. Trainiert dreimal pro Woche. Auch jetzt, während wir sprechen. Die DSU wird ihn gleich verhaften.«
Marie sah ihn fragend an.
»Das belgische Spezialeinsatzkommando. Eigentlich eine Nummer zu groß für Bahr. Aber er soll gleich begreifen, wie ernst die Lage ist.« Er vergrößerte das Bild auf seinem Laptop. »Er läuft jetzt die Zakstraat entlang, zwischen Itterbeek und Sint Anna Pede. Der rote Punkt dahinter, das ist einer von unseren Leuten.«
Marie sah eine fast ländliche Gegend mit Äckern und Feldern, an deren Rand der Park lag. Das ganze Gebiet wurde von einem Labyrinth aus Straßen und Wegen durchzogen.
»Wenn Bahr macht, was er immer macht, wird er diesen Weg nehmen.« Söderberg folgte mit dem Finger einer zickzackförmigen, roten Linie. Dann verschob er den Bildausschnitt, bis einige Sportplätze auf dem Bildschirm erschienen. »Zurück zu seinem Auto, das er am Drève Olympique geparkt hat. Aber so weit wird er nicht kommen, denn die DSU wird ihn im Park aufpicken, wenn ihm die Kälte schon ordentlich zugesetzt hat und er müde und durstig ist. Genau hier …«
Er zeigte auf eine kleine Halbinsel, die in den Weiher hineinragte. Die Strecke führte direkt am Ufer entlang. Am Scheitelpunkt der Insel würde Bahr auf drei Seiten vom Wasser umgeben sein. Also blieb ihm nur ein einziger Fluchtweg, und auf dem, sah Marie, würde er ziemlich schnell von einem Graben gestoppt werden, der in einem weiten Kreis den ganzen Weiher umschloss.
»Operationell gesehen reine Routine. Es ist dort stockdunkel. Sechs Männer stürzen sich auf einen komplett ahnungslosen Mann, fesseln ihm die Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken und ziehen ihm einen Sack über den Kopf. Dann werfen sie ihn in den Bus, rasen zum Sechsten und laden ihn dort ab: vollkommen desorientiert und verängstigt.«
»Und warum ausgerechnet dort?«
»Sagen wir es so, das Sechste ist für seinen chronischen Mangel an kommunikativer Kompetenz und für eine gewisse Raubeinigkeit bekannt. Glaub mir, sobald du in den düsteren Kellerräumen des Kommissariats auftauchst, wird Bahr sich in deine Arme stürzen und dich anflehen, alle deine Fragen beantworten zu dürfen. Vor allem, wenn du ihm verrätst, dass ihn seine Auftraggeber, ohne mit der Wimper zu zucken, geopfert haben. Und dass wir ihm aber eine zweite Chance geben wollen.«
»Und was ist mit seinem Recht auf einen Anwalt?«
Söderberg sah sie einen Moment lang überrascht an, ehe er seinen Blick wieder auf den Bildschirm richtete und auf den weißen Punkt starrte. »Ich kann dir garantieren, dass alles nach belgischem Recht und im Rahmen unserer EU-Vorschriften abläuft. Sobald die offizielle Einvernahme ansteht, darf er seinen Anwalt anrufen. Heute Nacht führst du mit Bahr nur ein ganz informelles Vorgespräch«, sagte er gleichmütig.
»Also mache ich mich der Mittäterschaft bei Einschüchterung, Körperverletzung und vorsätzlichen Verfahrensverstößen schuldig?«
Söderberg schüttelte den Kopf. »Erstens: Was die Belgier machen, geht uns nichts an. Zweitens: Es wird schon nicht so schlimm werden. Und drittens: Du erscheinst ja als Bahrs Schutzengel! Und trumpfst zur rechten Zeit mit ein paar beeindruckenden juristischen Formulierungen auf.«
Marie hielt sich am Griff über der Tür fest, als der Fahrer eine rasante Rechtskurve zog. Sie schossen unter der breiten Gleisstraße eines Bahnknotenpunkts in einen Tunnel hinein, die Scheibenwischer schrappten über die trockene Windschutzscheibe.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Söderberg leise, als der Regen wieder heftig gegen die Scheibe prasselte. »Der Chef der Einheit wird persönlich vor Ort sein. Pol de Swarte, ein alter Haudegen noch aus Zeiten der ehemaligen Rijkswacht. Sollte etwas schiefgehen, würde er die Prügel einstecken. Aber er steht kurz vor der Pensionierung, also wird er alles tun, um einen Skandal zu vermeiden.«
3
Marie und Söderberg stiegen in den Lkw der Einsatzleitung, wo sie sich in einem kleinen Vorraum zunächst in eine Liste mit Namen, Uhrzeit und Unterschrift eintragen mussten. Sie warf einen schnellen Blick auf die anderen Anwesenden. Generalkommissar Pol de Swarte und sein einsatzleitender Kommandant waren schon vor ihnen eingetroffen.
Die Kommandozentrale erinnerte an einen Atombunker. Der Raum wurde nur von einer schwachen Lampe und ein paar Bildschirmen beleuchtet. Der Lkw war gut isoliert, kein Geräusch drang von außen herein, nicht einmal der Starkregen, der aufs Dach prasselte, war zu hören. Nur die Klimaanlage summte leise vor sich hin.
Pol de Swarte hatte sich eigens für seine europäischen Gäste in Uniform geworfen und stand eilig auf, um Söderberg und Marie zu begrüßen. Er entschuldigte sich für den Mangel an Luxus, holte zwei Hocker aus einem Schrank und bat sie, Platz zu nehmen. Der Einsatzleiter an den Bildschirmen drehte sich kurz zu ihnen um und murmelte seinen Namen, ehe er sich wieder den Monitoren zuwandte und sein Headset fester an den Kopf drückte. »Target-1 ist in etwa zehn Minuten am ZO«, briefte er sie. »Wir erwarten ihn dort mit sechs Mann. Bis dahin läuft nur einer unserer Jungs hinter ihm her, um keinen Verdacht zu wecken.«
Marie schaute auf den größten Monitor, auf dem grünstichige und wackelige Bilder von einem Pfad und in der Mitte ein etwas helleres Licht zu sehen waren. Der Bildschirm daneben zeigte die Karte mit den sich langsam vorwärtsbewegenden Punkten, die sie schon auf Söderbergs Laptop gesehen hatte.
»Das ist unser Alpha-1, verkleidet als Freizeitsportler«, sagte de Swarte. »Target-1 trägt ein Lauflicht, damit er im Verkehr gut zu sehen ist. Darin haben wir den Tracker versteckt.«
»Was bedeutet ZO? Und wie sind sie an das Lauflicht gekommen?«, fragte Marie Söderberg leise.
»Zugriffsort«, flüsterte Söderberg zurück. »Bahr nimmt seine Sportkleidung immer schon zur Arbeit mit. Die Sporttasche lässt er im Auto. Ich habe ihnen die Genehmigung erteilt, den Code seiner Autoschlüssel auszulesen, damit sie die Heckklappe öffnen konnten.«
De Swarte drehte sich zu ihnen um. »Drei Alphas warten auf der Ostseite des Weges auf ihn, und die drei auf der Westseite werden ihm den Rückweg abschneiden, sobald er den ZO erreicht hat. Zoom doch mal zu ihnen, Chef …«
Der Einsatzleiter verschob die Karte Richtung Weiher, an dem die beiden Einsatzgruppen als sechs rote Punkte links und rechts des eingezeichneten Weges aufleuchteten.
»Tragen sie auch Helmkameras?«, fragte Söderberg.
»Klar«, erwiderte de Swarte knapp.
Marie zeigte auf ein paar ausgeschaltete Monitore. »Und dann werden deren Bilder hierhergeschickt?«
»Dafür wären ein paar Software-Updates nötig.« De Swarte zuckte mit den Schultern. »Sparmaßnahmen … Aber die Bilder werden intern abgespeichert, und hier begnügen wir uns mit dem, was Alpha-1 sendet. Er hat unsere aktuell einzige Infrarot-Brustkamera …«
»Abstand von zwanzig Metern zu Target-1 wiederherstellen, Alpha-1«, befahl der Einsatzleiter plötzlich.
Die Bilder begannen, heftiger zu ruckeln, doch der Abstand zwischen den Punkten auf der Karte verringerte sich nicht.
»Alpha-1, Tempo!«, schnaubte der Kommandant ins Mikrofon.
»Ton, bitte«, ordnete de Swarte an.
Der Einsatzleiter drückte einen Knopf, und augenblicklich war der Raum von Alpha-1’ Keuchen erfüllt, der sich offenbar mächtig anstrengen musste, um näher an Bahr heranzukommen.
»Noch siebenhundertfünfzig Meter bis ZO«, kündigte der Einsatzleiter an. »Alphas zwei bis sieben in Position!«
Marie und Söderberg verfolgten gespannt, wie die beiden Punkte auf der Karte weiter zusammenrückten. Bahrs Umrisse auf den Live-Bildern der Brustkamera waren immer deutlicher zu erkennen.
»Gut so, Alpha-1«, sagte der Kommandant und zwinkerte de Swarte zu.
Marie beugte sich zum Monitor vor und zeigte auf Bahrs Rücken. »Trägt Bahr da etwa eine kugelsichere Weste?«
Der Einsatzleiter wechselte einen schnellen Blick mit de Swarte, ehe er das Bild heranzoomte.
Bahr hatte definitiv etwas über seine Laufjacke gezogen.
»Er wirkt auch ein bisschen stämmiger als auf unseren Fotos«, sagte Söderberg.
Der Einsatzleiter drückte ein paar Tasten, um ein schärferes Bild zu bekommen, aber gegen die Regentropfen auf dem Kameraobjektiv von Alpha-1 kam die Technik nicht an.
»Alpha-1, physischer Check von Weste Target-1.«
Der Beamte fluchte leise und beschleunigte. Marie wunderte sich, dass Bahr nichts bemerkte, aber wahrscheinlich wollte er bei diesem Regen einfach nur noch so schnell wie möglich nach Hause kommen.
»Eventuell ballistische Schutzweste«, kam es keuchend aus den Lautsprechern.
Bahr hatte jetzt den Rand des Weihers erreicht.
»Alphas zwei bis sieben, Achtung! Target-1 auf hundertfünfzig Metern zum ZO. Zugriff in fünfundvierzig Sekunden. Warnung: Target-1 eventuell vorbereitet.«
Alpha-1 hatte Bahr inzwischen so weit eingeholt, dass auch dessen Schritte zu hören waren.
»An alle Alphas, noch fünfzehn Sekunden.«
Der Kommandant lehnte sich zurück und ließ seinen Blick zwischen den Monitoren hin und her laufen.
»Alle Alphas, zehn Sekunden. Alpha-1, Abstand, verdammt!«
Über die Brustkamera war zu sehen, dass Bahr langsamer geworden war und schließlich stehen blieb.
»Alpha-1, Bericht.«
»Target-1 steht still …«, klang es gedämpft.
Bahr hatte den rechten Arm vor den Oberkörper genommen. Der Ellenbogen ging nach oben, er schien etwas aus seiner Brusttasche zu holen.
»Er zieht eine Waffe!«, rief de Swarte hypernervös. »Unschädlich machen, sofort!«
Aber sein Kommandant behielt die Ruhe, schüttelte den Kopf und starrte gebannt auf den Bildschirm. Alpha-1 stand nicht mehr als fünfzehn Meter entfernt. Seine Brustkamera bewegte sich im Rhythmus seines Atems.
»Alpha-1, Waffe schussbereit.«
Das Bild wackelte.
»Schussbereit«, bestätigte Alpha-1 fast unhörbar.
»Schussfreigabe, sobald sich Target-1 zu Ihnen dreht.«
Aber Bahr blieb mit dem Rücken zu Alpha-1 stehen, während er seine Hand zurückzog und sie ans Ohr führte.
»Target-1 telefoniert«, hieß es im Flüsterton.
»Schussbereit bleiben, Alpha-1. Alphas zwei bis sieben, Position halten.«
»Mit wem spricht er da?«, fragte Söderberg. »Was sagt die Telefonüberwachung?«
Der Einsatzleiter tippte eine Nachricht in den Computer. Ein paar Sekunden später blinkte die Antwort auf.
»Target-1 wird auf unbekanntem Gerät von unbekannter Nummer angerufen.«
Am unteren Rand des Bildschirms lief die Zeitmessung unbeirrt weiter. Zwanzig, dreißig Sekunden lang telefonierte Bahr, dann steckte er das Handy wieder in die Brusttasche und lief weiter, ohne sich umzusehen.
»Alphas, Achtung! Sechs Sekunden … fünf … vier …«
Mit einem Mal war Bahr nicht mehr zu sehen.
»Herr im Himmel …«, rief de Swarte. »Wo ist er hin?«
»Target-1 in südwestliche Richtung abgeschwenkt«, meldete Alpha-1.
Der Kommandant schaute verblüfft auf die Karte, auf der sich der weiße Punkt in einer geraden Linie direkt auf das Wasser zubewegte. Alpha-1 setzte Bahr nach, bis das Kameraobjektiv ihn wieder erfasst hatte. Mit etwas Abstand folgten die roten Punkte der anderen Alphas.
»Alpha-1, Zugriff!«, rief der Kommandant.
Alpha-1 zog massiv das Tempo an.
»Halt, Polizei!«, brüllte es durch die Lautsprecher in ihre Ohren.
Der rote und der weiße Punkt überdeckten sich schon fast, als Alpha-1 mit einem kleinen Aufschrei plötzlich abrupt stehen blieb, das Bild seiner Brustkamera wurde schwarz. Unmittelbar danach war ein lautes Platschen zu hören, und der weiße Punkt verschwand vom Bildschirm.
»Alle Alphas Zugriff!«, rief der Kommandant.
Marie hörte eine leichte Verzweiflung in seiner Stimme. Sie beobachtete, wie sich die roten Punkte entlang der Wasserkante aufreihten und stehen blieben.
»Alpha-1, Bericht!«
»Bin ausgerutscht«, kam es zerknirscht zurück. »Kontakt zu Target-1 verloren.«
»Kamera säubern, Alpha-1!«, schnauzte der Kommandant.
Die Kamera wurde gedreht, man sah die Handschuhfinger von Alpha-1, die über das Objektiv wischten, aber das Bild blieb schmierig und unscharf.
Eine Minute lang beobachteten sie, wie die roten Punkte sich wie nervöse Glühwürmchen am Ufer auf und ab bewegten, auseinanderschwärmten und wieder aufeinander zuliefen.
»Ich alarmiere die Taucheinheit«, entschied de Swarte und griff nach seinem Mobiltelefon.
Plötzlich jagte der Punkt von Alpha-1 auf das Wasser zu. Der Einsatzleiter griff zum Mikrofon. »Stopp, Alpha-1! Tauchergruppe übernimmt.«
»LED-Licht von Target-1 lokalisiert«, rief Alpha 1.
»Alpha-1, du gehst sofort zurück …«, setzte er an, doch de Swarte zog ihm das Headset vom Kopf. »Alpha-1, hier spricht de Swarte, Target-1 festnehmen.«
Marie sah gebannt zu, wie sich der rote Punkt immer weiter vom Ufer entfernte. Sie erschrak, als Söderberg ihr auf den Arm tippte. Er machte eine Kopfbewegung Richtung Tür.
»Wir gehen zum ZO«, sagte Söderberg zu de Swarte. »Geben Sie mal Bescheid, dass wir kommen.«
Im Vorraum warfen sie sich ihre Mäntel über und eilten hinaus. Eiskalter Regen schlug ihnen ins Gesicht.
»Da drinnen werden wir nicht mehr klüger«, sagte Söderberg, während sie zum Weiher liefen.
»Vielleicht schafft es Bahr«, überlegte Marie. »Er kennt das Terrain.«
Sie kamen gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Alpha-1 in seinem klatschnassen Laufdress aus dem Wasser watete. Er hielt ihnen ein tropfendes Kleidungsstück mit einem brennenden Sicherheitslicht entgegen. »Die Weste von Target-1«, sagte er vor Kälte zitternd.
Einer der anderen Alphas nahm sie ihm ab. »Eine Gewichtsweste«, sagte er nach kurzer Inspektion. »Für die ganz Harten, wenn sie sich ein scharfes Training gönnen.«
»Und wo ist der Typ, der da drinsteckte?«, fragte Söderberg.
Alpha-1 schüttelte den Kopf. »Sagen Sie’s mir. Da …« Er zeigte mit dem Daumen rückwärts auf den Weiher, dann machte er mit der Hand eine 360-Grad-Drehung entlang eines imaginären Horizonts und fügte lakonisch hinzu: »Oder dort.«
»Shit happens«, gab Söderberg im selben Ton zurück und gab Marie ein Zeichen. »Ich bring dich zum Sechsten zurück.«
Erst im Auto brach es aus ihm heraus. »Verdammt, er wusste es. Jemand hat ihn gewarnt!«
»Ja, aber erst, als er schon im Park unterwegs war. Sonst wäre er gar nicht erst losgelaufen.«
»Oder einer der Alphas war übereifrig und ist zu früh gestartet. Ich will, dass du sie noch heute Nacht befragst. Einzeln!« Er verstummte, als benötigte er etwas Zeit, um seinen wieder aufsteigenden Ärger herunterzuschlucken. »Also gut. Wenn du etwas Belastbares hast, ruf mich an. Den schriftlichen Bericht kannst du nachliefern. Morgen Vormittag gehst du erst mal zu Francesca Giuliani. Sie leitet die Taskforce, und Bahr war ihr Assistent. Ich besorge dir einen Termin und schicke dir ihr Profil.«
4
Als Marie nach kaum vier Stunden Schlaf und einem Coffee to go am Morgen das Büro im zehnten Stock des Hauptsitzes der Europäischen Kommission betrat, stand Francesca Giuliani am Fenster. Sie war Mitte fünfzig, eine ebenso elegante wie energetische Erscheinung. Sie wandte sich Marie zu, lächelte und winkte sie zu sich.
»Non è terribile?« Sie seufzte.
Marie war irritiert. Was genau fand Giuliani furchtbar? Die Sache mit ihrem Assistenten Bahr? Den Ausblick? Das Wetter? Alles zusammen? »Es gibt sicher Schlimmeres«, erwiderte sie auf Englisch. Eine Antwort, die in jedem Fall passte.
Giuliani lächelte wieder und wechselte ebenfalls ins Englische. »Sie sind eine Optimistin. Das ist gut. Je länger ich als Gast der Kommission im Berlaymont arbeite, desto schwerer fällt es mir, positiv zu denken.«
Marie schaute sich um. Wenn sich der Stellenwert, den die Kommission der »Taskforce für eine Neuordnung der europäischen Wasserversorgung« zumaß, in der Größe dieses Büros dokumentieren sollte, hatte Giuliani hier gewiss kein leichtes Leben.
»Ich habe diese Festung nie gemocht. Selbst die Brüsseler nennen es ›Berlaymonstre‹«, fuhr sie fort. »Allein diese Außenlamellen – sie zerschneiden jeden Blick. Gefängnisgitter, die die Herren und Damen Kommissare von der Welt da draußen abschotten sollen.«
Giuliani schien plötzlich über sich selbst lachen zu müssen. Mit einer einladenden Geste forderte sie Marie auf, in einer Sitzgruppe Platz zu nehmen, die in eine Ecke des Raums gequetscht worden war.
Marie war überrascht, wie schnell Giuliani eine persönliche Atmosphäre aufzubauen wusste. Dem Profil zufolge, das Söderberg ihr zugemailt hatte, war Giuliani eine erfahrene Politikerin. Nach einer Karriere als Universitätsprofessorin saß sie nun schon zum dritten Mal für die Partito Democratico im Europäischen Parlament und genoss dort den Ruf einer herausragenden Netzwerkerin.
»Also Marie, ich darf doch Marie sagen? Francesca. Niklas Söderberg hat mich schon grob informiert. Weiter keine Spur von Dennis?«, fragte Giuliani.
»Die belgische Polizei fischt leider buchstäblich im Trüben. Aber vielleicht können wir ihnen ja noch ein paar nützliche Informationen liefern. Dazu müsste ich allerdings mehr über Ihren Auftrag wissen.«
Giuliani ermunterte sie mit einer Handbewegung, ihre Fragen zu stellen. Marie lehnte sich in ihren Sessel zurück und schaute sich um. »Fangen wir doch damit an, warum Sie als Vorsitzende des Umweltausschusses und führendes Parlamentsmitglied hier in einer solchen Body-shaped-Kammer arbeiten müssen? Ich hatte eigentlich erwartet, Sie in Ihrem Büro im Parlament zu finden.«
Maries kleine Provokation schien Giuliani Freude zu machen. »Das ist Europa, Marie. Ein fein austariertes System und eine Menge Symbolpolitik. Ohne die Initiative des Parlaments wäre die Kommission wohl dem Wunsch einzelner Staaten gefolgt, das Problem der Wasserprivatisierung einfach auszusitzen. Aber wir haben nicht nur mächtig Druck ausgeübt, sondern auch durchgesetzt, den Vorsitz in dieser wichtigen Taskforce zu übernehmen. Nun gefällt es der Kommission aber nicht, wenn eine Parlamentarierin den Fachleuten aus ihren Generaldirektionen Anweisungen erteilt. Also bringt man die Taskforce im Berlaymont unter, um sie im Blick zu behalten, und lässt die Leiterin demonstrativ am Katzentisch sitzen. Ich nehme das nicht persönlich, es zeigt nur, wie unbeliebt Projekte bei der Kommission sind, die man ihr von außen aufzwingt.«
»Sie meinen diesen Protest der zwölf Bürgermeister vor einem Jahr.«
»Der zwölf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ja. Und den Tod einer jungen Griechin namens Efthimia Simoneidis. Und den Tod des portugiesischen Bürgermeisters Alberto de Sousa infolge dieses Protests. Die anschließenden Großdemonstrationen in Dutzenden südeuropäischer Städte, die Petition der westeuropäischen NGOs mit Millionen von Unterschriften und nicht zuletzt unsere fraktionsübergreifende Initiative im Europäischen Parlament. Es war eine gemeinsame Kraftanstrengung, mit der wir das Recht auf Wasser dann endlich in der Grundrechte-Charta der EU verankern konnten. Und jetzt werden wir nach und nach die Wasserversorgung in das Eigentum der Städte zurückführen.«
Simoneidis und de Sousa, das waren die beiden, deren Fotos Marie gestern auf dem Transparent der Demonstranten gesehen hatte. Marie hatte vor ihrem Termin mit Giuliani noch eine halbe Stunde im Internet verbracht, um nicht ganz unwissend ins Berlaymont zu kommen.
Es war eine verrückte Aktion der Verzweiflung gewesen, die aus dem Ruder lief. Die zwölf Bürgermeister kamen aus Städten, in denen die Stadträte vor Jahren die Wasserversorgung privatisiert hatten und die nun wegen schlechter Verträge vor dem Ruin standen. Anfang Februar waren sie in Brüssel in die winterfest gemachten Springbrunnen geklettert, wo sie sich fast gänzlich entkleideten, während um sie herum junge Künstlerinnen und Künstler aus ihren Städten mit Performances und Flugblättern für Aufmerksamkeit sorgten. Die Fotos und Videos von den zwölf Stadtoberhäuptern, die fast nackt und zitternd im Frost standen, kursierten schnell im Netz. Die Lawine öffentlicher Empörung aber war durch den Tod der siebzehnjährigen Schülerin Efthimia ausgelöst worden. Das Unglück passierte an der Fontaine L’homme l’Atlantide auf einer Brücke über dem inneren Schnellstraßenring.
Sie war mit ihrer Theatergruppe aus einer Kleinstadt bei Thessaloniki angereist. Sie tanzten um den Verkehrskreisel herum, in dessen Zentrum ein vier Meter hoher Bronzemann mit Taucherbrille, Rucksack und Flossen die Geheimnisse des Meeres erkundete. Ein ausgebremster Autofahrer verlor die Nerven, trat aufs Gaspedal und touchierte die junge Frau so heftig, dass sie vom Brückenteil des Kreisverkehrs auf die darunterliegende Fahrbahn stürzte, wo sie von mehreren Wagen überrollt wurde.
Nur wenige Tage danach war Alberto de Sousa in einem Krankenhaus mit gerade mal zweiundsechzig Jahren einer schweren Lungenentzündung erlegen. Enttäuscht über seinen abseits gelegenen Protestort im Botanischen Garten, aber in seiner Not zu allem bereit, hatte er dort ausgeharrt, und konnte erst nach Stunden von jungen Schauspielerinnen seiner Gruppe zum Aufgeben bewegt werden. Erst hieß es, er habe sein Unglück selbst verschuldet, aber dann kam heraus, dass er zuvor einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte. Und zwar infolge eines Prozesses, bei dem seine Stadt zu einem sündhaft hohen Schadensersatz an einen Wasserkonzern verurteilt worden war.
»Verzeihen Sie meine vielleicht etwas naive Nachfrage. Wir Niederländer sind ja nicht nur für unseren Kaufmannsgeist bekannt, sondern wir haben seit jeher auch das Problem, dass wir eher zu viel Wasser haben anstatt zu wenig. Ist dieser ganze Kampf gegen die private Wasserbewirtschaftung nicht eine ideologische Übertreibung? Was ist daran so furchtbar, wenn der Kubikmeter Wasser ein paar Cent mehr kostet, weil sich ein Unternehmen eine Menge Arbeit damit macht?«
Giuliani stand auf und ging zu einem Aktenschrank, aus dem sie ein dickes spiralgebundenes Buch im A4-Format zog. Sie legte es vor Marie auf den Tisch. »Das hier wird Ihre Fragen beantworten. Ich garantiere Ihnen, Sie werden darin ein paar herausragende Beispiele für einen Kaufmannsgeist finden, der jede Chance nutzt, die Allgemeinheit auszupressen. Nennen Sie es ideologisch, aber ich halte nicht viel von Gewinnmargen, die von Beginn an zweistellig sind und in kürzester Zeit auf zwanzig, ja fünfundzwanzig Prozent Rendite hochgetrieben werden. Und das auf Kosten der Bürger, die immer mehr bezahlen müssen. Gleichzeitig werden die Investitionen so weit heruntergeschraubt, dass die mit Steuergeldern geschaffenen Infrastrukturen verrotten. Und selbst diese wenigen Investitionen werden noch über ewig lange Kredite finanziert, sodass die Städte nach Auslaufen der Konzessionen selbst dafür aufkommen müssen. Und um noch etwas deutlicher zu machen, dass es nicht nur um ein paar Cent geht. Diese Konzerne leisten sich internationale Anwaltskanzleien, um verschachtelte Vertragskonstrukte zu entwickeln, die niemand außerhalb ihrer Blase versteht. Auf deren Grundlage werden unsere Städte zu zig Millionen Euro Strafe verurteilt, sobald die Bevölkerung wegen der hohen Preise Wasser einspart. ›Angriff auf die Investoren‹ nennen die Schiedsgerichte das dann. Ich nenne es Raubtierkapitalismus.«
Selbst wenn Marie zwanzig Prozent italienischer Dramatik abzog, es war ganz offensichtlich, dass Giuliani von der Überzeugung angetrieben wurde, für eine gerechte Sache zu kämpfen. »Und die Aufgabe Ihrer Taskforce ist was?«
»Wir entwickeln in Tallinn einen Vertrag als Blaupause für alle anderen Städte, die sich mithilfe der Europäischen Union aus den Kontrakten mit privaten Investoren lösen oder zumindest die Anteilsmehrheit wieder zurückholen wollen. Wir setzen uns für faire und transparente Ausstiegsverträge und eine finanzielle Entlastung der Städte ein.«
»Welche Rolle spielte Ihr Assistent Dennis Bahr in dieser Angelegenheit?«
»Keine besonders wichtige. Die wesentlichen Player in der Taskforce sind die drei Abgesandten der fachlich zuständigen Generaldirektionen Umwelt, Wettbewerb und Regiopolitik. Dennis hat letztlich nur Daten recherchiert, Übersetzungen geprüft, mögliche Kompromisslinien formuliert. Verzeihen Sie mir die kleine Boshaftigkeit: Er ist eine etwas humorlose, aber eben auch durch und durch tugendhafte deutsche Arbeitsbiene.«
»Na ja, unsere Ermittlungen zeigen, dass er so tugendhaft wohl doch nicht ist. Privat scheinen Sie ihn aber auch nicht näher zu kennen?«
Giuliani lachte und warf ihr glänzendes Haar in einer Kopfbewegung nach hinten, die Marie an eine Shampoowerbung ihrer Kindheit erinnerte. »Nein, er ist ein höflicher, hilfsbereiter Kerl, aber in jeglicher Hinsicht vollkommen uninteressant. Und sowieso sind Frauen für Dennis ein ferner Kontinent.«
»Aber wissen Sie denn sonst gar nichts über ihn?«
Giuliani zuckte mit den Schultern. Sie wusste nur ein paar Informationen zu Bahrs beruflicher Vita nachzuliefern. Er hatte sich nach einem plötzlichen Karriereknick wohl sehr um diese Stelle bemüht. Zehn Jahre lang hatte er sich in Brüssel Meriten als kompetenter Parlamentsassistent bei einem deutschen Abgeordneten erworben. Als der nicht mehr zur Wahl antrat, spekulierte er wohl auf ein Bundestagsmandat in seiner Heimatstadt, wurde dann aber nicht nominiert. Offenbar war es ihm danach trotz seiner Erfahrung nicht gelungen, einen anderen Job im Parlament zu bekommen. Schließlich hatte wohl irgendwer, Giuliani wusste leider keinen Namen, die Hand über ihn gehalten und ihn bei einem befristeten Projekt in der Generaldirektion Wettbewerb untergebracht. Auf den Job in der Taskforce hatte er sich frei beworben, jedenfalls hatte niemand bei Giuliani angerufen, um sich für ihn zu verwenden.
Marie ließ sich noch eine Weile über die Zusammensetzung der Taskforce informieren, bis Giuliani auf ihre überdimensionale Armbanduhr schaute. »Ich muss leider noch zu einer Sitzung des Parlaments, Marie. Wir können unser Gespräch gerne bald fortsetzen. Mein Sekretär wird mit Ihnen nach einem Termin schauen.«
»Nur eine Frage noch, Francesca. Wem würde es nutzen, die Taskforce mithilfe von Dennis Bahr auszuspionieren?«
»Bis jetzt hatte ich bei den Verhandlungen in Tallinn keine Sekunde lang das Gefühl, dass dort jemand einen Vorteil durch Insiderwissen hatte. Und alles Weitere über diesen Kreis hinaus wäre reine Spekulation.«
Marie ließ nicht locker. »Spekulieren Sie ruhig. Alles kann jetzt helfen.«
»Nun, das größte Interesse hätte natürlich die Wasserwirtschaft. Zu wissen, wo es innerhalb der Taskforce gegensätzliche Positionen gibt, könnte ihr helfen, Gegenstrategien zu entwickeln. Aber genauso gut könnten es auch Geheimdienste außerhalb der EU gewesen sein. Natürliche Ressourcen sind ein zentrales Thema für die Wirtschaftsspionage. Einige der größten Wasserkonzerne sitzen in den USA. Und auch die Chinesen drängen immer stärker auf den Markt.«
Zurück im Erdgeschoss des Berlaymont, steuerte Marie einen Tisch mit ein paar Drehstühlen an. Sie entschied sich, das Gespräch noch gleich hier auf der Piazza zusammenzufassen und ihre nächsten Schritte festzulegen.
Sie könnte versuchen, den ehemaligen Abgeordneten in Deutschland zu befragen, für den Bahr gearbeitet hatte. Aber zuerst wollte sie mit den anderen Taskforce-Mitgliedern sprechen.
Es waren allesamt hochrangige Beamte: ein Deutscher namens Christian Nachtwey von der finanzierenden GD Regionalpolitik, der Österreicher Fritz Aumayr von der GD Wettbewerb, wo auch Dennis Bahr zeitweilig untergeschlüpft war, und die Portugiesin Beatriz Torres von der Generaldirektion Umwelt. Giuliani hatte es so zusammengefasst: Nachtwey musste das Geld beschaffen, Aumayr passte auf, dass dem freien Wettbewerb keine Daumenschrauben angelegt wurden, und Torres sollte dafür sorgen, dass das Ziel der Taskforce erreicht wurde und die Umweltkommissarin beim Schlussapplaus nicht leer ausging.
Sie schaute eine Weile dem Kommen und Gehen auf der Piazza zu. Hatte sie an alles Wichtige gedacht? Das Gewimmel lenkte sie zu sehr ab, sie drehte sich mit dem Sessel um. Einen Moment später klingelte ihr Mobiltelefon. Es war Niklas Söderberg.
»Bahr ist aufgetaucht. Er liegt in der Antwerpener Universitätsklinik in Edegem«, sagte er ohne eine Begrüßung.
»Oh … Wie geht es ihm?«
»Er liegt in einer Gefriertruhe der Abteilung für Rechtsmedizin. Ein Spaziergänger hat ihn heute früh im Parc de Pede gefunden.«
»Natürlicher Tod?«
»Das wirst du hoffentlich gleich erfahren. Bis jetzt wissen wir nur, dass er in dem Graben entlang seiner Laufstrecke gefunden wurde.«
»Dann ist er also tatsächlich gleich wieder aus dem Weiher herausgestiegen«, sagte sie. »Ich habe gestern Nacht die Aussage eines Polizisten aufgenommen, der sagte …«
»Nimm das alles später in deinen Rapport auf und mach dich jetzt auf den Weg«, unterbrach er sie. »Sie wissen, dass du kommst. Eine Dr. Dunnekaat ist gerade mit der Autopsie beschäftigt, und ich möchte, dass du die Erste bist, die ihre Ergebnisse zu hören bekommt. Schick mir den Bericht heute Abend, und morgen früh sehe ich dich in meinem Büro.«
5
Route 102«, lautete die ultrakurze Antwort der Rezeptionistin, als sie erklärte, einen Termin bei Dr. Dunnekaat zu haben. Brav folgte sie den Schildern und staunte über die farbenfrohe Innengestaltung des Gebäudes, dessen Äußeres sie eher an einen halb fertigen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erinnerte.
Im Kellergeschoss gab es einen weiteren Empfang. Die Frau hinter dem Schreibtisch wollte sie ins Wartezimmer schicken, aber Marie sah sie durchdringend an. Warteräume waren Tatorte, an denen hilflose Opfer ihrer Zeit beraubt wurden. Und sie war weder hilflos noch Opfer. »Ich bin als Vertreterin der Europäischen Union hier, um einen Bericht über den Tod von Herrn Dennis Bahr zu erstellen. Es handelt sich um einen …«
Sie wurde von einem lauten Schluchzen unterbrochen.
»Das ist der Lebensgefährte von Herrn Bahr«, flüsterte die Rezeptionistin mitleidig.
Marie schaute in den Warteraum. Ein magerer junger Mann von Anfang zwanzig saß mit tränenverschleierten Augen einsam auf einer Bank. Sie ging auf ihn zu. »Alles in Ordnung?«
Der junge Mann schüttelte heftig den Kopf. Sein halblanges schwarzes Haar fiel ihm wie ein Trauerschleier vor das Gesicht. »Er ist es, er ist es!«, rief er aus und begann wieder, heftig zu weinen.
Marie setzte sich neben ihn.
»Wir wollten doch Pizza essen gehen«, schluchzte er. »Gestern Abend. In unserem Lieblingsrestaurant am Pede.« Er zog sein Handy hervor. Auf dem Sperrbildschirm war ein Foto von Bahr zu sehen. Seine Hände umkrallten es so verzweifelt, als hoffte der Junge, den toten Geliebten aus dem Gerät heraus ins Leben zurückzerren zu können.
»Können Sie irgendwohin?«
»Zu meinen Eltern«, antwortete er resigniert. »Nach Moeskroen.«
Es klang, als müsste er sich nach einem freien Wochenende in der Kaserne zurückmelden.
Eine Frau in grünem Overall bog mit einem Laptop unterm Arm um die Ecke. Ihre große lilafarbene Brille bedeckte fast ihr halbes Gesicht. Sie nickte Marie zu und stellte sich mit »Dr. Dunnekaat« vor. Als sie auf eine Tür am Ende des Gangs deutete, rutschte ihr Ärmel ein Stück nach oben und gab den Blick auf einige chinesisch anmutende Tattoos frei.
Marie strich dem jungen Mann tröstend über den Arm und folgte ihr.
Im Sprechzimmer konnte sie einen Seufzer nicht unterdrücken, aber Dunnekaat schien es nicht zu bemerken. »Wir haben die Autopsie bereits durchgeführt«, sagte sie. »Eilantrag per gerichtlicher Anordnung. Kaffee, Wasser oder heiße Schokolade?«
»Schoko.«
»Bestmögliche Wahl, zumindest in unserem Petit Café des Morts.« Die Medizinerin trat an einen Getränkeautomaten heran und drückte auf einen Knopf.
Marie stand hinter ihr und sah, dass auch ihr Nacken von ein paar Drachenköpfen verziert war, die wachsam aus dem Kragen des Overalls hervorlugten.
Dunnekaat reichte ihr den Plastikbecher und wies einladend auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. »Der junge Mann dort draußen hat den Toten eben eindeutig identifiziert.«
»Sehr traurig«, sagte Marie. »Und wenn er dann noch erfährt, dass sein Partner eine Doppelexistenz geführt hat …«
Sie zuckte mit den Schultern. »Bei uns sind alle Leichen gleich. Nämlich tot.«
»Das sehe ich ein. Und wie ist Bahr nun zu Tode gekommen?«
Dunnekaat öffnete ihr Laptop und tippte etwas ein. »Hypothermie. Festgestellt auf Basis einer ausschließenden Diagnose. Es ist immer das gleiche Lied mit der Unterkühlung. Alles abhaken, und dann bleibt am Ende die Kälte übrig. Unsere Hypothese wird glücklicherweise von einer ganzen Reihe von Hinweisen gestützt.« Sie drehte das Laptop zu Marie und zeigte ihr ein Foto von einem Bein mit scharf umrandeten Verfärbungen. »Zum Beispiel haben wir diese Kälteflecken an den Knien vorgefunden. Sehen Sie, Leichenflecken können Sie noch wegdrücken, zumindest für eine kurze Zeit. Aber Kälteflecken bleiben, egal, was Sie tun. Sie haben auch eine andere Farbe, violett und manchmal auch scharlachrot. Leichenflecken hingegen sind blaugrau, es sei denn, es lag eine Unterkühlung vor, dann sind sie hellrot, und das haben wir auch bei Bahr gesehen. Das war Hinweis Nummer zwei.« Sie hob zwei Finger und fügte einen weiteren hinzu. »Hinweis drei: In seiner Magenschleimhaut fanden wir Wischnewski-Flecken. Nimmt die Kälte zu, fließt das Blut immer langsamer durch den Körper. Dadurch kommt es zu einer Ablagerung der roten Blutkörperchen in der Magenschleimhaut. Das Hämoglobin, das darin steckt, oder besser gesagt das Eiweiß, wird teilweise von der Salzsäure im Magen verdaut, bis nur noch schwarze Pünktchen übrig bleiben … Scheißhäuflein, wenn Sie so wollen. Möchten Sie noch mehr hören?« Sie schaute Marie durch ihre Riesenbrille an, hinter der ihre Augen mindestens aufs Doppelte vergrößert waren.
»Ich halte was aus.« Marie nahm einen Schluck von der heißen Schokolade, während Dunnekaat jetzt den vierten Finger streckte.
»Dann haben wir den kuriosen Umstand, dass Bahr völlig nackt war, als er gefunden wurde. Seine Kleidung lag verstreut um ihn herum, zumindest berichteten das die Jungs, die ihn ablieferten.«
»Ein Suizid per Unterkühlung?«
»Theoretisch ist alles möglich. Sie müssen aber bedenken, dass Opfer von Unterkühlungen oft an der sogenannten Kälteidiotie sterben. Fällt die Körpertemperatur unter zweiunddreißig Grad, sorgt eine Bewusstseinstrübung für heftigste Hitzeempfindungen. Und was macht jemand, dem glühend heiß ist?« Sie überließ die Antwort Marie und zeigte fünf Finger. »Der fünfte Hinweis komplettiert die Befunde, aber wir sind dabei über ein extrem bizarres Phänomen gestolpert. Letzte Nacht war es nirgendwo in Brüssel kälter als ein Grad plus. Frisch genug, um an einer Unterkühlung zu sterben, und sowieso, wenn man eine Weile lang in eiskaltem Wasser herumliegt. Aber als die Kollegen vor Ort die Rektaltemperatur des Toten maßen, kamen zehn Grad minus heraus. Wir vermuteten eine Störung am Messgerät. Eine Stunde später haben wir die Prozedur hier auf dem Tisch mit einem speziellen Thermometer wiederholt. Da waren es immer noch acht Grad minus. Wir haben beide Messgeräte überprüft, sie arbeiten einwandfrei. Wann haben Sie ihn das letzte Mal lebend gesehen, so gegen halb zehn am Abend?«
Marie dachte kurz nach. »Circa, ja.«
»Dann hat er also innerhalb von knapp sechs Stunden fast fünfzig Grad an Körperwärme verloren. Ein schönes Rätsel, das zu lösen ich gerne der hiesigen Polizei und Staatsanwaltschaft überlasse. Die Berechnungen zur Körperstarre sind übrigens noch nicht ganz abgeschlossen. Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, schicke ich sie Ihnen zu.«
Marie stellte ihren Becher ab und suchte in ihrer Brieftasche nach ihrer Karte. »Wissen Sie zufällig, wer ihn gefunden hat?«, fragte sie.
Dunnekaat konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Wer immer es war, er wollte anonym bleiben. Kein Wunder, nachts und bis in den frühen Morgen ist der Parc de Pede eine Callboy-Area«, sagte sie, während sie Maries Karte nahm.
»Bei diesem Wetter?«, fragte Marie überrascht.