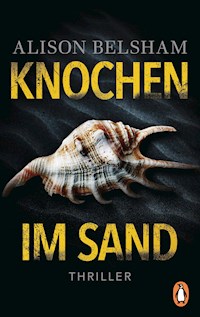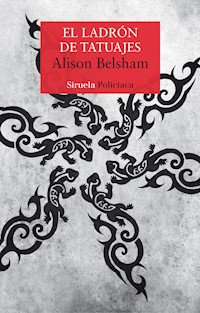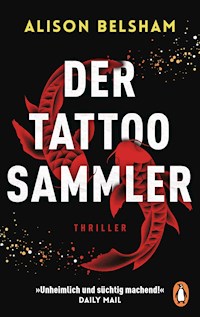
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mullins und Sullivan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Unheimlich und süchtigmachend ... ein Thriller, der unter die Haut geht!
Als die Tattoo-Künstlerin Marni Mullins in Brighton eine blutige Leiche entdeckt, ist ihr erster Impuls, den schrecklichen Anblick so schnell wie möglich zu vergessen. Doch das ist unmöglich, denn nach einem zweiten grausamen Mord bittet Detective Francis Sullivan sie dringend um Hilfe: Der Serienkiller schneidet seinen Opfern Tattoos vom Leib, und Marnis Kenntnis der Szene ist Francis‘ beste Chance, den brutalen Mörder zu identifizieren. Doch Marni möchte seit einem schlimmen Vorfall in ihrer Vergangenheit nie wieder mit der Polizei zu tun haben – und beschließt, den Tattoo-Sammler selbst zu jagen, bevor ein weiterer Unschuldiger Opfer seiner scharfen Messer wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ALISON BELSHAM begann ihre Autorenkarriere als Drehbuchschreiberin und war für den Orange Prize für Drehbücher nominiert sowie in der engeren Auswahl eines Drehbuchwettbewerbs der BBC. Mit ihrer Thrilleridee zu Der Tattoosammler gewann sie 2016 einen Wettbewerb auf dem Bloody Scotland Crime Writing Festival.
Der Tattoosammler in der Presse:
»Unheimlich und süchtigmachend – eine ausgezeichnete neue Thrillerstimme!«
Daily Mail
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Alison Belsham
Thriller
Aus dem Englischen von Kristina Lake-Zapp
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel The Tattoo Thiefbei Trapeze Books, Orion Publishing Group Ltd., London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 by Alison Belsham
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Penguin Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Favoritbüro
Covermotiv: cover artwork/design by Kishan Rajani (Orion Books)
Redaktion: Barbara Raschig
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23324-2V001
www.penguin-verlag.de
Für meine strahlenden JungsRupert und Tim
Eins und zwei, führ ich mein Werk herbei, drei und vier, entfern ein Stück Tattoo auch hier, fünf und sechs, ein blutiger Reflex, sieben und acht, die Klinge schneidet sacht.
Ich schäle das blutdurchtränkte T-Shirt vom Rücken des bewusstlosen Mannes und enthülle ein spektakuläres Tattoo. Die Fotokopie, die ich aus meiner Tasche ziehe, ist zerknittert, aber dennoch gut genug, um das Bild darauf mit dem auf seiner Haut abzugleichen. Im trüben Licht der Straßenlaterne erkenne ich, dass es sich um dasselbe Motiv handelt. Ein rundes polynesisches Tattoo in tiefschwarzer Tinte schmückt die linke Schulter des Mannes, in dessen Mitte ein kompliziertes, finster blickendes Stammesgesicht prangt. An den Seiten breiten sich zwei stilisierte Flügel aus, einer erstreckt sich über das Schulterblatt des Mannes, der andere über die linke Brusthälfte. Alles ist voller Blut.
Die Bilder sind identisch. Ich habe den richtigen Mann erwischt.
Der Puls an seinem Hals ist noch zu spüren, aber er schlägt so schwach, dass er mir sicher keine Probleme bereiten wird. Ich muss meine Arbeit unbedingt erledigen, solange sein Körper noch warm ist. Kühlt er ab, verliert die Haut an Elastizität, und das Fleisch wird starr. Das erschwert die Arbeit, und ich kann mir keine Fehler erlauben. Natürlich fließt beim Häuten eines lebenden Körpers sehr viel mehr Blut als bei einem toten, aber das macht mir nichts aus.
Mein Rucksack liegt ganz in der Nähe, ich hatte ihn abgesetzt, bevor ich den Mann ins Gebüsch zerrte. Ich hatte leichtes Spiel – wie immer war der kleine Park um diese Uhrzeit menschenleer. Es brauchte nur einen einzigen Schlag auf den Hinterkopf, und er ging in die Knie. Kein lautes Geräusch. Kein Tumult. Keine Zeugen. Ich wusste, dass er hier vorbeikäme, sobald er den Nachtclub verließ, denn ich hatte ihn zuvor dabei beobachtet, seine Gewohnheiten ausspioniert. Die Leute sind so dumm. Er ahnte nichts, selbst dann nicht, als ich auf ihn zuging, einen Schraubenschlüssel in der Hand. Sekunden später spritzte sein Blut aus einer Wunde an der Schläfe auf den Boden. Der Anfang war gemacht, und zwar höchst zufriedenstellend.
Nachdem er in die Knie gegangen war, packte ich ihn unter den Achselhöhlen und schleifte ihn so schnell ich konnte über die Pflastersteine. Ich wollte ihn zwischen die Sträucher schaffen, damit wir nicht gesehen wurden. Ein schwieriges Unterfangen, aber ich bin stark, und es gelang mir, ihn durch eine Lücke zwischen zwei Lorbeersträuchern zu ziehen.
Jetzt bin ich vor lauter Anstrengung außer Atem. Ich strecke die Hände aus, die Handflächen nach unten. Sie zittern leicht. Ich balle die Fäuste, dann öffne ich sie wieder. Beide Hände flattern jetzt wie Mottenflügel, genau wie mein Herz, das wie verrückt gegen meine Rippen schlägt. Ich unterdrücke ein Fluchen. Meine Aufgabe erfordert eine ruhige Hand. Ich muss das Zittern stoppen. Die Lösung dafür steckt in einer Seitentasche meines Rucksacks. Eine Schachtel Tabletten, eine kleine Flasche Wasser. Propranolol – der beliebteste Betablocker der Snooker-Spieler. Ich schlucke zwei Tabletten, schließe die Augen und warte darauf, dass sie Wirkung zeigen. Als ich das nächste Mal auf meine Hände blicke, ist das Zittern weg. Ich bin bereit zu beginnen.
Ich hole tief Luft, greife in die Rucksacktasche und taste nach meiner Messerrolle. Ein Gefühl der Zufriedenheit breitet sich in mir aus, als ich das weiche Leder berühre und die Umrisse aus Stahl spüre, die sich darunter abzeichnen. Gestern Abend habe ich die Klingen mit großer Sorgfalt geschärft. Anscheinend ahnte ich, dass heute der Tag kommen würde.
Ich lege die Rolle auf den Rücken des Mannes und löse die Schnüre. Das Leder entrollt sich, leise klackert Metall auf Metall. Die Klingen fühlen sich kalt an unter meinen Fingerspitzen. Ich wähle das kurzklingige Messer für die ersten Schnitte aus, mit denen ich den Umriss des Hautstücks markiere, das entfernt werden soll. Für die anschließende Häutung werde ich ein Messer mit einer längeren, nach hinten gekrümmten Klinge verwenden. Ich kaufe diese Messer in Japan, sie kosten ein kleines Vermögen. Aber das ist es mir wert. Sie werden nach derselben Methode hergestellt wie Samurai-Schwerter. Gehärteter Stahl ermöglicht es mir, schnell und präzise zu schneiden, als würde ich Skulpturen aus gefrorener Butter schnitzen.
Ich lege die restlichen Messer auf den Boden neben seinen Körper und fühle erneut seinen Puls. Noch schwächer als zuvor, aber er ist noch am Leben. Blut sickert aus seinem Kopf, langsamer jetzt. Zeit für einen kurzen, tiefen Testschnitt in seinen linken Oberschenkel. Er zuckt nicht zusammen oder schnappt nach Luft. Keine Regung, außer dem beständigen Sickern des dunklen, glitschigen Blutes. Gut. Er darf sich auf keinen Fall bewegen, während ich schneide.
Der Moment ist gekommen. Mit einer Hand straffe ich seine Haut, dann setze ich zum ersten Schnitt an. Zügig ziehe ich die Klinge von der Schulter über die vorstehenden Kanten seiner Schulterblätter, den Umrissen des Motivs folgend. Ein roter Streifen folgt meiner Klinge, warm läuft das Blut auf meine Finger. Ich halte den Atem an, während sich das Messer seinen Weg bahnt, genieße den Schauder, der mir das Rückgrat entlangläuft, spüre die Erregung, die mich durchfließt.
Der Mann wird tot sein, wenn ich fertig bin.
Er ist nicht der Erste. Und er wird auch nicht der Letzte sein.
1 Marni
Die Nadeln durchstachen die Haut schneller, als das Auge es mitverfolgen konnte, brachten dunkle Tinte in die Dermis ein und hinterließen blühende blutige Rosen auf der Oberfläche. Marni Mullins wischte die kleinen Tropfen alle paar Sekunden mit einem zusammengefalteten Küchenpapier ab, damit sie die Umrisse auf dem Arm ihres Kunden sehen konnte. Ein Tupfer Vaseline, dann bohrten sich die spitzen Nadeln erneut ins Fleisch und schufen eine weitere schwarze Linie, die für immer bleiben würde. Die Alchemie von Haut und Tinte.
In ihrer Arbeit fand Marni Zuflucht, das Summen und die leichte Vibration des Tätowiereisens in ihrer Hand beruhigten sie. So konnte sie vorübergehend den Erinnerungen entkommen, die sie plagten, den Dingen, die sie niemals vergessen würde.
Schwarz und rot. Das Zeichen, das sie in die nachgebende Haut stach. Ihr Kunde zuckte zusammen unter dem Druck der Nadelköpfe, obwohl Marni mit ihrer Wischhand seinen Arm festhielt. Sie kannte den Schmerz, unter dem er litt, nur allzu gut. Hatte sie nicht selbst viel zu viele Stunden die Nadeln der Tätowiermaschine ertragen? Sie fühlte mit ihm, aber das war nun mal der Preis, den man zahlen musste – ein Augenblick des Schmerzes für etwas, was ein Leben lang halten würde. Etwas, was einem niemand mehr wegnehmen konnte.
Sie strich sich mit dem Unterarm eine dunkle Locke aus der Stirn und fluchte leise, als sie ihr erneut über die Augen fiel. Mit geschürzten Lippen blies sie die Haare zur Seite und tauchte das mit sieben Nadeln bestückte Modul in einen kleinen Becher Wasser, um die Farbe der Tinte von Schwarz zu Schiefergrau zu ändern.
»Marni?«
»Ja. Wie geht’s, Steve?«
Er lag mit dem Gesicht nach unten auf ihrer Massagebank. Jetzt drehte er den Kopf zu ihr, blinzelte und schnitt eine Grimasse. »Können wir eine Pause machen?«
Marni warf einen Blick auf die Uhr. Sie arbeitete seit drei Stunden durchgehend an ihm. Plötzlich spürte sie die Spannung, die sich in ihren Schultern aufgebaut hatte.
»Klar, sicher doch.« Drei Stunden waren eine lange Sitzung, selbst für einen Stammkunden wie Steve. »Du steckst das weg wie ein Profi«, fügte sie hinzu und legte die Tätowiermaschine zu den anderen Utensilien auf eine Ablage neben ihrem Stuhl. Diese Worte sagte sie immer zu ihren Klienten, ganz gleich, ob sie tatsächlich durchhielten wie ein Profi oder nicht – was Steve mit seiner Zappelei und Stöhnerei ganz bestimmt nicht tat.
Aber sie brauchte ebenfalls eine Pause, denn langsam, aber sicher fing sie an, sich klaustrophobisch zu fühlen. Das war immer so bei Tattoo-Messen – Hallen mit Kunstlicht, abgestandener Luft und lärmigen Menschenmassen. Da es keine Fenster gab, konnte man nicht sagen, ob es draußen hell war oder dunkel, und Marni musste den Himmel sehen, ganz gleich, wo sie war. Hier drinnen war es heiß und stickig, die Halle gesteckt voll mit tätowierten Menschen und Horden von Voyeuren, die die Künstler bei der Arbeit begafften. Das Ganze wurde untermalt von plärrender Rockmusik und dem kontinuierlichen Surren der Tätowiereisen auf blutiger Haut.
Sie holte tief Luft und ließ den Kopf kreisen, um die Spannungen in ihrem Nacken zu mildern. Der scharfe Geruch nach Tinte, vermischt mit Blut und Desinfektionsmitteln, hing in der Luft. Sie streifte die schwarzen Latexhandschuhe ab und schleuderte sie in einen Müllsack. Steve streckte sich, spannte und lockerte die Armmuskeln, dann ballte er die Faust und streckte die Finger wieder, damit das Blut zirkulierte. Er war blasser als zu Beginn ihrer Sitzung.
»Zieh los und hol dir etwas zu essen. In einer halben Stunde geht’s weiter.«
Marni wickelte das blutige Motiv rasch in Frischhaltefolie ein, dann deutete sie in Richtung Cafeteria. Als Steve weg war, drängte sie sich durch eine Gruppe von Leuten zur Treppe, um ins Erdgeschoss zu gelangen und durch den Notausgang ins Freie zu stürmen. Draußen zog sie tief die kalte Luft in ihre Lunge und stellte fest, dass sie sich keinen Augenblick zu früh davongemacht hatte. Den Rücken gegen die kühle Betonwand gelehnt, schloss sie die Augen und konzentrierte sich darauf, den Druck zu mindern und die Last sowohl der Menschen als auch des Gebäudes loszuwerden.
Sie öffnete die Augen und blinzelte. Das gleißende Kunstlicht in der Halle wurde nun ersetzt durch strahlenden Sonnenschein. Möwen kreisten laut kreischend am Himmel, weiter unten, am Ende der menschenleeren Seitenstraße, schimmerte einladend ein Scheibchen Meer. Marni kostete die salzige Luft, dann drückte sie den Rücken durch, bis es schmerzte. Die Knochen knackten und knirschten, als sie die Schultern kreisen ließ. Unwillkürlich fragte sie sich, ob sie nicht langsam zu alt fürs Tätowieren wurde. Aber es gab nichts anderes, was sie tun konnte – und ehrlich gesagt, wollte sie auch gar nichts anderes tun. Seit sie achtzehn war, übte sie sich in dieser Kunst – neunzehn lange Jahre, in denen sie Tausende Quadratmeter Haut tätowiert hatte.
Sie schob die Hand in ihre Tasche, um sich zu vergewissern, dass sie ihre Zigaretten bei sich hatte, dann setzte sie sich in Bewegung und schlenderte durch das Gewirr der schmalen Gassen, das die Brighton Lanes bildete. Es war ein langes Wochenende, da der Montag auf einen Feiertag fiel, und die Touristen drängten sich in den Gassen wie die Elstern, angezogen von den Läden mit Vintage-Schmuck und Antiquitäten, wenn sie nicht gerade in den Chichi-Boutiquen nach dem perfekten Hochzeitsoutfit oder den perfekten Budapestern suchten. All ihre Lieblingscafés waren hoffnungslos überfüllt, aber das war ihr egal. Heute würde sie ihren Koffeinschuss unter freiem Himmel zu sich nehmen, deshalb bog sie von den Lanes in die North Street ein und ging zu dem Café in den Pavilion Gardens.
Vor der Ausgabe stand eine lange Schlange, was bedeutete, dass sie wahrscheinlich zu spät zu Steve zurückkehren würde, aber ein paar zusätzliche Minuten an der frischen Luft waren es ihr wert.
Sie blickte zum Himmel hinauf. Blassblau. Nicht das strahlende Azur eines Sommertags, sondern ein sanftes Lavendel, aufgelockert durch sich auflösende Wolkenfetzen, die am diesig grauen Horizont mit dem Meer verschmolzen. Perfekt für ein verlängertes Wochenende im Frühling.
»Was darf’s sein?«
»Einen doppelten Verlängerten, schwarz, bitte.«
»Kommt sofort.«
»Und einen Muffin«, fügte sie nach kurzem Überlegen hinzu. Niedriger Blutzucker. Nicht gerade die beste Wahl für eine Diabetikerin, aber sie konnte ihr Insulin später entsprechend dosieren.
Aus dem Royal Pavilion strömten plaudernde Touristen, erstaunt über das, was sie drinnen gesehen hatten. Der Pavilion war ein Disney-Palast, erbaut während der Regentschaftszeit – ein Bauwerk wie eine Hochzeitstorte mit Zwiebelkuppeln, spitzen Türmen und cremefarbenem Stuck, das Marni stets an Scheherazade und Tausendundeine Nacht denken ließ. Sie hatte sich gleich an ihrem allerersten Tag in Brighton in diesen Ort verliebt. Seufzend sah sie sich nach einem Sitzplatz um. Sämtliche Bänke waren besetzt, die Leute streckten sich auf den Rasenflächen aus, aßen und tranken, lachten oder lagen friedlich in der Sonne.
Dann sah sie ihn, und ihr Magen zog sich zusammen. Hastig drehte sie sich zur Ausgabe um und hoffte, dass er sie nicht gesehen hatte. Sie war heute Morgen nicht in der Stimmung für einen Zusammenstoß mit ihrem Ehemann. Ihrem Ex-Ehemann, um genau zu sein. Eine solche Begegnung war im günstigsten Fall unberechenbar, auf alle Fälle aber eine Herausforderung hinsichtlich der gemischten Gefühle, die er in ihr hervorrief. Sie hatten geheiratet, als sie achtzehn war, und sich vor zwölf Jahren getrennt, doch es verging kein einziger Tag, an dem sie nicht an ihn dachte. Ihre gemeinsame Elternschaft verkomplizierte die Beziehung, auf die am ehesten die Bezeichnung »Hassliebe« passte.
Sie riskierte einen verstohlenen Blick und sah, wie Thierry Mullins mit großen Schritten den Rasen überquerte. Ein aufgebrachter Ausdruck verfinsterte seine Züge. Was machte er hier draußen? Er sollte doch in der Messehalle sein – immerhin gehörte er dem Organisatorenteam der Brighton Tattoo Convention an.
»Zwei Pfund vierzig, bitte.«
Marni bezahlte ihren Kaffee, nahm den Pappbecher und schlängelte sich zwischen den Tischen hindurch zur gegenüberliegenden Seite des Gartencafés, damit Thierry sie nicht entdeckte. Ihre Hände zitterten vor Adrenalin, als sie sich eine Zigarette anzündete. Wieso übte er noch immer eine solche Wirkung auf sie aus? Sie waren schon länger geschieden, als sie verheiratet gewesen waren, aber er sah immer noch genauso aus wie damals, als sie ihm zum ersten Mal begegnet war. Groß und schlank mit einem aparten Gesicht, die dunkle Haut noch dunkler durch die Tattoos, die ihre lebenslange Faszination für diese lebenden Kunstwerke ausgelöst hatten. Sosehr sie sich bemühte, ihm aus dem Weg zu gehen, sosehr fühlte sie sich zu ihm hingezogen. Bei mehreren Gelegenheiten wären sie beinahe wieder zusammengekommen, doch dann hatte ihr Selbsterhaltungstrieb sie zurückgehalten. Aber die Beziehung hinter sich lassen? Sie hatte die Hoffnung nie aufgegeben. Marni zog an ihrer Zigarette und inhalierte tief. Koffein, Nikotin, tief durchatmen. Mit geschlossenen Augen wartete sie darauf, dass die chemischen Substanzen ihre Wirkung entfalteten.
Nach einer Weile ließ sie den Zigarettenstummel in den Bodensatz ihres Kaffees fallen und sah sich nach einem Mülleimer um. Ein Stück abseits des bestuhlten Bereichs, hinter dem Café, entdeckte sie einen grünen Plastikcontainer. Sie ging darauf zu und trat mit dem Fuß auf das Pedal, um den Deckel zu heben. Als sie den Becher hineinwarf, schlug ihr ein überwältigender fauliger Gestank entgegen. Ein Gestank, der sehr viel stechender war als der übliche unangenehme Geruch eines Mülleimers in einem öffentlichen Park an einem milden Tag. Galle stieg ihr in der Kehle auf, als sie in das dunkle Innere des Containers spähte und sich augenblicklich wünschte, sie hätte es nicht getan.
Zwischen zerdrückten Coladosen, ausrangierten Zeitungen und Fastfood-Verpackungen konnte sie etwas sehen. Bleiche Umrisse, die sich prompt in einen Arm, ein Bein, einen Torso verwandelten. Ein menschlicher Körper, zweifelsohne tot. Fassungslos starrte sie in den Container. Auf einmal bemerkte sie eine hektische Bewegung – eine Ratte, die am Rand einer schwarzen Wunde nagte. Gestört von dem plötzlichen hellen Tageslicht, verschwand sie mit einem Quieken zwischen dem Müll.
Marni sprang zurück, der Deckel knallte auf den Container.
So schnell sie konnte, floh sie aus den Pavilion Gardens.
2 Francis
Francis Sullivan schloss die Augen. Mit unter dem Gaumen klebender Hostie versuchte er, sich auf das Gemurmel der Zelebranten und der Gemeinde um ihn herum zu konzentrieren, wenngleich er in Gedanken ganz woanders war.
Detective Inspector Francis Sullivan.
Er ließ sich die Worte stumm auf der Zunge zergehen. Das würde er sein, morgen, an seinem ersten Tag im Job. Die Blitzbeförderung hatte ihn im Alter von neunundzwanzig Jahren zum jüngsten DI der Polizei von Sussex gemacht, und er war nervöser als an seinem ersten Tag auf der weiterführenden Schule. Es war eine gute Sache, wenngleich ziemlich Furcht einflößend, weil es zeigte, was für ein gewaltiges Vertrauen seine Vorgesetzten ihm entgegenbrachten. Sicher, er hatte die erforderlichen Prüfungen mit Bravour bestanden, hatte sich hervorragend vor dem Einstellungsgremium geschlagen. Aber warum beförderte man ihn so früh, zumal er noch relativ wenig praktische Erfahrung sammeln konnte? Weil sein Vater ein gefeierter Kronanwalt war? Er verabscheute diese Vorstellung.
Sein neuer Chef, Detective Chief Inspector Martin Bradshaw, hatte wenig begeistert gewirkt, als er Francis über die Beförderung informierte. Er hatte ihm auch nicht gratuliert. Francis fragte sich, ob DCI Bradshaw vollkommen hinter der Entscheidung gestanden hatte oder ob seine Beförderung von den anderen Mitgliedern des Einstellungsgremiums durchgedrückt worden war.
Ihm drehte sich der Magen um, als seine Gedanken zu Rory Mackay schweiften. Detective Sergeant Rory Mackay. Bei der Beförderung übergangen und nun sein Stellvertreter. Francis hatte Mackay letzte Woche kennengelernt. Eine formelle Vorstellung im Büro des Chefs, in deren Verlauf der weitaus erfahrenere DS klargestellt hatte, dass er nicht beeindruckt war. Er hatte den Gesichtsausdruck eines Mannes zur Schau getragen, der soeben die verbliebene Hälfte einer Made in dem Apfel gefunden hatte, den er gerade aß. Francis hatte die Ruhe bewahrt und war ihm mit höflicher Reserviertheit begegnet – er war sich der Risiken bewusst, die ein allzu kumpelhafter Umgang mit seinem Team mit sich brachte –, aber er konnte spüren, dass dies eine heikle Beziehung werden würde.
Der Mann wünschte sich, dass er versagte. Und Francis wusste, dass er damit nicht der Einzige war.
»Das Blut Christi.«
Francis schlug die Augen auf und hob den Kopf, um einen kleinen Schluck Wein aus dem Abendmahlkelch zu nehmen.
»Amen«, murmelte er.
So sei es.
Aber war es zu früh? Während des Auswahlverfahrens hatte er sich ruhig und zuversichtlich gefühlt. Prüfungen waren nie ein Problem für ihn gewesen. Hatte sein Erfolg auf dem Papier Erwartungen geschaffen, die er im Job nur schwer erfüllen konnte? Die Gefahren einer so zeitigen Beförderung waren bei der Einheit nahezu mythisch. Er hatte in der Cafeteria jede Menge Geschichten darüber gehört – ob belegt oder nicht, blieb dahingestellt. Den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Keine Erfolge vorweisen können. Es würde keines katastrophalen Fehlers bedürfen, um an diesem Punkt aus dem Rennen geworfen zu werden, nur ein, zwei schwierige Fälle, die ungelöst blieben. Kalte Fälle.
Furcht trübte die Freude über das, was er erreicht hatte. Detective Inspector Francis Sullivan. Er hatte nicht mehr geschlafen, seit man ihm die Nachricht übermittelt hatte. Die mentale Fokussiertheit, die er so dringend benötigte, war verpufft. Verdammt. Er mochte zwar ein Grünschnabel sein, aber er war nicht dumm. Das Team, dessen Leitung er übernahm, traute ihm den Job nicht zu. Sie glaubten nicht, dass er bereit dafür war. Er müsste sie gleich am allerersten Tag, beim allerersten Fall auf seine Seite ziehen, ansonsten würden alle sich bestätigt sehen, dass er seinem neuen Posten nicht gewachsen war. Bestimmt würde man ihm Steine in den Weg legen. Bradshaw und Mackay würden ihn beobachten und abwarten. Und Wege finden, ihn zu Fall zu bringen, davon war er überzeugt.
Er schaute zu der geschnitzten Jesus-Figur an ihrem Kreuz über der Kanzel auf. Der Sohn Gottes warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, und Francis senkte rasch wieder den Kopf. Er murmelte ein kurzes Gebet und bekreuzigte sich, dann stand er auf, um in seine Bankreihe zurückzukehren, wobei er sich selbst für seine Zerstreutheit tadelte.
Wie auf Autopilot sang er das letzte Lied, ohne sich der Bedeutung der Worte bewusst zu sein, bevor er niederkniete, um zu beten. Für ein paar Minuten konzentrierte er sich wieder auf den Grund, aus dem er hier war – ein Gebet für seine Mutter, eine Fürbitte für seine Schwester. Einen Segen für ihre Pfleger. Nichts für seinen Vater.
Das Handy in seiner Hose vibrierte, doch er war nicht schnell genug, um dem Piepston, der den Eingang einer Nachricht ankündigte, zuvorzukommen. In der stillen Kirche kam er ihm länger und lauter vor als sonst. Köpfe drehten sich zu ihm um, eine Frau zischte missbilligend. Francis warf Pater William einen verstohlenen Blick zu und beeilte sich, das Telefon leise zu stellen, dann senkte er reuevoll den Kopf und las eilig die eingegangene Textnachricht.
Sie war von DS Mackay.
Arbeitsbeginn einen Tag früher. Leichenfund gemeldet. Pavilion Gardens.
Francis wartete voller Ungeduld, dass der Gottesdienst endete. Sobald die Besucher sich anschickten aufzustehen, verließ Francis die Bankreihe und strebte auf das offene Portal an der Rückseite der Kirche zu. Pater William, der bereits unter das Vordach getreten war, schürzte die Lippen.
»Francis.«
»Ich kann mich gar nicht genug entschuldigen, Pater. Ich dachte, ich hätte mein Handy ausgeschaltet.«
»Darum geht es mir gar nicht. Du wirktest aufgewühlt während des Gottesdienstes. Möchtest du darüber reden?«
»Das würde ich gern«, erwiderte Francis, und das meinte er ernst. »Aber ich muss los. Eine Leiche wurde gefunden.«
Pater William bekreuzigte sich mit einem stummen Gebet, dann legte er eine Hand auf Francis’ Unterarm. »Die Welt ist reich an Bösem. Ich mache mir Sorgen wegen deiner Arbeit, Francis. Du wandelst stets am Rande der Verzweiflung.«
»Aber auf der Seite der Gerechtigkeit.«
»Gott ist der oberste Richter, denke daran.«
Eine Frau mittleren Alters rempelte Francis mit dem Ellbogen an. Er nahm den Vikar ungebührlich lange in Anspruch.
Der oberste Richter. Francis dachte über diese Formulierung nach. Im Himmel mochte das vielleicht zutreffen, hier unten auf der Erde dagegen fiel es Leuten wie ihm zu, das Böse zu verfolgen. Es war sein Job, Mörder zu stellen und vor Gericht zu bringen. Gerade hatte man ihm die erste Aufgabe übertragen, und er war fest entschlossen, sie zu lösen, so wahr ihm Gott helfe.
Und wenn von oben keine Hilfe käme, dann würde er es eben allein schaffen.
3 Francis
Francis kämpfte sich mit seinem Wagen Zentimeter für Zentimeter über die New Road. Am Feiertagswochenende war sogar mit Blaulicht kein Durchkommen durch die Menschenmengen. Verdammte Mischverkehrsfläche – das bedeutete doch nur, dass niemand wusste, welches Stück Straße ihm gehörte, und jeder nahm an, dass er Vorrang hatte. Er stellte kurz die Sirene an, um eine langsam dahinschlendernde Familie dazu zu bewegen, den Weg freizumachen, doch die starrte ihn nur mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Bei einer Reihe von Bänken vor den Pavilion Gardens hielt er am Bordstein an. Eine Frau, die ihren Kindern ein Eis gekauft hatte, warf ihm finstere Blicke zu, weil er mit dem Wagen dorthin fuhr, wo sie spazieren ging, doch die meisten Schaulustigen der kleinen Menschenmenge waren viel zu sehr damit beschäftigt, sich die Hälse zu verrenken und die Polizeiarbeiten auf der anderen Seite der Absperrung zu verfolgen, als dass sie Notiz von seiner Ankunft genommen hätten. Erleichtert stellte er fest, dass das Gebiet weiträumig abgesperrt war und mehrere uniformierte Polizisten die Absperrung bewachten.
Er zeigte seinen Dienstausweis und wurde eilig durchgewinkt. Rory Mackay sah ihn auf Anhieb und kam auf ihn zu. Sein beleibter Körper war in einen weißen Papieranzug gehüllt.
»Sergeant Mackay«, sagte Francis mit einem Nicken. »Geben Sie mir doch bitte einen kurzen Überblick über das, was wir haben.«
»Sie müssen erst einen Anzug überziehen, Chef«, entgegnete der Detective Sergeant und warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Ich habe einen Ersatzanzug im Kofferraum.«
Francis folgte Mackay zu einem silbernen Mitsubishi, der gleich auf der gegenüberliegenden Seite der Parkanlage neben anderen Fahrzeugen stand. Insgeheim verfluchte er sich dafür, dass er nicht daran gedacht hatte, einen entsprechenden Anzug einzupacken, um den Tatort nicht zu kontaminieren. Genauso wenig wie er daran gedacht hatte, von dieser Seite zu kommen, wo man viel besser parken konnte.
»Ich hatte angenommen, Sie würden schneller hier sein, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das hier Ihr erster Fall ist.«
Francis spürte, wie sich seine Schultern verspannten. »Ich war in der Kirche, Mackay. Ich hätte die Nachricht eigentlich gar nicht bekommen dürfen oder zumindest erst nach dem Gottesdienst.«
»Da haben Sie recht.«
Ein kurzes Grinsen huschte über das Gesicht des Sergeants, was Francis nicht entging.
Mackay öffnete den Kofferraum seines Wagens und reichte Francis einen Anzug. Während Francis ihn überstreifte, warf er einen Blick auf den Inhalt des Kofferraums. Drei Kästen Stella und zwei Paletten Heineken-Dosen. Grillkohle. Es war nicht schwer zu erraten, wie Mackay seinen Sonntag verbringen wollte.
»Dürfte Ihre Größe sein, aber ziehen Sie ihn vorsichtig an – die Dinger reißen schnell.«
»Ich hab schon mal so einen angehabt«, entgegnete Francis ruhig.
Der Anzug war eine Nummer zu klein, die Hosenbeine zu kurz. Rory lehnte sich an den Wagen und vertrieb sich das Warten mit einer E-Zigarette.
»Dann mal los«, sagte Francis und zog die Ärmel zurecht.
Mackay knallte die Kofferraumklappe zu, dann machten sie sich auf den Weg zurück zum Café.
»Der diensthabende Polizist hat um 11.47 Uhr einen Anruf bekommen, bei dem eine Leiche in einem Müllcontainer hinter dem Pavilion Gardens Café gemeldet wurde. Keine weiteren Details.«
»Wissen Sie schon, von wem der Anruf kam?«
»Nein, nur dass es sich um eine weibliche Stimme handelte. Die Frau hat aufgelegt, bevor der Kollege sie nach ihrem Namen fragen konnte.«
»Aber wir haben die Nummer?«
»Sie hat mit einem Prepaid-Handy angerufen.«
Das war das Erste, was sie verfolgen mussten.
»Der Leichnam?«, fuhr Francis fort.
»Männlich, nackt. Der Mann hat offensichtlich einen Schlag auf den Kopf bekommen und außerdem eine große Wunde an der linken Schulter und am Oberkörper. Wir konnten ihn noch nicht identifizieren, aber er hat eine Reihe von Tätowierungen, die uns dabei helfen dürften.«
»Haben Sie sonst noch etwas gefunden?«
»Wir durchsuchen den Container, sobald die Leiche abtransportiert ist – wir warten noch auf Rose.«
Rose Lewis, die forensische Pathologin. Eine zuverlässige Person – Francis hatte während seiner Zeit als Detective Constable bei mehreren Fällen mit ihr zusammengearbeitet.
»Gut.« Francis nickte. »Dann sehe ich mir das Ganze jetzt mal an.«
Kurz vor dem Café klingelte Rorys Handy. Er nahm den Anruf entgegen. »Ja, Sir, er ist jetzt da, Sir … Ich habe das Gebiet abgesperrt und die Spurensicherung bestellt. Die Gerichtsmedizinerin ist informiert, ja …«
Rory schwieg einen Augenblick, dann nickte er. »Ja, ich denke, er hat das Telefon jetzt eingeschaltet. Er war in der Kirche.«
An Rorys Tonfall konnte Francis hören, was dieser davon hielt. Er beschleunigte seinen Schritt – das war nicht gerade der Start, den er sich für seinen ersten Fall als Detective Inspector gewünscht hatte.
Rory führte ihn über den Rasen und um das Café herum zur Rückseite, wo ein grüner Plastikcontainer stand. Als sie näher kamen, stieg Francis der Gestank in die Nase. Sofort fing er an, durch den Mund zu atmen. In seiner Mundhöhle sammelte sich Speichel. Unauffällig kämpfte er gegen einen Würgereiz an. Die Techniker der Spurensicherung, ebenfalls in weißen Papieranzügen, suchten den Boden ab, maßen Distanzen aus und machten Fotos.
»Macht mal auf«, sagte Rory.
Detective Constable Tony Hitchins stand neben dem Container Wache. Als Francis und Rory davor stehen blieben, trat er auf das Fußpedal, um den Deckel zu heben, den Blick abgewandt. Francis zog ein Paar Latexhandschuhe an und trat an den Container.
Hitchins wich merklich die Farbe aus dem Gesicht. Francis sah, wie der DC die Lippen zu einer schmalen Linie verkniff.
»Sehen Sie zu, dass Sie den Tatort verlassen, bevor Sie sich übergeben, Hitchins.«
Francis fing den Deckel des Containers auf, den Hitchins abrupt losließ und sich eiligen Schrittes über den Rasen entfernte. Er schaffte es gerade noch, sich unter dem blau-weißen Polizeiband hindurchzuducken, dann krümmte er sich zusammen und erbrach das, was von seinem Sonntagsfrühstück übrig geblieben war, ins Gras.
»Um Himmels willen«, sagte Francis, und Rory schüttelte den Kopf, doch sie sahen einander nicht an. Es gab keinen Polizisten bei der Einheit, der sich bei der Sichtung einer Leiche nicht irgendwann übergeben hatte, auch wenn das keiner zugeben wollte.
Francis wandte sich wieder dem Container zu und wappnete sich gegen den Anblick, der ihn erwartete. Hoffentlich würde ihm nicht der gleiche Fauxpas passieren wie Hitchins. Nicht heute.
Und da war sie. Seine Leiche. Sein erstes Opfer als leitender Ermittler. Seine erste Begegnung mit einem Individuum, das er während der kommenden Wochen und Monate extrem gut kennenlernen würde, sozusagen ein Blind Date. Vermutlich erführe er mehr über das Opfer, als er über die Mitglieder seiner eigenen Familie wusste – zudem würde er aller Wahrscheinlichkeit nach auf Geheimnisse stoßen, die die Familie des Opfers bis ins Mark erschütterten. Doch im Augenblick war der Mann vor ihm ein Fremder. Grau, gekonnt gehäutet und teils verwest, vergammelte er wie der Müll um ihn herum. Mithilfe seines Teams würde Francis sein Inneres nach außen kehren, um herauszufinden, wie er getickt hatte und warum man ihn lieber tot sehen wollte als lebendig.
Francis prägte sich das schockierende Bild ein. Verdrehte Gliedmaßen, Haut wie Spachtelmasse, rot-schwarzes Fleisch, wo Gesicht und Torso als Rattenfutter gedient hatten. Selbst die eigene Mutter würde den Mann nicht erkennen. Der Anblick entfachte Francis’ Wut und würde dafür sorgen, dass er sich voll und ganz auf den Fall konzentrierte.
»Sergeant Mackay? Sergeant Mackay?«, fragte eine Stimme hinter Francis.
Er drehte sich um. Rory ging bereits zur Absperrung, wo ein Mann mit einer Kamera um den Hals stand. Presse.
»Tom«, sagte Rory mit einem Nicken. »Ich dachte mir schon, dass Sie früher oder später hier aufschlagen.«
»Ja ja, ich weiß, ich habe Ihnen gerade noch gefehlt«, erwiderte der Mann grinsend. »Was haben Sie für mich, Mackay?«
»Für Sie gar nichts«, gab Rory zurück. »Wir geben erst Informationen an die Presse, wenn wir es für richtig halten, vorher nicht. Und jetzt ziehen Sie Leine.«
Er drehte sich um und kehrte zu Francis zurück. »Nehmen Sie sich vor dem in Acht. Tom Fitz vom Argus. Der ist immer zuerst am Tatort.«
»Wie kriegt er so schnell raus, wohin er muss?«, wollte Francis wissen.
Rory zuckte die Achseln. »Hört den Polizeifunk ab, gibt den Polizisten Drinks aus.« Er wirkte ganz und gar nicht beeindruckt.
»Nun, halten Sie ihn sich warm«, riet Francis. »Man kann nie wissen, wann einem die Presse von Nutzen ist.«
»Rose ist da«, unterbrach Rory abrupt. Offensichtlich hatte er kein Interesse daran, Zugeständnisse an Reporter zu machen.
»Detective Inspector Sullivan«, rief eine freundliche Stimme.
Francis drehte sich um und sah sich Rose Lewis gegenüber, die einen halbwegs wiederhergestellten Hitchins anwies, mehrere Taschen mit ihrer Ausrüstung in der Nähe abzustellen. Sie war so klein und zierlich, dass selbst der kleinste Papieranzug an ihr schlackerte und sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um über den Containerrand zu spähen.
»Igitt, ekelig«, sagte sie und wandte sich zu Hitchins um. »Können Sie eine Leiter holen, damit ich Fotos machen kann?«
»Jawohl, Ma’am.«
»Ich nehme an, ich darf gratulieren?«, fragte Rose, als der DC loszog, um seine Aufgabe zu erledigen.
»Ja, danke«, antwortete Francis. »Genießen Sie das lange Wochenende?«
»Jetzt ja. Ihre erste Leiche als leitender Ermittler?«
Er nickte.
»Dann sollten Sie den Fall besser schnell lösen, nicht wahr?«
Das war ihm bewusst, und zwar mehr als deutlich.
Genau wie er sich der Konsequenzen bewusst war, falls er versagte.
4 Marni
Der Anruf hatte Marnis ganzen Mut erfordert. Zu wissen, dass sie mit einem Polizisten am anderen Ende der Leitung sprach, hatte sie fast genauso aufgewühlt wie die Entdeckung der Leiche. Sie hatte es kurz gemacht und sich geweigert, ihren Namen zu nennen. Alles, was mit der Polizei zusammenhing, versetzte sie noch immer schlagartig in eine Zeit zurück, die sie am liebsten vergessen würde. Sie hatte sich geschworen, dass sie nie wieder, für den Rest ihres Lebens nicht, etwas mit den Cops zu tun haben wollte.
Als sie zur Tattoo-Messe zurückkehrte, wartete Steve bereits eine halbe Stunde auf sie, und es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis ihre Hände aufhörten zu zittern und sie ihn weitertätowieren konnte. Er hatte nicht verärgert reagiert, als sie ihm zögernd erzählte, was passiert war. Was nicht weiter überraschte, da er sich brennend für ihre Entdeckung interessierte.
»Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Riecht das wirklich so schlimm, wie immer behauptet wird? Ist die Polizei sofort gekommen?«
Marni bekam Kopfschmerzen, weshalb sie ihren letzten Termin an diesem Tag absagte. Als die Brighton Tattoo Convention am Abend ihre Pforten schloss, fühlte sie sich ausgepowert und aufgewühlt. Andauernd trat ihr das Bild des leblosen Körpers vor Augen, und sie hatte immer noch den Gestank in der Nase. Wäre sie doch bloß nicht in die Pavilion Gardens gegangen! Mit der Polizei zu telefonieren, hatte ihre Ängste nur bestärkt, denn dadurch drängten die Erinnerungen, gegen die sie so sehr angekämpft hatte, lediglich zurück an die Oberfläche.
Nachdem sie ihr Equipment für den nächsten Tag verstaut hatte, spazierte Marni die Promenade entlang, um ihren Kopf freizubekommen. Sie konnte nicht aufhören, an das zu denken, was sie gesehen hatte. Die Art und Weise, wie die Haut des Mannes geglänzt hatte, als das Licht darauf fiel. Und diese dunklen Flecken! Zunächst hatte sie sie für Verletzungen gehalten, bis ihr klar wurde, dass es sich um Tattoos handelte. Der Anblick war wie ein Standbild, das hinter ihren Augenlidern festklebte – und jedes Mal, wenn sie es betrachtete, wurden die Details klarer. Die Tätowierung auf der rechten Seite seines Torsos – ein Paar betende Hände. Auf einem seiner Oberschenkel eine Skizze des heiligen Sebastian in Schwarz und Grau, die Wunden der Pfeile rot hervorgehoben.
Sie versuchte, die Gedanken an den Leichnam aus ihrem Kopf zu verdrängen und sich auf den Weg zu konzentrieren. Die Promenade war voller Menschen, es herrschte dichter Verkehr. Hinter ihr wurde ein schrilles Heulen immer lauter. Sie drehte sich um und sah etwa zwanzig bis dreißig Motorroller auf der Straße, jeder mit Spiegeln, Waschbärenschwänzen, Wimpeln und Flaggen geschmückt. Die Mods kamen über das verlängerte Wochenende in die Stadt. Die Fahrer in ihren Parkas und Nadelstreifenblazern sahen genauso unverwechselbar aus wie ihre Motorroller, Hush-Puppies- und The-Who-Memorabilien. Der Lärm der vorbeifahrenden Mopeds ging ihr auf die Nerven.
Es wurde dunkel. Das natriumgelbe Licht der Straßenlaternen tauchte alles in einen wohltuenden Bernsteinton, aber Marni sehnte sich nach einem Ort, an dem es dunkler war, ruhiger. Die kühle Luft vom Meer genießend, sprang sie geräuschlos die Steinstufen zum Strand hinunter.
Es war Ebbe, und sie ging über den knirschenden Kies zum Wasser. Hier unten war es kalt und dunkel, die Kakophonie vom Pier wurde übertönt vom Tosen und Rauschen der Wellen. Das Geräusch wirkte so hypnotisierend wie das Surren der Tätowiermaschine. Sie atmete tief die salzhaltige Luft ein und massierte beim Gehen die überstrapazierten Muskeln ihres rechten Arms. Morgen lag ein weiterer langer Tätowiertag vor ihr.
Sie sah den menschenleeren Strand hinunter. Ihr Blick blieb an einem baufälligen Gusseisenkoloss hängen, der gut zweihundert Meter vom Ufer entfernt im Meer stand.
Das war alles, was vom West Pier geblieben war. Eine dunkle Silhouette vor der dunklen See, dem Verfall anheimgegeben, seit der Pavillon darauf von einem Feuer zerstört worden war. Nicht länger mit der Küste verbunden, war er nun eine Insel, heimgesucht von den Geistern lang vergessener Urlauber und unbedeutender Kleinkrimineller.
Ihre Gedanken kehrten zu dem Leichenfund zurück. Was wäre aus dem Mann im Container geworden, wenn sie ihn nicht entdeckt hätte? Wäre er irgendwo auf einer Mülldeponie gelandet, wo er langsam verrottete, bis keine Spur mehr von ihm übrig blieb, abgesehen von seinen Knochen und Zahnfüllungen? Auch seine Tattoos würden zusammen mit seinem Körper verschwinden, wenn die Ratten an ihm nagten. Ob ihnen Fleisch mit Tinte anders schmeckte? Oder den sich windenden Maden, fett und weiß, die sich in das ungeschützte rote Fleisch bohrten? Eine schauderhafte Vorstellung.
Wer immer den Mann in den Container geworfen hatte, war mit ziemlicher Sicherheit für seinen Tod verantwortlich. Sie hoffte bei Gott, dass die Polizei in der Lage war, den, der das getan hatte, ausfindig zu machen und festzunehmen. Es war ein beunruhigender Gedanke, dass ein solches Verbrechen in unmittelbarer Nähe geschehen war.
Marni fröstelte. Sie war hierherspaziert, um vor dem Schlafengehen zur Ruhe zu kommen, aber das würde ihr wohl kaum gelingen. Sie zog ihre leichte Strickjacke enger um die Schultern und kehrte um zu den Lichtern des Palace Pier, der so lebendig und geschäftig wirkte wie der West Pier tot war. Der Wind ließ nach, und für einen kurzen Augenblick konnte sie ihre eigenen Schritte auf dem Kies hören. Der Strand, an dem es bei Tage von Menschen wimmelte, war um diese Uhrzeit ein einsamer Ort.
Plötzlich schrie eine Frau.
Marni bekam eine Gänsehaut. Ihre Brust zog sich zusammen, als sie herumwirbelte und angestrengt in die Dunkelheit starrte.
Eine Sekunde später war Gelächter von derselben Frau zu hören, in das ein Mann mit einfiel. Marni holte tief Luft und versuchte, sich zu beruhigen, aber ihr Herz hämmerte. Am Strand war niemand zu sehen, als sie quer über das breite Kiesstück zu der Steintreppe an der Promenade hastete.
Sie warf einen Blick auf den Palace Pier. Schemenhafte Gestalten bewegten sich zwischen den dicken Stahlträgern, mit denen der Pier verankert war. Männerstimmen schallten durch die gischthaltige Luft zu ihr herüber.
»Bist du allein, Süße?«
Marni wandte sich ab. Zur Hölle mit dem Kerl.
»Komm schon, wir können ein bisschen Spaß haben.« Eine andere Stimme, diesmal näher.
Sie ging nicht darauf ein, sondern stieg so schnell sie konnte die Stufen zur Promenade hinauf.
Als sie durch das nächtlich stille Kemptown nach Hause ging, kehrten ihre Gedanken zu etwas zurück, was ihr schon die ganze Zeit über durch den Kopf ging: das Tattoo des heiligen Sebastian auf dem Oberschenkel des Mannes. Sie wusste, warum. Es erinnerte sie an Thierrys Arbeit, vor allem die Art und Weise, wie die roten Pfeilwunden gestochen waren. Thierry. Warum war Thierry in den Pavilion Gardens gewesen, wenn er eigentlich auf der Tattoo-Messe hätte sein sollen?
Bitte, lieber Gott, mach, dass nichts dahintersteckt.
Konnte die Tätowierung auf dem Körper des Mannes tatsächlich von Thierry stammen? Unwahrscheinlich, und wenn doch, hatte es vermutlich nichts zu bedeuten. Natürlich nicht. Sie stellte Bezüge zur Vergangenheit her, die nicht rational waren. Doch wenn es um Thierry ging, war sie niemals rational. Er hatte einen emotionalen Einfluss auf sie, der nur noch stärker zu werden schien, je mehr sie versuchte, ihn zu leugnen. Selbstverständlich bestand keinerlei Zusammenhang zwischen Thierry und der Leiche in dem Müllcontainer. Es war lediglich ihre Besessenheit, die Thierry in alles miteinbezog, was ihr widerfuhr.
Als sie in die Great College Street einbog, konnte sie im Wohnzimmer an der Vorderseite ihres Hauses Licht sehen. Alex war daheim. Ein achtzehnjähriger Junge musste seine Mutter nicht unbedingt in einem Zustand wie diesem sehen. Sie holte tief Luft, um sich zu beruhigen, und zog ihr Handy aus der Tasche. Obwohl sie die meiste Zeit über versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen und ihre Gefühle für ihn zu unterdrücken, schien es doch immer Thierry zu sein, den sie in einem Krisenmoment brauchte. Sie wählte, wartete darauf, dass er dranging, hoffte auf seinen Zuspruch.
»Thierry?«
Sie hörte nichts als Rauschen. Dann Baulärm.
»Marni?« Sein französischer Akzent veränderte den Klang ihres Namens.
»Ja, ich bin’s.«
»Marni! Ich bin mit den Jungs in der Bar. Komm doch auch! Charlie und Noa würden sich freuen.«
Charlie und Noa waren Thierrys Kollegen beim Tatouage Gris, Brightons einzigem französischem Tätowierstudio. Sie konnte ihre Stimmen im Hintergrund hören, außerdem Frauengelächter. Zweifelsohne Tattoo-Groupies, die wegen der Messe in der Stadt waren. Thierry musste verrückt sein zu glauben, sie hätte Lust, sich ihnen anzuschließen.
»Nein, komm du her – ich muss mit dir reden.« Plötzlich sehnte sie sich verzweifelt danach, ihn zu sehen, wofür sie sich im selben Augenblick hasste. Er war eine Sucht, die sie einfach nicht loswurde.
»Worüber?«
»Ich hatte einen wirklich üblen Tag.«
Sie hörte Thierry seufzen.
»Thierry, ich habe eine Leiche gefunden.« Ihre Stimme schraubte sich eine Oktave höher. »Ich hab Angst …«
»Wow, nun mal langsam. Wovon redest du? Hast du die Polizei angerufen?«
»Selbstverständlich. Trotzdem muss ich etwas mit dir besprechen.«
»Nein. Ich bin müde, chérie, und tote Menschen gehen mich nichts an.«
»Komm schon, Thierry. Was, wenn es jemand war, den wir kannten? Was, wenn es Alex war?«
»Es war nicht Alex. Ich hab vor einer Stunde mit ihm telefoniert. Er war dabei, Pepper zu füttern. Ihr habt übrigens kein Hundefutter mehr.«
Pepper. Ihre Bulldogge.
»Bitte, Thierry.«
Thierry gab das stimmliche Äquivalent zu einem gallischen Achselzucken von sich, ein nonchalantes Grunzen, das sie einst geliebt hatte. »Wenn das ein Trick ist, um mich zu verführen …«
»Ach, Scheiße noch mal!« Sie legte auf und ging ins Haus.
»Mum!« Alex kam in den Flur und begrüßte sie mit einer Umarmung. »Wie war dein Tag?«
Marni straffte die Schultern und lächelte. »Super. Hab gute Arbeit geleistet bei einem meiner Stammkunden und mehreren Laufkunden. Und was hast du gemacht?«
Alex zog die Schultern hoch und ließ sie wieder sinken. »Ach, nichts Besonderes. Hab noch den Stoff für die letzte Prüfung wiederholt. Abi machen ist echt nervig.«
Einen Teller Pasta und ein Glas Wein später sank Marni aufs Sofa, um die Nachrichten zu sehen. Alex wollte auf Fußball umschalten, aber sie hatte die Fernbedienung. Im Nachhinein wünschte sie sich, sie hätte klein beigegeben.
… bittet die Polizei die anonyme Anruferin, die den Leichenfund in den Brightoner Pavilion Gardens gemeldet hat, sich an die nächste Dienststelle zu wenden, um bei der Aufklärung des Falles behilflich zu sein. Der Mann, der in einem Müllcontainer entdeckt wurde, konnte noch nicht identifiziert werden …
»Na schön, Alex, dann lass mal sehen, ob schon ein Tor gefallen ist.« Sie warf ihm die Fernbedienung zu und versuchte, das plötzliche Zittern ihrer Hände zu verbergen.
»Nein, warte mal – da ist jemand ermordet worden, in Brighton. Hier passiert doch nie was.«
Aber Marni wollte nichts davon hören. »Du wirst noch ein Tor verpassen«, hielt sie dagegen.
Da es nur wenige Fakten mitzuteilen gab, wandten sich die Nachrichten kurz darauf einem anderen Thema zu, und Alex zappte durch die Kanäle. Es stellte sich heraus, dass das Spiel ziemlich langweilig war; sie hatten kein Tor verpasst.
Alex wurde unruhig. »Wie lief’s heute?«
»Gut. Dein Vater hat seine Sache gut gemacht – die Tattoo-Messen in Brighton sind immer die besten.«
»Mum, denkst du, du kommst jemals wieder mit Dad zusammen?«
Marni verschluckte sich an ihrem Wein. Hustend schüttelte sie den Kopf. »Wie kommst du denn darauf?«
»Ihr hängt doch immer noch aneinander, wenn ihr zusammen seid.«
»Klar.« In seinem Alter schien das alles so einfach zu sein.
»Außerdem weiß ich, dass Dad das gern wollte.«
Tatsächlich? Hatte er als Single nicht viel mehr Spaß in einem Beruf, der jede Menge Gelegenheiten zum Flirten bot? Marni seufzte. »Das Problem mit deinem Vater ist, dass er die Vorstellung nicht mag, verheiratet zu sein. Die praktische Seite der Ehe umzusetzen, zählt nicht gerade zu seinen Stärken.«
»Niemand ist perfekt, Mum. Nicht einmal du.«
Marni Mullins träumte nicht. Sie konnte es sich nicht erlauben zu träumen – Träume waren zu schmerzhaft. Stattdessen lag sie einfach nur wach, die Augen weit offen in der schwarzen Leere. An Schlaf war schon lange nicht mehr zu denken, aber ihre Gedanken wanderten, ungebunden, unkoordiniert. Alex’ Worte hallten in ihren Ohren nach.
Hier passiert doch nie was.
Nur dass jetzt etwas passiert war und sie hineingezogen wurde. Ein Mann war tot. Ein Mann, der etwas an sich hatte, was aus irgendeinem Grund an die finsteren Untiefen ihrer Seele rührte. Etwas Vertrautes. Aber was war die Verbindung? Wenn er ein Einheimischer war, der sich hier hatte tätowieren lassen, würde sie ihn wahrscheinlich kennen. Nein, doch eher nicht. Tausende Menschen in Brighton hatten Tattoos. Und selbst wenn Thierry ihn tätowiert hatte, na und? Das bedeutete noch lange nicht, dass er etwas mit seinem Tod zu tun hatte.
Marni knipste die Nachttischlampe an. Das Licht blendete sie. Sie drückte die Augen zu und kämpfte gegen das Schluchzen an, das in ihrer Brust aufstieg. Es konnte keine Verbindung bestehen. Das war bloß ihre Fantasie, die ihr in dem Schwebezustand zwischen Wachsein und Schlaf etwas vorgaukelte. Sie setzte sich auf. Der Raum drehte sich. Galle stieg in ihrer Kehle auf.
Würgend rannte sie ins Badezimmer und beugte sich mit zusammengebissenen Zähnen über die Toilettenschüssel. Speichel flutete ihren Mund, und sie musste tief durchatmen, um ihre Gefühle endlich wieder unter Kontrolle zu bringen. Nach einer Weile sackte sie auf dem Fußboden zusammen, Tränen in den Augen. Sie blinzelte. Auf den weißen Fliesen waren Blutspritzer. In der Ferne hörte sie das kreischende Knirschen von zufallenden Metalltüren. Sah Ziegelwände in Anstaltsgrau. Ihr Bauch und ihre Brüste spannten im letzten Stadium der Schwangerschaft. Schritte auf dem Gang, ihr Blut gefror, eine Explosion aus Schmerz. Krämpfe. Sie kauerte sich zusammen, blutete, schrie um Hilfe. Bekam bloß einen weiteren Tritt in den Bauch …
Sie öffnete die Augen, und das Blut war verschwunden. Die Leiche und das Tattoo des heiligen Sebastian hatten diese Erinnerungen ausgelöst. Sie musste wissen, so oder so, ob die Tätowierung des toten Mannes von Thierry stammte. Hoffentlich nicht, denn dann könnte sie die ganze Sache vergessen.
Zurück in ihrem Schlafzimmer, suchte sie nach ihrem Smartphone und googelte die Nummer der Brighton Crimestoppers, einer gemeinnützigen Organisation zur Verbrechensbekämpfung, die eng mit der Polizei zusammenarbeitete.
Es läutete. Und läutete. Und läutete.
Marni wartete. Sie wusste nicht, warum. Es war zwanzig vor drei am Morgen, es war bestimmt niemand da, der ihren Anruf entgegennehmen würde.
Schlussendlich gab sie auf. Sie schleuderte das Handy zur Seite, warf sich rücklings aufs Bett und wartete darauf, von ihren Ängsten übermannt zu werden.
5 Rory
Der ranzige Gestank des Todes stach Rory in die Nase, noch bevor er es durch die Türen der Gerichtsmedizin geschafft hatte. Binnen Sekunden verwandelte sich der Geruch in Geschmack, der seinen Mund ausfüllte. Er fing an zu husten und strebte schnurstracks zu der Stelle, an der Rose Lewis ihr Wick VapoRub aufbewahrte. Laute Chormusik wummerte wie ein Sperrfeuer auf seine Ohren ein. Rose Lewis’ Arbeitsplatz war definitiv kein Ort für Katerstimmung – das wusste er vom letzten Mal.
»Morgen!«, rief Rose über den Lärm hinweg, dann beugte sie sich wieder über den Leichnam eines nackten Mannes, ein Skalpell in der Hand.
Rory nickte ihr zu und verteilte die durchsichtige Salbe zwischen Oberlippe und Nase, um den Gestank der Balsamierflüssigkeit, die nach fauligen Äpfeln roch, und der scharfen Essignote des Formaldehyds zu überdecken.
»Membra Jesu Nostri«, sagte Francis, der Rory gefolgt war und nun darauf wartete, dass er die VapoRub-Dose wieder zuschraubte.
Rory hatte keinen blassen Schimmer, worüber er sich ausließ.
»Verdammt, Sie sind gut, Sullivan«, sagte Rose, ging zu ihrem Soundsystem und drehte die Lautstärke herunter. »Komponist?«
»Buxtehude.«
»Richtig. Eignet sich besonders gut zum Arbeiten. Das Libretto widmet sich den einzelnen Körperpartien des leidenden Jesus. Aber das wissen Sie ja bereits.«
Rory reichte Francis kommentarlos die VapoRub-Dose. Diese Intellektuellen, die sich voreinander wichtigmachten. Es schien ein Spiel zu sein, das sie beide gern spielten, um herauszufinden, wer von ihnen der Cleverste war. Doch so löste man keine Fälle, und wenn Sullivan glaubte, er könne Rory damit beeindrucken, dann hatte er sich geschnitten.
Wenn er ehrlich war, zählte die Gerichtsmedizin nicht gerade zu Rorys Lieblingsorten, daher versuchte er, so wenig Zeit wie möglich dort zu verbringen. Es war nicht so, dass er Rose nicht mochte – sie verhielt sich ihm gegenüber stets ausgesprochen höflich, wenn auch ein wenig herablassend –, aber ihre Selbstsicherheit im harschen Gleißlicht des polarweißen Umfelds führte dazu, dass er sich mitunter etwas klein vorkam. Natürlich war die Arbeit, die Rose leistete, wichtig, aber DNA-Spuren und Blutspritzer waren nicht alles, sondern lediglich Teil des Gesamtbilds. Die Tendenz, bei der Lösung eines Falles die Wissenschaft für das A und O zu halten, nahm deutlich zu, doch in Wirklichkeit war sie lediglich ein Hilfsmittel, um die solide Polizeiarbeit zu unterstützen.
Rory zog ein Paar Latexhandschuhe an und folgte seinem Chef zu Roses Arbeitsplatz.
Im Augenblick war nur ein einziger Leichnam zu sehen, aber er wusste, dass in den Stahlschubladen an einer der Wände noch weitere lagen. Rose und ihr Team arbeiteten fleißig eine Leiche nach der anderen ab und setzten anhand der Geheimnisse, die Blut, Fleisch, Knochen und Zähne preisgaben, die verschiedenen Lebensgeschichten zusammen. Er fragte sich, was sie ihnen wohl über den Mann aus dem Müllcontainer erzählen würde.
Der Tote auf dem Obduktionstisch vor ihnen war zum Teil mit einem weißen Gummilaken bedeckt. Er lag auf dem Rücken, ein Schnitt erstreckte sich von seinem Sternum bis zum Schambein; Rose hatte bereits begonnen, die Organe zur weiteren Untersuchung zu entnehmen. Rory betrachtete den Leichnam, der deutliche Verwesungsspuren aufwies. Die Gesichtszüge waren unscharf. Die Ratten hatten sich an Haut und Fleisch gütlich getan – ein Teil der Lippe fehlte, die Nase war abgekaut, beide Wangen waren zerfleischt. Am restlichen Körper wirkte die Haut grau. Rory hatte über die Jahre hinweg zu viele Leichen gesehen, um entsetzt zurückzuzucken, aber er warf einen verstohlenen Seitenblick auf Francis. Es wäre nicht ganz fair zu behaupten, er sehe fassungslos aus – in Wirklichkeit blickte er nämlich eher interessiert. Trotzdem war sein Kiefer angespannt, was Rory vorher nicht aufgefallen war.
Rose hatte den Leichnam bestimmt schon fotografiert und vermessen, außerdem die Rückstände unter den Fingernägeln entfernt und sämtliche Wunden und Tätowierungen mithilfe ihres kleinen Aufnahmegeräts dokumentiert. Vermutlich hatte sie sogar auf die Musik verzichtet, um jedes Detail aufzuzeichnen. Im Augenblick untersuchte sie mit behandschuhten Fingern die Mundhöhle des Toten. Als Nächstes – die entwürdigendste Prozedur bei ungeklärter Todesursache – würde sie sich seinen Anus vornehmen und nach Hinweisen auf kürzlich erfolgten Sex oder sexuellen Missbrauch suchen.
Die beiden Polizisten sahen ihr schweigend zu, bis sie schließlich ihr Diktiergerät zückte und zu ihnen aufsah.
»Irgendwelche Erkenntnisse, Rose?«, fragte Francis.
Sie stellte die Musik ab. Gott sei Dank. Der Lärm ging ihm allmählich auf die Nerven.
»Erkenntnis Nummer eins: Ich werde Probleme mit Mike bekommen, weil ich am Montag des verlängerten Wochenendes arbeite.«
Francis zuckte die Achseln. »Wenn es nach mir ginge, würden Mörder ausschließlich montags bis freitags zwischen neun und siebzehn Uhr zuschlagen.«
Rose lachte.
»Apropos Überstunden«, sagte Rory. »Wie geht es Laurie?«
»Die Frage ist durchaus berechtigt. Pluspunkt für dich, weil du daran gedacht hast, Rory. Es geht ihm gut. Er hat mit der Oberschule begonnen, und er fühlt sich dort wohl.«
»Und was ist mit dem hier?« Francis deutete mit dem Kinn auf den Toten, um aufs Thema zurückzukommen.
Binnen einer Sekunde war Rose wieder durch und durch professionell.
»Richtig. Also, was haben wir bisher? Ich schätze, der Tod trat vor vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden ein, aber ich kann euch nicht genau sagen, ob er tot oder lebendig war, als er in den Müllcontainer geworfen wurde. Euer Team wird bestimmt in Erfahrung bringen, wann der Container zuletzt geleert wurde.«
»Hollins checkt das«, bestätigte Rory.
»Was ist mit der Überwachungskamera in der New Road?«
»Da ist Hitchins dran«, antwortete Francis.
»Die Tweedles«, sagte Rose. »Ihr solltet besser dranbleiben – die zwei können mitunter ein bisschen langsam sein.«
»Als ob ich das nicht wüsste«, murmelte Rory.
Tweedledum und Tweedledee, wie Hitchins und Hollins im Präsidium genannt wurden. Die beiden sahen einander verblüffend ähnlich; beide hatten widerspenstiges braunes Haar und eine Figur, die verriet, dass sie gern einen Donut zu viel aßen.
Rose sah Francis an, dann Rory.
»Sie haben Glück, einen solchen Stellvertreter zu haben, Francis.«
Francis nickte, aber er sagte nichts.
Schafft er es nicht mal, ihr beizupflichten?, fragte sich Rory.
»Rory ist einer unserer erfahrensten Männer«, fuhr Rose fort. »Er weiß, was er tut, also nutzen Sie seine Fähigkeiten.«
Der Chef runzelte die Stirn. Rory unterdrückte ein Grinsen – das war nicht gerade ein Vertrauensbeweis, Roses Einschätzungsvermögen betreffend.
»Ich bin mir sicher, Rory wird es mich wissen lassen, wenn ich etwas falsch mache«, sagte Francis. In seiner Stimme klang Schärfe mit.
Rory schnaubte. Plötzlich fühlte er sich genauso unbehaglich wie der Chef wegen des Verlaufs, den das Gespräch nahm. Rose stichelte, und Rory fragte sich, warum. Was bezweckte sie damit?
»Der Schlag auf den Kopf hat ihn nicht gleich getötet«, sagte sie nun und wandte ihre Aufmerksamkeit glücklicherweise wieder der Leiche zu.
»Sind Sie sicher?«, fragte Francis und betrachtete die teilweise rasierte Schädeldecke. Rose drehte den Kopf leicht zur Seite, damit sie die blutige Delle im Schädel sehen konnten.
»Absolut. Die Wunde war nicht ausschlaggebend für seinen Tod; der Schlag hat ihn bewusstlos gemacht und hätte schlimmstenfalls einen bleibenden Gehirnschaden verursacht.«
»Also, was hat ihn dann umgebracht?«, wollte Rory wissen.
»Das war eine Kombination aus mehreren Faktoren«, antwortete Rose. Ihre Stimme triefte vor Zufriedenheit über das, was sie herausgefunden hatte. »Nach dem Schlag auf den Kopf war er bewusstlos. Ich nehme an, dass er noch lebte, als er entsorgt wurde. Er hat viel Blut verloren, was ihn, zusammen mit einer starken Unterkühlung, umgebracht hat.«
»Blutverlust wegen der Kopfwunde? Die sieht gar nicht so groß aus«, wunderte sich Francis.
»Zum Teil deswegen, doch hauptsächlich wegen dieser Wunde hier.« Sie deutete auf die große blutige Fläche auf der Schulter und im Brustbereich des Mannes, wo die Haut fehlte.
»Ich dachte, das wären die Ratten gewesen, post mortem«, sagte Rory.
»Nicht ganz. Und hier wird es interessant, deshalb hab ich euch auch so schnell herbestellt.«
Rory betrachtete die blutige Masse.
»Sehen Sie ruhig genauer hin«, drängte Rose. Sie drehte sich zu der Ablage hinter ihr und nahm eine Lupe zur Hand, die sie Francis reichte. »Sehen Sie? Dort sind Schnittspuren, die meiner Meinung nach von einer kurzen, extrem scharfen Klinge stammen.«
Francis beugte sich vor und untersuchte die Stelle, auf die sie deutete, mit behandschuhter Hand. »Ich sehe, was Sie meinen.«
Er reichte Rory die Lupe und trat einen Schritt zurück. Rory betrachtete die Wunde. Rose hatte recht. Es waren unverkennbar Schnitte im Fleisch zu sehen, und die konnten unmöglich von Tieren stammen.
»Jesus!«
Er sah, wie sein Chef bei seiner Wortwahl zusammenzuckte. Ausgerechnet er musste mit diesem religiösen Fanatiker zusammengespannt werden!
»Glauben Sie, die Schnitte wurden vor oder nach dem Schlag auf den Kopf ausgeführt?«, wandte er sich an Rose.
»Was das betrifft, kann ich nur Vermutungen anstellen, aber ich würde sagen, danach«, antwortete die Gerichtsmedizinerin. »Die präzisen Schnitte legen nahe, dass sich das Opfer zum Zeitpunkt der Ausführung nicht gewehrt hat. Aber die Schnitte sind nicht tief. Sie sollten den Mann nicht umbringen. Es sieht eher danach aus, als habe jemand wohlüberlegt Haut und Fleisch vom Körper gelöst. Doch das lässt sich nur schwer mit Sicherheit sagen. Es gibt genauso viele Bissspuren wie Schnitte.«
Rory untersuchte weiter das freiliegende Fleisch. »Die Schnitte scheinen um die Wunde herumzuführen.«
»Die perpendikularen Schnitte, ja«, sagte Rose. »Aber hier und auch hier im Zentrum sind einige horizontale Schnitte in der Dermis zu erkennen.«
Rory kniff die Augen zusammen und blinzelte konzentriert. Er konnte lediglich ein paar kleine, gerade Linien in der schmutzigen breiigen Masse erkennen. Sein Magen zog sich zusammen, und für einen kurzen Moment musste er die Kiefer fest zusammenpressen, bis das Übelkeitsgefühl nachließ.
»Lassen Sie mal sehen«, sagte Francis.
Erleichtert reichte Rory ihm die Lupe.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte der DI und schaute angestrengt durch das Vergrößerungsglas.
»Das bedeutet, Francis, dass Ihr Opfer gehäutet wurde. Wahrscheinlich während es noch lebte, dem hohen Blutverlust nach zu urteilen.«
6 Francis
Schwarze Jeans, schwarze T-Shirts, rasierte Köpfe oder Dreadlocks. Kahl. Tätowiert. Haut. Um Francis herum floss literweise Tinte in lebendes Fleisch, so schnell, dass er die Bilder kaum erkennen konnte. Tiefschwarze, schmutzig blaue oder leuchtend bunte Zeichen. Was zum Teufel hatte er am Montag des verlängerten Wochenendes auf der Brighton Tattoo Convention verloren? Er hatte einen grummelnden Mackay zurück an den Leichenfundort geschickt, damit er die Gegend noch einmal nach Fingerabdrücken absuchen ließ und Ausschau hielt nach Fleischstücken, die womöglich aus dem Körper des Mannes geschnitten worden waren. Er wollte in der Zwischenzeit die mysteriöse Anruferin ausfindig machen, deshalb war er hier. Das Handy, von dem der Anruf getätigt worden war, gehörte einer hiesigen Tattoo-Künstlerin. Ihre Website verriet ihnen, dass sie auf der Messe war. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sie weitere Informationen für sie haben. Francis wollte unbedingt herausfinden, warum die Frau so ausweichend gewesen war und ihren Namen für sich behalten hatte.
Er fühlte sich schmerzlich verunsichert, als er die Haupthalle des Brighton Centre, des großen Veranstaltungs- und Kongresszentrums an der Kings Road, betrat. Offenbar war er der einzige Mensch im ganzen Gebäude, der keine Tätowierung hatte – und vermutlich der einzige, der einen Anzug trug.
Er holte tief, wenngleich widerwillig Luft, dann stürzte er sich ins Gedränge.
Die Leute wimmelten um ihn herum, schoben und stießen ihn zur Seite, traten ihm auf die Zehen und verrenkten sich die Hälse, um in die Standnischen zu blicken. Und dann war da der Lärm. An jedem Messestand dröhnte laute Heavy-Metal-Musik, die jeweils die der Nachbarstände zu übertönen versuchte.
Noch lauter aber war ein unablässiges, schrilles Geräusch. Er konnte die Quelle nicht ausmachen, bis seine Augen an dem nackten Rücken eines Mannes hängen blieben. Eine Frau tätowierte ihn – der Lärm stammte von dem kollektiven elektrischen Surren der Tattoomaschinen. Blut sickerte aus den schwarzen Linien, die sie in die Haut stach. Ein unangenehmer Geruch nach Kupfer hing in der Luft.
Es war stickig in der Halle und viel zu warm. Francis drängte sich bis zum Ende des Gangs, verzweifelt darum bemüht, eine freie Fläche zu finden. Er verstand nicht, warum man sich tätowieren ließ, und die Begeisterung der Massen verstand er erst recht nicht. Mit Sicherheit hatten all diese Menschen besser ausgesehen, bevor sie ihre Körper für immer verunstaltet hatten. Das Ganze hatte etwas von einem Stammesritual an sich. Aber welcher Stamm hielt ein solches Ritual ab, und welche Bedeutung hatte es?
»Entschuldigung?«
Er tippte einem vorbeigehenden Jugendlichen auf die Schulter. Der junge Mann drehte sich zu ihm um. Auf die linke Seite seiner Stirn war ein blaues Spinnennetz tätowiert, das unter seinem Haaransatz verschwand.
»Ja?«
»Ich suche eine Tattoo-Künstlerin namens Marni Mullins.«
Der Jugendliche zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Gesäßtasche seiner Jeans. Darauf abgebildet war der Grundriss der Kongresshalle mit den nummerierten Messeständen. Er drehte das Blatt um und ging die Liste mit Tattoo-Künstlern durch.
Als er den Kopf senkte, konnte Francis unter seinem kurzen blonden Haar den Rest des Spinnennetzes erkennen, außerdem die dunklen Umrisse eines Wortes. Er kniff die Augen zusammen, aber er konnte nicht erkennen, was dort stand.
»Marni …?«, fragte der Blonde.
»Mullins.«
»Stand achtundzwanzig.«
»Danke«, erwiderte Francis.
»Keine Ursache, Kumpel.« Der junge Mann verschwand im Gewimmel, noch bevor Francis ihn fragen konnte, wo genau sich Stand achtundzwanzig befand. Egal. Vermutlich waren die Stände numerisch geordnet. Seufzend begab er sich erneut in die Menge.