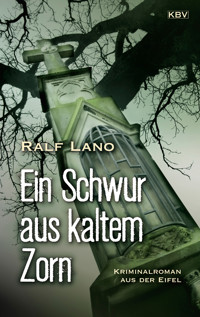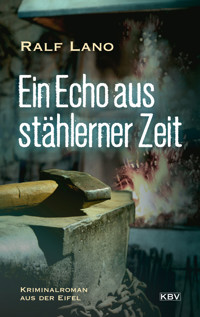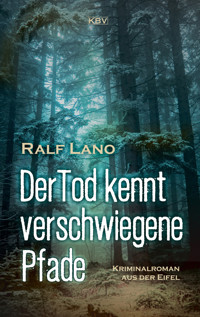
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Eifeler Dorfschmied ermittelt
- Sprache: Deutsch
Dorfschmied Karl ermittelt wieder Im heißen Sommer 1947 wird der Schmuggler Leopold Schilz im Wald bei Bitburg ermordet. Es ist der erste Fall für Kriminalkommissar Peters als Beamter der neuen Polizei von Rheinland-Pfalz. Er ahnt, dass etwas Größeres hinter der Sache steckt, und heuert den Dorfschmied Karl Bermes an, der sich mit den Hintergründen des lukrativen Kaffeeschmuggels gut auskennt. Karl wird in die Bande eingeschleust und nimmt an einer gefährlichen Tour teil, die von dem zwielichtigen Thomas Schwarz aus Bitburg angeführt wird. Auch der Tod scheint mitzumarschieren, und Karl muss bald erkennen, dass die Hintergründe des Falls wesentlich tiefer wurzeln als gedacht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Lano
Der Tod kennt verschwiegene Pfade
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Ein Echo aus stählerner Zeit
Ralf Lano, geb. 1965 in Kyllburg in der Eifel, ist gelernter Maschinenbautechniker und leidenschaftlicher Autor von Kriminalgeschichten. Bisher wurden über 30 seiner Erzählungen veröffentlicht, darunter auch der Kurzkrimi Die Kuh Elsa, mit dem er 2022 für den deutschen Kurzkrimi-Preis nominiert war.
Sein erster Kriminalroman Ein Echo aus stählerner Zeit (KBV) war 2023 der fulminante Auftakt einer mehrbändigen historischen Eifelkrimi-Reihe.
Ralf Lano lebt und arbeitet in der Westeifel und kennt die Region und die Menschen wie seine Westentasche.
Ralf Lano
Der Tod kenntverschwiegene Pfade
Originalausgabe
© 2024 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © Wirestock - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-701-8
E-Book-ISBN 978-3-95441-712-4
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
INHALT
PROLOG
MONTAG, 21.07.1947 TAG 1
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
DIENSTAG, 22.07.1947 TAG 2
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
MITTWOCH, 23.07.1947 TAG 3
-14-
-15-
-16-
-17-
DONNERSTAG, 31.07.1947 TAG 11
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
NACHT VON DONNERSTAG AUF FREITAG, 01.08.1947 TAG 12
-24-
-25-
SAMSTAG, 02.08.1947 TAG 13
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
SONNTAG, 03.08.1947 TAG 14
-33-
-34-
-35-
-36-
-37-
-38-
MONTAG, 04.08.1947 TAG 15
-39-
-40-
-41-
-42-
-43-
-44-
-45-
DIENSTAG, 05.08.1947 TAG 16
-46-
EPILOG
PROLOG
Man konnte die Dämmerung am Horizont hinter den Bäumen erahnen. Das zarte Rosa reichte noch nicht aus, um den Wald wirklich zu erhellen. Sein schlimmes Bein meldete sich wie bei allen seinen Touren, die er in den letzten Monaten unternommen hatte, mit einem dumpfen Pochen. Seit der Ardennenoffensive steckte ein Splitter oberhalb des linken Knies. Und das, obwohl er nie hatte Soldat spielen müssen. Wegen seiner starken Kurzsichtigkeit war Leopold Schilz gleich zu Beginn des Krieges ausgemustert worden. Die Kriegszeit verlief für ihn halbwegs glimpflich. Bis die Wehrmacht im vorletzten Dezember auf die glorreiche Idee gekommen war, sich erneut auf den Weg nach Paris zu machen, dieses Mal im Winter. Leopold lebte damals auf dem elterlichen Aussiedlerhof in der Nähe von Waxweiler. Dort sammelten sich nun also wie bereits 1940 Unmengen an Soldaten und Militärmaterial. Die Truppen stürmten kurz vor Weihnachten 1944 mit viel Hurra los, nur um einige Wochen später endgültig geschlagen den Rückzug anzutreten. Der Hof lag auf einem Bergrücken über dem Tal der Prüm. Weil man von dort einen guten Überblick über die Gegend hatte, beschlossen einige sture deutsche Soldaten, an dieser Stelle höchstpersönlich den Endsieg zu erringen. Leopolds Bruder Erwin war bereits 1941 in Russland gefallen. Seine Eltern und seine Schwester Hedwig kamen beim finalen Angriff amerikanischer Panzer auf ihren Hof ums Leben. Leopold war im Kuhstall verschüttet worden. In seinem Bein steckte seitdem der verdammte Splitter. Im Lazarett in Prüm fand sich kein Chirurg, der das Metallstück entfernen konnte.
Irgendwann schloss sich das Loch im Bein, und der Splitter gehörte nun wohl für immer zu Leopold. Das unregelmäßige Souvenir, das er unter der Haut ertasten konnte, bereitete ihm nur dann Probleme, wenn er lange gehen musste. Der Teufel liebte es anscheinend, den Menschen das Leben unnötig schwer zu machen. Denn das Gehen war zu Leopold Schilz’ Beruf geworden. Die schlechten Augen samt der ständig beschlagenen Brille hatten ihn nicht daran gehindert, selbst während des Krieges regelmäßig Ausflüge zur luxemburgischen Grenze, hoch bis Winterspelt oder runter nach Bitburg zu unternehmen. Freier konnte er sich nicht fühlen, als allein im Grün der Eifel unterwegs zu sein. Nachdem sein gewohntes Leben Anfang 1945 in einem Stahlgewitter untergegangen war, kam ihm dieses Steckenpferd unerwartet zupass. Es gab kaum einen Haupt-, Neben- oder Schleichweg in der Westeifel, den Leo über die Jahre nicht erkundet hatte.
Nach seiner Entlassung aus dem Lazarett im Spätsommer 1945 schlug er sich mehr schlecht als recht durch die Nachkriegszeit. Vom Bauernhof waren nur Ruinen geblieben. Auf den Ämtern in Prüm, Bitburg oder bei den Franzosen erntete er nur Schulterzucken, wenn er dort wegen einer Entschädigung vorstellig wurde. Für Leopold lautete die Lehre daraus: Kümmere dich um dich selbst, es wird dir niemand helfen. Damit wusste er wegen der abgeschiedenen Lage seines Elternhauses umzugehen.
Um sein Leben zu bestreiten, übernahm er bei Bauern rund um Waxweiler und Prüm alle Arten von Handlangertätigkeiten. Um die Kreisstadt machte man 1946 besser einen Bogen. Alle erwerbsfähigen Männer im Alter von sechzehn bis sechzig Jahren wurden dort verpflichtet, unentgeltlich Arbeitsdienste zu leisten. Anders wurde man der erheblichen Kriegszerstörungen durch Bomben und Artillerie nicht Herr. Bei Arbeitsverweigerung wurde die Lebensmittelkarte entzogen und der Name öffentlich bekanntgegeben. Diese Art der indirekten Zwangsarbeit widersprach Leopolds Drang nach Unabhängigkeit. Die Not dieser Monate prägte ihn nachhaltig, er war fest entschlossen, nie wieder zu hungern. Er pfiff auf alle Konventionen und Vorschriften, er hatte seinen eigenen Weg gefunden.
Alles änderte sich, als Thomas Schwarz im Sommer 1946 eines Tages vor ihm stand. Während der gemeinsamen Zeit in der Volksschule von Waxweiler war Thomas einer der hartnäckigsten Peiniger Leos gewesen. Wegen dessen Brille mit Gläsern, die an die gewölbten Böden von Schnapsflaschen erinnerten, hatte Leopold in seiner Kindheit und Jugend zu spüren bekommen, was es bedeutete, ein Außenseiter zu sein. Ständig musste er sich neue Spitznamen gefallen lassen. Der Name, den Thomas ihm verpasst hatte und der schließlich hängen geblieben war, lautete: Lupen-Leo. Es dauerte also verständlicherweise ein wenig, bis Leo ernsthaft auf das hörte, was Thomas Schwarz ihm mitzuteilen hatte.
Als er schließlich die Zusammenhänge verstand und erkannte, wie viel Profit in dem Transport der duftenden Bohnen und dem ein oder anderen Nebengeschäft lag, ging alles sehr schnell. Er übernahm die ersten Rucksäcke mit Ware und brachte sie sicher in den Süden der Eifel, von wo sie weiterverteilt wurden.
Als Ausgleich für seine schlechten Augen besaß er einen außergewöhnlichen Orientierungssinn und das Gehör einer Katze. Immer wieder legten sich Zöllner im Wald auf die Lauer. Sie konnten sich allerdings nie leise genug verhalten, um Leopolds Aufmerksamkeit zu entgehen. Seine Schleichwege versah er mit ständig wechselnden Marken, denen nur er folgen konnte. Bei klaren Nächten gaben ihm die Sterne, die so hell schienen, dass er sie sehen konnte, zusätzliche Orientierung.
Für die Fernsicht im Hellen trug er ein kleines Fernglas in seiner Jackentasche. Leopold hatte das Teil in den Ruinen des Schilz-Hofs gefunden, als Überbleibsel der Wehrmachtssoldaten, die dort ihr Leben für Führer, Volk und Vaterland gegeben und bei der Gelegenheit seine Familie ungefragt mitgenommen hatten.
Der Rucksack schnitt in die Schultern ein. Dreißig Kilo Kaffee aus Belgien neigten dazu, mit jedem zurückgelegten Kilometer ein gewisses Eigenleben zu entwickeln. Hinter ihm folgten die drei Frauen, die diesmal als Trägerinnen eingeteilt worden waren. Bei den ersten Wanderungen durch die Nacht hatte er ausschließlich ältere Männer angeführt. Seit geraumer Zeit tauchten immer mehr Frauen auf, die sich für diese Arbeit interessierten. Die meisten jungen und starken Männer waren entweder gefallen oder hockten noch irgendwo in Gefangenenlagern. Jeder musste schauen, wo er blieb, egal ob Mann oder Frau. Diese Nacht waren es drei Frauen, die ihm stumm folgten. Es war bereits so dunkel gewesen, als die drei Grazien in der letzten Nacht zu ihm gestoßen waren, dass Leo sie nicht genauer in Augenschein nehmen konnte. Manchmal wurden Namen genannt, manchmal eben nicht. Aber Namen waren sowieso Schall und Rauch.
Eigentlich hatte Andrej in dieser Nacht zusätzlich mit von der Partie sein sollen. Der elende Besserwisser stand unter dem Schutz von Thomas’ Chef. Trotzdem hatte Leo Andrej einfach stehen lassen. Niemand konnte ihm vorschreiben, wen er durch die Nacht zu führen hatte. Davon abgesehen hatte das dämliche Fuchsgesicht vor einigen Wochen etwas mitbekommen, das ihn überhaupt nichts anging. Es hatte ein klärendes Gespräch mit Thomas gebraucht, um Leopold davon abzuhalten, sich näher mit Andrej zu beschäftigen.
Vor ihm wurden die Bäume weniger und die Büsche zahlreicher. Der einfachste Weg hätte in diesem Teil der Eifel entlang des Tals der Prüm nach Süden geführt. Leopold entschied sich für den schwierigeren Weg über den Koosbüsch. Die Zöllner waren meist nicht motiviert genug, sich im steilen Gelände zu verstecken und nach ihm und seinen Begleitern zu suchen. Zu ihren Füßen lag nun das Dörfchen Stahl in einem kleinen Talkessel. Am Horizont sah man im Dämmerlicht des anbrechenden Morgens die ersten Häuser von Bitburg. Gleich hinter dem Dorf befand sich in einem Seitental der Nims ein verlassener Bauernhof, der sein Ziel für diesen Tag sein sollte.
Leopold blieb am Waldrand stehen. Die Frauen verhielten sich angemessen leise. Es war nichts Verdächtiges zu sehen oder zu hören. Leopold ließ den Rucksack vom Rücken gleiten, um an die zerbeulte Feldflasche zu kommen.
Eine seiner Begleiterinnen fragte: »Sind wir da?«
Leopold drehte sich in ihre Richtung, neben ihm stand eine verhärmte Frau mit angegrauten Haaren. Wie so viele andere war sie aufgrund der Kriegszeit und der damit einhergehenden komplizierten Lebensumstände vorzeitig gealtert.
»Wir sind da, wenn ich sage, wir sind da.« Leopold schulterte den Rucksack. »Es ist nicht mehr weit. Ihr wartet hier, bis ich euch ein Zeichen gebe«, kommandierte er.
Die Frau senkte devot den Kopf. So hatte das zu sein, die Frau sei dem Manne untertan, so stand es bereits in der Bibel. Und die Frauen waren sowieso alles Schlampen. Gut gelaunt setzte Leopold sich in Bewegung. Die Frauen traten einige Schritte zurück, wo sie mit dem Unterholz verschmolzen.
Vorsichtig stieg er die restlichen gut hundert Meter ins Tal der Nims hinab. Hier gab es nicht mehr die Deckung durch die Bäume, weshalb er wesentlich umsichtiger voranschritt. Doch nun blieb er abrupt stehen. Vor dem verfallenen Gebäude stand ein Fahrzeug. Einen solchen VW-Schwimmkübelwagen hatte er das letzte Mal beim Aufmarsch zur Ardennenoffensive gesehen.
Leopold trat nach links in den Schutz eines wild wuchernden Holunderbaums. Es saß jemand im Schwimmwagen. Dieser Jemand gähnte herzhaft und hob die Arme zu einem ausgiebigen Recken und Strecken in die Höhe. Der Mann stieg, um zu pinkeln. Leopold nahm das Fernglas, hob es vor die Brille und spähte zum Haus. Eines nach dem anderen überprüfte er die Fenster, die wie finstere, geometrische Löcher die bröckelige Fassade durchbrachen. Es gab keine abrupten Bewegungen oder etwa das verräterische Blitzen vom Metall eines Gewehres. Die Luft schien rein zu sein.
Leopold löste sich aus der Deckung des Holunders, mit behutsamen Schritten trat er auf den Weg zum Haus. Er hob die rechte Hand, um den Fremden auf sich aufmerksam zu machen. Unter seinen Füßen knackte ein Ast, den er übersehen hatte. Der Mann drehte sich mit offenem Hosenlatz um, erschrocken verstaute er seinen Pillermann. Leopold hob auch die linke Hand, er wollte dem Dämlack seine Harmlosigkeit demonstrieren. Bevor er etwas sagen konnte, knallte es. Urplötzlich konnte Leopold nicht mehr atmen. Sein Zwerchfell krampfte, die Faust eines Riesen schnürte ihm Herz und Brustkorb ab. Er machte einen unsicheren Schritt nach vorne, seine Hände flehten den Fremden nun um Hilfe an. Doch weder der noch sonst jemand in der Welt wäre in der Lage gewesen, Leopold Schilz noch zu helfen. Er registrierte als Letztes, dass die Sonne eben dabei war, über dem eingefallenen Dach des Hauses aufzugehen, dann wurde alles schwarz um ihn.
MONTAG, 21.07.1947TAG 1
-1-
Die Frau mit den angegrauten Haaren verstaute den Rucksack im Gebüsch. Sie war etwas ratlos, was sie mit dem Inhalt tun sollte, der ihr so unverhofft in die Finger gefallen war. Selbst wenn der Kaffee ihr nicht gehörte, man konnte ihn gegen viele nützliche und wichtige Dinge eintauschen. Dieser Marsch durch die Finsternis der Eifelnacht war wesentlich anstrengender gewesen, als sie sich das vorgestellt hatte. Ihre Begleiterinnen hingegen schienen noch frisch genug gewesen zu sein, um sich mitsamt ihrer Last über alle Berge zu machen.
Die Frau hatte sich in den nächstbesten Strauch am Wegesrand geflüchtet, als der Schuss gefallen war. Gleich darauf war ein Motor gestartet worden und ein Auto über den schlecht befestigten Feldweg davongepoltert. Danach hatte sie mit pochendem Herzen im Gebüsch gelegen. Sie war heute zum ersten Mal dabei gewesen. Ausgerechnet ihr musste nun so etwas passieren. Sie wollte nur ein wenig Geld hinzuverdienen, das sie dringend für ihre vier Kinder brauchte. Ihr Mann Hans galt seit der Invasion im Sommer 1944 in Frankreich als vermisst. Wegen der ständigen Bombenangriffe war sie im Herbst 1944 mit den Kindern aus Köln zu Verwandten nach Bitburg geflohen. Der schwere Bombenangriff Ende dieses Jahres hatte dafür gesorgt, dass die Kleinstadt der Metropole Köln an Schuttbergen in nichts nachstand. Der Kontakt für diesen nächtlichen Ausflug hatte sich über ihre Cousine Helli ergeben, die sich gelegentlich mit einem Soldaten der Luxemburger Garnison traf, der wiederum die Finger im Kaffeegeschäft hatte. Ihr jüngster Sohn, ihr süßes Herrmännchen, hatte den Winter nur knapp überlebt. Die Diphterie hing ihm selbst jetzt im Hochsommer noch in den Knochen. Er brauchte dringend mehr Fleisch in der Suppe, wenn er den nächsten Winter überleben sollte. Der wenige Schmuck, den sie aus Köln mitgebracht hatte, war bereits im Vorjahr bei Bauern in den umliegenden Dörfern in Kartoffeln und Eier umgewandelt worden.
Die Frau wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte, die anderen waren weg, und Leo rührte sich nicht mehr. Sie traute sich, den Kopf aus dem Gebüsch zu strecken. Ihr Führer lag verdreht auf dem Rücken, die Brille hing an einem Ohr. Unschlüssig verharrte sie nun auf der Stelle. Am Abend zuvor war sie den anderen Frauen ohne große Worte gefolgt. Es hatte noch nicht einmal die Zeit für eine gegenseitige Vorstellung gegeben. Der Schock über das Geschehene wich jetzt mehr und mehr der Erkenntnis darüber, dass nicht nur der Kaffee in ihrem Rucksack vakant war. Die Frau wunderte sich über ihre eigene Kaltschnäuzigkeit angesichts des Toten. Es wäre allerdings eine Verschwendung, den Kaffee zurückzulassen, und ihren Namen wusste niemand.
Sie sah sich um, ob der Schuss vielleicht jemanden angelockt hatte. Erschrocken ging sie in die Knie, ein blonder Mann mit schmalem Gesicht stand plötzlich neben Leos Leiche, die Frau kauerte sich tiefer auf den Erdboden. Ihr Herz setzte für einen Augenblick komplett aus, als der Blonde mit einer Pistole unbestimmt herumfuchtelte und sie dabei für einen Augenblick ins Visier nahm. Was sollte aus den Kindern werden, wenn es ihr wie Leo erging?
Die Frau betete stumm ein: »Gegrüßet seist du, Maria«, mit der inständigen Bitte an die Mutter Gottes, der Fremde möge sie nicht gesehen haben. Das half. Der Mann steckte die Waffe in die Jackentasche und kniete sich neben den Toten. Nach einigem Gezerre an der Leiche erschien ein Beutel an einer Kordel. Nachdem er wieder stand, streifte der Mann sich den Beutel über den Kopf. Dann lenkte er seine Schritte auf die zerstörte Kreisstadt zu.
Die Frau schickte ein weiteres, schnelles Dankgebet an die Mutter Gottes. Sie kam zu dem Entschluss, dass man das Schicksal nicht unnötig weiter herausfordern sollte. Der Kaffee aus ihrem Rucksack reichte ihr als Bezahlung für den Schrecken dieses Morgens. Vielleicht ließ sich damit sogar irgendwo etwas Medizin für Herrmann einhandeln. Die Frau überlegte. Sie musste ebenfalls nach Bitburg, die Kinder würden sich mittlerweile fragen, wo sie abgeblieben war. Sie entschied sich, in die entgegengesetzte Richtung des Mannes zu gehen, selbst wenn dies der längere Weg war. Mit dem Schmuggel war sie definitiv fertig. Sie schulterte den Rucksack und machte sich auf den Weg.
-2-
Der Weber-Hof bot ein Bild völliger Ruhe. Die Hitze nahm diesen Sommer kein Ende. Jetzt, am späten Nachmittag, flimmerte die heiße Luft über dem Kopfsteinpflaster des Hofes und dem Steinhaufen dahinter. Jedes Jahr wuchsen neue Kalksteine aus dem Eifelboden, die Jakob Weber zu einem kleinen Hügel hinter dem Backhaus stapelte.
»Jupp lässt ausrichten, du sollst die alten Rechnungen nicht vergessen.«
Jakob hatte seinen jüngsten Sohn Johannes losgeschickt, um in Jupps Wirtschaft eine Flasche Schnaps zu besorgen. Aber nun würde er den nächsten Frühschoppen wohl ausfallen lassen müssen.
Eigentlich besaß Jakobs Schwiegervater August ein eigenes Brennrecht. Weil der nicht mehr ganz richtig im Kopf war, kümmerte sich Jakob um die Brennerei. Unglücklicherweise trug Christine, die Tante seiner Frau Maria, den Schlüssel zum Lagerschrank stets in ihrer Schürze mit sich. Es blieb Jakob nichts anderes übrig, als Schnaps in der Dorfwirtschaft zu organisieren, wollte er nicht wie ein Geizkragen dastehen.
»An deiner Stelle würde ich mir die Schikanen von Christine nicht gefallen lassen.« Willi saß auf dem Stuhl in der Ecke neben dem Brennkessel. Rolfi, Jakobs großer Rottweiler, hockte mit schief gelegtem Kopf neben ihm.
Dankbar nahm Willi die ihm dargebotene Flasche entgegen. Sein Adamsapfel hüpfte bei jedem Schluck auf und ab. Mit einem befriedigten »Aah« gab er den Schnaps an Jakob zurück. »Das bringt die Lebensgeister zum Kichern.«
Jakob setzte seinerseits die Flasche an. Die Flüssigkeit bahnte sich wärmend ihren Weg seine Kehle hinunter.
»Wenn Christine früher zu frech geworden ist, habe ich sie an den Zöpfen gezogen.« Die Haut um Willis Augen legte sich in unzählige kleine Lachfalten. Willi war vor über fünfzig Jahren mit Christine in die Disselbacher Dorfschule gegangen. Damals hatte es vielleicht die Möglichkeit gegeben, an ihren Zöpfen zu ziehen. Heute erledigte sich dieses Thema mangels Haaren auf Christines Kopf von selbst.
»Christine konnte tanzen, da ist dir die Spucke weggeblieben.« Willis Augen verklärten sich.
Für eine tanzende Tante Christine fehlte Jakob die Fantasie. Willi war ein kleiner dicker alter Mann, dessen rot geädertes Gesicht sich um eine gewaltige Knollennase herum ausbreitete. Über dem rechten Ohr hing sein breitkrempiger Hut in keckem Winkel. Willi hatte viele Jahre als Maurer auf Baustellen außerhalb Disselbachs verbracht. Selbst wenn man die Hälfte der Geschichten über sein Berufsleben als Flunkerei abtat, war Willi in Deutschland weit herumgekommen. Danach half er noch einige Jahre im aktuell geschlossenen Steinbruch seines Schwiegersohns Valentin Neuerburg aus. Wie viele andere Dorfbewohner griff Jakob gelegentlich auf die Erfahrung und die ungebrochene Schaffenskraft des kleinen Mannes zurück. Es gab keinen Besseren im Dorf, wenn es darum ging, bauliche Veränderungen an Haus und Hof vorzunehmen.
Der Schornstein, an den der Brennkessel sowie der Herd in der Küche darüber angeschlossen waren, hatte bereits seit Monaten den ordnungsgemäßen Dienst verweigert. Zuletzt hatte sich die Küche bei jedem Anheizen in eine Räucherkammer verwandelt. Der größte Teil der Arbeit war bereits in der Woche zuvor erfolgt. Am Nachmittag waren sie dann fertig geworden. Kurz vor dem Abend glänzte nun frischer Mörtel in den Fugen des erneuerten Schornsteins. Den ganzen Tag über hatte Willi sich mit dem hofeigenen Viez zufriedengegeben. Zur Krönung des Feierabends gelüstete es ihn nach Hochprozentigem. Willis Vorliebe für klares Obstwasser war im Dorf mehr als bekannt. Weshalb er seit einer Weile ständig Bemerkungen über trockene Baustellen von sich gegeben hatte.
»Du wirst sehen, der Schornstein zieht jetzt wieder wie frisches Sauerkraut aus dem Fass.« Willi strich über das Mauerwerk. »Wir sollten ihn gleich anfeuern, um zu sehen, ob alles seine Richtigkeit hat.«
»Muss der Mörtel dazu nicht weiter trocknen?«
»Was glaubst du, warum ich den Quarzsand beigemischt habe?« Willi zog am linken Augenlid, um zu zeigen, dass er damit eines seiner kleinen Berufsgeheimnisse preisgab.
Kommentarlos ging Jakob nach draußen, mit einem Arm voll grob geviertelter Holzscheite kehrte er zurück. Willi öffnete die gusseiserne Tür unter dem kupfernen Kessel.
»Los, weiter frisch ans Werk! Steck etwas Papier zwischen die Scheite!«, befahl Willi Johannes.
Sorgsam zerriss der Junge einige Blätter der alten Zeitung, die zu diesem Zweck bereitlag, und stopfte sie in die Brennkammer.
Willi nahm einen der Schnipsel wieder heraus, um ihn mit Schnaps zu tränken. »Gutes Feuerwasser muss nicht nur innen brennen.«
Das getränkte Papier leuchtete blau, als es entzündet wurde. Willi hatte wie gewohnt gute Arbeit geleistet, der Unterdruck im Querschnitt des erneuerten Schornsteins sorgte für einen gleichmäßigen Sog an Sauerstoff durch die geöffnete Ofentür. Im Nu brannte ein lustiges Feuer, Willi grinste zufrieden. »So soll es sein, der Schornstein muss rauchen. Prost!«
Die Flasche gluckerte an seinem Mund. »Das genügt, du kannst die Tür schließen.«
Jakob gehorchte, das Rauschen der Flammen wurde leiser. Als er sich wieder aufrichtete, stand Tante Christine vor ihnen.
»Seid ihr verrückt geworden? Der Schornstein raucht, dass man es bis nach Bitburg sieht.« Sie blickte zur Flasche in Willis Hand. »Schnaps?« Das Wort klang aus ihrem Mund wie ein Fluch. »Wo kommt der her?« Sie sah Jakob an. »Woher hast du den Schlüssel?«
Jakob tropfte der Schweiß in die Augen.
Willi sprang ihm zur Seite. »Den Schnaps habe ich mitgebracht.« Er grinste sie an.
Ein Lächeln schlich sich auf Christines Lippen. Jakob hätte nicht gedacht, dass die Alte überhaupt die Muskeln für eine derartige Gesichtsbewegung besaß.
»Ach so. Ihr Handwerker solltet bei der Arbeit nicht so viel trinken. Das hält nur auf«, flötete sie.
Willi warf sich in die Brust. »Wer gute Arbeit leistet, der muss gut versorgt werden.«
»Jaja. Gute Arbeit hast du immer abgeliefert.«
Christine bückte sich zur Ofentür. Mit der in ihre Schürze eingewickelten rechten Hand öffnete sie die Tür. Eine Stichflamme schoss aus dem glühenden Inneren entlang ihres Kopftuchs nach oben zur Decke.
Willi reagierte tadellos. Entschlossen warf er die Tür wieder zu. Über Christines Kopftuch zog sich am Scheitel eine qualmende schwarze Rußspur hin.
»Um Himmels willen, Christine! Ist dir etwas geschehen?«
Die Alte umklammerte ihren Stock mit zitternden Fingern. »Nein, ich habe mich nur erschreckt.« Zur Bekräftigung schüttelte sie den Kopf. Diese Bewegung war zu viel für den angekokelten Stoff. Das Kopftuch rutschte langsam über ihre Ohren nach unten.
Ohne zu überlegen, zog Willi sein Taschentuch aus der Hosentasche und faltete daraus ein gleichmäßiges Dreieck. Widerspruchslos ließ Christine sich das schmutzige Tuch über das schüttere Haar ziehen und unter dem Kinn verschnüren.
»Jetzt siehst du wieder aus wie neu.« Willi strahlte.
Als echter Kavalier bot er ihr den angewinkelten rechten Arm an. Bereitwillig hakte Christine sich bei ihm ein.
»Komm, Willi, wir gehen rüber in die gute Stube. Vielleicht finden wir da noch einen kleinen Likör.«
Willi nickte, so als hätte er nichts anderes erwartet. Zu Jakob gewandt, meinte er: »Du kannst mit Johannes saubermachen.«
Das merkwürdige Paar schwebte über die Treppe auf den Hof hinaus.
Jakob folgte den beiden nach draußen. Von der Straße nach Badem erklang das Brummen eines Automotors. So etwas war in Disselbach keine Selbstverständlichkeit. Vor dem Krieg hatte es bei ihnen in der Gegend kaum Autos gegeben, nun, zwei Jahre danach, waren es noch weniger geworden. Aus diesem Grund glaubte Jakob, das Motorengeräusch identifizieren zu können. Es gab derzeit nur ein Auto im Dorf. Und tatsächlich sauste wenige Sekunden später dieser merkwürdige Schwimmwagen über die Hauptstraße. Am Lenkrad saß ihr Ortsbürgermeister Valentin Neuerburg.
»Na, wenn das mal nicht mein Prachtexemplar von Schwiegersohn gewesen ist«, kommentierte Willi.
»Der ist in aller Herrgottsfrüh nach Bitburg gefahren. Eigentlich wollte er zum Mittag wieder zurück sein, hat mir Walburga erzählt. Er muss wohl aufgehalten worden sein. Weiß der Himmel, welche krummen Dinger der gerade wieder dreht.«
Walburga war Willis Tochter und Valentins Ehefrau.
Jakob legte normalerweise Wert darauf, über das, was im Dorf geschah, gut unterrichtet zu sein. Erfahrungsgemäß war es jedoch besser, nicht alle Details über das zu wissen, was ihr Bürgermeister so trieb.
-3-
Von der Straße, die von Badem her ins Dorf hineinführte, stieg eine Staubwolke auf. Blinzelnd versuchte Karl Bermes, etwas zu erkennen. Er war eben dabei, seine einachsige Handkarre mit dem Werkzeug aus der Sakristei-Gasse auf die Hauptstraße zu schieben. Das Fenstergitter für die Sakristei hatte fast ein Jahr auf seinen Einbau warten müssen, ehe der Pfarrer ihm eine akzeptable Bezahlung hatte anbieten können.
Ein Auto hielt mit hoher Geschwindigkeit genau auf ihn zu. Der sehr spezielle Kübelwagen war, wie so vieles, ein Überbleibsel des Krieges. Trotz Karls diskreter Fragen wollte Valentin nicht mit der Sprache herausrücken, wie das Fahrzeug in seinen Besitz gewechselt war. Zu tief wollte Karl nicht nachbohren, es gab da schließlich auch die etwas heiklen Besitzverhältnisse für sein Motorrad. Die BMW war im Waldlager bei den letzten Kampfhandlungen 1945 vergessen worden. Josef Bermes hatte beherzt zugegriffen, weil er die Leidenschaft seines jüngsten Sohnes für alles, was einen Motor besaß, kannte. Die Maschine stand danach fast ein Jahr unter altem Stroh versteckt, bis Karl aus der Gefangenschaft zurück war. Der betrachtete das Zweirad als Belohnung für geleistete Dienste an Führer, Volk und Vaterland.
Als Eigentümer des Disselbacher Steinbruchs und des örtlichen Kramladens verfügte Valentin Neuerburg über gute Kontakte. Der Besitz eines Autos war dennoch keine Selbstverständlichkeit. Vom Standardauto der Wehrmacht, dem Kübelwagen, gab es einige Unterarten. Die Ingenieure in Wolfsburg hatten sich eine Variante ausgedacht, die in der Lage war, kleinere Gewässer schwimmend zu überqueren. Dafür gab es eine dichte Stahlwanne sowie einen kleinen Propeller hinten für den Antrieb im Wasser. Der Schwimmkübel war derzeit der ganze Stolz des Bürgermeisters. Trotz der schwierigen Versorgungslage mit Benzin machte Valentin praktisch keinen Schritt mehr zu Fuß. Obwohl sein Laden nur wenige Meter von der Kirche entfernt lag, fuhr er mit dem Wagen, samt Gattin und Kindern, sogar zum Hochamt am Sonntag an der Kirche vor.
Valentin jagte nun über die Straße auf Karl zu, als gelte es, den großen Preis von Disselbach zu gewinnen. Bei Jupps Wirtschaft gelang es einem Huhn erst im letzten Moment unter Aufbietung aller Flugkünste, nicht als Kühlerfigur zu enden. Karl steuerte vorsichtshalber seine Karre etwas nach links, mit Flattern wäre er nicht weit gekommen. Die Richtungskorrektur hätte er sich sparen können, der Bürgermeister bemerkte ihn. Die Bremsen des Kübelwagens schrillten, als er kurz vor Karl stehen blieb. Der Staub, den dieses Manöver aufwirbelte, umwaberte sie wie eine braune Nebelbank. Karl schloss die Augen. Ende der Dreißigerjahre hatten die Arbeitsdienstmänner aus dem Lager im Wald die gepflasterte Hauptstraße durch den Ort mit einer dünnen Teerschicht aus Restbeständen versehen. Da sich anschließend niemand mehr um den Unterhalt der Straße kümmerte, gab es mittlerweile große Lücken im Belag, durch die das alte Pflaster durchblitzte und wo sich jede Art von Dreck ablagern konnte.
»Karl!« Neuerburg hielt das Lenkrad fest umklammert. Er drehte den Kopf weit nach rechts und dann nach links, ehe er ihn zu sich winkte.
Karl stellte seine Karre ab. »Valentin?«
»Ist jemand im Dorf gewesen, der nach mir gefragt hat?« Der Bürgermeister sah sich erneut nervös um.
»Bei mir in der Schmiede nicht. Du solltest zu Hause im Geschäft nachhören.«
Der Staub verpasste der alten Friedhofsmauer an der Kirche eine weitere braune Schicht. Von der anderen Straßenseite sah der Küster des Dorfes, Eusebius Schmitz, Eus genannt, zu ihnen herüber. Dass er so nahe an der Kirche wohnte, wurde wegen seines verkürzten rechten Beins allgemein als sinnvoll angesehen. Karl grüßte ihn, Eus nickte stumm zurück. Der Bürgermeister hob sich etwas aus dem Sitz, um nach hinten sehen zu können.
»Es ist wirklich niemand hier gewesen?«
»Valentin, ich bin den größten Teil des Nachmittags hinter der Sakristei beschäftigt gewesen. Wenn ich konzentriert arbeite, hätte hier auf der Hauptstraße eine Parade mit Panzern stattfinden können, ohne dass ich es bemerkt hätte.«
Ihr Ortsbürgermeister zappelte nervös im Autositz herum. »Karl, du hast doch so gute Kontakte zur Polizei.«
Was eine Frage des Betrachtungswinkels war. Im letzten Sommer hatte Karl sich intensiver mit der Polizei herumschlagen müssen, als ihm lieb war. Begonnen hatte alles mit dem Mordanschlag auf seinen besten Freund Werner. Danach hatte er sich einige Tage mit einem französisch-deutschen Polizeigespann herumärgern dürfen. Im wenige Kilometer entfernten Kyllburg hatten die Franzosen in dem, was noch vom einst edlen Hotel Eifeler Hof stand, ihre Kommandantur für die Gegend eingerichtet. Nach den Vorfällen im Steinbruch war Karl regelmäßig dorthin kutschiert worden. Es gab zahlreiche amtliche Befragungen, die meisten davon erfolgten auf Französisch mit Dolmetscher. Unendlich lange Protokolle waren erstellt worden, die er alle lesen und unterschreiben musste. Immerhin sprach man ihn am Ende von allen Verdachtsmomenten frei. Anschließend erschien der deutsche Polizist, Kriminalsekretär Peters, noch einige Male allein in Disselbach. Es hatte etwas gebraucht, bis er endgültig akzeptierte, dass Karl für das Chaos im Steinbruch nicht verantwortlich gewesen war.
Die Gespräche mit dem sarkastischen Kettenraucher konnten sehr tiefgehend sein, unterhaltsam waren sie immer gewesen. Wobei Karl es für nicht ausgeschlossen hielt, dass die wiederholten Visiten mit dem echten Bohnenkaffee, den er zu bieten hatte, zusammenhingen. Sicher war er sich jedenfalls darüber, dass der Kriminalsekretär sich freute, mit jemandem reden zu können, der angesichts der Polizei nicht in Schockstarre verfiel.
Peters hatte ihn das letzte Mal im April in der Schmiede besucht. Die gut vierzig Kilometer von Disselbach nach Trier bedeuteten so kurz nach dem Krieg eine halbe Weltreise. Selbst ein Polizist konnte nicht einfach so in der Gegend herumfahren.
Es gab Karls Funkgerät, das sein Vater zusammen mit dem Motorrad im Waldlager nach dem Rückzug der Wehrmacht konfisziert hatte. Alles, was sich tragen oder bewegen ließ, verschwand in den Häusern und Schuppen des Dorfes. Das Funkgerät hatte einen Schuss abbekommen. Da nur einige Röhren defekt gewesen waren, hatte Peters im Herbst die benötigten Ersatzteile besorgt, damit sie in Kontakt bleiben konnten. Außer sehr sporadischen Funksprüchen im Frühjahr gab es aktuell keinerlei nennenswerte Anknüpfungspunkte zum Polizisten. Ein Umstand, den Karl eigentlich schade fand.
»Valentin, ich habe hier im Dorf keine Polizei gesehen.«
Neuerburgs Augen wanderten erneut unruhig umher. »Na gut, Karl. Sollte jemand nach mir fragen, sag ihm, du hast mich nicht gesehen.«
Der Bürgermeister gab abrupt Gas. Karl schloss die Augen wegen der erneuten Staubentwicklung. Als er sie wieder öffnete, befand sich der Kübelwagen bereits auf der kleinen Brücke, die über den Disselbach führte. Gleich danach bog er nach rechts in die Gasse ab, die zum Geschäfts- und Wohnhaus der Neuerburgs führte.
Karl versuchte erfolglos, einen Sinn in diesem merkwürdigen Gespräch zu finden. Seit ihr Ortsbürgermeister den Schwimmwagen vor fünf Monaten erworben hatte, war er damit ständig in irgendwelchen Geschäften unterwegs. Wie man hörte, hatte dies zur Folge, dass der Steinbruch im Herbst wieder öffnen durfte. Es war Valentin gelungen, die benötigten Genehmigungen sowie entsprechenden Bauprojekte für seine Steine zu organisieren.
Für Karl bedeutete der Wagen eine unverhoffte, regelmäßige Einnahmequelle. Das Auto war für den Krieg gebaut worden, und das sah man ihm auch an. In der Beifahrertür gab es mehrere Einschusslöcher. Karl wollte gar nicht erst wissen, woher der dunkle Fleck auf dem Beifahrersitz stammte.
Neuerburg hatte von Autos so viel Ahnung wie Karl vom Korbflechten. Das Verhältnis der Familien Bermes und Neuerburg blickte auf eine lange, spannungsreiche Geschichte zurück – ganz abgesehen von Valentins Rolle in der Affäre rund um Werner Schomer. Dennoch war Karl als Dorfschmied vom Bürgermeister dazu auserkoren worden, alles, was am Kübelwagen defekt war, zu reparieren. Fahrzeugtechnik gehörte nicht zu den Standardaufgabengebieten eines Schmieds, doch Karl war von allem Mechanischen fasziniert. Dank seines Motorrads und des fahrbaren Untersatzes des Ortsbürgermeisters konnte er seine Kenntnisse über Kraftfahrzeuge weiter vertiefen. Dass dabei ein halbwegs regelmäßiges Einkommen heraussprang, war ein angenehmer Nebeneffekt.
Valentin Neuerburg war normalerweise sehr von sich und dem, was er tat, überzeugt. Sein seltsames und aufgeregtes Verhalten jetzt konnte nur bedeuten, dass irgendetwas bei einem seiner Geschäfte nicht so gelaufen war wie gedacht.
-4-
Die Schublade klemmte mal wieder und weigerte sich, den Bleistiftspitzer freizugeben. Pauline Globkow zerrte entnervt am Griff. Der Tisch in der ehemaligen Kommandeursbaracke des Waldlagers hatte sich in den letzten anderthalb Jahren zu ihrem Arbeitsplatz entwickelt. Dabei verdiente das Gebilde, an dem sie Tag für Tag saß, nicht die Bezeichnung Schreibtisch. Der größte Teil bestand aus einem vermutlich einstmals stabilen Esszimmertisch, dem zwei Beine abhandengekommen waren. Ersetzt wurden diese durch grobe, halbwegs gerade Äste. Mit diversen Unterlegteilen versuchte Pauline seit Längerem, den Tisch am Wackeln zu hindern, jedoch mit mäßigem Erfolg. Die kleinste unachtsame Bewegung genügte, um das Mistding aus dem Gleichgewicht zu bringen. Pauline schaffte es die meiste Zeit, sich nicht darüber aufzuregen. So wie sie sich in den nun fast zwei Jahren, die sie im Lager wohnten, generell bemühte, sich nicht über alles aufzuregen, was an ihren Nerven zerrte. So etwas ließ sich leicht beschließen, die ordentliche Portion Jähzorn, die ihr als Charaktereigenschaft mitgegeben worden war, gestaltete das Umsetzen jedoch oft schwierig.
Schräg gegenüber glänzte der zweite Arbeitsplatz im Raum mit der Abwesenheit ihres Vaters. Als dieser fürchterliche Glatzkopf von der Waffen-SS sie im letzten Jahr entführt hatte, hatte Friedrich Globkow sich ihm und seinen Kumpanen entgegengestellt. Danach lag er fast zwei Monate im Krankenhaus. Mit seiner Gesundheit stand es ohnehin nicht zum Besten, seit er im Ersten Weltkrieg an der Ostfront durch eine Handgranate schwer verletzt worden war. Nach seiner Genesung schlurfte er den Herbst über wie ein alter Mann mühsam durch die Gegend. Was folgte, war dieser nicht enden wollende, beißend kalte Winter. Paulines Mutter Helene hatte ernsthaft befürchtet, dass ihr Mann die eisige Kälte und die wochenlange Mangelversorgung nicht überleben würde. Zum Glück hatte sie sich getäuscht.
Alles andere hätte Pauline als himmelschreiende Ungerechtigkeit empfunden. Ihr Vater war einer der wenigen Menschen, die sie kannte, der sich nie mit den Nazis arrangiert hatte. Vor der Machtergreifung war er auf dem Einwohnermeldeamt in Breslau beschäftigt gewesen. Die Globkows stammten aus einer alten traditionsbewussten schlesischen Bergarbeiterfamilie, die sich mit jeder Generation die gesellschaftliche Leiter weiter nach oben gearbeitet hatte. Arbeitnehmerrechte sowie die Notwendigkeit, dafür einzustehen und wenn nötig zu kämpfen, waren für ihren Vater nicht nur Parolen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war er in die Jugendorganisation der SPD eingetreten. Nach dem Krieg bekleidete er verschiedene kommunale Posten für seine Partei. Kurz nachdem die braunen Truppen dann das Kommando übernommen hatten, verlor er seine Stelle auf dem Amt. Die Nazizeit über arbeitete er in verschiedenen schlecht bezahlten Aushilfsstellen weit unter seinen Möglichkeiten.
Als Jugendliche hatte Pauline davon geträumt, in einem Hotel zu arbeiten. Sie verschlang Bücher wie andere Leute Süßigkeiten. Irgendwann fiel ihr Vicki Baums Menschen im Hotel in die Finger. Die Schilderungen rund um die vielen exotischen Menschen in diesem Roman ließen sie nicht mehr los. Leider taugten die Zeiten nicht für große Träume. Trotz ihrer guten Noten auf dem Gymnasium hatten ihre Eltern am Ende das Schulgeld nicht mehr aufbringen können. Pauline ging mit der Mittleren Reife ab. Bei den Nazis hatten kluge Frauen ohnehin nicht hoch im Kurs gestanden. Es fand sich eine Ausbildungsstelle zur kaufmännischen Kraft in einer Fabrik für Hausgeräte. Sie absolvierte diese Lehre ohne große Probleme, dafür allerdings mit viel Langeweile.
Anfang 1945 standen die Russen nicht mehr weit von ihrer alten Heimatstadt Breslau. Eigentlich hatte der Gauleiter von Niederschlesien, Karl Hanke, es verboten, nach Westen zu fliehen. Er erklärte Breslau sogar zur Festung. Wer mit genügend Verstand gesegnet war, kümmerte sich nicht um diese Anordnung. Eines Nachts im Januar 45 brach Pauline mit ihren Eltern ohne große Vorbereitung auf. Jeder durfte einen Koffer mit etwas Kleidung und Unterwäsche mitnehmen. Ihr Vater vertrat die Meinung, es wäre wichtiger, das Leben zu retten als irgendwelche Sachen, die man später wieder kaufen konnte. In seinem Rucksack befanden sich alle wichtigen Papiere der Familie. Trotz ihrer heftigen Proteste hatte Pauline nicht ein Buch mitnehmen dürfen. Alles Flehen oder Stampfen mit den Füßen konnte ihren Vater nicht erweichen. Viel später, als sie bereits Hunderte von Kilometern marschiert waren, verstand Pauline, dass er recht gehabt hatte.
Das Kriegsende hatten sie in Nürnberg erlebt. Bis in die fränkische Metropole war die Reise unglaublich verschlungen gewesen, alles versank im Chaos. Manchmal nahm sie ein Wehrmachts-Lkw mit, ab und zu konnte man einige Kilometer mit der Reichsbahn zurücklegen. Meistens ging es nachts zu Fuß nach Süden. Immer mit der Angst im Genick, dass ein SS-Kommando ihren Vater als Kämpfer rekrutieren wollte, trotz seines Ausweises, der ihn für wehruntauglich erklärte. Für mehrere Wochen waren sie in einem provisorischen Feldlager auf dem riesigen, ehemaligen Reichsparteitagsgelände der NSDAP untergekommen. Wegen der schlechten Nachrichten aus den von den Russen besetzten deutschen Ostgebieten hatten sich Paulines Eltern schweren Herzens dazu entschlossen, ihr Glück weiter im Westen zu versuchen. Ein Zug transportierte sie nach Koblenz, wo ihr Waggon falsch angekoppelt wurde, sodass sie nicht Frankfurt, sondern Trier an der Mosel erreichten. Keiner von ihnen hatte jemals etwas von dieser Stadt gehört. In Ermangelung an Alternativen waren sie im Oktober 1945 auf einen französischen Lkw geklettert, der von Trier aus hinauf in die Eifel fuhr. War bereits Trier Neuland gewesen, so klang Disselbach genauso wie die hinterste Provinz, die es auch war.
Der französischen Besatzungsmacht kam es gelegen, dass es dort im Wald ein aufgelassenes Lager des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes gab. Das umzäunte Gelände war eine staatliche Liegenschaft. Da das Deutsche Reich untergegangen war, entfiel die Notwendigkeit, sich mit irgendwelchen Besitzern über die Rechtmäßigkeit der Zuweisungen streiten zu müssen.
Die Globkows wurden als eine der ersten Familien in den flachen Baracken des Waldlagers einquartiert. Ihr Vater war nach dem langen Herumirren in Deutschland zu schwach, um erneut auf die Reise zu gehen.
Paulines Koffer war unterwegs auf der Strecke geblieben, der Rucksack ihres Vaters mit den Papieren zum Glück nicht. So konnte Friedrich Globkow den französischen Behörden seine alten SPD-Parteibücher vorzeigen und damit nachweisen, dass er von Anfang an ein Gegner der Nazidiktatur gewesen war. Dies sowie seine Fähigkeiten als Verwaltungsbeamter führten dazu, dass er im Winter 1945/46 zum Vorsteher des Lagers ernannt worden war.
Eine Weile lief alles mehr oder weniger in geordneten Bahnen, bis zum August 1946. Innerhalb weniger Tage hatte sich für Pauline ein Albtraum entwickelt, der aus heiterem Himmel über sie hereingebrochen war. Dabei hatte alles sehr vielversprechend für sie begonnen. Nach der mysteriösen Explosion mit dem Toten, unweit des Lagers, war wenig später der Disselbacher Dorfschmied, Karl Bermes, bei ihnen aufgetaucht. Obwohl das in den Romanen gerne thematisiert wurde, hielt Pauline Liebe auf den ersten Blick für eine Erfindung und ein Klischee der schreibenden Zunft. Deshalb konnte sie es kaum glauben, wie sehr sie der Anblick des großen, breitschultrigen Schmieds mit den dunklen, fast schwarzen Haaren und den warmen braunen Augen elektrisiert hatte. Karl verhielt sich ihr gegenüber wie ein Tollpatsch, was ihn für sie nur noch attraktiver machte. Bevor sich etwas Ernsthaftes zwischen ihnen anbahnen konnte, geriet allerdings einiges im Dorf und im Lager gehörig aus dem Lot. Praktisch zeitgleich mit Karl erschien der Mann mit der Glatze, Gottfried Huber, ein ehemaliger Offizier der Waffen-SS. Ohne dass sie hätte sagen können, wie, wurde Pauline in den Sog der Ereignisse hineingezogen.
Es war Karl Bermes gewesen, der ihr im Steinbruch das Leben gerettet hatte. Dennoch war es ihr lange schwergefallen, so etwas wie Dankbarkeit für ihn aufzubringen. Karl hatte vor ihrer Entführung und dem Kampf im Steinbruch die Gelegenheit gehabt, die Polizei zu alarmieren. Er kannte als Einziger die Zusammenhänge zwischen den SS-Leuten und seinem Freund Werner. Für Pauline stand außer Frage, dass, hätte der Schmied diesen Kriminalpolizisten früher über sein Wissen informiert, ihrem Vater nichts geschehen wäre.
Seit den Ereignissen war bereits fast ein Jahr vergangen. Den Herbst über war Pauline grundsätzlich nicht bereit gewesen, Karl Bermes zu verzeihen. Dann folgte der lange, kalte Winter. Für sie gefror die komplette Welt zu einem einzigen eisigen Klumpen, inklusive ihrer Gefühle.
Eigentlich war sie Karl mittlerweile gar nicht mehr böse, bisher hatte sich jedoch leider noch keine gute Gelegenheit zur Aussprache ergeben. Bei zufälligen Begegnungen verhielt Karl sich weiter wie ein unbeholfener Jüngling, der kaum den kurzen Hosen entwachsen war.
Gedankenverloren griff Pauline nach dem goldenen Anhänger mit der heiligen Hedwig von Schlesien an ihrem Hals. Ihre Großmutter Paula hatte ihr sowie ihrem Bruder Rudi zu Beginn des Krieges identische Anhänger als Talisman geschenkt. Die Großmutter war vor vier Jahren gestorben, Rudi wurde seit drei Jahren in Norditalien vermisst.
Das Leben ging weiter, ein Tag reihte sich an den nächsten. Früher hatte sie sich in die Traumwelt ihrer Romane geflüchtet. Dafür war sie inzwischen zu erwachsen, und die komplizierte Realität, so kurz nach dem Krieg, eignete sich nicht für Tagträume. Es würde kein edler Ritter in glänzender Rüstung erscheinen, um sie aus diesem Elend zu befreien. Hier in der Eifel gab es sowieso einen eklatanten Mangel an edlen Rittern. Dabei hätte sie durchaus mit dem ortsansässigen Schmied als Retter vorliebgenommen, wäre der nur nicht so unbeholfen und stoffelig im Umgang mit ihr. Man konnte von einem großen, starken Mann wie Karl Bermes doch wohl erwarten, dass er die Initiative ergriff.
Nun saß sie hier an diesem Schrottteil von Schreibtisch und musste die Aufgaben ihres Vaters übernehmen, weil der nur stundenweise arbeiten konnte. Ihre Ausbildung kam ihr zupass. Wieder galt es Bilanzen im Gleichgewicht zu halten. Wobei das Soll gegenüber dem Haben ständig die höheren Gewichte auf die Waage brachte. War das alles nicht etwas viel Verantwortung, die man auf ihren schmalen Schultern ablud? Schließlich war sie gerade erst zwanzig geworden. Den Leuten im Lager waren solche Feinheiten egal, solange jemand die Verantwortung übernahm. Pauline war zu der Überzeugung gekommen, dass es für die meisten am allerwichtigsten war, sich bei jemandem beschweren zu können. Allein über das ständige Genörgel und Gemecker hätte sie ganze Bücher schreiben können. Ihr wurde in dieser Gemengelage in etwa der Status einer Kronprinzessin zuerkannt, die in Vorbereitung auf ihre zukünftige Tätigkeit als Königin den kranken Herrscher vertreten musste. Nur hatte sie niemand gefragt, ob sie daran interessiert war, und in den Märchen wurde das Dasein als Prinzessin sowieso eindeutig geschönt dargestellt.
Die Tür in der rechten Zwischenwand öffnete sich. Dahinter befanden sich die Räume, die ursprünglich als Wohnung des Kommandanten des Arbeitslagers gedient hatten. Derzeit handelte es sich um die Residenz der Familie Globkow. Ein eigenes Zimmer war der einzige Luxus, der Pauline zugestanden wurde.
Ihr Vater schlurfte in den Raum. Immerhin konnte er wieder ohne Stock gehen, selbst wenn seine Gesichtsfarbe an den Inhalt eines Ascheeimers erinnerte.
»Ist etwas gewesen, Paulchen?«
Pauline hasste es, wenn er sie Paulchen nannte, sie war kein kleines Kind mehr. Wegen seines Zustands unterließ sie es, ihn darauf hinzuweisen.
»Frau Solkowski ist mal wieder der Meinung, ihr würde mehr Brot zustehen, wegen ihrer Eltern.«
Friedrich Globkow schüttelte den Kopf. »Es ist mir unverständlich, manchen Leuten kann man es einfach nicht recht machen. Wir sorgen doch nun wirklich dafür, dass alle gerecht behandelt werden.«
Trotz seines Schneckentempos hatte ihr Vater seinen ebenfalls zusammengezimmerten Schreibtisch gegenüber Paulines Tisch erreicht. Der alte Holzstuhl dahinter wackelte bedenklich, als Globkow sich wie ein nasser Sack darauf fallen ließ. »Heute Nachmittag kommt der Versorgungs-Lkw mit dem Petroleum. Es gibt bei der Gelegenheit eine weitere Ladung dieser neuen Carepakete aus Amerika. Frau Solkowski wird davon ebenfalls möglichst viele abgreifen wollen.«
Pauline nickte. Es gab Nervensägen im Lager, und es gab Frau Solkowski.
»Paulchen, würde es dir etwas ausmachen, wenn du dich um die Verteilung der Pakete kümmerst? Die verdammte Hitze setzt mir zu.«
Wieder nickte Pauline automatisch, wer sollte sich sonst kümmern? Dabei wünschte sie sich weit weg. Egal wohin, Hauptsache, weit weg von Disselbach und dem Lager.
-5-
Es führten nicht alle Wege Disselbachs nach Rom. Dafür konnte man auf der Hauptstraße nicht das Dorf durchqueren, ohne an der Dorfschule vorbeizukommen. Fräulein Schneebach, die Volksschullehrerin, lehnte am Rahmen der Eingangspforte zum Schulhof. Das Fräulein stammte aus Ostpreußen. Gleich nach ihrer Ausbildung 1913 war sie in die örtliche Dorfschule versetzt worden und residierte seitdem in der geräumigen Lehrerwohnung über dem Schulsaal. Vor etwas mehr als zehn Jahren war Karl ihr erklärter Lieblingsschüler gewesen. Dieses gute Verhältnis überdauerte das Ende von Karls Schulzeit und den Krieg. Das Fräulein stattete der Schmiede regelmäßig Besuche ab, Karl ließ sich hin und wieder in der Schule blicken, um mit ihr über die Dinge des Lebens zu plaudern. Dabei war es ihr sehr wichtig, dass Karl verstand, was sie umtrieb. Andere Disselbacher nickten nur höflich bei ihren Ausführungen, weil sie als Volksschullehrerin eine der höchsten Autoritäten war, die das Dorf zu bieten hatte.
Ihre Freundschaft hatte sich nach den Ereignissen im Steinbruch im Jahr zuvor sogar noch ein wenig vertieft. Nachdem alles vorbei gewesen war, hatte Karl das Fräulein aus einem Verschlag für Arbeitsmaterial befreien können.
Wieder stellte er seine Karre ab. »Fräulein Schneebach.«
»Guten Tag, Karl, was ist das denn eben gewesen? Um ein Haar hätte Jupp heute Abend Brathähnchen in seiner Wirtschaft servieren können.«
Karl sah die Straße entlang zum Disselbach, wo Neuerburg verschwunden war. »Gute Frage. Für mich hat es so ausgesehen, als befände Valentin sich auf der Flucht.«
»Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Wer sich in Gefahr begibt und so weiter. Ich werde dem Laden nachher einen Besuch abstatten. Mal sehen, was Walli mir so erzählt.«
Seitdem der Bürgermeister über einen fahrbaren Untersatz verfügte und ständig geschäftlich in der Gegend herumgondelte, stand seine Frau Walli die meiste Zeit im Laden. Fräulein Schneebach pflegte zu ihr ein fast so gutes Verhältnis wie zu Karl. Die Lehrerin konnte sich furchtbar darüber aufregen, dass Walli, die ebenfalls eine ihrer Musterschülerinnen gewesen war, ausgerechnet jemanden wie Valentin Neuerburg geheiratet hatte.
»Du hast das Gitter an der Sakristei angebracht?«
Karl nickte.
»Gut. Es macht keinen Sinn, wenn das Ding bei dir in der Schmiede Rost ansetzt. Wie will dich der Pfarrer bezahlen? Doch wohl hoffentlich nicht mit einem ›Vergelt’s Gott‹ und zehn Vaterunser für deine arme Sünderseele?«
»Etwas Beten für mich könnte bestimmt nichts schaden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er mir vier Benzinkanister aus dem bischöflichen Fuhrpark in Trier besorgt.«
Das Fräulein sah ihn skeptisch an. »Seine Durchgeistigkeit lässt sich auf solche weltlichen Geschäfte ein?«
Den Titel »Durchgeistigkeit« hatte die Lehrerin dem Priester wegen seiner Gewohnheit, mit auf dem Bauch gefalteten Händen sehr langsam durch die Gegend zu wandeln, verpasst. Trotz grundsätzlich unterschiedlicher Weltanschauungen mussten die evangelische Lehrerin und der katholische Priester sich irgendwie zusammenraufen. Der Pfarrer war für den Religionsunterricht in der Disselbacher Volksschule zuständig.
»Wie er das Benzin nach Disselbach schafft, ist mir egal. Ich kann es brauchen.«
Das Fräulein verschränkte die Hände hinter dem Rücken. »Wie dem auch sei. Hast du gehört, dass wir einen neuen Ministerpräsidenten haben?«
Seit dem Spätsommer 1946 gab es das neue Land, in dem sie nun lebten: Rheinland-Pfalz. Welche Auswirkungen das für die Bewohner Disselbachs haben sollte, wusste bisher niemand sinnvoll zu beantworten. Als gelernte Preußin wurde das Fräulein nicht müde, ständig den Unsinn dieser Maßnahme zu betonen. Vielleicht hatte sie mit ihrer Vermutung recht, diese Gründung sei nur ein Versuch der Besatzer, sich Deutschland mundgerecht zurechtzustutzen. Jedenfalls ergaben sich aus dieser Neugründung bisher keine konkreten Auswirkungen auf ihr Leben. Die Versorgungslage war nach wie vor schlecht. Die vielen Flüchtlinge im alten Reichsarbeitsdienstlager im Disselbacher Forst sorgten für Unruhe. Als Besatzer bestimmten die Franzosen weiter, was man tun oder lassen durfte. An allem herrschte Mangel, und Neuanschaffungen waren fast unmöglich. Herzlich willkommen in der neuen Friedenszeit.
Verschiedene politische Parteien waren für Karl eine grundsätzlich interessante, aber neue Erfahrung. Als Hitler sich zum Führer aller Deutschen ermächtigt hatte, selbst von denen, die das für keine gute Idee gehalten hatten, war Karl elf Jahre alt gewesen.
Die Besuche von Kriminalsekretär Peters im Herbst hatten sich nicht ausschließlich um Werner und die SS gedreht. In den sich mühsam entwickelnden Strukturen der meist neuen westdeutschen Länder war Peters viel daran gelegen, seinen Mitmenschen von den Segnungen demokratischer Verhältnisse und von der Gewaltenteilung zu predigen. Damit konnte er noch penetranter als das Fräulein sein. Während der Weimarer Republik war er als Polizist in Köln angestellt gewesen und damit alt genug, um verstanden zu haben, was Demokratie bedeutete. Unter den Nazis wurde er auf einem Karriere-Abstellgleis geparkt, weil er die braunen Machthaber nicht leiden konnte. Die Kriegszeit hatte er als Militärpolizist verbracht.
Die Lehrerin saugte ihrerseits alle Informationen aus sämtlichen Zeitungen, die den Weg nach Disselbach fanden, begierig auf. Da sie Karl meistens umgehend mit den neuesten Informationen aus Deutschland und der Welt versorgte, brauchte der sich nicht die Mühe zu machen. Das Fräulein war für ihn so etwas wie eine tönende Wochenschau, nur ohne bewegte Bilder.
»Soll mich das jetzt wundern? Wir haben vor acht Wochen gewählt. Wenn ich den Kriminalsekretär da richtig verstanden habe, ist es das Ziel von Wahlen, dass am Ende jemand so ein Amt bekommt.«
Die erste Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag war im Schulsaal durchgeführt worden. Valentin Neuerburg hatte sich als Verantwortlicher im Dorf dermaßen aufgespielt, dass man hätte meinen können, er hätte das Prozedere höchstpersönlich erfunden.
»Das stimmt, aber Ministerpräsident Boden ist zurückgetreten, der Neue heißt Peter Altmeier.«
»Wenn Sie das sagen.«
Der erste Name sagte Karl etwas. Das Fräulein regte sich seit seiner Wahl gerne über ihn auf. Den zweiten Namen kannte er nicht.
Prompt legte sie wieder los. »Dieser feine Herr Boden ist nun wirklich nicht als Landesoberhaupt tragbar gewesen. Es braucht keinen Regierungschef, der der Meinung ist, es dürften nicht so viele protestantische Flüchtlinge in ein mehrheitlich katholisches Land kommen. So etwas ist eine Unverschämtheit. Wo stünden denn heutzutage Regionen wie die Eifel ohne die protestantischen Preußen?«
Karls Erfahrung mit dem preußischen Wesen bezog sich in erster Linie auf die Jahre als Soldat im Krieg. Den größten Teil davon hatte er glimpflich in einem Luftwaffenbunker am Atlantik in Frankreich hinter sich gebracht. Er sah die Segnungen der Preußen trotzdem eher zwiespältig, unterließ es jedoch, sich darüber mit dem Fräulein zu streiten. Die war ohnehin bereits weiter in ihren Gedanken.
»Das mit der Allparteienregierung halte ich für ausgemachten Blödsinn, zu viele Köche verderben nur den Brei. Meiner Meinung nach muss es eine Regierung und eine Opposition geben. Was geschehen kann, wenn das nicht so ist, haben wir zwölf Jahre erleben dürfen. Die Natur ist stets auf ein Gleichgewicht bedacht. Unterschiedliche Kräfte heben sich gegenseitig auf. Kraft erzeugt Gegenkraft, actio est reactio. Das ist das Gesetz der Natur.«
Karl schwieg. Wenn sie so in Fahrt war, ließ man sie am besten ungestört zum Ende kommen.
»Herr Globkow sieht das vermutlich anders, weil seine Sozis auf diese Weise Teil der Regierung sind.«
Die Globkows. Das war ein Thema, das für Karl wesentlich wichtiger war als irgendwelche Ministerpräsidenten, die im fernen Koblenz residierten.
»Wie geht es Herrn Globkow?« Karl versuchte, möglichst neutral zu klingen.
Die Lehrerin kniff die Augen zusammen. »Das Lager im Wald ist keine zwei Kilometer entfernt. Es würde dir bestimmt keine körperlichen Schmerzen bereiten, den Globkows einen Höflichkeitsbesuch abzustatten.«
Karl sagte nichts, es war ein heikles Thema.
»Nun, es geht ihm langsam besser. Das heiße, trockene Wetter macht ihm zu schaffen, es ist aber besser als die Kälte.«