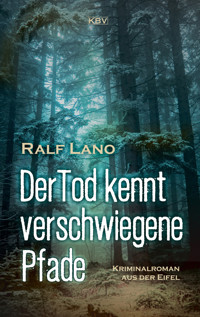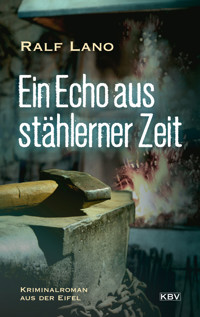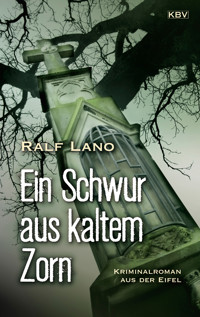
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Eifeler Dorfschmied ermittelt
- Sprache: Deutsch
Im Schatten des Kreuzes Der dritte Band der historischen Eifelkrimi-Reihe Das Leben in der Südeifel ist im Herbst 1947 durch eine verheerende Missernte und die Repressionen der Besatzer zunehmend schwerer geworden. Im Dorf Disselbach bereitet man sich dennoch auf hohen Besuch vor: Ein päpstlicher Ehrenprälat soll auf seiner Reise von Köln nach Trier im Ort einkehren. Zwischen Not und bescheidener Hoffnung ahnt niemand die drohende Gefahr. Der Kölner Verbrecherkönig Wolfgang Henkel erfährt, dass der Kirchenmann ein wertvolles Geschenk für den Papst bei sich trägt. Zudem hat er mit dem Dorfschmied Karl Bermes noch eine Rechnung offen. Als Vergeltung für seine vereitelten Schmuggelgeschäfte beauftragt er brutale Handlanger aus Bitburg, das Geschenk zu stehlen und Karl zur Rechenschaft zu ziehen. Das Dorf wird zum Schauplatz eines gefährlichen Spiels. Karl stellt sich mit wenigen Verbündeten gegen die Kriminellen – um das zu schützen, was die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht zu schützen vermag: ihr Zuhause.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ralf Lano
Ein Schwur aus kaltem Zorn
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Ein Echo aus stählerner Zeit
Der Tod kennt verschwiegene Pfade
Ralf Lano, geb. 1965 in Kyllburg in der Eifel, ist gelernter Maschinenbautechniker und leidenschaftlicher Autor von Kriminalgeschichten. Bisher wurden über 30 seiner Erzählungen veröffentlicht, darunter auch der Kurzkrimi Die Kuh Elsa, mit dem er 2022 für den deutschen Kurzkrimi-Preis nominiert war.
Sein erster Kriminalroman Ein Echo aus stählerner Zeit (KBV) war 2023 der fulminante Auftakt einer mehrbändigen historischen Eifelkrimi-Reihe.
Ralf Lano lebt und arbeitet in der Westeifel und kennt die Region und die Menschen wie seine Westentasche.
Ralf Lano
Ein Schwuraus kaltem Zorn
Originalausgabe
© 2025 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH
Am Markt 7 · DE-54576 Hillesheim · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
[email protected] · www.kbv-verlag.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere Herstellung: [email protected] · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von © rebel - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPIbooks GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95441-736-0 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-95441-747-6 (eBook)
Inhalt
PROLOG
1.
Mittwoch, 19.11.1947 nach Sonnenaufgang (früher am gleichen Tag)
2.
3.
4.
Am Morgen
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Am Vormittag
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Gegen Mittag
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Am frühen Nachmittag
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Am späten Nachmittag
55.
Gegen Abend
EPILOG
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
PROLOG
Kalt und ungemütlich war es hier im Süden der Eifel. Kurt Walterscheid hatte diesen Landstrich in den ganzen Jahren seiner Dienstzeit noch nie anders kennengelernt. Und dabei war er bereits seit Anfang der Zwanzigerjahre als Fahrer für das Bistum Köln tätig. Selbst wenn er irgendeinen Würdenträger, einen der Weihbischöfe oder gar den Bischof, im Sommer zu Festlichkeiten in die Eifel kutschieren musste, war das Wetter regelmäßig sehr durchwachsen bis schlecht gewesen. Jetzt, im Spätherbst, musste man sich wohl mit dem fiesen Nieselwetter abfinden. Immer wieder setzte Regen ein, der gleich darauf schon wieder aufhörte. Immerhin schneite es nicht.
Kurt rückte sich den Schirm seiner Fahrermütze zurecht, damit ihm die feinen Tropfen nicht so sehr in die Augen fielen. Der Schal und die lederne Fahrerjacke halfen gegen den schneidenden Wind, der über den Hügel strich, auf dem er den Wagen parken musste. Solche Vorgehensweisen kannte er zur Genüge. Es kam öfter vor, dass seine Fahrgäste die letzten Meter für eine Veranstaltung freiwillig zu Fuß zurücklegten. Damit sollte den örtlichen Gläubigen so etwas wie Demut vorgegaukelt werden. Selbst der feisteste Priester konnte sich so als armer Pilger im Auftrag des Herrn generieren.
Kurt hätte zum Thema Demut so manche Geschichte erzählen können. Meist war der Fond seines Wagens mit mehreren Fahrgästen gefüllt. Die Geistlichkeit unterhielt sich dann am liebsten auf Latein. Die hohen Herren gingen davon aus, dass Kurt auf diese Weise außen vor blieb. Schließlich hatte er nur die Volksschule besucht. Doch Kurt war nicht auf den Kopf gefallen. Mittlerweile über zwanzig Jahre im Dienst der Kirche sowie das Studium diverser Latein-Lehrbücher während der zumeist ausgiebigen Wartezeiten hatten dazu geführt, dass er den Gesprächen seiner Fahrgäste inzwischen fast problemlos folgen konnte. Die Überheblichkeit und der Zynismus, mit dem die hohen Herren gerne über ihre Schäflein herzogen, hätten manch anderen vielleicht dazu gebracht zu kündigen. Selbstverständlich war das für ihn keine Option, Isolde und die fünf Kinder wollten versorgt sein. So kurz nach dem zweiten großen Krieg gab es kaum bessere Arbeitsstellen als seine. Solange man brav das tat, was von einem verlangt wurde, sorgte das Bistum für seine Schäfchen.
Der Regen hatte wieder aufgehört, Kurts Jacke bedeckte ein dünner, feuchter Film. Er ging einige Meter an einem Weg entlang, um sich zu erleichtern. Der Italiener hatte ihn noch hochnäsiger behandelt, als er das von so manch anderem Fahrgast gewohnt war. Am besten begegnete man solchen Leuten mit Gleichmut.
Kurt knöpfte die Hose auf, bei dem Wetter und so früh am Morgen würde sich wohl niemand auf den matschigen Wiesen herumtreiben, der ihn hätte sehen können. Das Dorf breitete sich vor ihm in einem überschaubaren Tälchen aus. Solche kleinen Bauerndörfer gab es überall in der Eifel. Kurt hatte über die Jahre für sich die Theorie erarbeitet, dass man den Wohlstand eines Dorfes daran erkennen konnte, dass man die Größe der Kirche und die Kirchturmhöhe ins Verhältnis zur Anzahl der Häuser setzte. Gemäß dieser Betrachtungsweise waren die Leute hier in diesem Dorf im Süden der Eifel weder arm noch reich.
Disselbach war die erste Station für diesen Tag, nach dem Hochamt sollte es gleich weiter zum nächsten Besuch in das wenige Kilometer entfernte Dudeldorf gehen. Wegen des frühen Aufbrechens am Morgen in Gerolstein hatte Kurt nur eine trockene Scheibe Brot zum Frühstück gehabt. Nun freute er sich auf das Mittagessen. Normalerweise wurde er in den jeweiligen Küchen verköstigt. Das hatte den Vorteil, dass man sich hier und da von den anwesenden Damen einen Nachschlag einfordern konnte.
Kurt drehte sich einmal langsam im Kreis: Wald, Felder, Wiesen, ein alter Steinbruch. Was sonst sollte man in der Eifel erwarten? Er ging zurück zum Wagen. Darin war es zwar nicht warm, dafür aber trocken.
Ein mittelgroßer Mann mit höchst durchschnittlichem Aussehen stand plötzlich vor ihm. Kurt musste erst den Schrecken herunterschlucken, ehe er sagte: »Müssen Sie sich so anschleichen? Ist etwas? Haben die Herrschaften etwas vergessen?«
Der andere schob die lederne Schiebermütze nach hinten. »Wer soll was vergessen haben? Bei mir hat sich niemand gemeldet.«
Erst jetzt entdeckte Kurt den amerikanischen Jeep, der einige Meter hinter seinem schwarzen Opel Kapitän parkte. Er trug ein britisches Nummernschild und passende Markierungen auf der Motorhaube.
»Haben Sie auch jemanden hierhergebracht?«
Der andere überlegte einen Augenblick. »Nein, warum sollte ich?«
»Ich dachte nur, weil es ein britisches Fahrzeug ist.«
»Ach so, das ist nur geliehen, sozusagen. Ich bin hier, um einen alten Freund zu besuchen.«
»Dann kennen Sie sich hier aus?«
Der Fremde warf einen Blick zum Dorf, das sich hügelabwärts vor ihnen ausbreitete. »Das kann man so sagen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Wegen des Krieges und der Umstände danach hat es mich dann nach Köln verschlagen.«
»Nach Köln, das ist ja interessant, ich komme von da.«
Der Fremde grinste sehr breit. »Ohne dir nahetreten zu wollen, Kamerad, das hört man. Wie ist dein Name?«
Er trug eine ähnliche Montur wie Kurt. Von anderen Gelegenheiten wusste Kurt, dass die Briten einige zivile, deutsche Fahrer beschäftigten. Unter Kollegen duzte man sich.
»Kurt«, erfolgte die prompte Antwort.
Der Mann unterließ es, seinen Namen zu nennen, er nestelte an der aufgesetzten Tasche seiner dunklen Jacke. Zum Vorschein kam ein gefüllter Strumpf in Form eines großen Tropfens. Kurt schluckte.
»Weißt du, was das ist, mein Freund?«
Kurt nickte. Solche Totschläger sah er nicht zum ersten Mal. Unter seinem Fahrersitz lag ein massiver Eichenknüppel bereit. Die Nachkriegszeit brachte allerlei finstere Gestalten hervor, bei Fahrten über Land musste man auf alles vorbereitet sein. Nur half ihm seine Waffe im Moment nicht weiter. Er könnte niemals schnell genug an den Knüppel gelangen, um dem anderen zuvorzukommen. Kurt öffnete den Mund, sein Hilfeschrei blieb ihm im Hals stecken. In der linken Hand des Fremden erschien ein aufgeklapptes Rasiermesser. Sein Lächeln blieb erstaunlich freundlich.
»Pass auf, Kurt, das darfst du jetzt nicht persönlich nehmen, aber du störst.«
Kurt Walterscheid wollte etwas entgegnen, um Zeit zu gewinnen, doch sein Gegenüber war unglaublich schnell. Begleitet von den Worten: »Schlaf schön«, knallte der Strumpf mit der Bleifüllung gegen Kurts Stirn.
1.
Mittwoch, 19.11.1947nach Sonnenaufgang (früher am gleichen Tag)
Aus Strohseilen geflochtene Girlanden flatterten um die Bohnenstangen, die zu einem Willkommenstor drapiert am Ortseingang von Disselbach standen. Zwischen den Stangen bauschten sich handbemalte Spruchbänder aus alten Bettlaken. In der Kombination ergab sich ein Flattern und Rascheln, das sich so anhörte, als würden ihre Schüler bücherwedelnd den anbrechenden Tag begrüßen. Zumindest hörte es sich für Fräulein Schneebach so an. Die Dorfschullehrerin spähte an einer der Bohnenstangen entlang nach oben. Sie war an diesem Mittwochmorgen kaum früher auf den Beinen als an normalen Schultagen. Allerdings brauchte sie dann nur den Weg von ihrer Wohnung hinunter zum Schulsaal zu nehmen. Auf die Idee, um diese Uhrzeit an den Dorfrand zu gehen, wäre sie normalerweise gar nicht erst gekommen. Heute aber gab es einen besonderen Anlass, der dafür gesorgt hatte, dass sie sich möglichst unauffällig umschauen wollte. In den letzten Tagen hatte sich am Ortseingang einiges getan. Beim Bau des Tores hatte man auf ihre Expertise verzichtet. Was wiederum dazu führte, dass sie während der Vorbereitung auf das große Ereignis einen Bogen um dieses Ende des Dorfes gemacht hatte.
Fräulein Schneebach stand seit ihrem Amtsantritt in der Eifel vor über dreißig Jahren in stetiger Opposition zu den jeweiligen Dorfpfarrern. Seit über zehn Jahren musste sie sich nun mit Balduin Winkel auseinandersetzen. Der Priester konnte sich weder mit ihrer Herkunft aus Ostpreußen und noch viel weniger mit dem Umstand anfreunden, dass sie evangelisch getauft worden war. Sie hingegen brachten die Engstirnigkeit und die altmodischen Vorstellungen des Disselbacher Oberkatholiken regelmäßig auf die Palme.
Dennoch hatte ihr die Nachricht, mit der das heutige Ereignis vor drei Wochen angekündigt worden war, einen gehörigen Schrecken versetzt. Apollonia Felten, die Haushälterin des Pfarrers, hatte hysterisch an der Schulpforte Sturm geklopft. Die schriftliche Ankündigung der heutigen Visite hatte bei dem Dorfpfarrer zu einem veritablen Schwächeanfall geführt. Eben noch hatte er den Brief, den er nach der Frühmesse von Post-Theo erhalten hatte, gelesen und war dabei, sein Marmeladenbrot in den Kaffee zu tunken, im nächsten Augenblick lag er mit dem Gesicht in der Butter.
Warum Apollonia ausgerechnet zur evangelischen Lehrerin gerannt war, mochte am ehesten damit erklärt werden, dass die Lehrerin trotz der abweichenden Religionszugehörigkeit im Dorf als Respektsperson gleich hinter dem Pfarrer rangierte. In der Logik der Disselbacher bedeutete dies, dass sich die eine Autorität im Zweifelsfall vom Wohlbefinden der anderen überzeugen musste.
Das Fräulein war dieser Aufforderung ohne jedes Zögern nachgekommen. Als sie den Priester vorfand, hatte der sich bereits wieder weitestgehend von seinem Schrecken erholt. Nur die fettige Wange und der Marmeladenfleck auf der Soutane zeugten noch von dem Missgeschick.
Pfarrer Winkel war vom Erscheinen der Lehrerin nicht sonderlich begeistert gewesen, dennoch zeigte er ihr das Schreiben, das seinem Kreislauf den Tiefschlag versetzt hatte. Darin wurde dem Dorfpfarrer beschieden, ihm und damit selbstverständlich dem ganzen Dorf werde die große Ehre zuteil, zum Ziel einer Visitationsreise des päpstlichen Ehrenprälaten, Monsignore Rossi, auserkoren worden zu sein. Dieser italienische Würdenträger beabsichtige, von Köln nach Trier zu reisen, und wolle unter anderem in Disselbach haltmachen.
Die Lehrerin versuchte anschließend herauszufinden, was es mit diesem Titel eines päpstlichen Ehrenprälaten auf sich haben mochte. Ihre eigene Bibliothek wurde fein säuberlich von allen katholischen Traktaten und Nachschlagewerken freigehalten. Den Pfarrer wollte sie mit ihrem Unwissen bei seinen wichtigen täglichen Verrichtungen nicht belästigen. Die Disselbacher, die sie befragte, waren auch nicht imstande, ihre Wissenslücke zu schließen. Deshalb konnte sie den Hauptakteur des heutigen Tages nicht so richtig einsortieren.
Der anstehende Besuch hatte zu einer regen Betriebsamkeit im Dorf geführt, die an diesem Mittwoch nun endlich dem Höhepunkt zustrebte. Nach dem feierlichen Empfang am Begrüßungstor sollte der Prälat in der Disselbacher Dorfkirche St. Johannes ein festliches Hochamt zelebrieren. Selbstverständlich musste der hohe Herr vorher mit dem gebührenden Tamtam in Empfang genommen werden. Zu diesem Zweck hatte sich das komplette Dorf trotz der schlechten Versorgungslage zwei Jahre nach dem Krieg herausgeputzt, wie die Lehrerin es in ihrer ganzen Dienstzeit noch nicht erlebt hatte. An jedem Haus und so mancher Scheune flatterten bereits zu dieser frühen Stunde bunte Fahnen vor sich hin. Die Hauptstraße wurde den ganzen Weg bis zur Brücke über den Disselbach von einem Spalier frisch geschlagener, junger Fichten gesäumt. Das alles vermittelte den Eindruck, man hätte den Advent in diesem Jahr vorgezogen und Disselbach wartete auf den Nikolaus. Als Krönung des Ganzen war am Abend zuvor dieses fast drei Meter hohe Tor errichtet worden, um damit den päpstlichen Gesandten in der Gemeinde willkommen zu heißen.
Fräulein Schneebach schüttelte missmutig den Kopf über den Aufwand, der wegen dieses Besuchs betrieben wurde. Auf sie wirkte dieser Zirkus, als wäre der Prälat ein kleiner Gott, dem ein neuer Kult gestiftet werden sollte. Trotz der langen Jahre in der Eifel geschah es immer wieder, dass sie die Disselbacher nicht verstand. So kurz nach dem Krieg gab es wahrhaftig wichtigere Probleme zu bewältigen, als vor einem päpstlichen Ehrenprälaten zu buckeln.
Wegen der dichten Wolken brauchte es an diesem Morgen lange, bis es wirklich hell wurde. Das Fräulein inspizierte die Spruchbänder mit den Segenswünschen. Bei den grammatikalischen Katastrophen darauf stolperte ihre bereits mäßige Laune weiter die Treppe zum Keller ihres Gemüts hinunter. War ihr jahrelanges Streben, den Leuten ein vernünftiges Deutsch beizubringen, wirklich vergebliche Liebesmühe gewesen?
Aus den Augenwinkeln sah sie einen Mann, der sich ihr näherte. Jakob Weber schlenderte gemächlich auf sie zu. Bereits zu dieser frühen Stunde trug er seine gute Feuerwehruniform, obwohl der Ehrengast erst nach neun Uhr erwartet wurde.
»Guten Morgen, Fräulein Schneebach.« Jakob lupfte höflich die Kappe.
»Guten Morgen, Jakob.«
Jakob Weber erschien gelegentlich in der Schule, um sich bei ihr ein Buch aus der Bibliothek auszuleihen. Ebenso wie Karl Bermes, der Dorfschmied, war er ein Bücherfreund, der sich nicht um das scherte, was der Pfarrer in seiner hochkatholischen Bibliothek der rückständigen Machwerke feilbot. Das Fräulein bemühte sich trotz knapper Kassen, ihr Angebot an Büchern nach den Jahren der braunen Diktatur wieder mit neuer Qualität auszustatten.
Bei den Besuchen in der Schule nutzte Jakob gerne die Gelegenheit, bei dem Fräulein zu sitzen, eine Tasse Tee zu schlürfen und sich über Christine, die Tante seiner Frau Maria, zu beschweren. Das Fräulein lauschte verständnisvoll den Nöten und insbesondere den Neuigkeiten, die Jakob zu berichten wusste. Bessere Gelegenheiten, sich in sämtlichen Angelegenheiten des Dorfes auf den letzten Stand bringen zu lassen, gab es nicht. Man musste Christine Meier nicht mögen, um ihre hervorragende Vernetzung im Dorf über den kleinen Umweg Jakob anzuzapfen.
Das Fräulein sah wieder an den Bohnenstangen in die Höhe. »Ob dieser Prälat des Papstes den ganzen Aufwand zu würdigen weiß?«
Jakob blickte seinerseits nach oben. »Ich würde mal sagen, wenn man ein hohes Amt bekleidet, ist man davon überzeugt, so etwas stünde einem zu. Gleich nach uns reist der Prälat weiter nach Dudeldorf. Da wird der Aufwand eher noch größer sein, Dudeldorf hat mehr als doppelt so viele Einwohner wie Disselbach.«
»Mit christlicher Bescheidenheit hat das wenig zu tun.«
Jakob zuckte mit den Schultern. »Stimmt, aber jetzt steht der Krempel, und nachher bauen wir halt alles wieder ab.«
Eine solch stoische Einstellung war das, was das Fräulein an den Eifelern so mochte. Man nahm das Leben, wie es eben daherkam, meistens ohne großes Lamentieren.
»Was machst du um diese Zeit schon hier?«, fragte das Fräulein.
Jakob öffnete den ersten Knopf seiner Jacke. Sein Halsumfang befand sich offensichtlich nicht mehr ganz im Einklang mit der Kragenweite.
»Eine unserer Kühe hat in aller Herrgottsfrühe gekalbt. Ich hätte zu Hause bleiben können, bis der offizielle Teil beginnt. Leider ist Christine mit im Stall gewesen und hat sich ihre gute Schürze versaut. Deshalb ist sie schlecht gelaunt.«
Fräulein Schneebach nickte wissend. Jakob rüttelte am Tor. »Ich dachte mir, ich schaue mal nach, ob alles in Ordnung ist.«
Das Fräulein wandte sich zum Dorf. »Es ist noch früh und ganz schön frisch hier draußen. Ob deine Frau wohl etwas dagegen hat, wenn ich dich zu einer Tasse Tee einlade?«
Jakob dachte kurz nach. »Maria versteht, dass ich hin und wieder vor Christine Reißaus nehmen muss.«
»Du hast eine außergewöhnliche Frau.«
»Deshalb habe ich sie ja geheiratet.«
Das Fräulein unterdrückte das Lächeln. Gemeinsam mit Jakob machte sie sich auf den Weg zum Schulhaus.
2.
Wilhelm zwo leckte sich ausgiebig die linke Pfote. Entgegen seinen normalen Gewohnheiten zu dieser Jahreszeit hockte er auf der Fensterbank der Wohnstube. Der Fensterrahmen war zusätzlich mit Lappen aus alten Hemden und Hosen gegen den unangenehmen Wind abgedichtet, der um das Wohnhaus der Schmiede blies.
Ursprünglich hatte die Schmiede unweit der Kirche im Zentrum des Dorfes gelegen. Josef Bermes war noch ein Kind gewesen, als die Werkstatt zum wiederholten Mal ausgebrannt war. Es gelang damals nur mit knapper Not, das Wohngebäude der Schmiede sowie die umliegenden Häuser zu retten. Nach dieser Beinahekatastrophe war die Dorfgemeinschaft zu der Überzeugung gekommen, es musste etwas geschehen, damit nicht irgendwann der ganze Dorfkern in Schutt und Asche gelegt wurde.
Die Männer in der Familie Bermes neigten dazu, ihre eigenen Wege zu gehen und ihre Fahne nicht in jeden Windzug zu stellen. Dennoch verkaufte Josefs Vater Anton schließlich das Anwesen an der Kirche und erwarb ein Grundstück am Dorfrand. Um dort für die Zukunft auf Nummer sicher zu gehen, wurde die Schmiedewerkstatt als einzelnes Gebäude unabhängig von dem Wohnhaus und dem landwirtschaftlichen Trakt erbaut. Seitdem hatte es, abgesehen vom Schmiedefeuer in der Esse, nie wieder in der Werkstatt gebrannt. Die frei gewordene Werkstatt der alten Schmiede in der Dorfmitte war vor einigen Jahren zum Sitz der Freiwilligen Feuerwehr umfunktioniert worden und diente als Unterstellmöglichkeit für die Feuerwehrspritze.
Aus Brandschutzgründen mochte der Neubau am Ortsrand seinerzeit sinnvoll gewesen sein. Die Nähe zur Hügelkuppe und die Tatsache, dass der Ostwind vom nahen Disselbacher Forst ungehindert Anlauf auf das Anwesen nehmen konnte, waren die negative Konsequenz dieser Entscheidung. Die Schmiede benötigte im Winter stets ein bis zwei Festmeter Brennholz mehr als die Bauernhöfe und Häuser, die geschützter den Hügel abwärts lagen.
Auf der Sitzbank von Josef Bermes zeigte die Stofflappenabdichtung der Fenster Wirkung. Dort bemerkte man den Windzug so gut wie gar nicht. Auf der Fensterbank dagegen hätte eine Kerzenflamme ein ziemlich hektisches Eigenleben entwickelt, falls man eine Kerze dort überhaupt zum Brennen hätte bringen können.
Der große rote Kater verkroch sich mit Einzug des Herbstes tagsüber normalerweise bis zum Frühjahr in den Weidenkorb, der gleich neben dem gusseisernen Holzofen in der Ecke für ihn bereitstand. Warum Wilhelm zwo heute, wo der Wind besonders intensiv heulte, ausgerechnet auf der Fensterbank hockte, wusste einzig der liebe Gott. Josef hatte es bereits vor dem Krieg aufgegeben, den Kater verstehen zu wollen. Die Wege des Herrn mochten unergründlich sein, es hätte Josef allerdings nicht gewundert, wenn der Herr sich diese Wege beim Kater der Disselbacher Dorfschmiede abgeschaut hätte. Die wahrscheinlichste Erklärung für sein Verhalten lautete, dass Wilhelm zwo beleidigt war und das so zum Ausdruck bringen wollte. Vor gut zwanzig Minuten hatte er eine Maus vom Dachboden angeschleppt und sie stolz in den Durchgang zur Küche gelegt. Nur gut, dass Martha sich noch im Schlafzimmer befunden hatte, um den Kleiderschrank nach angemessener Bekleidung für das feierliche Hochamt zu durchforsten. Karl war bereits kurz zuvor zum Spritzenhaus gegangen. Dort wollten sich die Männer der Freiwilligen Feuerwehr zur Vorbereitung des Besuchs dieses päpstlichen Irgendetwas sammeln. Also musste Josef sich um das ungebetene Präsent von Wilhelm zwo kümmern.
Selbst ein Schlag mit dem Besen brachte den Kater nicht dazu, von dieser Gewohnheit abzulassen. Als Mäusefänger war er wirklich brauchbar. Nur schleppte er die Mäuse stets noch lebend an. Wilhelm zwo liebte es, die Viecher durch die Stube zu scheuchen, bevor er ihnen den Garaus machte. Martha konnte sonst so schnell nichts aus der Ruhe bringen, bei Mäusen reagierte sie allerdings hysterisch wie ein kleines Mädchen.
Da dieses Schauspiel leider regelmäßig aufgeführt wurde, hatten die Männer des Hauses Übung darin, die Mäuse mit der langen Blechschaufel zu erledigen und, so wie eben, auf dem Misthaufen zu entsorgen. Eigentlich diente die Schaufel dazu, die Glut im Ofen aufzulockern und, falls vorhanden, Kohle nachzulegen. Aufgrund des verlängerten Griffs eignete sich das Ding ebenfalls, in die Enge getriebenen Mäusen den Rest zu geben. Wilhelm zwo war ein Jäger, das Verspeisen seiner Beute lag wohl unter seiner Würde. Sobald er mit dem Spielen fertig war, ließ er seine Opfer liegen und zeigte den menschlichen Bewohnern der Schmiede die kalte Schulter.
Wenn überhaupt hörte Wilhelm zwo auf Martha. Früher hatte er sich bei Josefs ältestem Sohn Manfred auf die Oberschenkel gelegt und sich von ihm sogar streicheln lassen. Josef selbst, sein Zweitältester Heinrich und Karl hatten es immer vermieden, dem Kater zu nahe zu kommen. Keiner wollte blutige Kratzer auf dem Handrücken ernten.
Wie bei so vielen anderen Familien des Dorfes hatte der finstere Schnitter seinen Tribut auch bei der Familie Bermes eingefordert. Manfred und Heinrich würden nie wieder nach Hause zurückkehren. Es überstieg Josefs Vorstellungskraft, was die Führer, Könige, Präsidenten oder sonstigen Mächtigen der unterschiedlichen Staaten dazu bewog, die jungen Männer ihrer jeweiligen Völker auf blutigen Schlachtfeldern aufeinanderzuhetzen. Für ihn lag das einzig ehrenhafte Tun in ehrlicher Handwerks- oder Feldarbeit, zum Nutzen der Allgemeinheit und insbesondere zum Profit der eigenen Familie. Gemäß der Tradition sollte eigentlich Manfred als Erbe die Schmiede übernehmen. Das Schicksal war ein launisches Luder und entschied anders.
Josef hatte sich bis zum Krieg keinerlei Gedanken darum gemacht, dass dieser Plan nicht aufgehen könnte. Manfred war ein gelehriger Schüler der Schmiedekunst gewesen. Dass es am Ende ihr jüngster Sohn war, der die Schmiede übernahm, wäre Josef nie in den Sinn gekommen. Karl war ein furchtbar versponnenes Kind gewesen, das ständig Fragen stellte und für alles eine Erklärung haben wollte. Martha war immer besonders stolz auf die Wissbegier ihres Jüngsten gewesen, Josef wusste nicht, was er davon halten sollte. Einerseits konnte er mit den spinnerten Ideen seines Sohnes und den vielen Büchern, die er ständig anschleppte, nicht viel anfangen. Andererseits machten ihn die guten Noten in der Schule auch stolz.
Nachdem Karl eingeschult worden war, brachte sich die Dorfschullehrerin ungefragt ins Spiel. Manfred und Heinrich mogelten sich irgendwie durch den Unterricht der alten Jungfer. Karl wurde schnell zum erklärten Liebling des Fräuleins. Hätte die Lehrerin ihn nicht ganz so arg bedrängt und versucht, ihn unter Druck zu setzen, Josef hätte sich vermutlich dazu breitschlagen lassen, Karl auf das Gymnasium nach Bitburg zu schicken, trotz des zu zahlenden Schulgelds. Wegen ihrer penetranten und ständig rigoroser werdenden Forderungen stand Josef der eigene Dickschädel im Weg. Er schaltete seine Ohren bei den vielen Visiten der Jungfer auf Durchzug und bestand darauf, dass Karl eine Lehre bei ihm in der Schmiede hinter sich bringen musste. Anschließend könnte man immer noch schauen, welche anderen Möglichkeiten sich vielleicht ergaben.
Karl neigte selbst als Erwachsener dazu, sich zu allem und jedem ausgiebig seine Gedanken zu machen. Nicht selten konnte man ihn auf dem Amboss sitzend vorfinden. Manchmal musste man in die Hände klatschen, damit er aus seinen Tagträumen erwachte. Trotz dieses Verhaltens erledigte Karl alle seine Arbeiten zur Zufriedenheit seiner Kundschaft. Wen kümmerte es da, wie lange er müßig seinen Gedanken nachhing?
Die Zukunft der Disselbacher Dorfschmiede schien nun durch Karl gesichert. Es fehlte eigentlich nur die passende Frau, um das Familienerbe fortzuführen. Im Jahr zuvor hatte es, sehr zu Josefs und Marthas Leidwesen, den Anschein gehabt, Karl könnte Gefallen an Pauline Globkow gefunden haben. Ihr Vater Friedrich war als Verwalter des Flüchtlingslagers im Wald eingesetzt worden.
Wegen der Ereignisse rund um Werner Schomer im vorletzten Sommer und dem, was mit dem Polizeianwärter Eddi Franken vor einigen Monaten geschehen war, schien dieses Thema jedoch vom Tisch zu sein. Es war nur schade, dass der junge Polizist nicht mehr als potenzieller Bräutigam für Fräulein Naseweis zur Verfügung stand.
Diese Pauline war ein hübsches Ding, vielleicht etwas dünn geraten, aber ohne Zweifel hübsch. Da er sich standhaft weigerte, sich näher mit ihr bekannt zu machen, musste Josef sich auf das verlassen, was der Dorftratsch so hergab. Ließ man das, was es an Informationen über sie gab, ein wenig durch ein feines, gedankliches Sieb tropfen, lautete für ihn das Resultat, dass die junge Globkow einen starken Willen und einen eigenen Kopf besaß. Eben Fräulein Naseweis, wie Martha immer sagte.
Charaktereigenschaften, die nicht die schlechtesten für eine Frau an der Seite eines selbstständigen Schmiedes waren. Allerdings stammten die Globkows aus dem Osten. Ähnlich wie die vielen anderen Flüchtlinge erschien die Familie vor zwei Jahren mit buchstäblich nichts als dem, was sie am Leib trugen, im alten Arbeitsdienstlager im Wald. Insbesondere Martha legte großen Wert auf eine Schwiegertochter mit einer ordentlichen Aussteuer und einem möglichst großen Erbteil. Bei Pauline Globkow gab es absolut nichts zu holen.
Josef schüttelte den Kopf. So wie er Karl kannte, stand zu befürchten, dass er sich nicht darum kümmerte, welche Vorstellungen seine Eltern hinsichtlich einer Schwiegertochter umtrieben. Die Bewegung brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Der Tisch, an dem er saß, begann sich zu drehen. Zumindest machte es auf Josef diesen Eindruck, er krallte sich an der Kante fest.
Martha lag ihm bereits seit Jahren in den Ohren, endlich nach Kyllburg zum Arzt zu fahren, damit der ihm eine passende Medizin gegen seine Schwindelanfälle verschrieb. Wenn er es morgens langsam angehen ließ, kam sein Kreislauf nach und nach von selbst in Schwung. Ausgerechnet an diesem Morgen wollte das nicht funktionieren. Der Besuch dieses römischen Gesandten konnte ihm persönlich ohnehin gestohlen bleiben. Martha war im Hause Bermes für das Beten zuständig. Normalerweise gehörte es sich jedoch für ihn, bei einem solchen Ereignis zu erscheinen. Immerhin war er der Altschmied von Disselbach. Die Bermes' stellten, solange sich die Leute zurückerinnern konnten, die Schmiede im Dorf. Das, was sich gehörte, half nur nicht weiter, wenn die Gesundheit sich weigerte, ihren normalen Dienst zu versehen. Es wäre nicht gut, wenn Josef in der Kirche zusammensacken und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde.
Das Schließen der Augen für einige Sekunden beendete wie üblich jede Drehbewegung. Bis vor Kurzem hatte sich Josef nie Gedanken um die eigene Sterblichkeit gemacht. Dass er mit siebenundsechzig Jahren den bei Weitem größten Teil seines Lebens bereits hinter sich gebracht hatte, brauchte ihm niemand zu sagen. Nach einem arbeitsreichen Leben hoffte er nun auf einige angenehme Jahre des Ruhestands.
Enkel wären eine schöne Beschäftigung für einen alten Mann gewesen. Ganz zu schweigen davon, wie sehr Martha auf Nachkommenschaft hoffte. Nur machte Karl derzeit keinerlei Anstalten, endlich etwas in dieser Hinsicht in die Wege zu leiten. Weder mit diesem Flüchtlingsmädchen noch mit einer anderen jungen Frau. Dabei gab es nach dem verlustreichen Krieg in Disselbach genauso wie in den Nachbardörfern wahrhaftig eine üppige Auswahl an jungen Frauen, die eine gute Partie wie den Dorfschmied von Disselbach ohne zu zögern als Mann akzeptiert hätten. Martha streckte ihre Fühler in mehrere Richtungen aus, mit Ausnahme des Lagers. Es blieb abzuwarten und zu hoffen, ob sich daraus in naher Zukunft etwas entwickelte.
3.
Wegen der schlechten Straßen war an etwas weiteren Schlaf während der Fahrt leider nicht zu denken. Die vielen Schlaglöcher rissen Pitt regelmäßig mit unsanften Stößen ins Steißbein aus allen Versuchen zu dösen.
Dass sie mit sechs Mann eher nicht mit einem normalen Gefährt reisen würden, hätte er sich denken können. Der große ehemalige Militärwagen hatte ihn dann doch ein wenig verblüfft, als er am Abend zuvor im Hof gestanden hatte. Vor dem Aufbruch mitten in der Nacht hatte er von seinem Fahrer Ferdinand lernen dürfen, dass sie in einem Horch 108 EG Typ 40 unterwegs waren. Beim Militär hatte alles mit Nummern und möglichst bürokratisch klingenden Bezeichnungen versehen werden müssen.
Zum Glück hatte Pitt nie etwas mit militärischen Dingen zu tun gehabt. In Kriegszeiten war es eindeutig von Vorteil, die bürgerlichen Ehrenrechte abgesprochen bekommen zu haben. Er hatte zu oft miterlebt, wozu der Mensch fähig war, um an die Botschaften der Religion zu glauben. Dennoch war er vor einigen Jahren versucht gewesen, eine Kerze im Kölner Dom zu spenden, um für seine Ausmusterung zu danken. Da dies angesichts seines Lebenslaufs jedoch eher ein schlechter Witz gewesen wäre, ließ er es bleiben.
Die ersten beiden Kriegsjahre verbrachte Pitt im Gefängnis. Danach wurden seine Fähigkeiten, energisch für Ruhe und Ordnung zu sorgen, in verschiedenen Arbeitslagern von Industrieunternehmen rund um Köln benötigt. Dort verbrachte er die Jahre verhältnismäßig angenehm als Capo für widerspenstige Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Sein schlimmstes Erlebnis während des Krieges war ein Bombenangriff auf Leverkusen am 26. Oktober 1944 gewesen. Gemeinsam mit den anderen Aufsehern wurde er in ihrer Unterkunft verschüttet. Die nahe gelegenen Luftschutzräume blieben den ehrbaren Bürgern vorbehalten. Pitt überlebte und musste sich selbst aus den Trümmern befreien.
Auch um seine Verletzungen hatte sich damals niemand ernsthaft gekümmert. Als kleines Andenken an diese Nacht wurde seine linke Gesichtshälfte von einer gezackten Narbe verziert. In seinem Metier stellten Narben ähnliche Ehrenzeichen dar wie bei den Soldaten die Orden. Die Variante mit der schief zusammengewachsenen Wange, die er seitdem in der Visage spazieren trug, sorgte zusätzlich zu seiner körperlichen Präsenz auf den ersten Blick für weiteren Respekt. Es gab Schlimmeres, und er hatte sich an den Anblick im Spiegel gewöhnt.
Pitts eigentlicher Name lautete Arthur. Der Name Pitt war ihm bei seinem ersten Aufenthalt im Kölner Klingelpütz vor fünfundzwanzig Jahren zugewachsen. Viktor, einer der Herrscher in seinem Gefängnistrakt, hatte es auf seinen Arsch abgesehen. Und das auf eine Weise, die Arthur nicht bereit war zu akzeptieren.
Viktors letzter Spieljunge hatte Pitt geheißen. Als der entlassen wurde, sollte Arthur dessen Platz einnehmen. Weil Viktor nicht der Hellste war, verpasste er Arthur einfach den Namen Pitt, um sich nicht groß umgewöhnen zu müssen. Arthur war damals vielleicht jung gewesen, aber alles andere als naiv. Seine Kindheit hatte er in der Kölner Südstadt verbracht. Auf der Straße lernte man mit allen Problemen umzugehen, die sich einem in den Weg stellten. Arthur war willens und in der Lage, sich seiner Haut zu erwehren.
Viktor versuchte es exakt einmal, Arthur in den Waschräumen in die Unterhose zu fassen. Danach hatte nie wieder ein junger, gut aussehender Mann ein Problem mit Viktor. Der heftige Stoß mit dem Knie, den Arthur Viktor verpasst hatte, sorgte dafür, dass der anschließend Sopran hätte singen können. Nach dem Zwischenfall wurde Viktor in ein anderes Gefängnis verlegt.
Arthur erhielt wegen seiner Tat sechs milde, zusätzliche Monate aufgebrummt. Der Richter war wegen dessen Beweggründen gnädig gestimmt gewesen. Absitzen musste er die Zeit dann sowieso nicht. Zur Feier von Hindenburgs erster Präsidentschaft gab es eine Amnestie, und Arthur war für einige Jahre ein freier Mann. Sein Ruf, ein harter Knochen zu sein, der sich nichts gefallen ließ und dem man besser nicht in die Quere kam, spazierte gemeinsam mit ihm zum Gefängnistor hinaus.
Das, was er aus dieser ersten Zeit im Klingelpütz als Andenken behielt, war, dass ihn jeder nur noch Pitt nannte. Viele seiner Kumpel und Gegner konnten ihrerseits teils sehr schräge Spitznamen vorweisen. Deshalb hatte Arthur es akzeptiert, Pitt zu sein. Dass er mit Nachnamen Möller hieß, interessierte ohnehin keinen seiner Reisegefährten.
4.
Am Morgen
Bis zu diesem Morgen hatte Karl sich nie Gedanken über die Sinnhaftigkeit des militärischen Ansatzes bei der Freiwilligen Feuerwehr gemacht. Jakob, ihr Hauptmann, war so gar kein Kommisskopf. Dennoch klangen seine gebellten Befehle von eben so, als wäre er der Wiedergänger von Karls altem Ausbilder bei der Wehrmacht.
Wobei Hauptfeldwebel Karb bei Weitem mehr gewesen war als ein stupider Kommisskopf und Schleifer. Bei Karb hatte Karl gelernt, wie man Gegner effektiv im Nahkampf ausschaltete. Karl war seinerzeit gemeinsam mit seinem besten Freund Werner eingezogen worden. Die sehr spezielle Ausbildung des Hauptfeldwebels war für Karl eine Tortur gewesen. Doch das Schicksal hatte es gut mit ihm gemeint. Er wurde als besser geeignet für die Luftraumüberwachung eingestuft und an die französische Kanalküste versetzt. Werner hingegen hatte sich schnell zu Karbs Liebling entwickelt. Dies führte in der Endkonsequenz dazu, dass Werner im Krieg zu einem sehr gefährlichen Mann geworden war. Davon hätten einige ehemalige Waffen-SS-Leute, die im Sommer des letzten Jahres auf die Idee gekommen waren, sich hier in Disselbach mit ihm anlegen zu wollen, ein Lied singen können. Nur war keiner von ihnen mehr in der Lage, einen Bericht dazu abzuliefern, geschweige denn zu singen.
Jakob legte Wert darauf, dass seine Feuerwehrmänner der Größe nach in zwei Reihen Aufstellung nahmen. Da Karl der größte in der Truppe war, musste er in der ersten Reihe, gleich rechts vom Kommandanten, Aufstellung nehmen. Als Zweitgrößter stand links von ihm Albert Weber, Jakobs ältester Sohn. Danach folgten die restlichen zwölf Mann der ersten Reihe wie wohlsortierte Orgelpfeifen. Diese Anordnung wiederholte sich in der zweiten Reihe.
Karl drehte sich zu Jakob, der gab ihm mit einer Kinnbewegung zu verstehen, er solle geradeaus schauen. Jakob konnte ihm den Buckel runterrutschen. Karl hatte während seiner Jahre als Soldat genug Zeit darauf verschwendet, irgendwelchen oft schwer nachvollziehbaren Befehlen zu folgen. Hier, in der friedlichen Heimat, würde er garantiert nicht mehr auf Befehle seines Nachbarn hören. Bei einem echten Feuerwehreinsatz mochte es Sinn machen, harschen Anweisungen ohne Zögern zu folgen. Bei einem Einsatz wie diesem nicht.
Die Kälte des Morgens, die durch den böigen Wind und das fortwährende Nieseln verstärkt wurde, nagte sich unangenehm durch die Uniform und die Unterwäsche bis zur Haut vor. Karl hatte bei der Generalprobe am Abend zuvor vorgeschlagen, dass die Männer der Feuerwehr ihre Mäntel anziehen sollten. Jakob vertrat jedoch die Meinung, Mäntel seien dem feierlichen Ereignis nicht angemessen. So eine Parade zu Ehren eines päpstlichen Prälaten stand auf keinem Ausrüstungsplan für die Feuerwehr, deshalb gab es auch keine einheitlichen Überzüge für die Wehrmänner. Jakob wollte mit Uniformen glänzen und vermeiden, dem Besuch aus dem fernen Rom eine Truppe zu präsentieren, die wegen der unterschiedlichen zivilen Mäntel wie ein zusammengewürfelter Haufen wirkte. Die Verehrung für alles militärisch Anmutende war selbst nach dem verlorenen Krieg in Deutschland sehr präsent.
Dabei konnte man bei den Uniformen, die an diesem Morgen zu sehen waren, selbst mit viel gutem Willen nicht von einem einheitlichen Erscheinungsbild sprechen. Es bot sich ein wildes Uniformenpotpourri der letzten Jahrzehnte. Es gab verschlissene Jacken der kaiserlichen Armee. Manche konnten mit echten Feuerwehruniformen aus den Dreißigerjahren aufwarten. Die jüngeren Männer, wie auch Karl, die Soldaten gewesen waren, trugen zumeist ihre alten Wehrmachtsuniformen, in denen sie aus einem der Gefangenenlager ins Dorf zurückgekehrt waren. Als Zeichen der Zugehörigkeit hatte Jakobs Frau Maria Ärmelbänder mit der Aufschrift Freiwillige Feuerwehr Disselbach genäht.
Jakob hatte einmal seinen Willen durchsetzen wollen und hatte festgelegt, dass bei dem Empfang keine Mäntel getragen werden durften. Deshalb jagte nun eine Gänsehaut nach der anderen über Karls Rücken.
Er begann die Muskeln in Beinen und Armen abwechselnd anzuspannen. Bei der Wehrmacht hatte er gelernt, dass das half, wenigstens etwas Wärme in den Körper zu bekommen. Er ließ die Augen über die Kreuzung wandern. Die komplette Veranstaltung war auf die Straße ausgerichtet, die zum Dorf hinausführte. Folgte man diesem Weg, gelangte man durch die Dörfer Badem und Erdorf nach gut zehn Kilometern in die Kreisstadt Bitburg.
Diese Stelle am Ortseingang war für den Empfang ausgewählt worden, weil es genug Platz für alle gab. Von hier brauchte es nur einen kurzen Spaziergang, um zur Kirche im Ortszentrum zu gelangen. Die ursprüngliche Idee, die Begrüßung auf einer Wiese außerhalb des Dorfes aufzuführen, wurde wegen des nassen Wetters der letzten Wochen verworfen. Niemand hatte Lust, mit den Schuhen bis zu den Knöcheln im Matsch zu versinken und damit anschließend in die Kirche gehen zu müssen. Ehrenprälat hin, Ehrenprälat her.
Es war ohnehin erstaunlich genug, dass die Vorbereitungen für diese Veranstaltung pünktlich abgeschlossen werden konnten. Die Herrschaften von der französischen Besatzung waren in den Tagen zuvor auf die glorreiche Idee gekommen, sämtliche Bauernhöfe Disselbachs und die der umliegenden Dörfer zu durchsuchen. Das Wort »Razzia« hatte Karl in einem der Bücher gelesen, das er sich aus der Bibliothek des Fräuleins vor Jahren ausgeliehen hatte. Es war lange ein nur schwer fassbarer Begriff für ihn geblieben. Nun konnte er sich darunter etwas vorstellen.
Der Sommer 1947 war sehr heiß gewesen. Der ausbleibende Regen führte zu einer umfassenden Trockenheit in ganz Mitteleuropa. Fräulein Schneebach legte großen Eifer an den Tag, sich selbst und damit mit einem gewissen Automatismus auch Karl über die Entwicklungen in Deutschland und der Welt auf dem Laufenden zu halten. Aus diesem Grund war er ausführlich darüber informiert worden, dass das heiße Wetter zur schlechtesten Kartoffel- und Getreideernte des Jahrhunderts in Europa geführt hatte. Zwar waren größere Getreidelieferungen aus den USA zur Linderung dieses Problems in Aussicht gestellt worden. Die Schiffe sollten jedoch erst ab Dezember in Bremerhaven eintreffen, und danach musste die Ware ja noch überall verteilt werden.
Grundsätzlich waren alle Landwirte verpflichtet, jeweils genau festgelegte Mengen ihrer Ernte an die Kreisverwaltung abzuliefern. Diese Anordnung wurde jedoch eher als grobe Empfehlung betrachtet, über die man großzügig hinwegsehen konnte. Den Landwirt, dem keine gute Ausrede eingefallen wäre, warum seine Lieferungen geringer ausfielen als festgelegt, hätte man zumindest in ihrem Teil der Eifel selbst bei intensiver Suche nicht gefunden.
Um diesem allgemeinen Schwund der beanspruchten Liefermengen auf den Grund zu gehen, hatte es am Montag und Dienstag dieser Woche auf Anordnung der Militärverwaltung Nachkontrollen auf sämtlichen Bauernhöfen gegeben. Mit dieser überraschenden Maßnahme sollte überprüft werden, ob jeder in angemessenem Maße seiner Pflicht zur Ablieferung der Lebensmittel nachgekommen war.
Die Leute hatten es als absichtliche Schikane der Besatzer empfunden, dass sie ausgerechnet in dieser Woche von ihnen belästigt und damit in den Vorbereitungen für den wichtigen Besuch eines päpstlichen Prälaten in Disselbach gestört wurden. Karl berührten diese Maßnahmen wenig, seine Eltern betrieben nur etwas Landwirtschaft im Nebenerwerb. Die Haupteinnahmequelle der Familie war die Schmiede.
Sein Nachbar Jakob war da ein ganz anderes Kaliber. Der Familie Weber gehörte einer der größten Höfe des Dorfes. Die Kontrolleure besaßen die richtigen Spürnasen oder hatten schlicht genug Erfahrung darin, geheime Verstecke und doppelte Böden auf den Höfen zu identifizieren. Trotz des vehementen Protestes von Christine Meier wurde eine größere Ladung Kartoffeln abtransportiert. Was Christine besonders erbitterte, war der Umstand, dass bei dieser Gelegenheit zwölf Schnapsflaschen auf den französischen Lkw wanderten. Bei der Deklaration des Schnapses war Jakob wohl ein kleiner Rechenfehler unterlaufen. Da er das Brennrecht besaß, würde diese Vergesslichkeit vermutlich weiteren Ärger nach sich ziehen.
Trotz der großen Aufregung über die Zwangseintreibungen der letzten Tage hatte es nie in Zweifel gestanden, den Prälaten nicht wie geplant mit den gebührenden Ehren in Empfang zu nehmen.
Karls Blick wanderte zu seiner Mutter Martha, die ohne ihren Mann auf der anderen Straßenseite stand. Neben ihr warteten Jakobs Frau Maria und Tante Christine auf das Erscheinen des Prälaten. Die Kreislaufprobleme von Karls Vater kamen und gingen, ohne dass man hätte sagen können, mit welcher Gesetzmäßigkeit dies geschah. Das permanent schlechte Wetter der letzten Wochen setzte seinem Vater zusätzlich zu. Die Gesundheitsprobleme führten dazu, dass Karl nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft vor gut anderthalb Jahren alle Arbeiten in der Werkstatt übernommen hatte. Sein Vater war der Besitzer der Schmiede und führte den Meistertitel weiter, bis Karl die entsprechende Prüfung abgelegt hatte.
Da sich weiter nichts tat, wandelten Karls Gedanken davon. Sie irrlichterten hierhin und dahin, bis sie wieder bei den Eintreibungen der Vortage endeten. Gerade weil Karl nicht von den Maßnahmen betroffen gewesen war, konnte er sich einige Kommentare über seine guten Beziehungen zur Polizei anhören. Die Verantwortung der Aktion lag bei der französischen Besatzungsmacht und wurde von Soldaten aus Trier durchgeführt. Um der Veranstaltung zumindest ein Deckmäntelchen deutscher Behördenhoheit zu geben, hatten unglückliche deutsche Schutzpolizisten aus Bitburg als Dekoration danebengestanden.
Die Ereignisse rund um Werner hatten indirekt dazu geführt, dass Karl sich mit Kriminalkommissar Severin Peters angefreundet hatte. Das wurde von dem einen oder anderen Disselbacher mit großem Misstrauen beäugt. Karls Hinweise, dass Peters bei der Kriminalpolizei in Trier beschäftigt sei und mit dieser Aktion nichts zu tun hatte, interessierten jedoch niemanden. Selbst der Umstand, dass dessen Kollegen von der Schutzpolizei den Anordnungen der anwesenden Soldaten nur sehr widerwillig folgten, half nicht weiter. Jupp, der Wirt der Dorfwirtschaft, hatte sogar, als es sonst niemand hören konnte, gegenüber Karl von Gestapo-Methoden gesprochen.
Alles Lamentieren half nichts, die Lebensmittelvorräte des Dorfes mussten einen gehörigen Schwund hinnehmen. Es blieb nur zu hoffen, dass der kommende Winter nicht wieder solch sibirische Verhältnisse mit sich bringen würde wie der letzte.
Den Kommissar hatte Karl seit den Ereignissen im September nur viermal gesehen. Der Verlust seines Polizeianwärters nagte an Peters. Er machte sich Vorwürfe, dass er den unerfahrenen Nachwuchspolizisten auf eine solch gefährliche Mission wie die in Bitburg geschickt hatte. Seine Vorgesetzten waren ihrerseits nicht sonderlich begeistert über diese Katastrophe gewesen. Trotz der vordergründig erfolgreichen Mordermittlung in den Schmugglerkreisen.
Karl hatte nur zwei Wochen mit Eddi Franken verbracht. Es wäre zu viel zu behaupten, der rothaarige Saarländer sei in dieser kurzen Zeit ein echter Freund für ihn geworden. Eddi war ein wirklich netter Mensch gewesen. Daran ließ sich nicht rütteln, selbst wenn man ins Feld führte, das Eddi vermutlich mit Pauline angebandelt hätte, wäre er nicht im Einsatz ums Leben gekommen.
Karl hatte den Kopf gesenkt, Jakob stupste ihn an, damit er geradeaus schaute.
5.
Eine gute Stunde und zwei Tassen Tee später fand sich die Lehrerin erneut am frisch erbauten Eingangstor zum Dorf ein. Wie üblich hatte Jakob ihr die Zeit damit vertrieben, von seinen Kämpfen und Schwierigkeiten mit Christine zu berichten. Fräulein Schneebach kannte mehrere ähnliche Fälle im Dorf. Drei oder manchmal sogar vier Generationen unter einem Dach führten zwangsläufig zu Problemen.
Nach und nach versammelten sich sämtliche Disselbacher, die dazu in der Lage waren, am Begrüßungstor. Alle gestriegelt, gebürstet und in ihren besten Sonntagsstaat gezwängt. Eltern bemühten sich, ihre lieben Kleinen unter Kontrolle zu halten. Die örtlichen Vereine nahmen geordnet Aufstellung und versuchten dabei, nach Möglichkeit die besten Plätze ganz vorne zu ergattern. Die Mitglieder der Feuerwehr konkurrierten mit dem Kirchenchor um den Platz gleich am Tor. Vom Kriegerverein fand sich lediglich der Fahnenträger Alwin Wagner ein, da die übrigen alten Krieger sich auf die Feuerwehr und den Chor verteilten. Es gab Bestrebungen, einen Fußballverein zu gründen. Doch dafür waren noch zu wenige der jungen Männer des Dorfes aus der Gefangenschaft zurückgekehrt.
Fräulein Schneebach beaufsichtigte ihren eigenen Chor. In den vorangegangenen Tagen hatte sie versucht, mit den begabtesten Kindern der Volksschule einige Willkommenslieder einzustudieren. Ihrer bescheidenen Meinung nach konnte sich das Ergebnis ohne Weiteres mit dem Kirchenchor messen lassen.
Die Lehrerin nickte Karl Bermes zu, der in seiner Eigenschaft als Mitglied der Feuerwehr neben Jakob auf das Kommende wartete. Der junge Schmied sah zu den Spruchbändern, grinsend verdrehte er die Augen.
Das Fräulein räusperte sich und gab Wilhelmine Sternzellner einen Klaps auf die Schulter. Die Tochter des Schreiners konnte wie üblich nicht stillstehen.
Die allgemeine Erregung steigerte sich von Sekunde zu Sekunde. Die verschiedenen Taschenuhren, die immer wieder aus Westen und Hosentaschen hervorgenestelt wurden, zeigten Zeiten an, die um mehrere Minuten voneinander abwichen. Alle besagten sie jedoch synchron: Es konnte nicht mehr lange dauern.
Die Festtagsplanung sah vor, dass der Ehrenprälat samt einiger Begleiter von Badem her mit einem Auto eintreffen sollte. Den Wagen wollte man einige Hundert Meter vor dem Dorf abstellen. Den Rest des Weges sollten die hohen Herrschaften dann zu Fuß zurücklegen. Der eigentliche Empfang sollte hier am Willkommenstor über die provisorische Bühne gehen. Eine Abordnung der Messdiener stand mit gereckten Hälsen und qualmendem Weihrauchfass am Ortseingang bereit. Trotz der Kälte glänzte die hohe Stirn des Dorfpfarrers so, als wäre sie frisch mit einer Speckschwarte eingefettet worden. Immerhin konnte er hier nicht in ein Marmeladenbrot fallen.
Siegfried, der älteste Sohn des Bürgermeisters, meldete schließlich aufgeregt: »Sie kommen! Sie kommen!«
Die Feuerwehr nahm auf Jakobs Kommando hin Haltung an, der Kirchenchor begann ein feierliches Lied auf Latein zu trällern. Fräulein Schneebach wollte nicht nachstehen und gab ihren Kindern das Zeichen zum Beginn. Tapfer sangen die Kleinen gegen ihre Eltern an. Die Lehrerin bemühte sich, zugleich den Takt vorzugeben, leise den Liedtext vorzusprechen und sich den Hals zu verdrehen, um den Prälaten sehen zu können.
Es dauerte eine Weile, bis eine kleine Karawane bestehend aus drei Priestern in Sicht kam. Die Messdiener bimmelten wild mit den mitgebrachten Glöckchen, die Chöre legten an Lautstärke zu. Vorneweg marschierte eine unscheinbare Gestalt in umso prächtigeren Festtagsgewändern. Pfarrer Winkel wurde noch blasser um die Nase.
Die drei Musketiere des Herrn traten vor das Tor, wo der Pfarrer wegen seiner Leibesfülle ächzend in die Knie ging, um den Ring des Prälaten zu küssen. Die Sopranstimmen des Kirchenchors setzten zu einem jubilierenden Finale an. Fräulein Schneebachs Kinder hatten ihren Teil bereits zu Ende gesungen.
Valentin Neuerburg, der Ortsbürgermeister Disselbachs, trat mit angemessenem langsamem Schritt auf die Gäste zu. Auf seinem Kopf wackelte ein Zylinder, der seinem Vater gehört hatte und ihm mindestens eine Nummer zu klein war. Mit aufgeregter, hoher Stimme begann Valentin mit einer Begrüßungsrede, deren Satzbau Fräulein Schneebachs Mundwinkel zucken ließ. Während des langatmigen Vortrags nahm die Lehrerin den Gast aus dem Süden genauer in Augenschein. Bei dem hochtrabenden Titel hätte man ja wohl eine prächtigere Erscheinung erwarten dürfen. Das Ziel aller Bemühungen der Disselbacher war ein kleines, schmächtiges Männlein mit dicken silbernen Haaren, die sein violettes Birett in die Höhe drückten. Das einzig außergewöhnliche Attribut an ihm war seine gewaltige Nase über dem fliehenden Kinn.
Valentin war endlich zu einem glücklichen Ende gekommen. Sichtlich erleichtert trat er ins Glied zurück, wobei er sich mit einem Taschentuch den Schweiß unter dem Zylinder wegwischte. Als Nächstes stand Jakobs Auftritt auf dem Programm. Ihm als Chef der Feuerwehr war die Ehre zuteilgeworden, den Prälaten mit Salz und Brot zu begrüßen. Um Haltung bemüht marschierte er los. Auf den ausgebreiteten Händen balancierte er ein rundes Brot. Obendrauf befand sich eine kleine Schüssel mit Salz. In der feierlichen Stille konnte jeder Tante Christines Zischen hören: »Pass auf, deine Schnürsenkel sind offen, du Hornochse!«
Jakob sah unwillkürlich nach unten zu seinen Schuhen, am rechten Schuh flatterten tatsächlich die Schuhbänder. Der kurze Blick verhinderte nicht, dass er sich auf den Schnürsenkel trat. Mit einem Ruck stolperte er vorwärts, Brot und Salz machten sich selbstständig. Das Brot segelte, sich wie ein Diskus elegant drehend, davon und landete vor den Füßen der Messdiener. Das Salzschüsselchen flog im hohen Bogen über die Köpfe der Geistlichen hinweg, wo es seinen Inhalt gleichmäßig verteilte.
Mit rudernden Armen versuchte Jakob das Gleichgewicht wiederzuerlangen. Ohne Erfolg. Mit seinem ganzen, nicht unerheblichen Gewicht schlug er gegen einen Torpfosten. Die Bohnenstangen waren nur lose miteinander verbunden, sie sollten ja nur einen Tag halten. Das Tor neigte sich langsam nach vorne. Die Messdiener kreischten erschrocken auf, bevor sie sich hektisch in Sicherheit brachten. Eines der Spruchbänder schwebte auf den Prälaten und legte sich dekorativ um dessen Brust. Darauf stand zu lesen: »Wir entbieten dem Prälahten ein hertzliches Willkommen«.
Fräulein Schneebach musste in den nächsten Tagen unbedingt herausfinden, wer dies geschrieben hatte, ohne sie vorher um Rat zu fragen.
Es schepperte, als das Tor auf dem Weihrauchfass landete, das bei der Flucht der Messdiener vergessen worden war. Funken stoben empor, die glühenden Kohlen setzten ein dünnes Strohgeflecht in Brand. Jakob mochte erschrocken sein, seine Aufgabe als Kommandant der Feuerwehr vergaß er keineswegs. »Feuer«, krächzte er aufgeregt vom Boden her.
Es brauchte lediglich einige Feuerwehrleute, um die mickrigen Flammen auszutreten. Die Leute rannten wild durcheinander, ganz so, als hätte ein Erdbeben oder eine ähnliche Katastrophe die Eifel erschüttert. Die Aufregung, die sich auf dem Festplatz ausbreitete, ließ sich mit der Ursache auf keinen Fall rechtfertigen, fand zumindest Fräulein Schneebach.
Eine Bewegung hinter den Priestern fesselte für einen Augenblick ihre Aufmerksamkeit. Das konnte nicht sein! Die Lehrerin schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf, öffnete die Augen wieder, und tatsächlich, die Erscheinung war weg.
Ein Rundumblick blieb ergebnislos. Gleich neben Jakob, der liegen geblieben war und den Kopf unter den Händen verbarg, ging sie in die Hocke.
»Jakob, hast du dich verletzt?«
Der Feuerwehrhauptmann blinzelte zu ihr hoch. »Sehen Sie kein Loch, in dem ich versinken könnte, Fräulein Schneebach?«
»Tja, Löcher hat die Straße genügend, die sind nur leider nicht groß genug für dich.« Die Lehrerin sah sich um.
Pfarrer Winkel stand fassungslos mit hochrotem Gesicht inmitten des Chaos. Wegen der Aufregung war das, was er dem Prälaten zu erklären versuchte, nicht zu verstehen. Seine und des Fräuleins Blicke kreuzten sich. Wie ein Fisch auf dem Trockenen öffnete und schloss er mehrmals schnell den Mund, ohne etwas zu sagen. Seine Aufmerksamkeit galt wieder dem hohen Besuch.
Das Fräulein erhob sich, Jakob bemühte sich, neben ihr auf die Füße zu kommen. Entlang der Straße nach Badem war alles ruhig und verlassen. Da ihre Augen jedoch tadellos waren, glaubte sie nicht, dass sie sich geirrt hatte. Wenn es nicht zufälligerweise einen Doppelgänger gab, der ebenso zufällig in Disselbach herumspazierte, hatte sie vor einigen Augenblicken Werner Schomer gesehen. Werner war nach den Ereignissen im örtlichen Steinbruch vor über einem Jahr verschwunden. Nun hatte er hastig die Straße überquert, um hinter dem Brauer-Hof zu verschwinden. Sein Auftauchen konnte nur eines bedeuten: Ärger!
Ihre Augen suchten Karl, der sich am Löschen des Brandes beteiligt hatte. Er sah zu ihr herüber, es gelang ihm nicht, das Grinsen zu unterdrücken. So würde er nicht aus der Wäsche schauen, hätte er Werner ebenfalls gesehen. Das Fräulein musste sich, so schnell es ging, mit Karl unterhalten. Denn auch das war so sicher wie die in Kürze folgenden unzähligen Amen in der Kirche – egal was Werner nach Disselbach führte, er würde Karl auf jeden Fall einen Besuch abstatten.
6.
»Guck mal, Pitt, da hat sich so ein blöder Bauer mit seinem Ochsenkarren festgefahren.« Kuddel gackerte wie ein Huhn, dem man ein Ei stehlen wollte.
Obwohl es inzwischen hell genug war, um draußen etwas erkennen zu können, drehte Pitt den Kopf gar nicht erst um. Da er auf der Beifahrerseite saß, gab es für ihn dort, wo bei normalen Autos ein Fenster sein sollte, nur eine Plane mit einem milchigen Sichtfenster, die mehr schlecht als recht gegen den Fahrtwind schützte. Er zog den Kragen seiner Jacke enger. Ein Wollschal wäre nicht die schlechteste Wahl für diese Reise gewesen.
»Sind wir bald da, Pitt?«, erklang es zum wiederholten Mal von der hinteren Sitzbank.
Die Fahrzeuge für die Wehrmacht waren reine Transportmittel und nicht auf Komfort ausgelegt worden. Die Männer hinter ihm und ihrem Fahrer Ferdinand hockten auf einfachen Holzpritschen. Vorne boten die Sitze wenigstens eine dünne Polsterung.
»Hätte ich gewusst, dass man sich den Arsch wund sitzt, wäre ich in Köln geblieben«, brummte Kuddel, der direkt hinter Pitt saß.
Der sagte nichts, man musste sich mit dem Material zufriedengeben, das einem zur Verfügung gestellt wurde. Das Material, das ihm auf diese Mission mitgegeben worden war, trug die Namen Kuddel, Ferdinand, Hans im Glück, Dirk und Otto. Mit Ferdinand und Otto hatte er bereits zu tun gehabt, die anderen kannte er vom Sehen.
Pitt sah müßig zur Frontscheibe hinaus auf die schlecht befestigte Straße, die zur Abwechslung eine lange Gerade beschrieb. In den südlichen Teil der Eifel hatte es ihn nie zuvor verschlagen. Den Norden dieses Landstrichs rund um Euskirchen kannte er leidlich. Es war noch dunkel gewesen, als sie die Stadt passiert hatten. Eines wurde durch diese Fahrt bestätigt: Fähige Straßenbauer mit genügend Geld und Material gab es weder im Norden noch im Süden der Eifel.