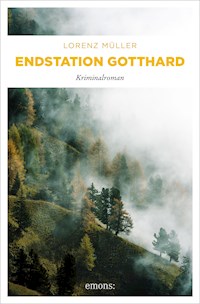Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Daniel Garvey
- Sprache: Deutsch
Ein düsterer Noir-Krimi, in dem der Regen alles wegspült. Auch die Moral. Daniel Garvey wird in einer Zuger Villa verhaftet, in einer Blutlache kniend. Die Bewohner des Hauses, Vater, Mutter und Sohn, wurden regelrecht hingerichtet, und alle Umstände weisen auf Daniel als Täter hin. Er behauptet jedoch beharrlich, nichts mit dem Mehrfachmord zu tun zu haben. Ermittler Forster, der seine Dienstmarke und sein einstiges Leben los ist, versucht inmitten seiner Sinnkrise die Tat zu verstehen – und herauszufinden, was es mit dem Verschwinden der 17‑jahrigen Tochter auf sich hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lorenz Müller, geboren 1977, lebt und schreibt in Zug, Schweiz. Nach juristischen und forensischen Ausbildungen arbeitete er als Staatsanwalt und für ein Versicherungsunternehmen. Seine bisherigen Kriminalromane »Endstation Gotthard« und »Der Pate von Zug« waren beide in den Schweizer Taschenbuch-Charts. www.lorenzmueller.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Die beschriebenen Orte dieser Geschichte sind real, teilweise leicht verändert.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: arcangel.com/Jarno Saren
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-107-2
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Menschliche Schlechtigkeit steht einem nicht ins Gesicht geschrieben wie eine Narbe oder Tätowierung.
Frei nach Paul Britton,
Prolog
Er war nervös, weil man im echten Leben nun mal nervös war, bevor man den Abzug drückte. Aber er war auch so etwas von bereit.
Gegen den Widerstand der Feder drückte er die letzte Patrone in das Magazin, dann das Magazin in den Griff der Pistole.
Zuletzt die Ladebewegung.
Er zählte bis drei und trat aus dem Regen unter das Vordach, in der Hand die Waffe. Zwischen ihm und der Haustür lag eine Schuhmatte mit dem Spruch: »Today is a good day«.
Fragte sich bloß, für wen.
***
Forster verließ den Gerichtssaal und sah nicht zurück. Er ging dem Seeufer entlang durch eine wolkenverhangene, monotone Welt, und in seinem Schädel sah es genau gleich aus. Grau, kalt und fremd.
Der Regen verhöhnte ihn mit einer kräftigen Dusche. Dies war einer jener Tage, die man nur noch in einer Bar zu Boden saufen konnte. Mehr war nicht drin, und ein Suff war allemal besser, als das Leben ungeschönt ertragen zu müssen.
Frisch geschieden und ein Gefühl in der Magengrube wie auf der eigenen Beerdigung.
1
Sophie saß im Bett. In ihrem Kopf war die Hölle los, und das verschwitzte Nachthemd klebte an ihr wie ein aufdringlicher Liebhaber. Sie hatte wieder diesen Traum gehabt, in dem der ekelerregende Typ sie am Oberschenkel streichelte. Sie hatte versucht wegzurennen, doch je schneller sie sein wollte, desto langsamer war sie.
Starker Regen trommelte einen seltsamen Rhythmus gegen das Zimmerfenster. Draußen war es hell – jedenfalls so hell, wie es der Regen zuließ. Ein weiterer Tag, an dem man keinen Hund rausschickte, ohne die Tierschützer am Hals zu haben.
Unten in der Küche schepperte eine Pfanne, und weit weg hörte sie die Stimmen ihrer Eltern und jene ihres Bruders Jérome. Ihr Bruder war der Vorzeigejunge und das weiße Schaf in der Familie. Vordergründig. In echt war er ganz anders und hatte mit seinen scheinheiligen neunzehn Jahren schon mehr Freundinnen als Kaugummis durchgekaut und ausgespuckt. Jérome passte unglaublich gut zu ihren Eltern. Verwöhnt und auf Äußeres getrimmt.
Seit einer Ewigkeit hatte Sophie null Bock, auch nur einen Satz von ihnen zu hören. Sie stieg aus dem Bett und setzte sich den kabellosen Kopfhörer auf. Auf dem Smartphone startete sie die Musik und drehte die Lautstärke auf zwei Drittel. Das Telefon packte sie zwischen Pobacke und Slip, den sie unter dem Nachthemd trug. Ihre Mutter hasste es, wenn sie sich das Gerät in die Unterhose steckte, doch da war es nun mal gut untergebracht.
Überhaupt. Selbst an den guten Tagen gab Maman den ganzen Tag nur Blech von sich. Bestenfalls wiederholte sie papageienhaft, was Papa drei Sätze vorher von sich gegeben hatte, und so kam sie wenigstens durch Nachplappern kurz auf das Niveau seines Denkvermögens. Papa Maurice war nicht viel heller. Wenn er etwas sagte, war das vom Niveau her nicht da oben bei den Wolken, sondern eher im Nebel unten, der sich am Boden orientierte.
Es ist keine Weisheit, dass keine Seele sich aussuchen kann, in welchen Haushalt sie geboren wird. Sie selbst, Sophie Arnaut, siebzehn und, wie sie fand, ganz schön attraktiv und clever, hatte definitiv die Oberarschkarte gezogen. Sie wurde von Maman durch das Leben mitgeschleift wie durch einen Parcours. Vom Coiffeur zur Maniküre, zum Waxing, danach zum Detoxen und Botoxen, und dies alles – wie es sich gehörte – an einem Tag. Immer wieder aufs Neue, als ob es für all die Behandlungen Extraleben und Pilze vom Himmel geregnet hätte. Super Mario hätte seine Freude gehabt.
In Sophies Kopfhörer klimperte Klaviermusik im Viervierteltakt, und das Lied begleitete sie aus ihrem Zimmer zum oberen Treppenabsatz. Wenn sie sich »Mad World« anhörte, dann immer die Donnie-Darko-Version und nicht das Original aus den Achtzigern, denn die Darko-Stimmung passte perfekt zu ihrem Leben.
Ab dem fünften Takt war Sophie ganz bei dieser melancholischen und doch freundlichen Männerstimme. Das Lied behütete sie vor der Realität. Wenigstens für ein paar Minuten übertönte es alles.
Um sicherzugehen, dass niemand in ihre Bubble eindringen konnte, aktivierte sie am Kopfhörer die Noise-Cancelling-Funktion. Bis auf die Stimme des Sängers und das Klavier war die Welt nun verstummt, und Sophie verharrte kurz, um das Lied so richtig zu spüren.
All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces …
Das Lied beschrieb ihr Leben. Bekannte, ausgediente Menschen und Orte, in einem Leben so fad wie schlecht gewürzter Tofu.
Sie schlenderte die Stufen hinunter bis ins Erdgeschoss. Es roch nach frisch gebrühtem Kaffee, dem penetranten Parfum ihrer Mutter und nach verbranntem Toast. Typisch. Maman Botox war nicht einmal imstande, den Toast hellbraun hinzukriegen oder das Parfum zu dosieren. Vom Nagellack an den Zehen bis hoch zu den Extensions war Maman einfach nur nudeldumm und gepimpt.
Bright an’ early for the daily races
Going nowhere, going nowhere …
Sophie ging die paar Schritte auf dem kühlen Fußboden durch den Flur, wandte sich nach rechts, bis sie den Türrahmen erreichte und in die Wohnküche blickte. Die Lampen waren an, und doch war es düster, weil der Regen von draußen nur wenig Licht hereinfallen ließ. Toast- und Kaffeegeruch erfüllten den Raum, aber da lag noch etwas anderes in der Luft. Schwefel, so intensiv, dass sie glaubte, sich in der Tür geirrt und statt der Küche die Hölle betreten zu haben.
Papa saß mit ausgestreckten Beinen auf dem Fliesenboden und mit dem Rücken gegen die Küchenzeile gelehnt. Beim Atmen hustete er sein Blut über den Boden. Er sah zu Sophie und streckte die Hand nach ihr aus.
Wollte er ihr die Hand reichen?
Doch Papa war schwach, und die Hand klatschte auf seinen Oberschenkel. Einen Augenblick später zuckte er, und Blut spritzte durch die Küche.
Daddy kippte zur Seite, während im Kopfhörer das Lied weiterlief.
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression …
Sie konnte ihre Mutter nirgendwo sehen, dafür stürzte ihr Bruder auf sie zu wie ein fliehendes Wildtier bei der Treibjagd. Bevor er Sophie erreichen konnte, taumelte er, ging in die Knie, riss den Toaster am Kabel von der Küchenzeile und schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Der verkohlte Toast landete auf dem Fußboden neben seiner rechten Hand.
Hide my head, I wanna drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow …
Auch Jérome bewegte sich jetzt nicht mehr, und um ihn herum wuchs die Blutlache und begann, das schwarze Stück Toast zu umarmen.
Sechs oder sieben Meter von Sophie entfernt tauchte eine dunkel gekleidete Gestalt in der Küche auf.
Es waren die Bewegungen eines kräftigen und sportlichen Mannes. Das Gesicht lag im Schatten der Kapuze von dessen Regenparka verborgen. Für Sophie war er ein Wesen ohne Gesicht. In der rechten Hand hielt er eine Pistole, und aus dem Lauf der Waffe dampfte das verschossene Pulver.
»Mad World« spielte weiter.
And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I’m dying
Are the best I’ve ever had …
Die Gestalt warf das Magazin der Waffe aus. Aus einer Tasche des Parkas zog er ein anderes Magazin und drückte es in den Pistolengriff. Mit der Ladebewegung schoss die nackte Angst durch Sophies Körper. Sie warf sich in Richtung der Haustür, stolperte ins Freie und rannte durch den Regen. Rannte wie eine, die soeben dem Tod ins Gesicht gesehen hatte.
Auf dem Rasen im Vorgarten stolperte sie und fiel der Länge nach hin. Der Kopfhörer rutschte ihr vom Kopf, und mit dem Mobiltelefon in der Unterhose rappelte sie sich auf und rannte davon.
Lauf!
Sophie erreichte den Waldrand und drehte sich zum Haus ihrer Eltern um. Der Regen verschlang alle Geräusche, noch bevor sie entstehen konnten, und sie sah auf hundert Meter Distanz, wie er in Zeitlupe aus dem Haus kam. Die Kapuze immer noch über den Kopf gezogen, in der einen Hand die Waffe, in der anderen eine Art Stoffsack. Er warf beides auf den Rücksitz des zerbeulten schwarzen Saab, der vor dem Haus parkiert war. Dann schlug er die Tür zu und machte eine halbe Drehung in ihre Richtung.
Sie sahen sich an, und für einige Sekunden bewegte sich keiner von ihnen. Er stand nur da, die Hände im Parka verborgen und die Kapuze tief im Gesicht. Sophie spürte, wie zwischen ihnen eine Art Verbindung entstand, als ob er mit ihr ein Gespräch begonnen hätte.
Hi. Ich habe deine Familie ausgelöscht.
Und sie würde sagen, ich weiß, und versuchen, das Bild ihres Bruders aus dem Kopf zu löschen, wie er in seinem Blut dalag. Sie fühlte sich wie unter Zwang, denn es gab nur diese eine Frage, die sie stellen konnte.
Sind sie tot?
Ja, sie sind alle gegangen.
Er stand immer noch im Regen und blickte in ihre Richtung, als ob er sich für seine Tat rechtfertigen wollte.
Sophie kam aus dem Tagtraum zu sich. Natürlich hatte es kein solches Gespräch gegeben. Alles hatte nur in ihrem Kopf stattgefunden.
Der Regen prasselte in ihr Gesicht, und sie hielt die Anspannung nicht länger aus. Sie drehte sich von ihm weg und rannte in den Wald hinein. Dann kam ein Gedankenblitz. Sophie fasste an ihre Pobacke, aber das Mobiltelefon war nicht mehr da. Es musste irgendwo hinter ihr liegen. Aus dem Slip gerutscht und vom Regen ersäuft. Ihr ganzes Leben war auf diesem Gerät gespeichert. Wirklich alles – abgesehen von ihrem Tagebuch.
Etliche Minuten später und mehrere hundert Meter im Waldesinneren stand sie an einem Bach, der sich, braun wie Gülle, den Abhang hinunterwälzte.
Sie zitterte und wusste nicht, ob das vom Schock oder vom kalten Regen kam. Vielleicht war es beides, und es war okay so. Solange sie zitterte, wusste sie, dass sie noch am Leben war.
2
Mit Blaulicht und Sirene schoss der silbergraue VW-Bus durch die Dreißigerzone an der Grabenstraße. Die Leute am Straßenrand gingen zur Seite, als ob die Scheibenwischer sie mit dem Wasser weggefegt hätten.
An der nächsten Kreuzung zog Grübel den Wagen links in die Zugerbergstraße hoch und trat das Gaspedal voll durch. Der Motor heulte auf, die Beschleunigung aber blieb bescheiden, weil der Bus zu schwer war. Viel zu schwer, weil er alles mitführte, was Kriminaltechniker an Tatorten benötigten. Von Lampen für die Tatortbeleuchtung über Absperr- und Spurensicherungsmaterial, Fotoausrüstung, Polizeisiegel für Türen, die keiner öffnen sollte, und DNA-Stäbchen bis hin zu Formularen, die seinen Alltag dokumentierten und standardisierten. Den ganzen Karsumpel.
Die paar Minuten Fahrt in die Quartierstraßen der Schönegg und des Bellevues kamen ihm überdehnt lange vor. Das lag vermutlich daran, dass der Bus die steile Zugerbergstraße hoch aus dem letzten Loch pfiff und der Regen ihm die Sicht nahm, obwohl die Scheibenwischer wie auf Koks wippten. Bei der Schönegg machte er die Sirene aus und fuhr durch den Bellevueweg hinunter bis dahin, wo zwischen ihm und der Gimenenstraße bloß noch eine einzelne kubische Villa mitten in der Landwirtschaftszone stand. Er fragte sich, wie es möglich sein konnte, dass wieder einmal einer mit Brieftasche mitten in die Wiese hatte bauen können, während sonst alle von Verdichten und Einzonungsstopp sprachen. Dieser hier hatte sich wohl eine Wildcard gekauft. Aber jetzt gab es Wichtigeres als Siedlungspolitik.
Grübel hielt in der Einfahrt hinter dem Streifenwagen an, wagte sich in das Sauwetter hinaus, und der Regen lief ihm praktisch sofort über den Nacken bis hinunter in die Unterhose. Er sprintete am Streifenwagen vorbei und sah kurz zu der Gestalt, die auf dem Rücksitz saß und den Blick zu den Füßen richtete. Als er die vier Stufen zur Veranda an der Vordertür hocheilte, um unter das Vordach zu kommen, wartete bereits ein Uniformierter auf ihn.
»Was kannst du mir zum Tatort sagen?«
Benny Weiß klebte die Uniform am Bauchansatz, und er zog Grübel am Kragen zu sich her.
»Pass auf, dass du nicht in das Erbrochene trittst.«
Grübel sah hinter sich. Tatsächlich, er wäre beinahe in die Hinterlassenschaft getreten, die nach Frühstück aussah. Wenn er hätte wetten müssen, dann hätte er auf schwarzen Kaffee und Birchermüesli gesetzt.
»Wer hat meinen Tatort verunstaltet?«
»Immerhin ist dies bereits geklärt. Wir haben drinnen alles gesichert. Waren nur kurz drin. Ihn dort«, Weiß zeigte zum Streifenwagen, »haben wir verhaftet und bei allen, die sonst noch da waren, den Puls gesucht. Vergeblich.« Weiß zögerte. »Ja, und dann sind wir mit dem Verhafteten raus, und Kollege Fredi hat sein Frühstück wiedergekäut.«
»Meine Güte, das ist doch nicht möglich. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten zwanzig Jahren an einem Tatort ein Kamerad erbrochen hat. Aber Fredi kriegt das ausgerechnet bei einem Tötungsdelikt hin, wo uns garantiert alle auf die Finger schauen.«
Weiß deutete mit dem Kinn in Richtung der geschlossenen Haustür.
»Du kannst sagen, was du willst, aber erst nachdem du es selbst gesehen hast. Vorher wäre ich an deiner Stelle schön still.«
»Schlimm?«
»Schlimmer.«
»Soll heißen?«
»Drei Opfer. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ein Massaker ist das. Nur ein Monster ist zu so etwas fähig.«
Weiß, eine Hand auf dem Pistolengriff ruhend, deutete zum Streifenwagen, wo die Gestalt noch immer reglos auf der Rückbank saß.
»Er hat keine Anstalten gemacht, sich zu wehren oder wegzulaufen. Hat sich einfach so verhaften lassen, als ob er auf uns gewartet hätte. Immerhin wissen wir, wer er ist.«
»War sicher wahnsinnig schwer, dies herauszubekommen«, gab Grübel mit zynischem Unterton zurück. »Den erkenne ich auch durch die verregnete Autoscheibe. Eine lila Kuh in der Stadtbahn zieht weniger Blicke auf sich, als er es tut.«
Weiß legte sein Gesicht in Falten und referierte weiter, als ob er gerade eine Meisterleistung präsentieren wollte. »Ich kenne ihn aus der Zeitung. Er ist Nordire und heißt Garvey. Aber an seinen Vornamen kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls wohnt er hier in der Stadt und hat in den letzten Jahren die Schlagzeilen dominiert.«
»Daniel. Er heißt Daniel Garvey. Wer kennt ihn nicht, den Mann, vor dem sogar die Mafia und die Irish Republican Army den Schwanz eingezogen haben? Außer wir täuschen uns beide, und er sieht ihm ähnlich.«
»Nein, tun wir nicht. Er ist es. Seine Visage war ja nicht nur einmal in der Zeitung. Die Journalisten haben ihn förmlich gejagt und erst in Ruhe gelassen, nachdem sie die Story komplett ausgelutscht hatten. Und Forster hat nach dem Fall den Bettel hingeworfen.«
Grübel kannte Forster besser als alle anderen und wusste, was geschehen war. Aber das spielte jetzt keine Rolle, denn sie hatten einen Tatort, und er war der Herr des Tatorts, bis er den anderen erlaubte, näher zu treten.
Grübel sah in den grauen Himmel hoch und schüttelte den Kopf. Die Niederschläge ließen kein bisschen nach. Für seine Arbeit war Starkregen etwa so schlimm wie Feuer in der Sprengstofffabrik. Ausnahmslos jeder, der einen Tatort betrat, brachte etwas mit, und heute würde es in erster Linie Regenwasser sein. Eine ganze Menge Wasser. Das war zwar nicht so schlimm wie Bleiche, aber es war dennoch der Alptraum einer jeden Spurensicherung. Die Beweise schwammen ihm im eigentlichen Sinne davon.
»Wo im Haus ist der Tatort?«
»Rein und dann gleich nach links in die Küche. Wir haben das ganze Haus gesichert, aber dich interessiert in erster Linie der Flur hinter dieser Tür und dann gleich links die Küche. Du kannst es nicht übersehen.«
Einige Minuten später stand Grübel im Spurenschutzanzug, mit Mundschutz und mit der Fotokamera mit Fisheye-Objektiv im Hauseingang. Die Haustür war zwar zu, aber selbst hier drin dominierte das Rauschen des Regens. Ansonsten war es still wie in einer Kirche. Der Unterschied zu Kirchen lag aber darin, dass dies ein entweihter Ort war, denn es roch nach ausgeschossenen Patronenhülsen und einer großen Menge Blut. Wer es einmal gerochen hat, braucht seine Augen nicht, um zu wissen, was ihn erwartet.
Grübel stellte sich in den Türrahmen, der zur Küche führte. Er machte zuerst ein Übersichtsfoto und studierte erst dann den Raum detailliert und nach jenem Raster, das er für sich im Kopf auf jeden Tatort legte. Von links nach rechts und von oben nach unten. So hatte es sich bewährt.
Der Raum war eine geräumige Wohnküche. Teure Bodenfliesen waren verlegt worden, denn auf jeder zweiten war der Medusenkopf dieses italienischen Modelabels eingraviert worden. Bloß der Name der Designerfirma wollte ihm nicht einfallen. Egal.
Die Fenster reichten bis zum Boden, und die Wände der Küche waren schlicht weiß verputzt und jetzt rot gesprenkelt. Selbst an Küchendecke und Dampfabzug sah er Blut.
Zwischen der linken Wand und der Küchenzeile stand ein Glastisch, und direkt bei der Küchenzeile lag ein Mann, das Gesicht auf den Fliesen und um ihn herum eine Blutlache, die kaum angetrocknet war. Anhand der grauen Haare und der Hautfalten am Handrücken tippte Grübel auf ü-sechzig. Das blaue Businesshemd mit weißem Kragen war besudelt und richtiggehend zerfetzt worden. Wie viele Schüsse ihn getroffen hatten, würden sie bald wissen, aber im Moment war die Anzahl egal. Das Ausmaß der Tat war auf einen Blick erkennbar. Grübel sah sich um, zählte rudimentär und kam auf über dreißig ausgeschossene Patronenhülsen, die über den Fliesenboden verteilt dalagen. Die einen Fliesen schienen sauber geblieben und hoffentlich geeignet für die Abnahme von Fingerabdrücken, die anderen ragten wie Eilande aus den Blutlachen der Opfer.
Hinter dem Mann und der Kochinsel lugten die Beine einer Frau hervor, verhüllt in Strümpfen mit Ornamentmustern. Einer der Frauenfüße steckte in einem goldenen High Heel, der andere Schuh lag mit gebrochenem Absatz im Blut, das sich aus den Schusswunden des Mannes ergossen hatte.
Weiß hatte nicht übertrieben. Dies hier war ein Massaker. Er kannte zwar die genaue Anzahl der Schusswunden noch nicht, aber er hatte noch nie zuvor so viele ausgeschossene Hülsen an einem Tatort liegen gesehen. Auf dem Schießstand sah es vor dem Aufräumen ähnlich aus.
Rechts von der Küchenzeile lag ein junger Mann um die zwanzig. Um ihn herum war alles rot verschmiert, als ob er sich vor dem Sterben gewälzt hätte. Und von da führten die Spuren an Grübel vorbei aus der Küche und zur Haustür.
Wer machte so etwas?
Im Poloshirt des jungen Mannes, Brustbereich eher rechts, erkannte er drei Ein- oder Ausschusslöcher im Stoff. Was von beidem, würde sich noch zeigen. Voreilige Schlüsse gehörten nicht an einen Tatort, aber die Position, wie der junge Mann dalag, etwas weg von der Küchenzeile hin zur Tür gerichtet, auf dem Rücken, ließ erahnen, dass er deutlich abseits von den anderen Toten in der Küche gestanden hatte oder sich davon wegbewegt haben könnte. Vielleicht hatte der Jüngste sich aus der Küche verdrücken wollen, als die Schüsse fielen. Wie auch immer, der Täter hatte ihn trotzdem erwischt.
Wenn seine Ahnung stimmte, wie das hier abgelaufen sein musste, dann hatte der junge Kerl die Projektile in den Rücken abgekriegt, und Grübel blickte auf die Austrittswunden in der Brust. Abwarten, was die Rechtsmedizin dazu zu sagen hatte.
Das verschmierte Blut daneben ließ erahnen, dass jemand sich zu dem jungen Mann begeben und ihn umgedreht hatte. Dann war dieser Jemand mit den blutverschmierten Schuhen raus bis zur Haustür und zur Veranda gelaufen, wo die Spuren schwächer wurden.
Wieso drehte man jemanden um, nachdem man ihn erschossen hatte? Hatte der Täter etwas in seinen Kleidern gesucht? Oder sich einfach nur vergewissern wollen, dass er den Richtigen erwischt hatte? Aber falls der junge Mann das Ziel gewesen war, wieso hatte er dann bloß drei Schuss abbekommen und der ältere geschätzte ein bis zwei Magazine voll? Das waren Fragen, welche die Ermittler zu beantworten hatten, nicht er. Aber das waren Fragen, von denen er wusste, dass sie noch wichtig würden.
Jetzt stand Grübel einen guten Meter weit in der Küche drin und ließ seinen Blick über die Wände schweifen. Neben ihm, nahe beim Durchgang raus zu Flur und Haustür, hatten sich drei Projektile in die Wand gebohrt. Der Schütze musste also da drüben am anderen Ende der Küche gestanden und in seine Richtung gefeuert haben.
Grübel hörte sich selbst tief in den Mundschutz ausatmen. Im Spurenschutzanzug wurde es allmählich feuchtwarm.
»Verflucht, wer macht so etwas?«
Daniel Garvey. Was um alles in der Welt hatte der hier zu suchen gehabt? Eigentlich gab es nur zwei Varianten. Garvey zog den Ärger förmlich an, oder er machte den Ärger. Statistisch gesehen sprach alles für die zweite Variante, denn er war ja kein Unbekannter. Die Spuren würden schon zeigen, wer der Täter war. Was Grübel hier vor sich sah, würde reichlich Spuren liefern. Auch vom Täter.
Grübel machte einige Aufnahmen, auch von den Wänden mit den Einschusslöchern und von der Decke über der Kochinsel. Dann ging er Schritt für Schritt zurück und gab acht, dass er auf keine Blutspuren trat. Draußen bei Weiß pulte er sich halb aus dem Schutzanzug, der mobilen Sauna, wie sie ihn nannten.
»Das verschmierte Blut im Flur. Seid ihr wo reingetreten?«, fragte er Weiß.
Der zeigte ihm zwar seine Schuhsohlen, war sich aber ganz sicher. »Nein, wir haben uns Mühe gegeben, das garantiere ich dir. Aber dieser Garvey war von oben bis unten besudelt. Als wir ihn verhaftet haben, hat er neben dem jungen Mann rechts im Blut gekniet. Zum Dank dürfen wir dann am Schluss den Streifenwagen reinigen lassen. Garvey hat wie weggetreten vor sich hingestarrt. Wie in Trance, und er war bis ins Gesicht hoch mit Blut verschmiert. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat der etwas eingeworfen. Kann man nie ausschließen.«
»War er bewaffnet?«
»Garvey? Nein. Aber du hast es selbst gesehen. Irgendwo da drin muss eine Waffe liegen. Wenn nicht … warte mal. Es gibt doch diese Sherlock-Holmes-Geschichte mit dem Toten in einem von innen abgeschlossenen Raum, aber die Tatwaffe ist nicht im Raum. Ich glaube, die Lösung in Conan Doyles Fall ging so, dass –«
»Ist es okay für dich, wenn wir hier arbeiten, statt Holmes und Watson zu spielen? Wäre echt gut, wenn du dich auf Daniel Garvey konzentrierst. Wenn der wirklich weggetreten war, dann nehmen wir ihm besser gleich eine Blutprobe ab. Der Staatsanwalt soll das sofort genehmigen, damit wir keinen Ärger mit einem Verteidiger kriegen.«
»Klar, ich informiere die Staatsanwaltschaft. Mit Garvey stimmt hundertpro etwas nicht. Der war selbst im Gesicht voller Blut. Auch um den Mund herum. Frag mich nicht, was der da drin getan hat, aber bei der Verhaftung sah er aus wie aus einem Horrorfilm.«
»Da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist ein Overkill, der in keinem Lehrbuch fehlen sollte. Ich habe über dreißig Patronenhülsen gezählt und mir dabei noch nicht einmal Mühe gegeben, alle zu zählen. Es sieht aus, wie wenn das A-Team aus der TV-Serie herumgeballert hätte.«
Sie schwiegen. Von Weitem näherten sich noch mehr Polizeisirenen. Die Verstärkung rückte an.
»Habt ihr von Garvey ein Foto gemacht?«
»Ja, mit Fredis Handykamera. Aber erst, als wir ihn hinten gebunden im Flur in die Ecke gestellt hatten. Ich wollte mir sicher sein, dass er nicht auf uns losgehen kann.«
Grübels graue Zellen arbeiteten auf Hochtouren, und er schälte sich ganz aus dem Spusi-Anzug. »Ich schaue mir zuerst Garvey an. Bloß damit wir keine Spuren an ihm verpassen, die er sich im Auto abwischen könnte.«
»Klar. Ich nehme an, seine Hände gehören in Tüten verklebt, bis die Spusi an ihm durchgeführt ist?«
»Auf jeden Fall, das muss ich jetzt sofort tun, nicht dass er Spuren von demjenigen abbekommt, der vor ihm im Streifenwagen auf der Rückbank gesessen hat.«
»Ist bereits passiert«, bluffte Weiß und stand jetzt fast stramm vor Stolz. »Ich habe ihm die Hände noch drinnen bei der Haustür in Tüten gesteckt und verklebt. Erst danach haben wir ihn zum Wagen gebracht. Ich war letzte Woche bei deinen Kollegen in der internen Weiterbildung.«
»›Der Erste Angriff aus forensischer Sicht‹?«
»Genau der. Sie haben uns gesagt, man soll jeweils so schnell wie möglich die Hände in Tüten stecken.«
Grübel klopfte Weiß auf die Schulter. »Gute Arbeit.« Denn bei Starkregen reichte eine kurze Zeit im Freien, und erste wichtige Spuren konnten bereits abgewaschen sein. Entweder man hatte mit einem Tatort Glück oder dann nur Pech.
»Und er hat sich wirklich nicht gewehrt?«
»Nicht im Geringsten. Frag Fredi.«
Weiß zeigte zum Streifenwagen, wo Garveys Silhouette auf dem Rücksitz erkennbar war. Fredi stand neben dem Wagen und ließ sich vom Regen anständig waschen.
»Du hast völlig recht, da drin sieht es aus wie in einem Tarantino-Film«, sagte Grübel.
»Sag ich doch. Nur ein gottloses Monster ist zu so etwas fähig«, schloss Weiß.
Grübel ging in den Regen hinaus und gab sich erst gar keine Mühe, sich zu beeilen. Er würde ohnehin gleich klatschnass sein. Seine Nase berührte die Seitenscheibe, über die der Regen in langen Bahnen abperlte, und wenige Zentimeter entfernt auf der anderen Seite der Scheibe saß Daniel Garvey. Kein Zweifel, er war es.
3
Die Zuger Altstadt war wie ausgestorben. Keine Touristen und keine Rentner auf Spaziergängen. Selbst für die Fischer war es zu nass.
Forster saß am Bartresen der »Fischerstube«, vor ihm auf dem schweren Holz stand ein Glas Jack Daniel’s Single Barrel, und sein Atem roch nach den anderen Gläsern, die er bereits gekippt hatte. Die ersten drei hatten anständig reingeknallt, aber an sein Leben konnte er sich noch erinnern. Also mussten mehr Drinks her.
Er blendete das Lachen und Diskutieren der anderen Gäste aus, während draußen der Allmächtige versuchte, mit offenen Himmelsschleusen die Welt zu reinigen. Aber das war wohl auch nicht des Herrn bester Tag, denn die Menschen und die Stadt wollten sich partout nicht das Loch runterspülen lassen. In der Häuserzeile gegenüber liefen die Dachrinnen über, und das Tageslicht war fast weg, obwohl es eigentlich die längsten Tage des Jahres hätten sein sollen. Das Radio dudelte vor sich hin, und die beiden Moderatoren im Studio machten sich einen Spaß daraus, nur Lieder zu spielen, die von schlechtem Wetter berichteten. Das machte es allerdings auch nicht besser. »Singin’ in the Rain« und »Purple Rain« waren durch und hatten auch nichts verändert. Immerhin war dieses Sauwetter kein schlechter Polizist, denn wenn in diesen Tagen einer auf die schiefe Bahn geriet, dann passierte das wohl zu Hause, wo es trocken war. Die Nachbarn würden dann schon anrufen. Ertappt.
Er seufzte, denn er hatte schon wieder an seinen früheren Beruf gedacht und wusste nicht, wie man das Denken eines Polizisten abschalten konnte. Wie nannte man das Theaterstück eigentlich, in dem er die Hauptrolle spielte? Gab es ein Wort dafür, wenn Drama, Tiefpunkt und Komödie sich vermischten?
Immer wieder tauchten zwischen seinen Schläfen Gedanken zu Tatorten und Delinquenten auf, ebenso Erinnerungen an seinen Ex-Chef ohne Rückgrat. Eigentlich hätte man über ihn eine Doku drehen und sie »My Octopus Boss« nennen können. Die Geschichte des Mannes, der sich durch jedes noch so enge Loch hatte quetschen können, wann immer es um die eigene Karriere gegangen war. Aber viel mehr hatte dieser Tintenfisch von einem Polizeioffizier nicht erreicht, außer dass Forster ihm beim letzten Gespräch das Wort »Vollidiot« buchstabiert und dann die Polizei für immer verlassen hatte. Dazwischen hatte er eine Tür so hinter sich zugehauen, dass man es im ganzen Polizeigebäude gehört hatte.
Die letzten Monate waren eine irre Kiste. Nachdem er die Waffe und den Dienstausweis abgegeben hatte, veränderte sich alles. Es war, als ob sein früheres Leben an diesen beiden Gegenständen geklebt hätte. Kaum waren Waffe und Dienstausweis weg, gab es bloß einen Trend. Mit Vollgas über den Abgrund in die Krise. Kontostand runter, Sandra war mitsamt Katze und der teuren Kaffeemaschine ausgezogen, und vom Kripoermittler hatte er sich zu Daniel Garveys Handlanger und Tagelöhner entwickelt. Seit er sich halbwegs mit Garvey angefreundet hatte, machte er die Evolution in der Gegenrichtung durch. Er entwickelte sich zum Neandertaler, erkannte sich im Spiegel kaum wieder, und er konnte nicht mehr viel tiefer sinken. Dabei hatte er zuerst nur eingewilligt, Daniel Garveys Trauzeuge zu sein. Seit Sandras Auszug waren die Garveys praktisch seine einzigen Kontakte geworden, die er halbwegs regelmäßig pflegte. Alle anderen mieden ihn oder er sie.
Nicht denken. Trinken.
Das ergab heute am meisten Sinn, denn dabei konnte nichts schiefgehen. Forster wollte den nächsten Whiskey kippen, kam aber nicht dazu. Eine Rothaarige um die fünfzig setzte sich auf den Barhocker neben ihn, parkierte eine Hand auf seinem Oberschenkel und klimperte mit den Wimpern. Sie stellte sich ihm als Nathalie vor und sprach ein perfektes Hochdeutsch. Zugegeben, sie hatte recht schöne Augen, aber das war auch schon alles. Ein Arzt hatte ihr das Gesicht zu einer ausdruckslosen Maske in Richtung der Ohren gezogen. Das Rot der Haare war offensichtlich falsch, das Katalognäschen unten zu schmal und die Oberweite zu mächtig für ihre Figur.
»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte sie gekonnt spannungsgeladen. Diesen Satz hatte sie offensichtlich nicht zum ersten Mal von sich gegeben.
Forster schob ihre Hand von seinem Bein. »Sorry, aber wenn ich Sie so mit der Hand anbaggern würde, hätte ich mir bereits eine eingefangen oder eine Klage am Hals. Gehen Sie besser zurück zum Tisch mit den Duckfaces. Ich bin eh nicht bei Kasse. Schlechte Partie.«
Forster kippte den Jack die Kehle runter und blickte geradeaus zu den beleuchteten Flaschen an der Wand hinter dem Bartresen. Die zutiefst beleidigte Männerjägerin verzog sich, und drüben am Frauentisch entbrannte intensives Getuschel. Er erntete Blicke, die ihn in einem Paralleluniversum in kleine Stücke hackten, aber hier in der »Fischerstube« blieb der Effekt aus. Paralleluniversum? Forster lachte über seine eigenen Gedanken.
»Gib mir noch mal das Gleiche«, brummte er.
Der kräftige Kerl im T-Shirt hinter dem Bartresen stemmte die Hände in die Hüften und machte keine Anstalten, nachzugießen. Stattdessen fragte er: »Was ist denn dir über die Leber gekrochen?«
»Geht dich nichts an.«
»Wenn du mir die Gäste vergraulst, dann geht es mich etwas an.«
»Wie du meinst.« Forster erhob sich vom Barhocker und schwankte zur Tür. »Dann nehme ich den nächsten gerne draußen, damit ich dir die Cougars nicht verjage. Bei dem Sauwetter gehen die Kätzchen nur drinnen auf die Jagd. Da habe ich es draußen schön ruhig.«
Er setzte sich unter der Arkade auf den Fenstersims der Bar und wartete auf seinen besten Freund Jack Daniel’s. Vor dem Fischereimuseum spie ein Kanaldeckel Wasser aus, das eigentlich darin hätte versickern sollen, und ein kühler Wind zog durch die Arkade. Eigentlich war der Tag gar nicht so schlecht, denn der nächste Jack fand seinen Weg zu ihm.
»Das ist heute dein letzter. Du solltest ein paar Tage die Finger davon lassen.«
Forster nippte am Glas und sah zum See hinunter. Der Kerl mit der roten Baywatch-Schwimmboje kraulte durch das graue Wasser, so wie er es von Januar bis Dezember jeden Tag tat. Viel Spaß beim Frieren.
»Was ist mit dir los, Forster? Hast du Ärger?«
Forster lachte lauter als beabsichtigt. Die Kontrolle über seine Stimme hatte Jack übernommen. »Es geht mir super. Seit heute elf Uhr bin ich geschieden. Mach dir wegen mir keinen Kopf. Wenn du nichts hast, können sie dir auch nichts mehr wegnehmen.« Er schüttelte den Kopf und blickte in den Whiskey, der für einen Tag wie heute eine erstaunlich freundliche Honigfarbe hatte.
»Den hier solltest du besser nicht austrinken, denn die Sorgen macht er nicht weg. Geh schlafen und stell dich unter eine kalte Dusche. Danach solltest du deine Probleme regeln.«
Forster lallte. »Danke, aber kalte Duschen hatte ich in letzter Zeit schon genug, und Probleme gibt es nur wegen Menschen. Wegen nichts anderem. Heuchler und Lügner an jeder Ecke. Vom Müllmann bis zum Politiker sagt dir keiner, was er wirklich denkt.«
»Was haben die Müllabfuhr und Politiker mit deinem Suff zu tun?«
»Mehr, als du denkst. Du wählst sie, und dann betrügen sie dich in einer Berner Hotellobby mit einem Lobbyisten. Darum heißt es auch Lobbyist. Glaub mir, die Rothaarige da drin ist kein bisschen besser. Geld weg, Rothaarige weg. Das ist das Prinzip der glänzenden Welt, die sie uns aufgezwungen haben.«
»Ist das eine Art Metapher für Menschen, die dich hintergangen haben?«
»Metapher? Was quatschst denn du für einen Blödsinn? Bin ich besoffen, oder bist du es?«
»Ich frage ja nur.«
»Das ist keine Metapher, es ist so, wie ich es sage. Versuche doch mal, einem Politiker in Bern seine Sponsoren auf den Hemdkragen zu sticken, die ihm heimlich Geld in den Hosenbund stecken. So wie sie es bei den Hockey-Coaches tun. Dann wird der Kragen immer dicker, und der Hals hat keinen Platz mehr. Weißt du, so sind die Menschen. Verkaufen sich an jeden. Hauptsache, es gibt Kohle und Renommee. Was glaubst du, weshalb die in der Politik ihre Sponsoren nicht offenlegen wollen? Etwa wegen der Bürokratie?« Forster lachte laut. Bürokratie. Von wegen.
»War nicht die Scheidung der Grund für deinen miesen Tag?«
»Bist du schwer von Begriff? Es ist doch offensichtlich. Das Problem sind die Narzissten da draußen. In dieser Welt zählen bloß noch Knete und Likes. Die Scheidung ist nur ein Symptom von dem ganzen Mist hier. Siehst du die Zusammenhänge nicht? Jeder will ein kleiner König sein.«
Der Barbesitzer runzelte die Stirn, Forster kippte den letzten Jack und schwankte durch die Arkade dem See entgegen, in der Hand das leere Glas. Er ging in den Regen hinaus, ohne zurückzusehen. »Man muss volle Gläser leer machen, um Platz für Neues zu schaffen«, rief er, wusste aber nicht, ob der andere ihn überhaupt noch verstand.
Der Regen übernahm die kalte Dusche, und sein Kopf wurde kein bisschen klarer.
***
Nachdem Daniel Garvey in die Strafanstalt Zug überführt worden war, musste er einen ganzen Parcours durchlaufen. Zuerst führten ihn zwei Uniformierte durch lieblose Flure mit Stahltüren und Sicherheitskameras. Er wurde von allen Seiten fotografiert. Daniel hatte schweigend hingehalten, und in seinem Kopf kamen und gingen die Bilder aus dem Haus der Familie Arnaut.
Der Kriminaltechniker kratzte ihm mit seltsamen Stäbchen den Fingernagelschmutz unter den Nägeln hervor, und mit Wattestäbchen nahm er Abriebe von den Handflächen, den Fingern und vom Blut in seinem Gesicht. Danach roch Daniel noch immer das Schießpulver und den verbrannten Toast. Die Polizisten mit Einweghandschuhen und Mundschutz zogen ihm die Kleider aus, legten sie vorsichtig auf Tischen aus, fotografierten und tüteten sie ein. Daniel sah den jungen Arnaut vor sich auf den Küchenfliesen liegen – und sich selbst in dessen Blut knien. Irgendwann hatten sie ihm alle Kleider abgenommen, und er stand nackt da, wurde abermals fotografiert, auf Narben und Verletzungen untersucht, selbst das Tattoo auf seinem rechten Schulterblatt mit der Botschaft »One Life« wurde fotografiert und inspiziert. Einer wollte wissen, was es mit dem Tattoo auf sich habe, aber Daniel brummte, dass er es im Internet nachschlagen könne. Für mehr reichte seine Konzentration nicht aus. Sein Kopf war ganz woanders.
Am Ende der Spurensicherung schickte man ihn dauerbewacht unter die Dusche, die ihn mehr an eine Militärkaserne erinnerte als an einen Ort, wo man sich reinigte. Das Wasser aus der Brause zog wenigstens das Blut von Arnaut junior den Abfluss hinunter, und seine eigene Haut kam zum Vorschein. Danach – so dachte er sich – würde die Tortur wohl eine Pause finden, aber das war eine Fehleinschätzung. Sie steckten ihn in einen grauen Jogginganzug, nahmen ihm die Fingerabdrücke ab, fotografierten ihn abermals von allen Seiten, und er wurde in eine Gefängniszelle geführt.
»Muss jemand über Ihre Verhaftung informiert werden?«, fragte einer der Polizisten ihn in breitmauligem Tonfall, und er realisierte, dass sein Status jetzt »verhaftet« lautete.
»Hören Sie mich? Wer muss wissen, dass Sie hier sind?«
Daniel drehte sich zu dem Mann um, der in der Zellentür stand und ihn beäugte.
»Meine Frau, bitte. Anna Garvey-Berger.« Er strengte sich an, aber die Zahlenfolge wollte ihm nicht einfallen. »Ich kann mich nicht an ihre Telefonnummer erinnern. Ich brauche eine Pause.«
»Kein Problem. Das kriegen wir auch so hin. Die Polizei kennt alle Telefonnummern.«
Dann ging der Uniformierte, ein Gefängnismitarbeiter verschloss die Tür, und nach den metallenen Schließgeräuschen blieb Daniel in völliger Stille zurück. Eine Zelle, so steril und grau wie die Flure davor. Lieblos wie der Kontrollraum des havarierten Kraftwerks Tschernobyl und gerade mal zweieinhalb auf dreieinhalb Meter groß. Vor dem Fenster versperrten schwere Gitterstäbe die Aussicht, und in Daniel verkrampfte sich so ziemlich alles, was dazu überhaupt in der Lage war.
Er hatte vor einigen Jahren in der Zeitung gelesen, dass ein Häftling – mit Geschick und dem Hebelarmprinzip – diese Gitterstäbe verbogen und sich danach auf Nimmerwiedersehen verabschiedet hatte. Aber er wusste gar nicht, ob das stimmte oder so eine Art Knastlatein war. Er dachte ohnehin an anderes als ans Abhauen.
Sein Kopf reproduzierte die Bilder vom Tatort, und beim Anblick der Zelle und seines Jogginganzugs geisterte ein Refrain von Green Day mit der rotzfrechen Stimme des Sängers durch seinen Kopf.
Welcome to Pa-ra-dise.
Daniel hätte gerne etwas gegessen und Anna gesprochen, um sich und sie zu beruhigen. Aber kaum hatte er sich auf das Bett mit der Matratze mit Plastiküberzug gesetzt und im Raum umgesehen, wurde er abgeholt und – wie es die beiden Polizisten nannten – transportbereit gemacht. Seine Hand- und Fußgelenke wurden in Handschellen gequetscht und mit einer Kette verbunden. Gefesselt wie Hannibal Lecter, konnte er gerade mal halbe Schritte machen, und die Uniformierten mussten ihn im unterirdischen Gang vom Gefängnis hinüber zum Polizeigebäude an beiden Ellenbogen festhalten, damit er nicht stolperte.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie im Untergrund zum Lift und dann hoch in ein Büro gelangten, das keinerlei persönliche Note zeigte. Keine Bilder oder Aufstellfotos, noch nicht mal einen Kaktus.
Hinter dem Schreibtisch stand eine Frau in Jeans und Bluse, am Handgelenk trug sie eine klobige Golduhr, die sicher nicht echt war, und ihre langen Haare schob sie sich hinter das rechte Ohr wie bei einem Date. Ein Zeichen von Nervosität oder eingeübter Selbstsicherheit. Sie wies auf den Stuhl an ihrem Schreibtisch.
»Setzen Sie sich, Herr Garvey.«
Die Uniformierten halfen ihm, indem sie ihm unsanft den Stuhl in die Knie schoben und ihn so auf die Sitzfläche des Stuhls beförderten.
»Wir gehen gleich Ihre Personalien durch. Vorher erkläre ich Ihnen, wer alles anwesend ist. Neben Ihnen sitzt Rechtsanwältin Egger. Sie stellt heute das Anwaltspikett und ist für diese Einvernahme beigezogen worden. Verfügen Sie über einen eigenen Anwalt?«
Daniel schüttelte den Kopf. Die Zeiten, in denen er ständig Anwälte gebraucht hatte, lagen schon etwas zurück.
»Dann stellt Frau Egger fürs Erste Ihre Verteidigung sicher. Die Herren Arnold und Frigo von der Zuger Polizei sind zu Ihrer Bewachung hier, und ich bin Caroline Nussbaumer, Staatsanwältin. Verstehen Sie mich, oder benötigen Sie eine Übersetzung?«
»Nein.«
Das Ganze hier ging Daniel zu schnell. Sein Kopf hinkte bei jedem Satz zwei bis drei Worte hinterher.
»Nein was? Nein, Sie verstehen mich nicht, oder nein, Sie brauchen keine Übersetzung?«
»Keine Übersetzung. Ich verstehe Sie.«
Nussbaumer gab auch danach das gleiche Tempo vor. Die Rechtsbelehrung hatte sie dermaßen runtergeleiert, dass Daniel immer noch bei der unverständlichen Erklärung über falsche Anschuldigung und Irreführung der Rechtspflege festhing, während sie unablässig weitersprach und schon ganz woanders war.
»Erzählen Sie mir, was heute passiert ist?«
Daniel löste sich von der Rechtsbelehrung und blickte von der Staatsanwältin zur Verteidigerin und wieder zurück.
»Könnten Sie die Frage noch einmal …?«
Egger neigte sich zu ihm. »Die Frage war, wie Ihr Tag abgelaufen –«
Weiter kam sie nicht, weil Nussbaumer dazwischenging. »Ich stelle hier die Fragen. Also noch einmal. Schildern Sie Ihren Tagesablauf vom Aufstehen nach dem Aufwachen bis zu diesem Augenblick.«
»Ich weiß nicht, wann ich aufgestanden bin.« Er überlegte länger. »Es war etwa … Nein, ich bin nicht sicher. Ist ja auch egal. Jedenfalls … ich bin aus dem Keller der Arnauts hochgekommen, und alle waren tot.«
Vor ihm ging der Film ab, wie er in die Küche trat. Er roch das Blut und das Schießpulver. Er hörte den Regen rauschen – aber das Rauschen kam aus seiner Erinnerung und existierte im Hier und Jetzt gar nicht.
»Wer war tot?«, bohrte Nussbaumer nach.
»Alle.«
»Haben Sie sich im Keller der Familie Arnaut aufgehalten?«
Daniel wollte sich an der Stirn anfassen, aber die Ketten hielten seine Hände zurück.
»Ja, im Keller war ich.«
»Was haben Sie dort gemacht?«
»Ich wollte …« Er sah sich, wie er da gekniet hatte, seine Hände voller Blut, nachdem er den jungen Arnaut umgedreht hatte.
»Alles war voller Blut … ich habe …«
»Sind Sie okay?«, fragte Egger. »Ich glaube, meinem Mandanten geht es nicht gut.«
Daniel sah sie an. Mandant? Ach so, ja. Er war ja verhaftet worden.
»Es geht schon.«
»Sicher?«
»Das sehen Sie doch«, intervenierte Nussbaumer. »Er ist unverletzt und reagiert auf die Fragen. Könnten wir bitte fortfahren?«
Daniel sah Nussbaumer an.
»Also noch einmal. Was haben Sie im Haus der Familie Arnaut gemacht?«
»Ich war da, weil ich …« Daniel fand seine eigenen Gedanken kaum. »Ich wollte dort … als ich aus dem Keller zurückgekommen bin, da stand die Haustür offen, und alle …« Er nahm wahr, dass er ständig Sprechpausen machte, und kriegte es nicht in den Griff, zusammenhängend zu sprechen. »Alle waren tot.«
»Haben Sie sie getötet?«
Egger rutschte auf dem Stuhl hin und her. »Darauf müssen Sie nicht antworten. Sie haben die Rechtsbelehrung gehört.«
Daniel sah wortlos zu Nussbaumer.
»Haben Sie, oder haben Sie nicht?«, fragte sie noch mal.
Er sah in ihr Gesicht und versuchte noch einmal zu erzählen, warum er im Haus der Arnauts gewesen war. Aber sein Oberstübchen wollte ihm keine Sätze liefern.
»Sie sind alle tot.«
Zu mehr war er nicht zu gebrauchen. Nussbaumer beendete die Einvernahme und teilte mit, dass weitere folgen würden, sobald er sich ausgeruht habe. Für Daniel klang das wie eine Drohung, die aber schnell verpuffte, weil Nussbaumer nachdoppelte: »Ich werde wohl beim Gericht Antrag auf U-Haft stellen müssen. Verstehen Sie das?«
Alle schauten zu Daniel, und er nickte wortlos.
»Sie sind kein Unbekannter«, schob Nussbaumer nach. »Gemäß den Informationen der Polizei haben Sie vor nicht allzu langer Zeit an der Pfnüselküste im Kanton Schwyz eine Villa in die Luft gesprengt. Dann haben Sie sich mit der Mafia angelegt, und Polizisten sind gestorben.« Nussbaumers Blick hielt Daniel kaum aus. »Diesmal hat es drei Tote gegeben, und Sie waren beim Eintreffen der Polizei am Tatort.« Sie lehnte sich im Bürosessel zurück. »Was sage ich da? Sie waren nicht nur am Tatort, sondern mitten im Tatort. Von oben bis unten voll mit Blut der Opfer. Wenn es nach mir geht, bleiben Sie so lange in U-Haft, bis dieser Fall restlos geklärt ist.«
Daniel wusste nicht, was er sagen sollte, aber Egger intervenierte. »Der Vorhalt zu Beginn dieser Einvernahme hat sich ausschließlich auf die Ereignisse bei der Familie Arnaut bezogen. Falls meinem Klienten darüber hinaus weitere Taten vorgeworfen werden, muss ich dies als Verteidigerin wissen. Und zwar jetzt sofort. Wird der Tatvorwurf erweitert, oder werden meinem Mandanten mehrere Taten vorgeworfen?«
Nussbaumer schüttelte genervt den Kopf. »Nein, zurzeit nicht.«
»Dann gibt es wohl auch keinen Grund, meinem Klienten andere Ereignisse vorzuwerfen und daraus einen Haftgrund aufzubauschen. Oder weiß ich etwas nicht?«
Abermals schüttelte Nussbaumer den Kopf und fühlte sich offensichtlich angegriffen. »Der Mehrfachmord von heute Morgen reicht allemal für eine U-Haft. Wir werden ja sehen, was dabei noch ans Tageslicht kommt. Bei Herrn Garvey habe ich da so ein Gefühl.«
»Allerdings arbeiten wir mit Fakten. Nicht mit Gefühlen. Nicht wahr?«, konterte Egger, und die beiden Polizisten sahen zwischen den beiden Frauen hin und her, und jetzt, da die Diskussion abgestorben war, ruhten wiederum alle Blicke auf Nussbaumer.
Daniel unterzeichnete das Einvernahmeprotokoll. Danach wurde er durch den unterirdischen Gang in seine Gefängniszelle zurückgebracht.
Zu Daniels Erstaunen wurden seine Gedanken in der Gefängniszelle schnell klarer, und dies, obwohl er die beengenden Wände und Gitterstäbe vor dem Fenster kaum aushalten konnte.
Sein Kopf begann, die Ereignisse zu ordnen. Er erinnerte sich, wie heute früh alles abgelaufen war. Er sah die Details vom Tatort, und ihm war klar, dass er ab jetzt sagen und tun konnte, was er wollte. Er galt für alle als der Täter eines Dreifachmordes, und ihm war klar, dass er diesen Verdacht nicht so leicht loswerden würde. Die Polizei hatte ihn noch am Tatort verhaftet, blutverschmiert von oben bis unten. Ein Tatverdächtiger konnte unmöglich tiefer in der Klemme stecken, als er es gerade tat.
Er fluchte gegen die Betonwand, und das Lied von Green Day kam ihm wieder in den Sinn.
Welcome to Pa-ra-dise.
***
Zitternd und im Nachthemd stand Sophie unter einer riesigen Fichte und starrte in den Wald. Im Blätterdach rauschte der Regen, und sie war so allein wie nie zuvor.
Ihr Kopf versuchte, sie zu übertölpeln. Sie glaubte, im Wald die Donnie-Darko-Version von »Mad World« zu hören. Im Unterholz hinter ihr hatte die Klavierbegleitung eingesetzt. Sie blickte zum Pianisten, konnte ihn aber nicht sehen. Dafür sah sie ihren Bruder rennen und hinfallen – und er stand nicht mehr auf.
Sophie war kurz davor, loszulaufen, aber etwas hielt sie an Ort und Stelle.
»Reiß dich zusammen, Sophie«, flüsterte sie. »Das ist alles nicht echt. Es ist nur in meinem Kopf.«
Ja. Sie riss sich zusammen. Gegen sich selbst durfte man nicht verlieren und gegen die anderen erst recht nicht. Niemals.
»Ich bin Sophie Arnaut!«, schrie sie die Bäume an, und das Klavier wurde leiser. »Ich reiße mich zusammen und gebe nie, nie auf. Sicher nicht heute. Es gibt hier kein Klavier.«
Sie ging weiter. Immer weiter weg von da, wo ihre Familie ausgelöscht worden war. Sie hatte jetzt kein Zuhause mehr, und es gab auch kein Zurück.
4
Forster lag unter dem offenen Fenster auf seinem Sofa. Er hörte sich selbst grunzen und schnarchen und wälzte sich im Halbschlaf.
Mit dem Klingeln des Telefons schoss er hoch und stieß den Kopf von unten gegen den offen stehenden Fensterflügel. Er rieb sich die Stirn, und gerade hasste er die Welt wieder etwas mehr.
Er stand auf und suchte das Telefon, weil es nicht schweigen wollte. Auch das noch! Der Regen hatte ihn durch das offene Fenster sogar in seiner Wohnung drin erwischt. Sein linkes Hosenbein war nass, und auf dem Sofa sah er einen dunklen Fleck. Seine Arme fühlten sich kalt an wie der Tagesfang aus dem See. Er ging der Dachschräge entlang und nahm den Anruf entgegen, während er das Fenster schloss.
»Was ist?«, keifte er ins Telefon, ohne nachzusehen, wer dran war.
»Forster? Alles okay bei dir?«
Anna Garvey. Wieder einmal jemand von den Garveys. Wer sonst. Aber auf jeden Fall war es besser, wenn sie ihn störte und nicht ihr Göttergatte. Daniel Garvey hatte sich in den letzten Monaten zwar als ziemlich okay herausgestellt, er hatte sich für Daniel aber auch eine Kugel eingefangen, weil der einmal mehr, ohne zu überlegen, mit dem Kopf durch die Wand hatte gehen wollen. Daniel blieb ein Ärgermagnet.
Der Regen hatte Forster mehr erwischt, als er gedacht hatte. An der linken Schulter klebte ihm das T-Shirt, und das eine Hosenbein fühlte sich an, als ob er eingenässt hätte. Eiskalt statt körperwarm.