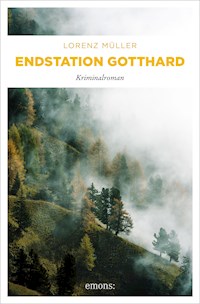
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Daniel Garvey
- Sprache: Deutsch
Dunkle Geheimnisse in den Alpen Ein Mann verschwindet spurlos – und wird Monate später auf einer einsamen Landstrasse im Tessin tot aufgefunden. Nackt, kahl geschoren und verdreckt. Da sich die Polizei nicht für den Fall zu interessieren scheint, sucht der Bruder des Toten auf eigene Faust nach Antworten. Er ahnt nicht, dass er dabei einem mächtigen Gegner in die Quere kommt, der in der Abgeschiedenheit der Leventina Unaussprechliches treibt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lorenz Müller, geboren 1977 in der Stadt Zug, Schweiz, lebt noch heute im Kanton Zug. Nach juristischen und forensischen Ausbildungen arbeitete er jahrelang als Staatsanwalt. Das Schreiben ist sein Hobby, und seine freie Zeit verbringt er am liebsten in abgeschiedenen Winkeln der Schweizer Alpen.
Diese Geschichte mit all ihren Handlungen und Figuren ist frei erfunden. Sollten Sie sich dennoch in einer der nachfolgenden Personen wiedererkennen, bilden Sie sich bloss nicht zu viel darauf ein. Alle beschriebenen Orte sind dagegen real, wenn auch teilweise ein klein wenig verändert.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Nature in Stock/
Giacomo De Donañ†
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-550-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Immerhin! Mich wird umgebenGotteshimmel, dort wie hier, Und als Totenlampen schwebenNachts die Sterne über mir.
Prolog
Er rannte durch den dunklen Wald, gekleidet in einen hellen Jogginganzug aus Baumwolle. Er trug weder Schuhe noch Socken und stolperte durch die Nacht. Er musste stehen bleiben, um nach Atem zu ringen. Die kalte Bergluft brannte in seinen Lungen, und es roch nach Schnee. Sein Herz hämmerte so wild, dass er glaubte, es würde ihm demnächst aus der Brust springen. Von einem Moment auf den anderen war er davongelaufen. Er hatte sich nicht an die kalte Luft gewöhnen können und keine Gelegenheit gefunden, Schuhe anzuziehen. Seine Flucht war zwar geplant, aber nicht terminiert gewesen.
Er lief um nichts weniger als um seine Freiheit. Beim Atmen büsste er dafür, dass man ihm seit Wochen verwehrt hatte, auch nur kurze Distanzen über hundert, zweihundert Meter zu laufen. Auch war er länger nicht mehr an der frischen Luft gewesen, und er hatte keine Ahnung, welcher Monat auf den Kalenderblättern stand. September vielleicht. Die kalte Luft sprach eher für Oktober oder November.
Eine gefühlte Ewigkeit hatte er im steilen Gelände auf seinen nackten Füssen zurückgelegt. Über Wiesen und durch einen abfallenden Bergwald war er eben noch gerannt. Die Art der Landschaft und die Bauweise eines Viehstalles, an dem er vorbeigeeilt war, verrieten ihm, dass er sich in den Alpen befand. Auf der Alpensüdseite. Wo genau, wusste er nicht. Er lief einfach nur weg vor denen, die ihn durch die Nacht jagten. Ganz genau wusste er dagegen, wer seine Verfolger waren. Sie hatten ihn lange Zeit gefangen gehalten und «Nummer 17» genannt – auf Italienisch und auch auf Englisch hatten sich diese Männer unterhalten. Zwischen einigen Worten und Befehlen auf Englisch hatte er immer wieder einen Dialekt gehört. Tessiner Dialekt. Meist aber waren seine Bewacher wortkarg gewesen, und sie hatten Sturmmasken getragen, sodass er deren Gesichter nie hatte sehen können. Sie jagten ihn jetzt durch den Wald. Er wusste nicht, wie viele Verfolger er hatte. Klar war ihm hingegen, dass sie Meter für Meter zu ihm aufholten, und er hörte hinter sich im Wald immer wieder das Bellen eines Hundes.
Ein Fährtenhund.
Seine Füsse pochten vor Pein. Beim Rennen war er etliche Male auf scharfkantige Steine und trockene Äste getreten, und das Brennen in seinen Fusssohlen war kaum auszuhalten gewesen. Jeden Schmerzstoss hatte er still in sich hineingefressen. Den Hass auf diese Männer hätte er laut herausschreien können. Doch er musste sich zusammenreissen.
Ihm war klar, dass er in diesem Gelände nicht mehr weit kommen würde. Er brauchte dringend eine Pause. Er musste bald ein Haus oder ein Fahrzeug erreichen und Unterschlupf finden. Nur so hatte er eine reelle Chance, zu entkommen. Zuerst musste er einen Weg finden, wie er den bellenden Fährtenhund irreführen konnte. Wie bewerkstelligte man so etwas?
Er hatte keine Ahnung.
Er stand immer noch um Atem ringend im Wald, die Hände auf seine Knie abgestützt. Er schaute an sich hinunter und erkannte, was ihm jeden Moment zum Verhängnis werden konnte. Sein Jogginganzug. Der Baumwollstoff war derart hell, dass er im Mondlicht leuchtete wie ein weisses Blatt Papier.
Hastig streifte er Sweatshirt und Hose ab und stand nun nackt im Wald. Der eisige Nordwind fühlte sich noch kälter an, und sein Körper zitterte.
Im Wald über ihm ertönte wieder das Bellen des Hundes. Seine Verfolger waren nahe. Zu nahe. Vielleicht noch hundert Meter, dann würden sie bei ihm sein.
Einen Augenblick lang wurde er den Gedanken nicht los, der kalte Wind trage den sauer riechenden Schweiss seiner Verfolger und den abstossenden Mundgeruch des Hundes zu ihm. Dann schlugen ihm diese Reize derart intensiv in die Nase, dass er glaubte, seine Verfolger hätten ihn bereits umringt. Es waren grässliche Gerüche, die ihn beherrschten. Ihm wurde schwindlig. Derartige Sinneswahrnehmungen waren ihm nicht fremd. Seit einiger Zeit hatte er immer wieder so intensiv wahrgenommen. Wie aus Eimern gegossen überkam es ihn, und genauso schnell verschwanden diese Wahrnehmungen jeweils wieder. Nicht zum ersten Mal vermutete er, erkrankt zu sein. Er wusste, dass kein Mensch derart intensiv riechen konnte. Es gab keine andere Erklärung. Das war eine Veränderung. Eine Krankheit.
Der Mundgeruch des Hundes schnürte ihm den Hals zu. Die Eingeweide zogen sich in ihm zusammen, und saurer Speichel ergoss sich in seine Mundwinkel. Nackt im Wald stehend übergab er sich; viel kam nicht aus ihm heraus. Sein Magen war leer, und so würgte er bloss Luft und etwas Magensäure hoch.
Er richtete sich abrupt auf und rannte weiter durch die Nacht. Trotz der unerträglichen Schmerzen in den Füssen und dem Klemmen im Magen kämpfte er gegen das Bedürfnis an, sich hinzusetzen und auszuruhen. Er wollte nicht länger Nummer 17 sein. Er wollte frei sein. Ihm war es egal, wohin er dazu laufen musste, und sogar scheissegal, dass er nackt war. Er wollte nur weg von hier. Der einzige Gedanke, der ihn antrieb, war, sich immer leicht talwärts zu halten. Seine Kräfte reichten nicht mehr aus, um bergan zu laufen. Seine Beine waren schwer wie Blei und reagierten nur verzögert auf die Befehle aus seinem Kopf. Im rechten Oberschenkel, der sein Körpergewicht auf der Bergseite tragen musste, bahnte sich ein Muskelkrampf an.
Unkontrolliert stolperte er über Äste und Steine. Er versuchte, Tempo zu gewinnen, obwohl er todmüde war.
Nach weiteren zwei- bis dreihundert Schritten hörte er das Rauschen eines Bergbaches, das mit jedem Schritt anschwoll.
Ein Bach ist gut. Im Wasser bricht meine Fährte ab.
Kurz bevor er den Bergbach erreichte, trat er auf eine Steinplatte, die lose auf dem Waldboden lag. Sie kratzte über andere darunterliegende Steine, gab nach und rutschte talwärts. Sein linkes Bein verlor den Halt, und seinem rechten Bein fehlte die Kraft, um sein Körpergewicht aufzufangen.
Er fiel talwärts. Mit Oberkörper und Gesicht schlug er hart auf dem Waldboden auf. Schmerz schoss durch seinen Körper, und er roch den Wald, als präsentierte sich dieser ihm auf einem Gemälde mit leuchtenden Farben. Gelbe Nadeln von Lärchen. Karge Erde mit einer Eisennote. Trockene Flechten auf Baumrinde, die modrig rochen. Und die Haare eines Tieres, das er nicht sehen konnte. Während diese Bilderexplosion seine Sinne vereinnahmte, rutschte er talwärts in den dunklen Wald ab. Zuerst langsam, dann immer schneller. Er überschlug sich mehrmals.
Zehn Meter.
Zwanzig Meter.
Dreissig Meter.
Immer weiter stürzte er hinunter.
Es war unmöglich, sich an etwas festzuhalten. Seine Arme schlugen gegen den Waldboden und die kahlen Äste von Stauden. Sein ungeschützter Körper schrammte über Geröll und Dreck. Immer wieder schlug er mit Kopf und Oberkörper gegen Bäume.
Ein paar Meter weit schleuderte es ihn durch ein steiniges Bachbett. Eiskaltes Bergwasser klatschte gegen seinen nackten Rücken, und Steine rammten seine Rippen.
Er überschlug sich so lange, bis er nicht mehr wusste, wo der Himmel und wo die Erde war. Nach einer gefühlten Ewigkeit schlitterte er auf dem Rücken in flacheres Terrain. Die Schwerkraft verlor ihre Wirkung. Sein Fall verlangsamte sich, und er blieb benommen in einer abschüssigen Bergwiese liegen.
In seinen Armen und Beinen pochte dumpf sein Herzschlag. In seinem Körper hatte sich ein alles überziehendes Taubheitsgefühl ausgebreitet. In seinem Kopf hörte er ein Surren, und im Mund spürte er den metallenen Geschmack des eigenen Blutes.
Er roch Gras und den Schnee, der auf den Berggipfeln lag. Eine weitere Geruchslawine überrollte ihn. Doch dieses Mal war alles anders. Zum ersten Mal seit langer Zeit kamen in ihm Gefühle der Geborgenheit auf. Er roch Asphalt. Frischen Asphalt. Für einen Moment glaubte er, dass mitten in der Nacht eine Gruppe von Tiefbauarbeitern den Deckbelag einer Strasse durch die Landschaft zog. Der Geruch von Teer versetzte ihn für einen kurzen Augenblick in seine Kindheit zurück. Er und Daniel, sein älterer Bruder, hatten am Gartenzaun ihrer Eltern gestanden und Strassenarbeitern zugeschaut, wie diese mit langstieligen Teerrechen und in verschwitzten Kleidern den Auftritt der heranrollenden Walze vorbereitet hatten. Der schwarze Teer dampfte, und der durchdringende Duft von Bitumen war allgegenwärtig. Die Ausläufer eines Sommergewitters liessen Regentropfen auf den heissen Teer fallen und aufdampfen, als ob sich ein schwarzer Magmastrom im Meer abgekühlt hätte.
Orientierungslos versuchte der Mann, seinen geschundenen Körper im Gras aufzurichten. Er konnte nicht aufstehen. Ihm fehlte die Kraft dazu. Er fiel wieder hin und musste erkennen, dass er mit Händen und Füssen den Untergrund nicht mehr spürte. Sein Tastsinn hatte versagt.
Er begann auf allen vieren vorwärtszukriechen. Unbeholfen und langsam.
Im Mondlicht erkannte er vor sich eine verschwommene weisse Strassenmarkierung, die sich in ein Doppelbild aufteilte und dann wieder zu einer einzelnen Linie verschmolz. Alles um ihn herum drehte sich, als würde er noch immer fallen und sich überschlagen.
Irgendwo bellte der Hund seiner Verfolger, weit weg.
Er kroch auf dem Asphalt voran und folgte der weissen Strassenmarkierung. Es waren seine Instinkte, die ihn leiteten. Klare Gedanken konnte er nicht mehr fassen. Nur eine schwache Stimme war in seinem Kopf, die ihn antrieb, der Strasse zu folgen.
Mit letzten Kräften zog er seinen geschundenen und schmutzigen Körper über den Asphalt. Mit jedem Meter, den er sich vorwärtsschleppte, wurde die Nacht um ihn herum dunkler und stiller. Noch einmal nahm er intensive Gerüche wahr. Felsen mit feuchtem Moos. Er assoziierte das mit der Farbe Ocker, wieso, wusste er nicht. Diese Farbe war vor seinem inneren Auge aufgetaucht. Neben ihm tropfte Wasser rhythmisch in eine Pfütze und erzeugte ein hallendes Echo.
Seine letzte Kraftreserve war aufgebraucht.
Er blieb reglos liegen.
1
Daniel Garvey schlich wie ein Schatten durch einen fremden Flur. Im schwachen Licht der Nacht hatten der Marmorfussboden und die antiken Möbel des Landhauses ihre pompöse Aura verloren. Nur Umrisse und fahle Farben waren zu erkennen. Das Gebäude mit angebautem Gästehaus im Norden und moderner Orangerie im Süden lag im Dunkeln. Es thronte über dem ausladenden Garten, im Osten durch das Ufer des Zugersees begrenzt. An der Seeuferlinie standen Trauerweiden, die mit ihren Ästen fast bis zum Wasser hinunterreichten und das Grundstück vor den neidischen Blicken der Hobbykapitäne schützten. Über dem Wasser lag eine meterdicke Nebelschicht, die sich im Laufe der Nacht gebildet und langsam zwischen die Herrenhäuser von Oberrisch geschoben hatte.
Um Daniel herum herrschte völlige Stille. Die weichen Schuhsohlen gaben keine Geräusche von sich, und der schwarze eng anliegende Overall erzeugte nicht das geringste Rascheln oder Knistern. Lautlos wie ein Schatten rein und unbemerkt wieder raus. Das war seit einigen Jahren ein Teil seiner Arbeit. Noch nie war er dabei erwischt worden, und je länger er dieser Beschäftigung nachging, desto abgebrühter war er geworden. Nur einmal für einen kurzen Moment drohte er, in einer modernen Loftwohnung aufzufliegen. Die blütenweisse Katze der Hausbewohnerin hatte sich beim Gehen ständig an seine Beine geschmiegt. Zuerst hatte er versucht, die Katze ins Badezimmer einzusperren, dann aber einsehen müssen, dass das lästige Tier dies nicht mit sich hätte machen lassen. Ausgerechnet als er sich an der offen stehenden Schlafzimmertür der Loftbewohnerin hatte vorbeischleichen wollen, war er der Katze gegen eine Pfote gestossen. Das Tier hatte laut gefaucht, und die Hausherrin war augenblicklich wach. Daniel war in jener Nacht zwar unentdeckt geblieben, musste aber in der Folge zwanzig Minuten komplett reglos im Flur ausharren und abwarten, bis die Katze sich wieder beruhigt und die Hausherrin wieder ins Land der Träume zurückgefunden hatte.
Es war kurz nach drei Uhr, und in dieser Nacht hatte Daniel noch vor keiner Herausforderung gestanden. Die Alarmanlage hatte er über die Aussenhaut des Gebäudes ausser Gefecht gesetzt. Das Alarmsystem war miserabel konzipiert. Ein Kabel versorgte fast die gesamte Sicherheitsanlage von aussen mit Strom. Eine Einladung für jeden Einbrecher.
Im Inneren hatte Daniel bereits Treppenhaus und Flur hinter sich gebracht. Da gab es erst gar keine Alarmsicherung. Er konnte sich frei durch das Gebäude bewegen: ein weiterer Fehler im Sicherheitskonzept.
Durch einen Torbogen in der rechten Wand betrat er einen grosszügigen Raum. In der Mitte stand ein Schreibtisch aus Kirschholz, und darauf lag eine Schreibunterlage aus Leder. Oberhalb der Schreibfläche protzte eine dieser grünen Bankerlampen und am Schreibtisch ein schwerer Ledersessel. Vor dem Schreibtisch standen zwei weitere Ledersessel, als ob gerade zwei Besucher für eine Besprechung erwartet worden wären. Direkt daneben: ein Glastisch mit Spirituosen in böhmischen Kristallglaskaraffen. Die Wand rechts des Schreibtisches war durch ein Regal mit Büchern und Aktenordnern verdeckt. An der gegenüberliegenden Wand hingen zwei Ölbilder in dicken Holzrahmen, über den Bildern kleine Messinglampen, welche die Bilder tagsüber beleuchten und in jenes Licht tauchen sollten, das ihrem Kaufwert entsprach.
Der Empfänger in Daniels linkem Ohr knackte leise, und Anna Bergers Stimme ertönte. «Garvey? Kannst du mich hören?»
Eine rhetorische Frage. Natürlich konnte er sie hören. Sie hatten seine Sprechgarnitur eben getestet, bevor er den Garten des Landhauses betreten hatte.
Nebst dem Empfänger trug Daniel ein enges Band mit Kehlkopfmikrofon um den Hals. Er betätigte mit einer Hand eine flache Kontaktstelle an seinem Halsband. Er flüsterte beinahe unhörbar und mit fast geschlossenen Lippen in das Mikrofon: «Büro – Bilder – Kontakte – lahmlegen.»
Bei seinen nächtlichen Aktionen verwendete er nie ganze Sätze, und er mied Worte mit Zischlauten. Die falschen Laute hätten schlafende Hausbewohner aufwecken und auf ihn aufmerksam machen können. In Daniels Welt blieb man besser unbemerkt. Dazu war Anna da. Sie räumte ihm Hindernisse aus dem Weg.
«Erledigt. Du hast freie Bahn.» Annas Stimme war dermassen klar, dass er jedes Mal einen kurzen Moment lang glaubte, Anna stehe direkt neben ihm.
Er hob das linke der beiden Bilder aus seiner Halterung und lehnte es darunter an die Wand. Eine kleine, stählerne Safe-Tür mit einem Schlüsselloch und einem Zahleneingabefeld war zum Vorschein gekommen. Ohne Zeit zu verlieren, steckte er zwei hakenartige Metallstreifen in das Schlüsselloch, drehte und bewegte die beiden Metallhaken, als ob sie in der schmalen Öffnung des Schlosses tanzen sollten. Nach wenigen Sekunden gab der Schliessmechanismus in der Safe-Tür ein leises Knacken von sich. Die erste Sicherheitsstufe war überwunden.
Dann schob er zwei flache Kontaktstreifen aus Kupfer unter die Abdeckung des Zahlenfeldes, schloss einen kleinen Sender an und aktivierte diesen. Als die Leuchtdiode am Gerät von Orange auf Grün wechselte und blinkte, hauchte Daniel wieder in sein Mikrofon: «Stufe eins überwunden. Code abfragen.»
Anna liess einen Augenblick auf sich warten. «Moment.» Es vergingen nur wenige Sekunden. «Z wie Zorro.»
Daniel studierte das Nummernfeld und verstand. Er tippte die Eins, Zwei, Drei, die Fünf und dann die Sieben, die Acht und Neun. Zum Schluss drückte er die Rautetaste, und die Safe-Tür schwang automatisch auf.
«Stufe zwei überwunden», hauchte er in sein Mikrofon.
Im Safe lagen bloss gestapelte Verträge und Geschäftsunterlagen. Oben auf den Papieren thronte eine goldene Rolex, in deren Zifferblatt bei jeder Stundenposition ein Diamant eingelassen war. Daniel war klar, dass die Uhr bloss im Safe lag, weil der Hausherr über den Safe verfügte. Der Safe war für Wichtigeres bestimmt als für eine Uhr. Bei Menschen, die ein derart grosses Vermögen besassen wie der Bewohner dieses Landhauses, in dessen Karaffen der Whiskey mindestens fünfundzwanzig Jahre alt und die Frauen auf den Cocktailpartys dafür umso jünger sein mussten, waren nie Schmuckstücke der Grund für besondere Sicherheitsvorkehrungen. Die Superreichen wollten ihre Geschäftsunterlagen, Aktien und Anteilsverträge an Gesellschaften und Investmentfonds in Sicherheit wissen. Die Unterlagen waren nicht bloss ein paar zehntausend oder hunderttausend Franken wert. Das hätte eher der Rolex mit den zwölf Diamanten entsprochen, die für Daniels Geschmack überladen und protzig aussah. Vor ihm lagen Wertpapiere und Verträge, die diesen Leuten Erträge garantierten, welche jedes Jahr derart schwindelerregend hoch ausfielen, dass manch einem Steuerbeamten die Augen aus dem Kopf gefallen wären. Vor Daniel lagen Papiere, die weder bei der Bank noch beim Vermögensverwalter liegen sollten. Von der Steuerverwaltung ganz zu schweigen. Die millionenschweren Erträge daraus waren es, welche ihren Eigentümern den Kauf teurer Uhren, Pelzmäntel und Luxusautos überhaupt erst ermöglichten. Pelzmäntel und teure Uhren, ja selbst ein Ferrari oder in gewissen Fällen sogar die deutlich jüngere Ehefrau, das waren alles bloss Dinge des täglichen Gebrauchs. Man tauschte sie aus wie ein Paar Socken mit Loch. Das dahinterstehende Prinzip war dasselbe wie auf jedem Bauernhof. Besass der Bauer gesunde Kühe, ging ihm die Milch nie aus. Er tat also gut daran, prioritär den Kühen Sorge zu tragen und nicht der Milch in der Kanne. Milch gaben gesunde Kühe reichlich und fast wie von selbst. Die Arbeit erledigte ohnehin der Melkroboter.
Daniel hätte diese Uhr mitnehmen und bei einem Hehler für vielleicht acht- bis zehntausend Franken versetzen können. Er wäre jede Wette eingegangen, dass der Hausherr die Rolex in den nächsten Tagen nicht einmal vermisst hätte. Vielleicht hätte sich der Eigentümer nach zwei, drei Wochen gefragt, ob er die Uhr eher auf der Jacht hatte liegen lassen oder im Suff verschenkt hatte. So richtig quälend wären die Gedanken an die verschwundene Rolex nicht gewesen. Mit Sicherheit aber hätte es demselben Mann kalten Schweiss auf die Stirn getrieben, wenn er morgen früh auch nur eines dieser Wertpapiere verkehrt herum im Safe liegend angetroffen hätte. Vor dem Untergang solcher Geldquellen fürchteten sich die Reichen. Eine Angst, die Daniel sich zunutze machte.
Im offenen Safe vor Daniel lag ein Vermögen. Doch es interessierte ihn nicht. Statt nach den Dokumenten oder der Uhr zu greifen, glitt seine rechte Hand in die linke Brusttasche seines Overalls. Er zog eine Visitenkarte heraus und legte sie in den Safe. Diese Karte mit dem Logo der «Garvey Security Consulting AG» lehnte er so gegen die Rolex, dass sie praktisch aufrecht stand und sofort jeden Blick auf sich zog. Wenn der Hausherr den Safe bei der nächsten Gelegenheit öffnete, musste sein Blick zwangsläufig auf Daniels Karte fallen. Das war seine Karte für spezielle Einsätze. Daniel stellte sich vor, wie seine Kunden einen Moment lang mit offenen Mündern vor seiner Visitenkarte verharrten und es nicht fassen konnten. Es musste verstörend sein, wenn einer trotz bereits bestehender Sicherheitsvorkehrungen durchs Haus schleichen und völlig unbemerkt bleiben konnte.
Daniel verschloss den Safe vorsichtig. Nach ein paar flinken Bewegungen hing das Ölbild wieder an seinem Platz, und er verliess den Raum lautlos durch den Torbogen. Nichts wies darauf hin, dass er jemals hier gewesen war. Er amüsierte sich am Wortspiel, dass er seinen Kunden Visiten abstattete, wie es ein Arzt tat, wenn der im Spital von Bett zu Bett ging. Nur dass er dabei unbemerkt blieb und bloss die Visitenkarte zurückliess.
Erneut tippte er an die Kontaktstelle des Kehlkopfmikrofons. «Kontakte – Bilder – aktivieren.»
Daniel folgte dem Flur um eine Neunzig-Grad-Biegung. Der Marmorfussboden wechselte hier seine Farbe. Das marmorierte Weiss machte einem tiefen Blau Platz. Brasilianischer Marmor breitete sich quadratmeterweise vor seinen Füssen aus, und Annas Stimme ertönte.
«Bilder im Büro sind wieder aktiv geschaltet. Die zweite Tür rechts führt zum Schlafzimmer.»
Wenige Augenblicke später schlüpfte Daniel durch die halb offen stehende Schlafzimmertür. Im Bett schliefen zwei Personen, links der Hausherr mit vollem grauem Haar, von grosser Statur, durchtrainiert, in Rückenlage. Der Mann atmete schwer, und in seiner Nase fiepte es bei jedem Atemzug. Die satinierte Bettwäsche verbarg seinen Unterkörper, und der Oberkörper lag frei. Nacktschläfer. Neben ihm schlief eine schlanke Frau, deutlich jünger, blonde lange Haare, kantig hervortretende Schlüsselbeinknochen, magerer Hals. Sie trug ein leichtes Seidennachthemd, und für einen Augenblick blieb Daniels Blick an ihrer Augenbinde hängen. Damit war auch dieses Klischee erfüllt. Restlicht schien dem Schönheitsschlaf abträglich zu sein. Aber Schönheit lag im Auge des Betrachters. Die Schlüsselbeinknochen und der magere Hals der Frau machten auf ihn einen etwas ungesunden Eindruck.
Langsam und lautlos schlich Daniel sich zum Nachttisch neben dem Mann. Er griff erneut in die linke Brusttasche seines Overalls und nahm eine weitere Visitenkarte mit seinem Logo zur Hand. Er lehnte sie an den versilberten Wecker an, damit sie dem Mann in wenigen Stunden direkt in die Hände geraten musste, sobald er den lästigen Wecker ausschalten wollte. Am Abend hatte Daniel auf dieser Visitenkarte mit Füllfeder einen persönlichen Gruss angebracht: «Mit vorzüglicher Hochachtung.»
Daniel verliess das Schlafzimmer und schlich sich auf demselben Weg zurück. Die Farbe des Marmors änderte sich wieder in helles Weiss. Er folgte dem Flur und stieg die geschwungene Treppe in die Eingangshalle ins Parterre hinunter.
Die Eingangshalle war grösser als der Grundriss einer normalen Dreizimmerwohnung, und mittendrin stand eine lebensgrosse Kopie des David von Florenz auf einem Marmorsockel. Die linke Hand zum Gesicht erhoben, die andere neben dem rechten Oberschenkel hängend. Die Statue blickte auf Daniel herab. Hier wollte er seinen letzten Gruss anbringen. Er griff in seine Brusttasche und konnte die dritte Visitenkarte nicht finden. Er tastete danach, aber da war nichts. Daniel hielt für einen Moment inne und dachte nach. Er erinnerte sich genau daran, dass er auch die dritte Karte vorbereitet und in seine Brusttasche gesteckt hatte. War sie ihm oben im Schlafzimmer aus der Tasche gerutscht?
Sicher nicht. Unmöglich. Du hast sie hier irgendwo. Du musst bloss richtig nachsehen.
Daniel wollte noch einmal in seinen Taschen nach der Visitenkarte wühlen, als in seinem Ohr Annas Stimme ertönte. «Schau in deiner anderen Brusttasche nach.»
Daniel hörte auf ihre Anweisung und ertastete etwas, das deutlich dicker war als eine Visitenkarte. Er zog es heraus und blickte auf das Objekt in seiner Hand. Ein einzeln verpacktes Kondom mit dem aufgedruckten Logo der «Garvey Security Consulting AG».
Er vergass, beim Sprechen das Kehlkopfmikrofon zu aktivieren. «Was zum Teufel …»
Es knackte wieder in seinem Ohr.
«Es hat Universalgrösse. Es wird David passen.»
Daniel stand einen Moment lang ratlos vor der Statue. Sein Blick wanderte vom Kondom in seiner Hand zum unverhüllten Penis der Statue. Das konnte er unmöglich tun. Der Hausherr würde ihm dies später als Geschmacklosigkeit vorwerfen. Daniel war klar, dass es schon für rote Köpfe sorgen würde, dass er nachts durch diese Flure geschlichen war und seine Grüsse hinterlassen hatte. Das mit dem Kondom, das wäre wahrlich keine Werbung für einen Geschäftsmann gewesen, der sich höchste Schweizer Präzision auf die Fahne geschrieben hatte.
«Komm schon, Garvey. Tu es für mich. Eine solche Gelegenheit kommt nie wieder. Du weisst schon: Ein Kondom bietet Schutz. Wir tun das auch. Tu es und mach ein Foto für mich.»
Daniel entschied sich, es zu tun, wählte aber eine dezentere Variante. Er drückte der Davidstatue das verpackte Kondom in die rechte Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann ging er drei Schritte zurück, um sein Werk zu betrachten.
Der blasse David stand nun im schwachen Licht und mit der Kondompackung in der Hand da und vermittelte den Eindruck eines frivolen Lebemenschen, hier und jetzt bereit, sich auf ein ungezwungenes Abenteuer einzulassen. Vielleicht hatte Michelangelo mit seiner Statue genau diese Botschaft übermitteln wollen.
Lebe und geniesse!
Wer wusste schon, was sich ein Künstler gedacht hatte oder nicht.
Kurz darauf verliess Daniel das Landhaus leise und unbemerkt. Er schloss mit wenigen Handgriffen die Haupteingangstür hinter sich ab, stellte die Alarmanlage scharf und eilte über den kurz gemähten Zierrasen dem Seeufer entgegen. Im Laufen tippte er an die Kontaktstelle seines Halsbands. «Bin draussen.»
Er stieg in das stille Wasser des Zugersees, das ihn wie eine kalte Hand umschloss. Einige Minuten lang schwamm er durch Dunkelheit und Nebel in Richtung der Seemitte. Wohin er sich bewegte, konnte er nicht sehen, aber er beobachtete regelmässig das Display seiner Armbanduhr. Zwei sich langsam nähernde Punkte darauf verrieten ihm, dass er es gleich geschafft hatte. Vor ihm tauchte im Nebel ein grosser Schatten auf. Ziel erreicht. Daniel schwamm zum Bug des Ruderbootes, kletterte trotz des Gewichts seiner nassen Kleider flink hinein und setzte sich Anna gegenüber auf eine Holzplanke.
«Mission accomplished. Nach Hause, bitte.»
Aus seinen Kleidern rann kaltes Seewasser und ergoss sich in das Ruderboot.
***
Anna war mit der Aktion von soeben zufrieden. Einmal mehr hatten sie als Team perfekt harmoniert und die Vorbereitungen hatten sich als präzise erwiesen. Alles war wie am Schnürchen gelaufen.
Sie klappte ihren Laptop zu, schob ihn in ihre Umhängetasche und begann in Richtung Ost-Nordost zu rudern, dahin, wo sie das Bootshaus vermutete. In Daniels Gegenwart fühlte sie sich wieder wohler. Vorhin, so ganz allein im Nebel auf dem dunkeln See, das war nicht ihre Welt.
Eine Frage lag ihr schon die ganze Zeit über auf der Zunge. «Welcher Mann, der auf Frauen steht, stellt in seinem Entrée die Statue eines nackten Mannes auf?»
Daniel stand in seinen Badeshorts im Boot, trocknete sich mit einem Frotteetuch ab, und Anna studierte verstohlen seine sportliche Silhouette. Er war bald vierzig und damit knapp zehn Jahre älter als sie, und manchmal wirkte Daniel auf sie wie ein Soldat. Durchtrainiert, immer kontrolliert, strategisch denkend und stets in seiner eigenen Mitte. Wie machte er das bloss?
«Wenn dich die Davidstatue interessiert, ruf ihn an und frag ihn. Du erreichst ihn gerade auf seinem Festnetzanschluss», sagte Daniel.
Anna lachte ob der Vorstellung, den Kunden aus dem Schlaf zu läuten und ihm eine unverschämte Frage zu stellen, während der auf das Kondom starrte.
Sie ruderte das Boot durch die Nebelschwaden weiter auf den See hinaus.
Daniel schaute auf seine GPS-Uhr. «Das Bootshaus liegt etwas mehr rechts.» Er zog sich trockene Kleider über.
Nach einer kurzen Pause und etlichen Ruderschlägen konnte Anna ihre Frage nicht mehr zurückhalten. Sie musste es wissen. «Hast du für mich ein Foto von David mit dem Kondom gemacht?»
Es war zwar dunkel, aber Anna konnte gerade noch erkennen, dass Daniel zu ihr herübersah und grinste.
2
Im ersten Licht dieses Donnerstags lenkte Pietro Buletti seinen verbeulten Ford Escort von Airolo in südlicher Richtung über die Via San Gottardo. Durch das halb offene Beifahrerfenster schlug das wummernde Geräusch des Luftstroms ins Fahrzeuginnere, und das Autoradio schepperte eine alte Aufnahme von Sam Cooke.
«That’s the sound of the men, working on a chain ga-ang …»
Es war kurz vor sechs Uhr, und der Luftzug des Fahrtwindes zupfte an Bulettis grauem Haar, das ihm in ungepflegt fettigen Strähnen über die Schläfen reichte.
Buletti lauschte Cookes Stimme. Er gab sich der Melancholie des Liedes hin und vergass dabei all seine Probleme. Er dachte nicht an den Alkohol, der schon seit Längerem sein bester Freund war. Buletti dachte für einmal auch nicht an den tödlichen Arbeitsunfall seines Bruders, der schon Jahre zurücklag, ihn aber immer noch nicht losliess. Für einen Moment hatte er das Bild seines Bruders verdrängt, wie dieser wie eine totgeschlagene Fliege unter einer gefällten Fichte gelegen hatte. Für gewöhnlich verfolgten ihn auch die Tracht Prügel, die sein Vater ausgeteilt hatte, wenn sie als Kinder für dessen Dafürhalten zu laut gespielt hatten. Solange der alte Buletti beschäftigt gewesen war und nichts getrunken hatte, war er ein ruhiger und gutmütiger Mensch. War er allerdings wieder einmal ohne Arbeit und in Selbstmitleid dem Alkohol verfallen, hatte er des Öfteren schon das verspielte Kichern seiner Söhne als Provokation empfunden und heftige Ohrfeigen oder Hiebe mit dem Ledergurt ausgeteilt.
Doch jetzt gab es für Buletti nur Sam Cookes Stimme und die verlassene Strasse. Ein seltener Moment der Leichtigkeit in seinem Leben.
Er summte die Melodie des Liedes mit, und seine Augen folgten dem Strassenverlauf.
«… all day long they work so hard ’till the sun is going down …»
Direkt nach der Segheria Filippi, dem hier schon seit Ewigkeiten ansässigen Sägewerk, durchfuhr Bulettis Wagen eine Linkskurve und tauchte abrupt in die dunkeln Schatten des Strassentunnels ein. Dies war einer der letzten unbeleuchteten Tunnel auf der Via San Gottardo. Früher waren hier in der Gegend die Tunnel der Landstrassen alle in diesem Zustand. Dunkel, felsig und stetig tropfend vom Wasser, das durch Spalten im Felsen der Schwerkraft folgte. Der Strassenbelag befand sich in einem bemitleidenswerten Zustand. Schlaglöcher und Spurrillen brachten Bulettis Autoreifen zum Rattern, und die Scheinwerfer des Wagens tauchten die Tunnelwände in schwaches Licht.
Der Tunnel beschrieb jetzt eine weit gezogene Linkskurve, als Buletti mit knapp siebzig Stundenkilometern über etwas fuhr. Das linke Vorderrad schlug laut in den Radkasten. Es folgten ein Scheppern am Fahrzeugunterboden und ein harter Schlag gegen das linke Hinterrad. Die Schläge zuckten durch die Karosserie, übertrugen sich über das Lenkrad in Bulettis Handflächen, und er trat mit aller Kraft das Bremspedal durch.
Buletti nahm das Klirren von Glas wahr.
Die Reifen rutschten kreischend über den Asphalt. Er riss das Lenkrad reflexartig nach rechts, und das rechte Vorderrad seines Ford Escort schrammte den Rinnstein entlang. Die Radfelge schabte über einen Granitrand, und Buletti schüttelte es auf dem Fahrersitz kräftig durch. Er zog das Auto wieder nach links zurück in die Mitte der Fahrspur.
Nach etwa fünfzig Metern kam sein Wagen ruckartig zum Stillstand.
Sam Cookes Stimme schepperte weiter aus dem Autoradio.
«… you hear them moaning their lives away …»
In Bulettis Kopf hallte das Schlagen der Räder in den Radkasten nach, als ob jemand die Geräusche in seinem Schädel in eine Endlosschlaufe gelegt hätte.
«… then you hear somebody say: that’s the sound of the men, working on the chain ga-ang …»
Wie ferngesteuert betätigte Buletti den Knopf beim Lenkrad. Mit dem Aufleuchten des Pannenblinkers erklang aus dem Armaturenbrett ein Tick-tack-tick-tack. Die Fahrzeugblinker warfen ihr oranges Licht in den Tunnel.
Buletti blickte in den Rückspiegel und schob sich eine fettige Haarsträhne aus der Stirn. Seine Hand zitterte, und er hatte seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Die Arme waren kraftlos, die Beine weich wie Pudding und die Atmung oberflächlich. Sein Blick wanderte nervös umher, unfähig, sich auf etwas zu konzentrieren.
«Che cosa …?», fragte er und dachte an Alkohol, den er sich nun sehnlichst wünschte. Im Gegensatz zu seinem Vater beruhigte ihn der Alkohol. Das hätte er jetzt brauchen können.
Buletti hatte nichts vor sich auf der Strasse liegen sehen, obwohl die Scheinwerfer eingeschaltet waren. «Da war nichts!», schrie er in die Stille des Fahrzeuginnenraumes. Doch da hatte etwas in der Fahrspur gelegen.
Bulettis rechter Fuss drückte immer noch auf das Bremspedal. Auch im tiefroten Schein seiner Bremslichter konnte er im Rückspiegel nicht erkennen, was hinter ihm auf der Strasse lag.
«Da ist nichts!», schrie er verzweifelt. «Nichts, verdammt!», und schlug mit den Händen gegen das Lenkrad.
Buletti roch etwas Vertrautes. Den Geruch von Dry Gin. Er schaute sich im Auto um und sah, dass seine Ginflasche auf der zerschlissenen Schuhmatte der Beifahrerseite lag. Die Flasche war bei der Vollbremsung vom Beifahrersitz nach vorne gegen die Armaturen geschossen und beim Aufprall zerbrochen. Wacholdergeruch. Vage konnte er sich an ein Geräusch erinnern, das dazu passte. Klirrendes Glas.
Aus dem Körper der Flasche war ein Glassplitter herausgebrochen, und der grösste Teil des Gins hatte sich über die Schuhmatte ergossen. Er griff instinktiv nach der Flasche und konnte seinen Blick nicht mehr davon abwenden.
Sein Kopf war wie taub. Hängen geblieben. Buletti war in einen tranceähnlichen Zustand verfallen.
Minutenlang blieb es im Tunnel still, bis ein Scheinwerferpaar den Innenraum des Ford Escort erhellte. Ein Adria-Camper mit deutschem Nummernschild fuhr in gemächlichem Tempo auf Buletti zu. Der Camper war bloss noch wenige Meter von ihm entfernt, verlangsamte die Fahrt und kam neben Buletti zum Stillstand. Der Fahrer des Campers schaltete sein Fernlicht ein, und sofort war es taghell.
Buletti erkannte über den Innenspiegel, dass tatsächlich etwas hinter ihm auf der Strasse lag. Es sah aus wie ein grosses Bündel Wäsche. Um besser sehen zu können, drehte er sich auf dem Fahrersitz um und blickte durch das Heckfenster. Jetzt sah er alles. Beine, den Körper eines Mannes und einen abgewinkelten, unnatürlich verdrehten Arm.
Buletti bekreuzigte sich und begann zu beten. «Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori.»
Bulettis Stimme versagte, und seine Lippen führten das Gebet lautlos fort. Kalter Schweiss drang aus seinen Hautporen, das Zittern in seinen Armen nahm zu, und sein rechter Fuss rutschte vom Bremspedal. Er spürte nichts mehr, hatte gerade das Gefühl für seinen Körper verloren. In den Ohren hörte er das eigene Blut rauschen, und dann wurde das Geräusch in den Ohren von einer Taubheit überdeckt, als ob jemand eine Glasglocke über ihn gestülpt hätte. Die Welt war still. Unglaublich still.
«Ich habe ihn nicht gesehen», hörte Buletti sich selbst sagen, die eigene Stimme von weit her klingend. Es breitete sich helles Weiss über sein Gesichtsfeld aus, und er kippte ohnmächtig zur Seite.
3
Daniel sass an seinem Schreibtisch. Er hatte es geschafft. Seine Aktion von letzter Nacht hatte ihm einen neuen Kundenauftrag beschert, und dies sogar schneller als erwartet. Allerdings wusste Daniel, dass Johansson, der ihm gerade gegenübersass, genauso verärgert war wie andere zuvor. Keiner seiner Kunden hatte erwartet, dass der mit ihm kurz zuvor vereinbarte Passus im Vertrag «die bestehenden Sicherheitssysteme einem eingehenden und realitätsnahen Test unterziehen» bedeutete, dass Daniel bei ihnen nachts unangekündigt einstieg, während sie selbst schliefen. Er bewies ihnen dadurch, dass sie in ihren Villen leichte Beute für Einbruch oder Raubüberfälle waren. Nichts war in dieser Welt mehr sicher, und wenn man dies den Leuten plastisch vor Augen führte, waren sie gerne bereit, grössere Summen in die eigene Sicherheit zu investieren. Für den Kunden bedeutete dies echte Fortschritte bei der eigenen Sicherheit, und für Daniel winkten Auftragsvolumen, die jeden vernünftigen Rahmen sprengten. Mit der Angst liess sich gutes Geld verdienen.
«Es freut mich, dass Sie uns mit diesem Auftrag betrauen. Ihr Vertrauen ist für uns –»
«Und Sie glauben, dass dieser andere Tresor mit Bluetooth-Funktion nichts taugt?», fragte Johansson.
Daniel war sich sogar sehr sicher. «Wie gesagt: Lassen Sie die Finger von Lösungen mit IT-Schnittstellen. Erst recht von drahtlosen Technologien. Den Safe, über den Sie nachdenken, kriege ich mit dem richtigen Equipment noch schneller auf als Ihr jetziges Modell. Wir werden Ihnen in wenigen Wochen eine Lösung präsentieren, die selbst in zehn Jahren noch den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Massgeschneidert, versteht sich. Setzen Sie auf die richtige Technik, und Sie haben für lange Zeit Ruhe.»
Johansson zog die Ärmel seines weissen Hemds unter dem Sakko zurecht und rückte seine Rolex am Handgelenk in Position. Es war nicht zu übersehen, dass seine Laune sich seit seiner Ankunft hier bei Daniel keineswegs verbessert hatte. Er wirkte ungeduldig und verärgert. Das war der Preis der Werbeaktion von vergangener Nacht.
«Schicken Sie mir den Vertrag zu, und teilen Sie meiner Assistentin mit, wann Sie gedenken, das Sicherheitssystem bei uns zu installieren. Je schneller, desto besser.»
Daniel war klar, dass alles perfekt werden musste. Falls nicht, würde Johansson ihm seinen nächtlichen Besuch übel nehmen. Eine sechsstellige Investition tätigten auch Superreiche nur dann gerne, wenn sie sich lohnte.
«Wie haben Sie mein Sicherheitssystem überlistet?», fragte Johannson.
«Es gibt zwei Schwachstellen. Die Stromzufuhr wurde über die Gebäudeaussenhülle gezogen. Dies kann man mit dem Fernglas von der Hauptstrasse aus erkennen. Ich konnte dank dieser Ihr System von ausserhalb durchschauen und austricksen. Ausserdem ist Ihr Sicherheitssystem so ausgelegt, dass Sie es über Funkschnittstellen bedienen und kontrollieren können. Das erspart zwar das Ziehen von Verkabelungen unter dem Verputz im Innern Ihrer Räume. Aber jedes System, das Sie über das Internet oder über kabellose Schnittstellen bedienen, kann im Grunde jeder kapern. Die Ausrüstung dazu kriegen Sie in jedem Elektronikfachgeschäft. Für maximal ein paar hundert Franken. Jeder etwas versierte Einbrecher benötigt also nicht mehr als ein paar Hunderternoten und den Mumm, bei Ihnen einzusteigen. Für Sie dagegen steht deutlich mehr auf dem Spiel.»
Den letzten Satz hatte Daniel gerne nachgelegt. Den Willen, Geld auszugeben, musste man beim Kunden fördern. Verkaufsstrategie war schliesslich nichts Verbotenes.
Johansson erhob sich von seinem Stuhl und drehte sich von Daniels Schreibtisch weg. Offenbar wurde er beim Gedanken unruhig, dass all seine Wertpapiere im Safe nicht sicher waren.
Daniel begleitete ihn aus seinem Büro ins Sekretariat und von dort zur Tür zu Treppenhaus und Lift des Park-Towers. Johansson verabschiedete sich trocken und betrat im achten Stock den Lift. Nachdem die automatische Tür sich geschlossen hatte, zog Daniel die Tür zum Treppenhaus hinter sich zu.
Anna blickte von ihrem Schreibtisch auf. Ihr dunkles langes Haar hatte sie am Hinterkopf eingedreht und mit einem langen gelben Bleistift von oben nach unten festgesteckt. Sie steckte ihre Haare immer mit dem Bleistift hoch, wenn sie bei der Arbeit am Computer sass. «Erzähl schon. Was hat er zur Davidstatue gesagt?»
Daniel konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
«Er hat nichts gesagt, aber er sieht das wohl als Entehrung seines Davids. Trotzdem darfst du jetzt gleich die Vertragspapiere aufsetzen. Er sieht dringenden Bedarf nach einem neuen Sicherheitssystem.»
Daniel fragte sich, ob dies der richtige Moment für eine Flasche Champagner war. Doch Anna deutete mit dem Kugelschreiber in der Hand auf das Besprechungszimmer.
«Da drinnen wartet dein nächster Termin.»
Daniel war überrascht. Er blickte zur geschlossenen Tür. «Ich habe keinen Termin. Habe ich einen vergessen?»
«Nein. Es ist wieder dieser Ermittler von der Polizei. Er will dich sprechen.»
Seit Monaten war dieser Ermittler der Zuger Polizei, Josef Forster, immer mal wieder bei ihm aufgekreuzt. Ihre Gespräche hatten sich stets um Daniels Bruder Brian gedreht. Seit dessen Vermisstenmeldung hatte Forster nach Brian gesucht. Allerdings hatte sich nie ein vernünftiger Hinweis auf Brians Verbleib ergeben.
Die Gedanken an seinen Bruder holten Daniel wieder in den Ernst der vergangenen Monate zurück. Vergessen war der nächtliche Ausflug mit Kondom und Davidstatue.
Das letzte Lebenszeichen seines jüngeren Bruders lag nun schon fast ein Jahr zurück. Am achtundzwanzigsten Oktober vorigen Jahres war Brian spurlos verschwunden. Frau Huber, eine ältere Nachbarin, die über ihm wohnte und ihre Nase in alles und jedermanns Angelegenheiten zu stecken pflegte, hatte ihn als letzte Person gesehen. Dies war, als Brian an seinem Wohnort in Rotkreuz die Moto Guzzi bestiegen und den Helm aufgesetzt hatte. Danach war er in die Meierskappelerstrasse eingebogen und in südlicher Richtung davongefahren. Das Ziel dieser Motorradfahrt konnte die Polizei bis heute nicht ermitteln. Wenn man der Nachbarin glauben konnte, hatte Brian kein Reisegepäck bei sich. Auch von seiner Moto Guzzi hatte während vieler Wochen jede Spur gefehlt. Erst im April dieses Jahres und auch mehr per Zufall hatten zwei Wanderer Brians Motorrad gefunden. Die beiden hatten es vorgezogen, einem unwegsamen Flusslauf im Piemont in der Nähe von Varallo zu folgen. Sie waren im beinahe ausgetrockneten Flussbett der Sesia durch die Hügellandschaft gewandert. Brians zerbeulte Moto Guzzi fanden sie zwischen Bäumen und Sträuchern auf einer Kiesbank im Flussbett. Von ihm selbst fehlte jede Spur.
Alle Nachfragen der Polizei, egal ob in Spitälern, Kliniken, bis hin zu Brians erweitertem Freundeskreis, blieben ergebnislos. Es hatte auch nie eine Meldung gegeben, dass ein Leichnam aus der Sesia geborgen worden wäre. Der Fundort seiner Moto Guzzi legte nahe, dass Brian nach Italien gefahren sein musste. Der Grund für diese Fahrt war allerdings genauso unklar wie das Geheimnis, warum Brian danach verschwunden war.
Seit dessen Verschwinden hatte Daniel sich viele Male gefragt, ob sein Bruder überhaupt noch lebte. Je mehr Zeit verstrichen war, desto mehr schwand seine Hoffnung. Seit ein paar Wochen plagten Daniel Gedanken, dass die Mitteilung von Brians Tod folgen würde. Dabei fühlte er sich jeweils, als hätte er seinen Bruder bereits aufgegeben und Verrat an ihm begangen. Er hatte nie vorgehabt, die Suche nach ihm abzubrechen, und doch musste er sich zwischenzeitlich eingestehen, dass er nicht die leiseste Ahnung hatte, wo und wie er noch nach seinem Bruder suchen konnte. Der Polizei ging es nicht anders. Jedes Mal, wenn Forster ihn über die neusten spärlichen Erkenntnisse informierte, änderte sich nichts daran, dass Brian verschwunden blieb. Brauchbare Ansätze für die weitere Suche fehlten. Selbst die anfängliche Notsuche der Polizei nach Brians Mobiltelefon hatte zu nichts geführt.
Als Daniel das Besprechungszimmer betrat, erhob sich Josef Forster von seinem Stuhl und begrüsste ihn. Daniel schätzte Forster auf Mitte bis Ende fünfzig. Heute trug er ein Hemd und darüber eine dunkelbraune Lederjacke. An seinem Gesicht erkannte Daniel, dass etwas anders war als bei allen bisherigen Kontakten. Forster mied längeren Augenkontakt zu ihm.
«Gibt es Neuigkeiten?», fragte Daniel.
«Ja, tatsächlich. Es tut uns sehr leid, Herr Garvey. Ihr Bruder ist in den frühen Morgenstunden verstorben.»
Einen Augenblick lang herrschte betretenes Schweigen.
Daniel sass reglos da. Ungeordnete Gedanken jagten durch seinen Kopf, und er blickte Forster über den Besprechungstisch hinweg an.
Was ist passiert? Wo ist er?
Daniel konnte diese Fragen nicht laut formulieren. Stattdessen sagte er wie fremdgesteuert: «Sind Sie … sicher?»
«Die Tessiner Kollegen haben mir das Foto eines verstorbenen Mannes zugestellt. Ich bin mir sicher, dass es Ihr Bruder ist.»
Daniel sah Forster fragend an, und Forster führte weiter aus: «Ich habe das Foto heute früh per E-Mail erhalten und mit jenen verglichen, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Er ist es. Er muss vor wenigen Stunden ums Leben gekommen sein.»
Durch Daniels Kopf rasten Gedanken, die er nicht festhalten konnte.
Das Motorrad in einem Flussbett in Italien. Seit Monaten verschwunden, ohne sich zu melden. Im Tessin verstorben.
Wieso dort?
Wieso hatte er sich nie gemeldet?
«Ich verstehe nicht …» Daniel konnte den Satz nicht beenden.
«Ich weiss noch nichts über die genauen Umstände. Die Kollegen haben mir bloss gemeldet, dass Ihr Bruder von einem Auto angefahren worden ist.»
Daniel verstand gar nichts mehr. Ein Autounfall? Das hatte er nicht erwartet.
Jetzt sprudelte es aus Daniel heraus. «Ich verstehe es nicht. Wir suchen ihn seit Monaten. Sein Motorrad hat in diesem Flussbett gelegen. Er … Er hat sich nie gemeldet.» Daniel machte eine Pause. «Angefahren?»
«Sie verstehen es schon richtig. Aber Antworten habe ich im Moment leider auch keine. Ich weiss bloss, dass Ihr Bruder keinen Ausweis bei sich getragen hat, als er gefunden worden ist. Deshalb haben die Tessiner Kollegen die Fotodatenbank vermisster Personen durchgesehen und sind dabei auf Ihren Bruder gestossen.»
Während Forster weitererzählte, starrte Daniel auf dessen schmale Zahnlücke zwischen den Schaufelzähnen. Sein Blick hing an dieser Zahnlücke fest. Er konnte sich nicht davon befreien.
«Für uns sind viele Fragen offen. Sicher erscheint im Moment einzig, dass Ihr Bruder in den frühen Morgenstunden bei Airolo von einem Auto angefahren worden und verstorben ist. Diese Umstände sind für uns … Sie passen auch für uns noch nicht so recht zusammen.»
Daniels Blick wanderte von Forsters Zahnlücke zu den Augen, dann zu dessen Händen. Nervös knetete Forster mit den Fingern an seinem linken Daumen herum. Offenbar fühlte sich das Überbringen schlechter Nachrichten genauso beschissen an, wie diese zu empfangen.
«Was?», fragte Daniel. «Was passt für Sie nicht so recht zusammen?»
«Ihr Bruder hat auf dem Foto keine Haare. Er muss sich in den Tagen vor dem Unfall den Kopf kahl rasiert haben.»
Daniel war verblüfft.
Die Haare abrasiert?
Das passte überhaupt nicht zu ihm.
Brian hatte sein hellbraunes welliges Haar seit jeher etwas länger getragen und stets perfekt zurückgekämmt. Selbst wenn er seinen Motorradhelm ablegte, sassen seine Haare wie frisch frisiert. Wieso sollte er verschwinden, sich all die Monate über nie melden, sich dazu entscheiden, die Haare abzurasieren, und dann einfach wieder auftauchen?
«Das passt nicht zu ihm. Brian hätte sich nie seine Haare abrasiert», sagte Daniel. Er musste zuerst nachdenken, bis er die nächste Frage formulieren konnte. «Was für ein Autounfall?»
«Ich weiss noch nichts Genaues. Der Unfall hat sich heute in den frühen Morgenstunden ereignet. Fest steht nur, dass Ihr Bruder zu Fuss in einem unbeleuchteten Strassentunnel unterwegs war. Dort hat ihn ein Auto erfasst.»
Daniel war still und hörte nur zu.
«Die Aussagen des Fahrzeuglenkers konnten die Tessiner Kollegen noch nicht aufnehmen. Der Fahrer steht seit dem Unfall unter Schock. Er ist nicht dazu in der Lage, eine Aussage zu machen. Aber dieser Herr Buletti, das ist der Fahrer, soll dafür bekannt sein, dass er öfters alkoholisiert hinter dem Lenkrad sitzt.»
Forster machte eine kurze Pause und erzählte weiter. «Wir wissen auch noch nicht, wieso Ihr Bruder beim Betreten des Tunnels keine Kleider trug.»
Das war zu viel der Informationen.
Keine Kleider?
Daniel fühlte sich plötzlich unwohl, und offenbar sah man ihm dies auch an. Forster sprang von seinem Stuhl auf und rief Anna durch die Tür des Besprechungszimmers zu, sie solle Daniel ein Glas Wasser bringen.
Einige Minuten lang befassten sich Forster und Anna bloss noch mit Daniel, und der fühlte sich desorientiert, sprach nicht und blickte nur vor sich auf die Tischplatte.
Daniel hörte Annas Stimme.
«Du bist ganz blass. Willst du an die Luft?», fragte sie.
Aber Daniel antwortete nicht.
Forster schlug Daniel vor, ihn an die frische Luft zu begleiten. Anna riet ihm, einen Schluck Wasser zu trinken.
Daniel winkte bei jedem Ratschlag ab. Er hatte für einige Minuten keine Kontrolle über seine Gedanken, er sass nur da und versuchte zu begreifen, was er eben gehört hatte.
Nach einer Weile erholte er sich, und Farbe kehrte in sein Gesicht zurück. «Ich brauche etwas Ruhe. Kann ich Sie später anrufen, falls ich Fragen habe?»
«Jederzeit, Herr Garvey. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen können. Allerdings ist da noch etwas.»
Anna und Daniel schauten erwartungsvoll zu Forster, und der reagierte seine Nervosität wieder durch das Kneten an seinem Daumen ab. «Sie müssen Ihren Bruder identifizieren. Sind Sie dazu in der Lage?»
Daniel überlegte kurz und nickte.
«Wann und wo?», fragte Anna.
Forster erklärte es ihr.
4
Am Freitag kurz nach zehn Uhr betraten Caporale Sandro Bernasconi, Daniel und Anna das Spital. Das Gebäude stand am oberen Dorfrand von Faido und machte einen schlichten Eindruck auf Anna. Es gab keinen modernen Schnickschnack und keine Extravaganzen. Die Region verfügte nicht über das nötige Geld, ein modernes Krankenhaus zu betreiben. Im Grunde genommen war es eine Überraschung, dass ein Ort mit gerade mal zweitausend Einwohnern überhaupt ein Spital mit fünfzehn Betten führte.
Daniel und Anna folgten dem Caporale durch den schlecht beleuchteten Flur im Keller, und Anna studierte den Mann, während er schräg vor ihnen durch den Flur schritt. An seiner rechten Hüfte wippte die Dienstwaffe im Rhythmus seiner Schritte. Er war ein älterer Polizist, hatte kurzgetrimmte graue Haare und ein wettergegerbtes Gesicht. Anna war sich sicher, dass er die fünfzig schon längst hinter sich gelassen hatte. Für sein Alter war er aber in erstaunlich guter Form. Seine Bewegungen waren geschmeidig wie die eines Athleten und unter seiner blauen Uniform zeichneten sich die Konturen eines durchtrainierten Körpers ab. Trotz der tiefen Furchen um seine eisblauen Augen schien diesen nichts zu entgehen.
Nach dem Caporale und Daniel trat auch Anna in den engen Aufbahrungsraum, der fast vollständig in Weiss gehalten war. An der gegenüberliegenden Wand befanden sich drei Kühlfächer mit Stahltüren. In der Mitte des Raumes stand ein Schragen aus Metall mit alten Speichenrädern, darauf lag der Leichnam, der mit einem weissen Tuch zugedeckt worden war. Der alte Schragen wirkte deplatziert, fast wie aus einem älteren Kriegsfilm. Anna schätzte das Alter des Spitals auf etwa vierzig Jahre oder etwas älter. Aber hier drinnen war alles blitzblank sauber und gut unterhalten.
Am Kopfende des zugedeckten Leichnams stand ein junger Mann in schwarzer Hose und weissem Hemd. Der Mann begrüsste Daniel und Anna auf Deutsch, mit markantem Tessiner Akzent. Er strahlte dabei Anteilnahme und Demut aus, ohne dies mit Worthülsen sagen zu müssen. Das war nicht das erste Mal, dass er mit Hinterbliebenen zu tun hatte.
Anna beobachtete Daniel, und der blickte schweigend auf das weisse Leichentuch. Ihr tat der Gedanke in der Seele weh, dass Daniel gleich seinen Bruder identifizieren musste. Sie griff instinktiv nach seiner rechten Hand und drückte sie.
Sie hatte Daniels Bruder nur flüchtig kennengelernt. Dennoch fürchtete sie sich vor dem Moment, in welchem das Tuch angehoben werden würde. Sie versuchte, sich auf Daniel zu konzentrieren. Der war still und machte auf sie den Eindruck, als ob er lieber davongelaufen wäre. Er verlagerte sein Körpergewicht von einem Fuss auf den anderen, und sie spürte über seine Hand, dass Daniel innerlich bebte. Daniel wollte davonlaufen, aber das Bedürfnis nach Gewissheit war stärker. Er zwang sich, hierzubleiben und es hinter sich zu bringen.
Caporale Bernasconi wandte sich in gebrochenem Deutsch an Daniel. «Wenn Sie bereit sind, wird Signore Gobbi …»
Daniel nickte.
«Sie brauchen mir nur zu sagen, ob es Ihr Bruder ist. Mehr nicht.»
Daniel nickte abermals und schaute auf das weisse Tuch und die Konturen des Kopfes, die sich darunter abzeichneten.
Andächtig schlug Gobbi das weisse Tuch um, und ein blasses Gesicht kam zum Vorschein.
Gobbi trat zwei Schritte zur Seite und wartete.
Daniel studierte das Gesicht seines Bruders. Anna blickte zuerst zum Gesicht des Toten und dann zu Daniel. Das war Brian Garvey. Da bestand kein Zweifel. Daniel machte einen gefassten Eindruck, also schaute auch sie sich die markanten Gesichtszüge an, die sie sofort wiedererkannte, obwohl sie Brian nicht mehr als zwei- oder dreimal flüchtig begegnet war.
Äusserlich glichen sich Daniel und sein Bruder. In ihrer Art hatten sie sich aber deutlich unterschieden. Daniel war, seit Anna ihn kannte, der kontrollierte und stets ruhige Charakter, der immer zuerst nachdachte, bevor er etwas tat. Brian dagegen war mehr der Künstlertyp, der von kreativen Ideen und seinen Reisen um die Welt schwärmte. Brian konnte sich einen veritablen Schwips antrinken und in diesem Zustand spannende Geschichten von Reisen erzählen, die jeden in ihren Bann zogen. Von Daniel hingegen hätte Anna nicht sagen können, dass er auch nur ein einziges Mal zu viel getrunken hatte. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Daniel seine Selbstkontrolle freiwillig fünf Flaschen Bier überlassen würde.
Daniels Blick wanderte zu Brians Schädel, dahin, wo früher welliges hellbraunes Haar gewesen war. Brians Kopfhaut war kahl rasiert wie die eines Skinheads, und die Haut an Kopf und Hals blass wie Mozzarella. Sie war derart blass, dass klar war, dass Brian länger nicht an der Sonne gewesen war. Auf einer seiner Reisen dem Mittelmeer entlang konnte er also nicht gewesen sein, bevor er hier verunfallt war. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Hätte Brian eine Reise ans Meer gemacht, hätte er mit Sicherheit Daniel angerufen und diesen dazu zu bewegen versucht, ihm hinterherzureisen, um gemeinsam den Charme der südeuropäischen Küstenstriche und die Vielfalt der Mittelmeerküche zu geniessen.
Jetzt erst realisierte Anna, wie intensiv es im Aufbahrungsraum nach Desinfektionsmittel roch. Ein durchdringender Duft. Daniels Griff um Annas Hand wurde fester. Er streckte seine linke Hand nach Brians Stirn aus. Doch dann zog er sie wieder zurück, ohne seinen Bruder zu berühren.
Daniels Rechte, die immer noch Annas Hand festhielt, zitterte. Er wandte sich von seinem Bruder ab, blickte kurz zum Caporale und nickte diesem zu. Dann löste er sich wortlos von Annas Hand, wandte sich vom Leichnam ab und ging durch den langen Flur Richtung Ausgang.
Anna folgte ihm mit zügigen Schritten und holte ihn auf dem Flur ein. Sie erkannte, dass Daniels Knie beim Gehen leicht nachgaben. Es war offensichtlich, dass Daniel sich nicht gut fühlte.
Anna griff nach seinem rechten Oberarm und führte ihn ins Freie. Sie spürte Daniels angespannte Muskeln durch den Ärmel seines Sakkos. Anna war überrascht, dass sie nicht ansatzweise um seine Muskeln herumgreifen konnte. Sie schob diese Erkenntnis sofort wieder beiseite. Es ging jetzt nicht um seinen Bizeps. Daniel brauchte jemanden, der für ihn da war, und ausser ihr hatte er niemanden.
***
An der frischen Luft fühlte sich Daniel rasch besser. Er wusste genau, woher sein Unbehagen von vorhin gekommen war. In diesem sterilen Aufbahrungsraum hatte sich sein Magen allein schon wegen der düsteren und beengenden Atmosphäre zusammengezogen. Der Raum hatte auf ihn gewirkt wie eine Mischung aus Operationssaal und Luftschutzkeller. Und der Anblick seines Bruders war ein harter Schlag gewesen. Ihn plagte nicht nur der Schmerz über Brians Tod. Er hatte Brians Verletzungen gesehen. Tiefe Schürfwunden und grossflächige Prellmarken. Der Anblick war eine Pein, als ob die Schmerzen seines Bruders sich auf ihn übertragen hätten. Dazu kamen diese beklemmenden Gefühle. Da drinnen hatte es sich für ihn angefühlt, als ob der Aufbahrungsraum immer enger und die Luft immer schwerer zu atmen geworden wäre.
Daniel kannte solche Beklemmungsgefühle. Sie waren nichts Neues. Schon als Knabe hatte er so gefühlt, wenn er sich beim Versteckenspielen im Kleiderschrank seiner Eltern oder im Putzschrank zwischen Staubsaugerrohr und Dreitrittleiter versteckt hatte. Dasselbe hatte er gefühlt, als er vor wenigen Jahren am Flughafen Heathrow im Lift stecken geblieben war. Auch damals gaukelten ihm seine Gedanken vor, dass der Lift mit jeder Sekunde enger und enger und er zwischen den Wänden zerdrückt werden würde. Daniel wusste natürlich, dass so etwas nicht passieren konnte. Das waren bloss Hirngespinste. Reine Fiktion. Dennoch wurde seine Atmung in vergleichbaren Situationen automatisch flach und unkontrolliert. Aus dem Nichts kamen früher wie heute Gedanken in ihm auf, dass bloss tiefe Atemzüge ausreichten, um ihn mit genügend Atemluft zu versorgen. Und genau darin lag der Grund, dass sich seine Panikgefühle in engen Räumen blitzschnell verstärken konnten. Je mehr Atemluft er inhalierte, desto mehr beschleunigte sein Puls, desto unkontrollierter waren seine Gedanken und desto schwieriger wurde es für ihn, von diesem Schnellzug in die Gefühlshölle wieder abzuspringen.
Bloss wenige Minuten mit Anna im Freien reichten aus. Hier beengten ihn weder Wände noch eine tief hängende Betondecke. Die warme Herbstsonne schien ihm ins Gesicht. Seine Atmung verlangsamte sich, und er fühlte sich besser. Seine Gedanken wurden langsam wieder klar.
Daniel sah sich um und studierte die Landschaft, die ihn und Anna umgab. Das helle Licht liess die Lärchenwälder an den Berghängen in leuchtendem Gelb erstrahlen, und das tiefe Blau des Himmels bildete dazu einen unwirklichen, fast surrealen Farbkontrast. Daniel konnte sich nicht lange auf die Landschaft konzentrieren. In Gedanken war er bald wieder bei Brians kahl rasiertem Kopf, seiner blassen Haut und den Verletzungen.
«Vielleicht war er doch in einem Spital», sagte Daniel.
«Wegen der hellen Haut?» Anna zögerte kurz. «Er war sicher längere Zeit nicht an der Sonne, aber wenn er in einem Spital gewesen wäre, hätte er sich dann nicht gemeldet?»
Wieso sollte man ihm in einem Spital den Kopf kahl rasiert haben?
«Das macht keinen Sinn. Ich habe keine Operationsnarben an Brians Kopf gesehen. Da sind nur diese … Blutergüsse.» Daniel war selbst erstaunt darüber, dass er drinnen Brians Kopf so genau studiert hatte. Er hatte nicht aktiv nach Narben gesucht, sah aber Brians Kopf und die Verletzungen vor seinem inneren Auge.
Eine fiese Schürfwunde hatte Brians rechte Wange verunstaltet und hinterliess den Eindruck, als wäre er mit Wange und Jochbein über rauen Untergrund geschrammt. Als ob man ein leichtes, weiches Fichtenholz mit einer groben Feile bearbeitet hätte. Daniel glaubte, diesen Schmerz im Gesicht zu fühlen, den Brian erfahren haben musste. Bloss für einen Augenblick. Dann war dieses Gefühl wieder verschwunden.
Caporale Bernasconi trat zu ihnen in die Sonne. «Wenn Sie dazu in der Verfassung sind, gibt es noch einige Formalitäten zu besprechen. Wir gehen dazu besser in mein Büro. Sie können mir folgen.»
Daniel und Anna fuhren dem Caporale hinterher, obwohl man sich in Faido unmöglich verfahren konnte. Daniel sass auf dem Beifahrersitz seines Saab 9-3, und Anna lenkte den Wagen durch die engen Gassen ins Zentrum. Ein Dorf, dem man unschwer ansah, dass es auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Risse in den Fassaden der Häuser, rostige Gartenpavillons und ein stattliches Hotel mit geschlossenen Fensterläden.
Daniel und Anna sassen im ersten Obergeschoss des Gemeindehauses. Das Büro des Caporale wirkte unpersönlich und bot eine Zeitreise in die frühen achtziger Jahre. Das Geräusch der Schuhsohlen beim Gehen dämpfte ein dunkelgrau gesprenkelter Filzteppich. Bernasconis Schreibtischoberfläche bestand aus einem farbigen Kunstharzbelag. Es war einer dieser Beläge mit hässlichen, kleinen Farbflecken, bei denen man den Eindruck hatte, dass dem Hersteller versehentlich feinkörniges Plastikgranulat durcheinandergeraten war, das man dann aus reiner Geschmacksverirrung so belassen hatte.
Wie früher in der Schule, dachte Daniel. Genauso hatte seine Pultoberfläche auch ausgesehen.
An den Wänden hingen Landkarten des Kantons Tessin. Sie waren vom Sonnenlicht verblichen. Einige zeigten Höhenlinien, andere farbig markierte Sektoren. Das mussten Übersichten sein, die der Polizei bei Grossereignissen oder Naturgefahren halfen. Aktuell waren diese Karten sicher nicht mehr. An einer Wand stand ein grauer Aktenschrank für Hängeregister, und die Lehnen der Holzstühle, auf denen Daniel und Anna sassen, drückten ihnen mit der Oberkante gegen die Schulterblätter.
«Wir werden den Leichnam Ihres Bruders nach Zürich ins Institut für Rechtsmedizin überführen. Dort werden die Verletzungen untersucht, damit wir wissen, wie sich der Unfall zugetragen hat», sagte der Caporale.
Daniel fühlte sich durch diese Mitteilung etwas überrumpelt. Er hatte noch nicht die Zeit gefunden, sich darüber Gedanken zu machen, welche Abklärungen die Polizei veranlassen würde.
«Haben Sie Einwände dagegen, Herr Garvey?», fragte er weiter.
Daniel ging davon aus, dass diese Untersuchung notwendig war, also gab es auch keinen Grund, dagegen zu sein. «Nein, ich … ich unterstütze diese Untersuchung.» Er selbst interessierte sich vor allem für eines. «Wissen Sie, wie es zu diesem Unfall gekommen ist?»
Der Caporale lehnte sich in seinem Stuhl zurück, und der Stuhl knarzte in den Nahtstellen, da, wo die Stuhlbeine an der Sitzfläche befestigt waren. Seine Augen verengten sich kaum merkbar. «Im Moment ist es für Schlussfolgerungen zu früh. Ich könnte bloss spekulieren, und das bringt nichts. Im Normalfall können wir ganz gut rekonstruieren, wie sich ein Unfall zugetragen hat. Dazu müssen wir die Obduktion abwarten.»
Bernasconi sprach, als ob ihn die Angelegenheit langweilen würde. Solche Fälle schienen für ihn Routine und kein Grund zu sein, mehr Engagement zu zeigen.
«Ich vermute anhand der Fahrtrichtung, dass dieser Buletti von seinem Wohnort in Airolo nach Piotta hinunterfahren wollte. Seine Cousine führt dort mit ihrem Mann eine Osteria. Buletti hängt dort praktisch täglich am Tresen und betrinkt sich.»
«Wissen Sie etwas darüber, woher mein Bruder vor dem Unfall gekommen ist? Weshalb trug er keine Kleider?», fragte Daniel.
Der Gesichtsausdruck des Caporale veränderte sich wiederum kaum wahrnehmbar. Daniel bemerkte, dass diese Fragen in ihm etwas ausgelöst hatten. Einen Anflug von Ungeduld? Der Caporale lehnte sich wieder nach vorne, der Stuhl knarzte abermals, und er stützte sich mit seinen Ellenbogen auf der Tischplatte ab.
«Ich verstehe, dass Sie sich für solche Fragen interessieren. Aber allem voran interessieren jetzt die Todesursache und der Ablauf des Autounfalls.» Die Stimme des Caporale war nun etwas sanfter und wirkte auf Daniel fast gespielt freundlich. «Ich verstehe natürlich, dass Sie Antworten wollen. Aber auch wenn es etwas eigenartig erscheint, dass Ihr Bruder sich längere Zeit nicht gemeldet hat und ohne Kleider unterwegs war, so muss ich mich bei meiner Arbeit auf den Autounfall konzentrieren. Buletti ist dafür bekannt, dass er trinkt und sich trotzdem hinter das Lenkrad setzt. Er stellt für andere Menschen eine Gefahr dar.»
Daniel war klar, dass der Caporale sich nur für den Unfall selbst interessierte, nicht für die vielen offenen Fragen zu Brians Verschwinden und allem, was damit zusammenhing. Daraus machte er keinen Hehl. Daniel wollte dies ansprechen. «Aber –»
Der Caporale doppelte sofort nach und fiel Daniel ins Wort. «Sehen Sie, Herr Garvey.» Das Wort «Garvey» betonte er, als ob es praktisch nur aus dem Buchstaben e bestanden hätte. Garve-ey. «Auch wir sind etwas irritiert über die Umstände. Wir wüssten auch gerne, weshalb Ihr Bruder frühmorgens ohne Kleider unterwegs war. Noch dazu in einem unbeleuchteten Strassentunnel ohne Gehweg. Nackt umherzulaufen entspricht nicht unseren … Wie sagt man in Deutsch … Konventionen. Hier in der Leventina ist das Leben ruhig, und wir sind stolz auf unsere Traditionen. Das Nacktwandern ist bei uns kein Trend wie in anderen Regionen des Landes.»
Blödsinn!
Daniels Instinkte meldeten sich, und die Aussage des Caporale machte ihn wütend. Er verstand nicht, wie der glauben konnte, dass Brian nackt wandern war. Brian war weder der Typ, der wandern ging, noch hätte die Freikörperkultur zu ihm gepasst. Dass er nackt in einem Alpental überfahren wurde, war in höchstem Masse auffällig. Dieser Umstand musste auf eine besondere Bewandtnis zurückgehen.
«Hatte mein Bruder Wanderutensilien bei sich?», fragte er.
«Soweit wir wissen, nicht. Aber sehen Sie, Ihr Bruder war ein erwachsener Mann. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Wir respektieren das. Wir werden bei unseren Ermittlungen auch das ungewöhnliche Auftauchen Ihres Bruders nicht ausser Acht lassen. Aber Sie müssen Verständnis haben, Herr Garve-ey» – da war es wieder, dieses in die Länge gezogene e – «dass uns vor allem dieser Buletti interessiert. Wir müssen ihn von den Strassen fernhalten, bevor sich noch eine Tragödie ereignet. Wir müssen unsere Ermittlungen auf das Unfallereignis konzentrieren.»





























