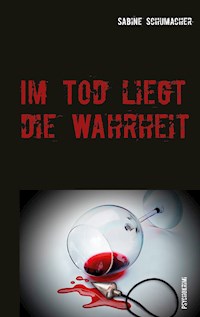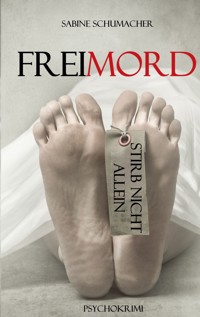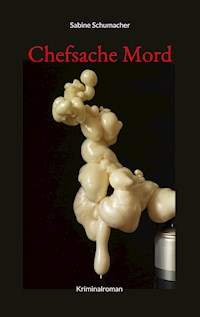Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Franz Branntwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
München. Im Perlacher Forst wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Nur mit Turnschuhen bekleidet, wurde der unbekannte Tote noch lebend an einen Baum gefesselt und hilflos zurückgelassen. Das Ermittlerteam um Kriminalhauptkommissar Franz Branntwein steht vor einem Rätsel: Missgeschick oder Mord? Bei der Leichenschau kommt Unglaubliches ans Licht. Erste Spuren führen ins Münchner Nachtleben der High Society. Als eine zweite Person verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. "Original München. Original Bayerisch." Franz Branntweins fünfter Fall.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Titel der Reihe
„Franz Branntwein ermittelt“:
Gemeinsam sind wir tot
(Psychokrimi)
-
Im Tod liegt die Wahrheit
(Psychokrimi)
-
Ein Herz für Tote
(Psychokrimi)
-
Chefsache Mord
(Kriminalroman)
„Das Spiel zeigt den Charakter.“(Deutsches Sprichwort)
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANGZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
EPILOG
DANKSAGUNG
BUCHTIPPS
PROLOG
Er wollte weg, einfach nur weg. Weg von den verlogenen Spießern in Smoking und Abendkleid. Weg von deren blasiertem Lächeln, mit dem jede Falte, jedes überflüssige Pfund und jeder einzelne durch Abwesenheit glänzende Partner genaustens registriert wurden. Weg von der heuchlerischen Scheinheiligkeit, die sie hinter klirrenden Champagnerkelchen verbargen. Später, im intimen Kreis, würden sie über jede noch so kleine vermeintliche Schwäche oder Unzulänglichkeit der Anderen lästern um das eigene Ego zu streicheln. Das war immer so. Seine eigene Familie, Gastgeber des Abends, bildete da keine Ausnahme.
Aber Weglaufen kam natürlich nicht in Frage. Er konnte nicht einfach verschwinden. Noch nicht. Schließlich war er, Luca Alexander von Bornstein, die Hauptattraktion! Ihm zu Ehren waren alle gekommen. Zahllose Verwandte und Bekannte, um ihn in der Welt der Erwachsenen willkommen zu heißen. Traditionsgetreu mit drei Jahren Verspätung.
Luca feierte heute seinen einundzwanzigsten Geburtstag, was bedeutete, dass er offiziell Teilhaber der von Bornstein'schen Privatbank wurde und einen Platz im Vorstand innehatte. Unabhängig davon, ob er das selber wollte und auch unabhängig davon, dass er noch nicht einmal das BWL-Studium abgeschlossen hatte. Denn auch sein Vater war in diesem Alter in die Bank gekommen, ebenso wie Lucas Großvater und dessen Vater vor ihm. Die von Bornsteins hielten nicht viel von Veränderungen.
Die Rede seines alten Herrn, von der jeder noch so banale Witz euphorisch beklatscht und jeder Verweis auf die lange Familientradition mit respektvollem Gemurmel bedacht wurde, schien kein Ende zu nehmen. Luca konnte kaum erwarten, dass ihm die vorbereiteten Dokumente offiziell zur Unterschrift vorlegt werden würden. Gleich danach wollte er sich aus dem Staub machen. Möglichst unauffällig, das hatte er seinen Eltern versprechen müssen.
Mit Thomas und Adrian, ebenfalls Söhne aus gutem Hause, wie seine Mutter es nennen würde, war Luca seit Kindheitstagen befreundet. Die drei hatten sich im Internat kennengelernt, zusammen die Pubertät durchlebt und auch gemeinsam ihre ersten sexuellen Erfahrungen in einem Schweizer Bordell gesammelt. Enttäuschende Erfahrungen, wie sie sich anschließend eingestehen mussten.
Auf der langweiligen Feier glänzten die beiden Freunde durch Abwesenheit, aber sie hatten ein Geburtstagsevent für ihn vorbereitet. Eine Überraschung, die sich Luca um keinen Preis entgehen lassen wollte. Ihre kryptischen Anspielungen versprachen eine spannende und aufregende Nacht. Feste Schuhe sollte er anziehen und eine Taschenlampe mitbringen, die mehr Lumen hatte als das iPhone.
Das Geburtstagskind stoppte einen der vorbeieilenden Mietkellner des Cateringservice' und tauschte sein leeres Glas gegen ein volles. Es war schon das fünfte an diesem Abend. Zusammen mit dem Kokain, das er vorhin konsumiert hatte, half ihm der Champagner dabei, seine innere Unruhe im Zaum zu halten.
Lucas Großmutter schritt würdevoll auf ihn zu. Sie hielt sich kerzengerade, war aber wie immer schwer auf den schwarzen Stock aus Ebenholz gestützt, dessen Knauf mit einer Nachbildung des Kopfes ihres ersten Rennpferds verziert war; die anspruchsvolle Arbeit eines Silberschmieds, von deren Erlös ein Dorf im Jemen vermutlich ein Jahr lang überleben könnte, wie der Enkel dachte.
So wie seine Eltern und Großeltern wollte er nie werden, nur auf Prestige und Einfluss bedacht und darüber vergessen zu leben. Ihm selbst würde das nicht passieren.
Er starrte auf die einzelnen grauen Borsten, die aus dem Kinn der alten Dame sprossen. Sie war vollendet frisiert, dezent geschminkt und trug ein schwarzes Kleid von Jenny Packham, dessen Pailletten mit den großen Brillantohrringen um die Wette funkelten. Luca fragte sich, warum niemand ihren Kinnbart zupfte. Vielleicht traute sich keiner.
„Luca! Gib deiner Großmutter einen Kuss!“
Widerwillig beugte er sich hinab und drückte artig seine Lippen auf die welke Wange, die spitzen Haare geflissentlich umgehend. Das schwere, süßliche Parfüm ließ ihn die Luft anhalten.
Er hob den Blick und sah seine Schwester Anne an einer der beiden hohen Flügeltüren zur Parkanlage lehnen, die heute weit geöffnet waren. Sie grinste und machte eine Geste, als würde sie sich mit dem Finger die Kehle durchschneiden. Luca verhinderte im letzten Moment, seiner Großmutter uncharmant ins Ohr zu prusten.
Mit ihren gerade mal sechzehn Jahren war Anne das Nesthäkchen im Haus. Luca mochte seine Schwester, auch wenn sie in letzter Zeit Allüren entwickelte, die ihm nicht gefielen. Es gab Tage, da wich sie kaum von seiner Seite, wollte überall mit dabei sein und einfach alles wissen. Das nervte! Manchmal musste er fast schon Gewalt anwenden um sie aus seinen Zimmern zu bugsieren. Heute hatte sie ihn wieder heimlich belauscht – auch das eine mehr als lästige Marotte, die langsam zur Gewohnheit wurde. Dabei hatte sie, zu seinem großen Ärger, einige Details aus dem Telefonat mit seinen Freunden aufgeschnappt.
„Aber ich werde sterben vor Langeweile!“, hatte sie anschließend gestöhnt und ihn flehend angesehen. „Die ganze Verwandtschaft, die hier sein wird ... Ich ertrage das nicht! Du musst mich einfach mitnehmen!“
„Nein. Unter keinen Umständen. Schlag dir das aus deinem süßen Köpfchen.“ So vage sich Thomas und Adrian auch ausgedrückt hatten – es war klar, dass es sich bei der Überraschung um eine Art des Vergnügens handeln würde, bei dem er Anne nicht gebrauchen konnte.
„Du denkst immer nur an dich!“, warf sie ihm vor. „Und das Schlimme ist: Du kommst damit durch.“
Der eisige Blick, den sie ihm nach seiner unerbittlichen Absage zugeworfen hatte, ließ ihn sogar noch in der Erinnerung frösteln, doch er war hart geblieben.
„Gut“, hatte sie schließlich gezischt. „Ganz wie du meinst. Aber das wirst du bereuen. Ich weiß mehr, als du ahnst.“
Zum Glück schien sich Anne mittlerweile beruhigt zu haben. Luca zwinkerte zurück und grinste ebenfalls.
Applaus brandete auf. Die Rede war beendet. Luca hakte seine Großmutter galant unter und führte sie durch die Grüppchen der Gäste zu einem der Stühle in der ersten Reihe, die im Nebensalon für den eigentlichen großen Akt der Vertragsunterzeichnung vor einem Podium aufgestellt worden waren.
Die Zeremonie verlief schnell und reibungslos. Luca nahm mit bedeutungsvoller Geste den goldenen Füller der von Bornsteins entgegen – angeblich hatte er seinem Ururgroßvater gehört und wurde von einer Generation zur anderen vererbt – und setzte schwungvoll seinen Namen unter das notariell beurkundete Dokument, das ihn zum Multimillionär machte. Bescheiden lächelnd verbeugte er sich vor den Anwesenden, sprach ein paar Worte des Dankes und lud zum Buffet ein, das im hell erleuchteten Gartenpavillon aufgebaut war.
Während die Gästeschar schwatzend den Raum verließ, nutzte Luca die Gelegenheit zum Rückzug. Sein Geburtstagspräsent hatte er schon heute Mittag erhalten, und er freute sich darauf, es endlich auszuprobieren. Schnell lief er die Treppe hoch. Von dem langen Flur gingen etliche Türen ab. Auch die zu seinen Räumlichkeiten. Ein Salon mit Schreibtisch, ein Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad und ein begehbarer Kleiderschrank.
Der Smoking landete samt Hemd und Fliege achtlos auf dem Boden. Flink schlüpfte Luca in Jeans und T-Shirt, die handgefertigten Lederslipper aus Italien ersetzte er durch robuste Sneaker.
Schon früher am Abend hatte er die Taschenlampe aus der Abstellkammer gemopst, jetzt steckte der Bankerbe vorsichtshalber noch einen Wollpullover und eine Packung Kondome zu ihr in den Rucksack; schließlich wusste er nicht, was ihn erwartete. Zumindest nicht im Detail. Aber es würde ein Männerausflug werden, so viel stand fest. Luca spürte ein erwartungsvolles Pochen zwischen den Beinen.
Schnell noch eine Line gezogen, das restliche Kokain in die Hosentasche gestopft, und er war bereit zum Aufbruch. Vorsichtig lauschte Luca an der geöffneten Zimmertür auf Hinweise, dass sein Verschwinden bereits bemerkt worden war. Nichts. Vermutlich drängelten sich alle am Buffet im Garten. Schließlich war das Essen umsonst. Leise kichernd huschte er die Treppe hinunter.
Das Geburtstagsgeschenk seiner Eltern parkte draußen in der Auffahrt. Ein roter Porsche Panamera 4 Platinum Edition, die Alten hatten sich nicht lumpen lassen. Luca warf den Rucksack auf den Beifahrersitz und ließ den Motor aufheulen. „So viel zum unauffälligen Abgang“, dachte er und lachte laut, als der Kies beim Beschleunigen zu beiden Seiten spritze. Noch hatte er kein rechtes Gefühl für die dreihundertdreißig Pferdestärken unter der Haube.
Anne, die sich hinter einem Busch versteckt hatte, sah ihrem Bruder mit zusammengekniffenen Augen nach, wie er mit abgeblendeten Scheinwerfern die baumgesäumte Zufahrt entlang jagte. Nur kurz leuchteten die Bremslichter am Ende der Allee auf, bevor das Auto mit hohem Tempo die Kurve schnitt und ihren bohrenden Blicken entschwand.
EINS
Wenn er geahnt hätte, was ihn erwartete, wäre Wilhelm Schachinger, von allen nur Willi genannt, heute wohl lieber mit seiner Schwester an einen See geradelt, als in den Wald zu gehen.
Der Rentner war früh aufgebrochen, nun aber schon seit Stunden unterwegs. Auf einer kleinen Lichtung hielt er inne, um drei Kohlweißlinge zu beobachten, die behäbig zwischen den gefiederten Blättern eines Frauenfarns umher taumelten. Vereinzelte, schräg durch die Kronen der Bäume fallende Sonnenstrahlen wirkten wie Bühnenscheinwerfer, die die kleinen Tänzer gekonnt in Szene setzten.
Willi genoss das friedliche Bild und nutzte die Gelegenheit, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Im geflochtenen Weidenkorb auf seinem Rücken befanden sich rund fünf Kilogramm Blaubeeren. Keine schlechte Ausbeute. Er wollte Marmelade kochen. Mit einem Schuss Rum und einer Prise Zimt. Sein Geheimrezept. Er verschenkte die süße Leckerei zu Weihnachten gerne an Freunde und Bekannte, und auch das eigene Vorratsregal sollte mit vier neuen Gläsern bestückt werden. Willi stopfte das karierte Stofftuch zurück in die Hosentasche und zog stattdessen eine Flasche aus der dafür vorgesehenen Lasche des Bauchgurts, den er um die Hüfte geschlungen hatte. Frisch lief das Wasser seine Kehle hinunter. Willi war ein wenig unschlüssig, ob die gesammelte Menge Beeren ausreichen würde. Nach einigem Hin und Her beschloss er, den Korb noch um etwa ein weiteres Kilo zu bereichern. Den Parkplatz, auf dem er seinen Wagen abgestellt hatte, konnte er ebenso gut in einem großen Bogen erreichen.
Die Hauptwege des Perlacher Forstes im Südosten Münchens waren in einem Rautenmuster angelegt worden, allerdings nicht analog zur Autobahn, was die Orientierung schwierig machte. Zudem verliefen viele kleinere Pfade kreuz und quer durch den Wald. Immer wieder mal erschienen in der Lokalpresse hämisch anmutende Artikel über Touristen, die sich angeblich in dem knapp dreizehneinhalb Quadratkilometer großen Waldgebiet verirrt hatten, aber Willi kannte sich aus. Um zu den üppigsten Heidelbeergehölzen zu gelangen, musste er die üblichen Pfade verlassen und querfeldein gehen. Seit die Forstwirtschaft damit begonnen hatte, tote Bäume nicht mehr abzutransportieren, sondern einfach im Wald verrotten zu lassen, war das zwar schwieriger geworden, aber nicht unmöglich. Für seine 73 Jahre war er noch recht rüstig. Er musste eben gut aufpassen, wohin er seine Schritte setzte. Und ab und zu ein wenig kraxeln oder sich ducken.
So wie jetzt.
Zwei einstmals beeindruckend mächtige, einander gegenüberstehende Baumstämme waren abgebrochen und hatten sich auf ungefähr eineinhalb Metern Höhe in den Astgabelungen des jeweils anderen verkeilt. Moose und Flechten überzogen die Rinden, machten den Weg frei für Bakterien und Pilze, die das Holz zersetzen würden. Zu beiden Seiten wucherten wilde Brombeerhecken, auch Brennnesseln waren zu sehen. Es war still in diesem Abschnitt des Waldes. Still und einsam. Weit weg vom Publikumsmagnet Perlacher Mugl, wie der Aussichtsberg genannt wurde, oder dem bekannten Hirschbrunnen.
Willi wurde langsamer. Den Sonnenstrahlen gelang es kaum noch, die Kronen der gedrängt stehenden Laub- und Nadelbäume zu durchdringen. Das eigentlich natürliche Hindernis vor ihm wirkte auf ihn wie ein düsteres Tor zur Schattenwelt.
Unvermittelt schauderte er.
„Jetzt mach‘ dich nicht lächerlich!“, schimpfte der Rentner mit sich selbst. „Schattenwelt! Soweit kommt's noch!“ Trotz der harschen Worte setzte er nur zögernd einen Fuß vor den anderen, bewusst bemüht, das Gefühl einer nahenden Bedrohung ebenso zu ignorieren wie die aufgestellten Härchen an seinen Unterarmen. Er versuchte den Kopf einzuziehen und gleichzeitig nach oben zu schielen, als würden die sterbenden Bäume jeden Moment bersten und ihn unter sich begraben können. Modriger Fäulnisgeruch stieg ihm die Nase.
Nur drei Schritte, dann hätte er es geschafft.
Eins, zwei ... Erleichtert richtete er sich auf.
Zu hastig, zu früh.
Der Deckel des Weidenkorbs prallte hart gegen einen der umgestürzten Stämme und riss Willi unvermittelt nach hinten. Er verlor das Gleichgewicht und knallte, wild mit den Armen rudernd, unsanft auf den Rücken. Zum Glück stieß er sich nicht den Hinterkopf, doch der Sturz aufs robuste Korbgeflecht presste ihm die Atemluft aus den Lungen. Er ächzte laut. Wie ein umgeworfener Käfer blieb er liegen, die Augen geschlossen.
Der weiche Waldboden hatte den Fall abgemildert. Willi war schnell klar, dass er Glück im Unglück gehabt hatte: Es schien nichts gebrochen zu sein. Nur über dem Steißbein und zwischen den Schulterblättern spürte er einen pochenden Schmerz. Dafür war ihm der Schreck in die Glieder gefahren.
Mit zitternden Fingern nestelte er blind an den Riemen. Er wollte zunächst den Korb loswerden, bevor er sich aufzusetzen versuchte. Fünf Kilo mehr oder weniger spielten für Willis Bauchmuskulatur eine durchaus gewichtige Rolle. Sich ungeschickt windend schlüpfte er aus den Trägern und öffnete endlich wieder die Augen.
Er drehte den Kopf nach rechts und links, versuchte einen Blick auf den Waldboden zu erhaschen, ehe er seine Hände hinein grub, um sich hoch zu stemmen. In eine Schnecke oder eine Ameisenstraße zu fassen wäre das letzte, was er jetzt gebrauchen konnte. Doch es gelang ihm nicht. Der Winkel war zu ungünstig.
Gerade als er sich seufzend eingestand, dass er das Risiko einer unangenehmen Berührung eben würde eingehen müssen, erregte etwas anderes sein Interesse. Nur wenige Meter von ihm entfernt hoben sich zwei weiße Flecken vom diffusen Grün und Braun des Waldes ab.
Willi runzelte die Stirn. Seine Sehkraft war nicht mehr so gut wie früher. „Schuhsohlen?“ Mühsam rappelte er sich in eine sitzende Position auf. Er blinzelte mehrmals und schluckte hart. Dann begann er zu schreien.
ZWEI
Eine knappe Stunde später hielt ein uniformierter Polizist eilfertig das blau-weiße Absperrband in die Höhe, um Kriminalhauptkommissar Franz Branntwein mit seinem laut Hersteller nelkengrünen Mercedes W124, Baujahr 1993, passieren zu lassen.
Das Fahrzeug war ein Erbstück seines Freundes und ehemaligen Vorgesetzten Günter Haller, der viel zu früh eines gewaltsamen Todes gestorben war. Für Branntwein völlig überraschend hatte ihm Hallers geschiedene Frau – und Erbin – nach der Beisetzung den Fahrzeugbrief und die Schlüssel des frisch gewarteten Gerade-So-Oldtimers in die Hand gedrückt. Obwohl mit dem Auto auch Erinnerungen verbunden waren, die er lieber vergessen hätte, hatte der Kommissar das Geschenk dankbar angenommen. Seit der Zwangsverschrottung seines geliebten Golfs war er ohne eigenen fahrbaren Untersatz gewesen.
Ein Umstand, der vor allem seine Assistentin Susanne Nowak manchmal an den Rand des Wahnsinns getrieben hatte. Niemand wusste besser als ihr Chef, wann sie zu schalten, blinken, bremsen oder Gas zu geben hatte, und es gelang ihm als Beifahrer nicht, dieses Wissen für sich zu behalten.
Jetzt rumpelte Branntwein noch ein paar Meter den unbefestigten Forstweg entlang und stellte den Daimler dann hinter dem weißen Sprinter der Spurensicherung ab. Die promovierten Rechtsmedizinerin Elisabeth Schneider hatte ihr Elektroauto ein Stück weiter im Schatten neben einem Krankenwagen geparkt, dessen Hecktüren weit offenstanden.
„Das wird wohl der Zeuge sein, der da auf der Trage liegt“, mutmaßte die Kriminalassistentin und löste den Sicherheitsgurt. „Sollen wir mit ihm anfangen oder zuerst nach der Leiche sehen?“
„Am besten bringen wir die Befragung gleich hinter uns, dann kann der Sanka endlich losfahren und Conni hat auch noch ein bisschen mehr Zeit.“ Gemeint war Conrad Fleischmann, der Leiter der Spurensicherung, der sie sowieso erst in die Nähe der Leiche lassen würde, nachdem dort jede Fichtennadel zweimal umgedreht worden war.
„Wilhelm Schachinger, dreiundsiebzig Jahre alt, Rentner, verwitwet, hier aus München“, las Susi auf dem Weg zum Krankenwagen vor. Die Informationen hatte ihr der Kollege Joachim Mayer inzwischen aus dem Kommissariat aufs Smartphone geschickt.
„Vorstrafen?“
„Hat Mausi keine erwähnt.“ Susi verwendete den Spitznamen des IT-Experten und Mannes für die Recherche. Er verdankte ihn seiner innigen Liebe zum Computer und dessen Zubehör, die er einmal zu oft auf einer Weihnachtsfeier in betrunkenem Zustand lauthals kundgetan hatte.
„Wird auch Zeit, dass ihr aufkreuzt“, wurden die Ermittler von einem der beiden Sanitäter empfangen, nachdem sie ihre Ausweise in die Luft gehalten hatten.
„Is' scho recht“, antwortete Branntwein, schenkte aber weder dem mürrischen Jüngling noch dessen rotwangigem Pickelgesicht weitere Beachtung. Susi folgte ihrem Chef wortlos in den Rettungswagen. Aus einer Infusion tropfte Kochsalzlösung in die Vene des Witwers, am anderen Arm hing eine Blutdruckmanschette. Es roch nach medizinischem Alkohol und Schweiß. Bei ihrem Eintreten hob der Zeuge den Kopf. Er war ein wenig blass, machte insgesamt aber einen gefassten Eindruck.
„Grüß Gott Herr Schachinger, mein Name ist Franz Branntwein, und das ist Susanne Nowak.“
„Grüß Gott. Sind Sie wirklich von der Polizei?“ Schachingers Blick wanderte kritisch von Branntweins ausgetretenen Turnschuhen nach oben und blieb kurz am Aufdruck des schwarzen T-Shirts hängen, der unter der Jeansjacke hervorblitze. „Optimismus heißt rückwärts Sumsi mit Po“, las er den Text unter der Comicdarstellung einer Biene laut vor. „Also zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben.“
„Waren Sie denn auch bei der Truppe?“, fragte Susi freundlich, während sie sich bemühte, mit ihrer riesigen, selbstgebatikten Umhängetasche nicht gegen den Infusionsschlauch zu stoßen.
„Nein.“ Schachinger räusperte sich. „Ich war Zahnarzt.“
„Ein Mann der Krone also“, spaßte Branntwein, wurde aber gleich wieder ernst. „So, Herr Schachinger, dann erzählen Sie mal. Dieser Bereich liegt ziemlich weit ab vom Schuss. Was haben Sie hier gemacht?“
„Ich hab' Blaubeeren gepflückt. – Aber nur für den Eigenbedarf“, fügte er schnell hinzu. „Das darf man doch, oder? Ich meine, das ist nicht gegen das Gesetz.“
„Äh ... Weißt du das, Susi?“
„Ja, es gibt das sogenannte Recht auf Aneignung von Waldpflanzen. Die Menge ist nicht klar definiert, aber in den meisten Regionen gilt bei Beeren ein Kilogramm pro Kopf, bei Pilzen um die zweihundertfünfzig Gramm.“
„Da haben Sie's“, wandte sich Branntwein zufrieden an Schachinger. „Aber wir sind ja auch nicht von der Beerenpolizei, sondern von der Mordkommission. Machen Sie sich da mal keine Gedanken.“
„Hier im Korb sind mindestens fünf Kilo“, mischte sich der Sanitäter von draußen ein.
Schachinger wurde noch ein wenig blasser. „Ich wollte Marmelade kochen“, stammelte er.
„Wie gesagt, Herr Schachinger, das interessiert uns nicht. Erzählen Sie doch mal, wie Sie die Leiche gefunden haben.“
„Ja, also ... Ich hab‘ mich bücken müssen, weil zwei Bäume umgefallen waren. Außen rum ging nicht, weil da überall Brombeerranken und Brennnesseln wuchsen. Und irgendwie bin ich dann mit dem Korb oben hängengeblieben und gestolpert.“
„Sie sind gestürzt?“, hakte Susi nach.
„Genau. Auf den Rücken. Und da hab' ich sie gesehen.“
„Sie?“, fragte Branntwein erstaunt. „Es sind mehrere?“ Er wandte den Kopf. Susi schaute ebenso alarmiert wie er.
„Die Schuhsohlen,“ konkretisierte der Zeuge.
„Ach so.“
Schachingers Stimme senkte sich zu einem Flüstern. „Aber ansonsten war er splitterfasernackt. Splitterfaser, sage ich Ihnen!“
„Ja, das haben wir schon gehört“, wiegelte Branntwein ab. „Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Waren beispielsweise weitere Menschen in der Nähe? Oder haben Sie ein Auto bemerkt, das weggefahren ist?“
„Nein. Gar nichts. Wir waren völlig allein, der Tote und ich.“
„Haben Sie ihn angefasst? Vielleicht, um den Puls zu fühlen?“
Willi Schachinger keuchte entsetzt. „Gott bewahre!“
„Fotos gemacht?“
„Womit denn?“ Er fummelte mühsam ein Handy aus dem Bauchgurt. „Das ist nur zum Telefonieren und für SMS. Weder Internet noch Kamera. Mein Enkel sagt, dass ich es wohl wegwerfen muss, wenn der Akku mal nicht mehr funktioniert.“
„Oder dem Museum spenden“, rutschte es Susi heraus. „Ähm ... Sind Sie öfter in diesem Gebiet unterwegs, Herr Schachinger?“, fragte sie dann.
„Na ja, so zwei-dreimal im Jahr. Im Sommer wegen der Beeren und im Herbst dann halt zwecks der Schwammerl.“
„Und war es da auch immer so einsam wie heute?“
Der Rentner nickte. „Mhm. Darum komme ich ja hierher. Ist eine gute Gegend. Da findet man wenigstens noch was. Im Forstenrieder Park gibt's auch ein paar ergiebige Stellen. Vor allem für Pfifferlinge.“
„Wirklich?“ Branntwein beugte sich interessiert vor. „Wo denn genau?“
„Sie müssen diese Frage nicht beantworten, Herr Schachinger“, beeilte sich Susi zu sagen und warf ihrem Chef einen strengen Blick zu.
Der zog die Mundwinkel nach unten. „Dann halt nicht.“ Er wandte sich zum Gehen. „Gute Besserung wünsche ich, Herr Schachinger. Bitte melden Sie sich, falls Ihnen noch etwas einfallen sollte.“
Susi kramte eine Visitenkarte aus dem Seitenfach ihrer Tasche. „Und geben Sie uns Bescheid, wenn Sie verreisen möchten.“
Willi Schachinger nickte und steckte die Karte in die Brusttasche seines Hemdes. Er sah sich verstohlen um und krümmte dann wiederholt den Zeigefinger. Die junge Kriminalassistentin verstand und beugte sich zu ihm hinunter. „Ich bekomme jetzt aber wirklich keinen Ärger wegen der Beeren, oder?“, fragte der Rentner leise. „Sie können sich gerne ein paar mitnehmen, wenn Sie mögen.“
„Vielen Dank, das tue ich! Aber machen Sie sich keine Sorgen, alles gut. Auf Wiedersehen, Herr Schachinger.“ Sie drückte dem Mann kurz die Hand und hüpfte aus dem Wagen. „Ich komme gleich!“, rief sie ihrem Chef zu, der sich von einem Polizisten den Weg zum Fundort der Leiche zeigen ließ. „Muss nur noch kurz was einpacken!“ Sie fingerte eine kleine Tupperdose aus der Umhängetasche.
Branntwein wartete schon auf sie. „Was hast du denn da gemacht?“, fragte er.
Susi zeigte ihm ihre Beute. „Eine größere Dose hab' ich leider nicht einstecken.“
„Du bist eh die einzige Frau, die ich kenne, die so einen Haufen Zeug mit sich rumschleppt“, antwortete Branntwein, weil er es nicht besser wusste. Er leckte sich die Lippen. Die Heidelbeeren rochen herrlich frisch und saftig. „Meine Mutter – Gott hab' sie selig – hat sonntags manchmal Blaubeerpfannkuchen gebacken“, schwelgte der Hauptkommissar in kulinarischen Kindheitserinnerungen, stibitzte eine der süßen Früchte und steckte sie sich ungewaschen in den Mund. „Da geht's lang“, sagte er dann und zeigte in den Wald hinein. „Ungefähr sechshundert Meter. Nach vierhundert Metern, bei der vom Blitz getroffenen Ulme, sollen wir uns leicht rechts halten, und dann immer der Nase nach. Angeblich gar nicht zu verfehlen.“
„Du nimmst mich auf den Arm“, sagte Susi und beeilte sich, ihm zu folgen.
„Stimmt“, grinste Branntwein, „Es ist eine Eiche. Hier wachsen keine Ulmen.“
DREI
Leichter Wind war aufgekommen. Das Flatterband, mit dem die Mitarbeiter der Spurensicherung den Fundort der Leiche abgesperrt hatten, machte seinem Namen alle Ehre. Die Anzahl der in den Waldboden gerammten gelben Fähnchen hingegen war kärglich, wie Kriminalhauptkommissar Franz Branntwein innerlich seufzend bemerkte. Auch wenn wenige Markierungen nicht zwingend bedeuten mussten, dass es kaum Hinweise gab, denen nachgegangen werden konnte.
„Servus Conni“, rief er dem Leiter der Kriminaltechnik über das Rauschen in den Wipfeln hinweg zu und blieb brav vor dem Absperrband stehen. Selbst wenn es keine Spuren geben sollte, die seine Assistentin Susanne Nowak und er hätten zertrampeln können, würde Conrad Fleischmann anderenfalls auf ihn losgehen wie eine Harpyie aus der griechischen Mythologie auf die Feinde des Zeus'; Frauenkopf hin oder her. Branntwein hatte da so seine Erfahrungen.
„Hallo Susi! Servus Franz!“ Fleischmann, der – ebenso wie seine Mitarbeiter – einen weißen Schutzoverall trug, hob grüßend die Hand. Er stand bei den beiden umgefallenen Bäumen, dem Schattentor, wie Wilhelm Schachinger es im Geiste genannt hatte, und fotografierte die Abdrücke, die der Rentner hier mit Schuhen, Korb und Körper hinterlassen hatte. „Ihr könnt rübergehen. Aber in gerader Linie, wenn ich bitten darf. In einem Radius von zwei Metern um den Baum herum könnt ihr euch frei bewegen.“ Die beiden Ermittler mussten nicht fragen, welchen der vielen Bäume Conrad Fleischmann genau meinte. „Ich komm' dann auch gleich, muss euch eh was zeigen“, fügte er rufend hinzu.
Der Mann saß mit dem Rücken an den Stamm gelehnt auf dem Waldboden und war, bis auf ein Paar weiße Sneaker, unbekleidet. Er hielt den Kopf gesenkt. Der Oberkörper hing nach vorne, schwarze Haare fielen ihm in die Stirn. Jemand hatte seine Handgelenke mit Klettmanschetten, an deren Ösen eine großgliedrige Stahlkette befestigt war, hinter dem Baum mit einem Karabiner aneinandergefesselt. Neben ihm kniete eine Frau um die Fünfzig, auch sie war in einen Overall der KTU gehüllt.
„Servus Sissi“, begrüßte Franz Branntwein die Rechtsmedizinerin Elisabeth Schneider mit österreichischem Dialekt. Nach einem gemeinsamen Kinobesuch und anschließendem späten Abendessen beim Lieblings-Italiener hatten sie die letzte Nacht zusammen in Schneiders Wohnung verbracht und sich erst heute Morgen voneinander verabschiedet.
„Servus Franz“, antwortete sie auf die gleiche Weise. Zunächst war der Pseudo-Akzent nur ein Running-Gag gewesen, um ihrem Spitznamen „Kaiserpaar“ gerecht zu werden, den ihnen die Kollegen am Anfang ihrer Beziehung vor knapp sechs Monaten aufgrund ihrer Vornamen verpasst hatten. Mittlerweile war ihnen das Begrüßungsritual zur Gewohnheit geworden. Schneider stand auf, um Branntwein schnell einen Kuss auf die Wange zu geben. „Hallo Susi“, wandte sie sich dann lächelnd an die junge Kriminalassistentin.
„Grüß dich, Elisabeth. – Ganz schön düster hier.“ Die Jüngere hob den Kopf gen Himmel, der zwischen den sich wiegenden Baumspitzen nur sporadisch hervorblitzte.
„Ja, finde ich auch. Achtzig Meter in die eine oder in die andere Richtung, und der Wald wirkt gleich wieder viel freundlicher. – Conni ist ziemlich sauer, weil die SpuSi die ganze Ausrüstung 'quer durch die Pampa' schleppen musste“, sagte sie augenzwinkernd und zeigte auf die akkubetriebenen Scheinwerfer. „Das war ein Zitat.“
„Wissen wir denn schon, wer der Tote war?“, fragte Branntwein und umrundete vorsichtig den Baum.
„Nein.“ Schneider schüttelte den Kopf. „Wie ihr seht, hatte er keine Papiere bei sich.“
„Hm. Ein Anhänger der Freikörperkultur?“
Susi zückte ihr Smartphone. „Könntest du mal ...?“, bat sie. Die Rechtsmedizinerin hob das Kinn des Unbekannten an, damit die Kriminalassistentin ein Foto seines Gesichts machen konnte. „Ich schicke das gleich mal an Mausi“, sagte Susi. „Vielleicht gibt es eine passende Vermisstenmeldung. – Was denkst du, wie lange er hier schon sitzt? Er sieht ziemlich ... hm ... frisch aus.“
Elisabeth Schneider nickte. „Stimmt. Den Todeszeitpunkt würde ich auf die frühen Morgenstunden legen, die Leichenstarre ist noch nicht voll ausgeprägt. Aber wenn mich mein erster Eindruck nicht täuscht, war er mehrere Tage lang an den Baum gekettet.“
„Mehrere Tage?!“, rief Branntwein erstaunt. Er beugte sich vor und schnüffelte. „Was stinkt hier eigentlich so?“
„Riecht, als hätte er in so einem Billig-Aftershave vom Discounter gebadet“, fand Susi.
„Der kleine Prinz“, feixte Fleischmann, der gerade in Hörweite vorüberging.
Susi wirkte verärgert. „Soll das etwa eine Anspielung auf den erigierten Penis sein? Das ist doch nicht ungewöhnlich, zumal er sitzend gestorben ist! – Wirklich, Conni, das ist sogar für deine Verhältnisse ...“
„Nein, nein“, versicherte Fleischmann schnell und wurde tatsächlich ein wenig rot. „Das war ein Wortwitz! Es gibt da einen After Shave Balsam, der so heißt. Also fast. Wenn du den einmal gerochen hast, vergisst du ihn nie wieder. Die Eigenmarke eines Discounters.“ Fleischmann räusperte sich und stiefelte weiter.
„Scheint ja ein krasses Zeug zu sein.“ Branntwein grunzte beeindruckt.
„Jedenfalls hat es erfolgreich die Tiere davon abgehalten, ihn bei lebendigem Leib anzuknabbern“, sagte Schneider ohne jeden Anflug von Sarkasmus. „Die Frage ist jedoch eher, wonach es nicht riecht“, ergänzte sie und kniete sich erneut neben die Leiche. „Nach Urin und Kot nämlich.“ Sie nahm ein Instrument aus ihrem Arztkoffer, das die Ermittler an eine Art Mini-Spaten erinnerte, und stach zwischen den Oberschenkeln des Opfers geschickt ein circa fünf mal drei Zentimeter großes Stück Moosteppich aus der Erde, das sie in eine Beweismitteltüte steckte. „Ich muss das natürlich noch durch die Obduktion morgen bestätigen, aber einer ersten Einschätzung nach würde ich vermuten, dass unser John Doe hier verdurstet ist.“
„Morgen?“, echote Branntwein.
„Verdurstet?“, rief Susi.
Schneider nickte. „Ja. Beides. Heute schaffe ich es nicht mehr. Bei mir staut sich die Arbeit. Zwei Verkehrstote, ganz in der Nähe. Liegen schon seit Samstagnacht im Kühlfach.“ Sie hob erneut den Kopf der Leiche an und zeigte mit ihrem behandschuhten Finger auf Blutspuren an Lippen und Kinn. „Seht ihr das? Er hat sich auf die Zunge gebissen. Vermutlich hatte er Krämpfe.“ Sie ließ den Kopf behutsam hinabsinken. „Ich werde jetzt die Kette lösen“, sagte sie und stand auf. – „Seid ihr mit den Aufnahmen hier fertig? Ich will ihn losmachen!“ Die gerufene Frage war an Conrad Fleischmann gerichtet. Der Kriminaltechniker hob den Daumen und kam wieder näher, um der Rechtsmedizinerin zur Hand zu gehen.
Schneider öffnete den Karabiner und tütete ihn ein, während Fleischmann mögliche Spuren an den Enden der Stahlketten sicherte, indem er Zugbeutel darüber streifte. Mit einigem Kraftaufwand drehte Elisabeth Schneider die Arme des jungen Mannes so, dass die Armbeugen zu sehen waren. „Dachte ich mir“, murmelte sie und sah auf. „Einstichstellen. Passt zu den Salzablagerungen auf der Haut.“ Susi hatte sich schon gefragt, was die hellen weißen Linien zu bedeuten hatten, mit denen der Körper des Toten überzogen war. „Er war auf Entzug. Das damit einhergehende starke Schwitzen hat den Flüssigkeitsverlust noch erhöht. Die Nieren haben nach und nach ihre Produktion eingestellt, es kam zu einem Kaliumüberschuss, und das Herz hat aufgehört zu schlagen.“ Schneider drückte die Haut auf seinem Handrücken zusammen. Die Falte blieb stehen. „Aber, wie gesagt, das muss die Leichenschau bestätigen. Drei Tage hat er hier gesessen, würde ich sagen, im Schatten unter den Bäumen vielleicht vier.“
„Hast du Tattoos oder Piercings entdeckt?“, fragte Branntwein.
„Nein, keine besonderen Merkmale, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.“
Susi tippte die Hinweise für Mausi ins Smartphone und schickte sie zusammen mit dem Foto des Toten an den Kollegen im Büro. „Was ist mit seinen Schultern passiert?“, wollte sie dann wissen und steckte das Handy weg.
Schneider seufzte. „Beide ausgekugelt. Vermutlich, als er sich befreien wollte. Vielleicht auch während der Krämpfe, die mit dem körperlichen Entzug einhergegangen sein müssen.“ Sie schüttelte traurig den Kopf. „Der arme Kerl hat sehr gelitten.“
„Du bist also sicher, dass er noch am Leben war, als er an den Baum gekettet wurde“, vergewisserte sich Branntwein.
„Ja. Absolut sicher.“
„Und er war bei Bewusstsein?“
„Ob er sich selbst hingesetzt hat oder betäubt abgelegt wurde, kann ich vor einer toxikologischen Untersuchung nicht mit Sicherheit sagen. Aber irgendwann hat er begonnen, sich gegen seine Fesseln zu wehren, das siehst du an den Furchen, die seine Schuhe auf dem Waldboden hinterlassen haben. Die tiefen Abschürfungen am Rücken sind ebenfalls eindeutig, genau wie die Striemen an den Handgelenken und die Wunde am Hinterkopf, die er sich selbst beigebracht hat, indem er immer wieder mit dem Schädel gegen den Stamm geschlagen und gedrückt hat. Aber keine Hinweise auf gewaltvolle Fremdeinwirkung. Bis jetzt zumindest“, schränkte sie obligatorisch ein.
Conrad Fleischmann zeigte in den Forst hinein. „Ungefähr noch mal zweihundert Meter weiter ist ein kleiner Hohlweg, kaum mehr als ein breiter Pfad, aber der Boden dort ist furztrocken. Wir konnten keine Reifenspuren sicherstellen – falls jemals welche da waren.“
„Schuhabdrücke?“ Branntwein ging zu den Füßen des Leichnams und blickte auf die Sohlen der Sneaker. Bis auf ein paar Fichtennadeln, die sich im Profil verfangen hatten, und Moosfetzen an den Hacken, die wohl vom Scharren während der Befreiungsversuche herrührten, waren sie sauber.
„Abdrücke ist zu viel gesagt“, zerstörte Fleischmann dann auch die vage Hoffnung des Kommissars, „aber ich bin ziemlich sicher, dass sie mindestens zu zweit gewesen sein müssen.“
„Allein hätte er sich ja auch schlecht in dieser Position an den Baum ketten können“, bemerkte Susi trocken.
„Ja, ja. – Oder seine Kleidung verschwinden lassen. Kommt mal mit, ich wollte euch doch noch was zeigen.“ Fleischmann ging voraus. Nach rund fünfzehn Metern blieb er stehen und deutete auf ein paar umgeknickte Farnbüschel neben einem verrottenden Baumstumpf. „Ich glaube, hier hat er sich ausgezogen.“
„Könnte das nicht auch von einem Tier plattgedrückt worden sein? Einem Wildschwein vielleicht?“, fragte Susi.
„Nur, wenn die Sau gerne shoppen geht.“ Fleischmann zog mit triumphierendem Grinsen eine Beweismitteltüte aus der Hosentasche seines Overalls. Die Ermittler erkannten den Fetzen einer Plastiktüte mit dem Teil des Logos eines bekannten Modehauses. „Noble Marke – im Gegensatz zum Aftershave und den Turnschuhen. Hing hier an dem Stumpf. Offensichtlich abgerissen.“
„Im Wald liegt doch haufenweise Müll rum. Das beweist gar nichts“, murrte Branntwein.
„Eben nicht“, widersprach der Leiter der Spurensicherung. „Keine Taschentücher des wildpinkelnden Weibsvolks, keine Bierflaschen oder Kronkorken – nicht einmal Hundehaufen. Meine Leute haben vom Marterpfahl bis zur hohlen Gasse nur drei Zigarettenkippen gefunden und die waren allesamt schon älter. Dieses Stück Plastik hingegen“, er hob die Beweismitteltüte in die Höhe, „liegt hier noch keine Woche.“
„Du hast recht, es ist einsam hier. Seit wir da sind ist auch noch niemand vorbeigekommen“, bemerkte Susi.
Fleischmann nickte gewichtig. „Dieser Abschnitt scheint ein echter Geheimtipp zu sein, wenn du mal jemanden unbemerkt nackt an einen Baum ketten und verrecken lassen willst.“ Er streckte den Rücken durch. „Ich muss dann wieder ... Die Geier vom Bestattungsinstitut werden gleich da sein und ich möchte Elisabeth dabei helfen, die Leiche zu strecken. Nicht, dass die ihnen wieder fast aus dem Sarg purzelt.“
„Ja, geh' nur“, antwortete Branntwein abwesend. „Was glaubst du, wem das hier alles gehört?“, wandte er sich nachdenklich an seine Assistentin. „Ist das Privatbesitz?“
„Nein. Der Perlacher Forst gehört zusammen mit dem Grünwalder Forst und dem Forstenrieder Park zu den Bayerischen Staatsforsten“, antwortete Susi. „Genauer gesagt zur Betriebsklasse Süd des Forstbetriebes München.“ Ihrem Chef blieb der Mund offenstehen. „Schau' nicht so ungläubig, ich hab's genudelt“, lachte Susi. „Aber bei den Forstbetrieben ist erst morgen früh wieder jemand zu erreichen. Von neun bis zwölf.“
„Mist! – Dann fahren wir jetzt ins Büro zurück, vielleicht ...“
„Franz?! Susi?! Kommt ihr mal bitte?“ Elisabeth Schneider winkte ihnen zu. „Das habe ich gerade entdeckt“, sagte sie, als die Ermittler herantraten. Sie zeigte auf ein kleines Tattoo, das auf der Haut über dem Steißbein des unbekannten Toten prangte. Es handelte sich um zwei parallel verlaufende Kreise, von denen jeweils schräg rechts ein Pfeil abging. Sogenannte Marssymbole, denen das männliche Geschlecht zugewiesen wird. An der runden Basis überlappten sich die beiden Zeichen und bildeten eine Schnittmenge.
„Na, das scheint mir ja der passende Fall für Ihre Abteilung zu sein“, bemerkte einer der beiden Leichenträger spöttisch.
Branntwein riss verwundert den Kopf nach oben. Es war das erste Mal, dass einer der Angestellten des Bestattungsinstituts, mit dem der Freistaat bei unklaren Todesfällen zusammenarbeitete, das Wort an ihn richtete, seit er sie einmal mit den Aasfressern aus den Lucky Luke-Comics verglichen hatte. Natürlich nur Gangart und Körperhaltung betreffend, aber sie waren trotzdem beleidigt gewesen. „Wie meinen Sie das?“, fragte er und kniff misstrauisch die Augen zusammen.
Susi zupfte am Ärmel seiner Jeansjacke. „Lass' gut sein Chef, das bringt doch nichts.“
Branntwein schüttelte ihre Hand ab. „Ich will das aber wissen“, sagte er, ohne sein Gegenüber aus den Augen zu lassen.
„Nun, wie soll ich das schon meinen?“ Der Leichenträger hob das Kinn und zog die Mundwinkel nach unten. „Es wird eben einiges gemunkelt.“
„Aha! Gemunkelt also! Es wird einiges gemunkelt! – Es gibt aber keinen Grund zum Munkeln! Und soll ich Ihnen auch sagen warum nicht?“ Branntweins Stimme war lauter geworden. Er machte einen Schritt auf den Anderen zu. Elisabeth Schneider und Susi hielten die Luft an, Conrad Fleischmann verschränkte die Arme und folgte dem Disput mit gespanntem Interesse. „Weil es kein Geheimnis ist, dass zwei meiner Leute homosexuell sind! Weil nichts Munkelhaftes daran ist, wenn zwei der besten Oberkommissare der Münchner Kriminalpolizei beschlossen haben, gemeinsam durchs Leben zu gehen! Und soll ich Ihnen noch etwas sagen?“ Der Sargträger bemühte sich um einen möglichst arroganten Gesichtsausdruck, doch der hüpfende Adamsapfel verriet seine Anspannung. Branntwein fuchtelte mit dem Finger vor seiner Nase herum. „Daniel Baumann und Georg Hinterhuber werden sich einen Rauhaardackel zulegen, wenn sie in Pension gehen!“, rief Branntwein triumphierend und reckte einen Zeigefinger in die Höhe. „Das ist zwar noch um die dreißig Jahre hin, aber sie werden eine Familie gründen, und zwar völlig egal, was so verklemmte Spießer wie Sie dazu sagen!“ Er atmete tief durch. „Und jetzt schauen Sie zu, dass Sie Land gewinnen, Sie homophober ...“
„Ähm, Chef ...? Die müssen erst noch die Leiche einpacken“, machte ihn Susi aufmerksam.
„Wir sind hier eh fertig!“ Branntwein bückte sich und gab Elisabeth Schneider einen flüchtigen Schmatz auf die Wange. „Tschüss Sissi, wir hören uns später. Servus, Conni, habe die Ehre!“ Immer noch wütend stapfte er davon. Susi beeilte sich, ihm zu folgen. Dass ihre ausladende Umhängetasche dabei gegen den Unterleib des dunkel gekleideten Anzugträgers stieß, war reiner Zufall.
VIER
Die Kaffeemaschine zischte. Ein Geräusch, dem Kriminalhauptkommissar Franz Branntwein auf einer Liste seiner persönlichen Lieblingstöne Platz drei einräumen würde, nur übertroffen vom zufriedenen Babyglucksen seiner Tochter Antonia, mittlerweile erwachsen und Medizinstudentin an der LMU, und dem Live-Mitschnitt eines Konzerts des Saxofonisten Coleman Hawkins aus dem Jahr 1962.
Er warf seine Jeansjacke auf den Boden vor der Garderobe hinter der Tür und durchquerte das Amtszimmer im Polizeipräsidium in der Ettstraße zielstrebig in Richtung Sideboard.
„Dir auch einen schönen Tag“, murmelte Joachim Mayer.
Susi, die die drei anwesenden Kollegen mit einem fröhlichen Hallo begrüßt und sich dann eine Dose Cola aus dem Kühlschrank geholt hatte, nahm ihren Chef in Schutz: „Lass' ihn, Mausi, er hat sich heute schon genug ärgern müssen.“
„Ach?! Fahrradfahrer im Kreisverkehr oder Gehbehinderter am Zebrastreifen?“
Gegen ihren Willen musste Susi lachen. „Keins von beidem. – Aber das soll er euch selbst erzählen, wenn er möchte.“
Vier Augenpaare richteten sich auf Branntweins Rücken. Der Kommissar rührte gedankenverloren in seinem Thermobecher. Wie immer hatte er viel Milch und Zucker in den Kaffee gegeben. Von der Unterhaltung schien er nichts mitbekommen zu haben, stattdessen starrte er auf die Raufasertapete, an der das