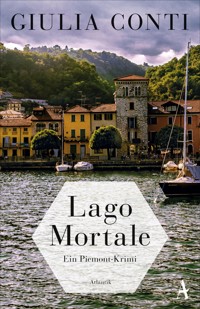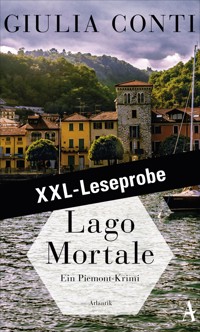13,99 €
Mehr erfahren.
Brütend heiße Julitage in Turin. Am Ufer des Po wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. War es Mord, und ist die verstörte junge Frau an seiner Seite die Täterin? Wie der Tote gehört sie zu einer Gruppe junger Turiner Naturschützer, die sich gegen geplante Zugtrasse durch das nahe Susatal nach Lyon einsetzen. Außerdem für den Schutz der Wölfe, in denen viele im Tal eine Bedrohung sehen. Camilla di Salvo hat sich eigentlich auf einen ruhigen Sommer gefreut. Aber als die Psychologin zur Hilfe gerufen wird, geht sie – überzeugt von der Unschuld der jungen Frau – auf Tätersuche und bringt sich damit selbst in höchste Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Giulia Conti
Der Tote am Fluss
Ein Turin-Krimi
1
Als ein Spaziergänger Domenico Falcone an einem Julimorgen erschlagen am Ufer des Po entdeckte, war es gerade hell geworden, Turin noch nicht richtig wach, und wie es der Zufall wollte, war ich zur selben Zeit mit dem Ruderboot auf dem Fluss unterwegs, nicht sehr weit entfernt vom Fundort der Leiche. Eine Stunde später fand ich mich selbst am Tatort wieder. Meinen ersten Urlaubstag hatte ich mir allerdings anders vorgestellt. Immerhin hatte er gar nicht so schlecht begonnen. Ich war früh aufgestanden, noch im Dunkeln, hatte mir auf die Schnelle einen Cappuccino zubereitet, ein paar biscotti dazu gegessen, war im anbrechenden Morgenlicht mit dem Fahrrad durch das noch menschenleere Turin zum Vereinshaus meines mitten in der Stadt am Po gelegenen Ruderclubs gefahren, wo mich bereits Lorenzo erwartete, der Trainer, den alle nur Renzo nannten, und der mich wie gewohnt mit einem knappen Nicken und knurriger Miene begrüßt hatte.
Renzo war ein wortkarger Typ, dessen gealtertem zähem Körper man den einst erfolgreichen Ruderer schon von weitem ansah. Im Verhältnis zu seiner Statur war er extrem breitschultrig, und seine mageren Beine, die stets in ausgewaschenen, zu kurzen Shorts steckten, waren sehnig und braun gebrannt. Der ganze Mann schien wie gegerbt von dem kräftezehrenden Sport. Renzo hatte mir kurz nach meiner Ankunft geholfen, das schlanke, gut zehn Meter lange Zweierrennboot von der Stellage herunterzuheben, an den Steg zu tragen und ins Wasser zu legen, war wortlos in sein Beiboot gestiegen und hatte schon den kleinen Außenborder angelassen, der jetzt leise vor sich hin tuckerte.
Meine Freundin Franca kam auch heute zu spät, war wie ich schon im Sportdress und murmelte hastig eine Entschuldigung, sah dabei aber strahlend und sehr ausgeschlafen aus. Wenn ich damit gerechnet hatte, dass Renzo sie wegen ihrer Unpünktlichkeit anfahren würde, hatte ich mich getäuscht. Er schien an diesem strahlenden Julimorgen gute Laune zu haben, außerdem durfte Franca sich bei ihm mehr erlauben als andere. Sogar dieser knurrige Trainer konnte sich ihrem warmherzigen Temperament nicht verschließen.
Wir legten sofort los, und wie immer waren die ersten Schläge mühsam, die Müdigkeit saß mir in den Knochen, und als ich die Ruderblätter eintauchte – ich nannte die Ruder aus Gewohnheit immer noch so, obwohl sie eigentlich Skulls hießen –, fühlte es sich an, als zöge ich sie durch flüssiges Blei anstatt durch Wasser. Franca dagegen bewegte sich gewohnt geschmeidig. Meine beste Freundin gab als Schlagfrau unseren Rhythmus vor, während ich auf meinem Platz hinter ihr im Bug des Bootes auch dafür sorgte, dass wir den Kurs hielten. Ich klinkte mich in ihren Takt ein, blickte auf ihren schmalen Rücken und ihre dunklen, zu einem tief sitzenden Zopf gebändigten Haare, sah, wie sich ihre Muskeln unter ihrem Shirt anspannten und lockerten und dachte zum hundertsten Mal, wie viel leichthändiger sie war als ich, nicht nur beim Rudern, sondern eigentlich in fast allen Dingen des Lebens.
Nichts ließ an diesem Morgen erahnen, dass ich schon bald an einen Tatort gerufen würde, wo mich ein toter junger Mann und eine verstörte junge Frau erwarteten. Die Luft war zu der frühen Stunde noch kühl, aber die Julisonne hatte schon viel Kraft; ein weiterer Tag mit sengender Hitze kündigte sich an. Der leicht modrige Geruch des Flusses stieg mir in die Nase, und aus den Augenwinkeln nahm ich schemenhaft die Stadt wahr, wie einen Film, der neben mir ablief. Auf der Seite des Flusses, die dem historischen Zentrum zugewandt war, ragte die Spitze der eigenwilligen Mole Antonelliana in den Himmel, dann passierten wir den Ponte Vittorio Emanuele I, die Brücke, auf die Turins größter und imposantester Platz aus leicht erhabener Lage zufiel. Danach, hinter den Murazzi, den alten steinernen Lagerhallen am Po, wurde es grüner. Aber bis auf zwei ältere Männer mit Fischerhüten auf dem Kopf sowie Eimern und Klappstühlen neben sich, die ihre Angeln ausgeworfen hatten, lag das Flussufer noch still. Doch langsam erwachte die Stadt, und im Parco del Valentino würde es bald zu wuseln beginnen.
Der Park flog jetzt an mir vorbei, mit seinen Kiosken, die zu seinem quirligen Charme gehörten, wo an Tischen und Stühlen draußen schon ein paar Frühaufsteher beim Espresso saßen und sich den ersten Sonnenstrahlen entgegenstreckten. Auch zwei Jogger trabten am Ufer entlang, und einmal paddelte uns ein Kajakfahrer entgegen, sonst war auf dem Fluss nichts los. Da es rundum so still war, hörte sich unser Boot richtig laut an, das Rauschen, mit dem es durch das Wasser glitt, und das sanfte Klatschen, wenn wir die Ruderblätter eintauchten.
»Oberkörper aufrecht, Camilla!«, rief Renzo, und mein Blick ging über Franca hinweg nach hinten, wo ich nur noch die äußerste Spitze der Mole sah und unsere Strömungsspur, die sich nach ein paar Metern in den trüben Fluten des Po verlor.
Der Himmel über mir war blassblau mit ein paar wattigen, sehr weißen Wolken, die sich weiter hinten über den Bergen ballten. Ein Flugzeug zog über der Stadt seine Bahn, ging langsam tiefer, nahm Kurs auf den Turiner Flughafen. Sah man uns von da oben? Als winzigen Punkt, der sich über den Fluss bewegte? Woher mochte die Maschine wohl kommen? Und was tat sich gerade in ihrem Inneren? Stewardessen, die letzte Kontrollblicke warfen? Passagiere, die wegen der bevorstehenden Landung den Gurt anlegten? Darunter waren bestimmt einige, denen gerade der Angstschweiß ausbrach.
Damit kannte ich mich aus. Bis vor einiger Zeit hatte ich für eine Fluggesellschaft Seminare gegen Flugangst geleitet und hautnah erlebt, welche Qualen manche Passagiere oben in der Luft durchlitten, dabei oft geradezu in eine Angstspirale gerieten. Ich selbst war schon lange nicht mehr mit dem Flugzeug verreist, obwohl ich eigentlich gern flog, es genoss, wenn ich beim Start tief in meinen Sessel gedrückt wurde, gefolgt von diesem großartigen und immer wieder überraschenden Moment, wenn sich die tonnenschwere Maschine so leicht vom Boden löste und in den Steilflug ging. Aber Fernreisen waren erst einmal aus meinem Leben gestrichen, denn sonst hätte es bedeutet, dass ich für meine Patienten über längere Zeit hinweg gar nicht mehr erreichbar gewesen wäre, auch nicht in Notfällen, was ich ihnen nicht zumuten wollte. Außerdem kam Fliegen mit meinem Hund nicht infrage, denn für dessen Flugangst, eingesperrt in einen Käfig im Bauch des Fliegers, war noch keine Therapie erfunden. Aber immerhin hatte ich mir in diesem Juli zum ersten Mal seit geraumer Zeit eine längere Auszeit genommen, ganze drei Sommerwochen, und die hatten gerade erst begonnen.
Nach einer Weile hatten Franca und ich ganz zu unserem Rhythmus gefunden. Wir stiegen beide kräftig in die Riemen, erhöhten die Schlagzahl etwas, atmeten und bewegten uns im selben Takt, fast so, als wären wir zu einer einzigen Person verschmolzen, die das Boot durch den Fluss vorantrieb. Renzo kauerte in seinem von dem kleinen Motor angetriebenen schon älteren Aluboot, dessen ursprünglich blaue Farbe an den Bordwänden fast überall abgeblättert war, und fuhr tuckernd in einiger Entfernung neben uns her, ein Megafon in der Hand, in das er seine Anweisungen bellte. Wir machten volle Fahrt, als ich plötzlich von einem Geschehen am Ufer abgelenkt wurde. Durch das trotz der sommerlichen Trockenheit sattgrüne dichte Laub der Bäume am Uferhang zuckte ein regelmäßiges blaues Flackern. Was war da los?
Ich riskierte einen schnellen Blick und sah, wie zwei Carabinieri sich auf der Wiese darunter umtaten, der eine über etwas gebückt, der andere so laut telefonierend, dass seine Stimme bis zu uns drang, ich aber dennoch die einzelnen Worte nicht verstehen konnte. Dann entdeckte ich das Polizeiauto, das oben an der Straße hinter einer lichteren Baumreihe abgestellt war und still vor sich hin blinkte. Dort rauschte und dröhnte inzwischen auch der Verkehr, drängelndes Hupen ertönte in immer kürzeren Abständen. Die Stadt war erwacht.
»Camilla! Konzentrier dich gefälligst!« Das war wieder Renzo, der natürlich bemerkt hatte, dass ich mich von den Aktivitäten am Ufer ablenken ließ.
Tatsächlich waren wir leicht aus dem Takt geraten, obwohl Franca sich, anders als ich, nicht hatte irritieren lassen und stoisch weitergerudert war. Fast hätte ich das Ruderblatt im Wasser verkantet, und wir hätten uns einen Krebs gefangen – der Albtraum jedes Ruderers, vor allem natürlich, wenn das im Wettkampf passierte. Den hatten wir aber erst noch vor uns. Unser Ruderclub wurde in wenigen Tagen einhundertfünfzig Jahre alt, was groß gefeiert werden sollte, unter anderem mit verschiedenen Regatten, zu denen Sportler auch aus den Nachbarländern erwartet wurden und an denen Franca und ich mit dem Zweier teilnehmen wollten. Dafür trainierten wir nun schon seit einiger Zeit zwei- bis dreimal in der Woche, immer am frühen Morgen. Noch vor wenigen Jahren hätte ich nicht gewusst, dass ein Krebs beim Rudern kein Schalentier meint, das plötzlich aus dem Wasser vor dem Boot auftaucht, sondern einen Schlagfehler mit verheerender Wirkung. Damals hatte ich noch keinen blassen Schimmer von diesem Sport, hatte die Ruderer immer nur fasziniert von der Brücke aus beobachtet auf dem Heimweg zurück von meiner Praxis – zu der Zeit wohnte ich noch auf der anderen Seite des Po –, und war fasziniert von ihrer Eleganz, ihrer Kraft und Harmonie, diesem ästhetischen Zusammenklang, der vollends unwiderstehlich wurde, wenn die Abenddämmerung anbrach und den Fluss mit den dahingleitenden Booten in einen rötlichen Schimmer tauchte.
Drei Jahre war es her, dass ich beschlossen hatte, es einmal selbst auszuprobieren, auch Franca hatte ich dazu überredet, und wir waren kurz darauf in einen der vielen Turiner Rudervereine eingetreten, um schon bald überrascht festzustellen, wie talentiert wir beide für diesen Sport waren, Franca noch etwas mehr als ich. Seither trafen wir uns regelmäßig zum Training auf dem Po, eigentlich nur zum Spaß, aus dem allerdings in den letzten Wochen vor dem Wettkampf sportlicher Ernst geworden war.
Ich war wieder im Takt, und wir erreichten kurz vor dem Isolotto di Moncalieri den Wendepunkt, der das Ende der Trainingsstrecke im gestauten Teil des Flusses mitten in der Stadt markierte und an dem wir umkehrten. Es lief sehr gut, wir hatten unseren Rhythmus wiedergefunden, ruderten jetzt mit der kaum merklichen Strömung, rollten stetig auf den metallenen Schienen vor und zurück, perfekt miteinander im Einklang, als ob sogar unsere Herzen im selben Takt schlügen. Meine Haut prickelte, und trotz der großen, fast schmerzhaften Anstrengung durchströmte mich eine wohlige Wärme. Das Wasser fühlte sich nicht mehr an wie Blei, sondern eher wie flüssige Sahne, und das Boot sauste über den stillen Fluss, fast als würde es ganz von allein noch schneller werden, und wie immer lauschte ich tief beglückt dem Knacken, das beim Drehen des Blattes regelmäßig wie ein Metronom ertönte. Sogar Renzo schien zufrieden zu sein, jedenfalls überschüttete er uns nicht mehr mit Instruktionen aus seinem Megafon. Als wir wieder an der Stelle mit den Carabinieri vorbeikamen, warf ich noch einmal einen schnellen Blick zum Ufer, wo jetzt noch mehr Uniformierte zugange waren, die das Gelände inzwischen in einem weiten Kreis mit Flatterband gesichert hatten. Ich bezwang meine Neugier und konzentrierte mich ganz aufs Rudern, bis wir zügig und ohne weitere Fehler am Vereinshaus anlegten.
»Noch einen Cappuccino in der Bar?«, fragte Franca, nachdem wir das Boot zurück auf die Stellage gehoben, gesäubert und trocken gewischt, uns geduscht und den verschwitzten Sportdress gegen unsere Alltagskleidung getauscht hatten, ich gegen einen sehr leichten Hosenanzug, Franca gegen eines ihrer lässigen bunten Sommerkleider.
Die Frage hätte sie sich eigentlich sparen können, denn in den letzten Wochen waren wir fast schon automatisch nach jedem Training in der Vereinsbar gelandet, da unsere Arbeitszeiten das erlaubten. Ich öffnete meine Praxis erst um zehn Uhr, außerdem hatte ich ja Urlaub, und Franca machte ihr Café, das sie im Stadtteil San Salvario, also gleich um die Ecke, betrieb, auch immer erst gegen zehn Uhr auf. Vor zwei Tagen hatten wir Renzo, den wir trotz seiner mürrischen Art sehr mochten, vorgeschlagen, doch noch auf einen Espresso mitzukommen, aber er hatte nur den Kopf geschüttelt und war mit zwei geschulterten Rudern sofort ins Bootshaus verschwunden.
Die Bar verströmte mit ihren Ledersesseln, holzgetäfelten Wänden, den antiken, mit Pokalen geschmückten Vitrinen und gerahmten historischen Stichen die lange, bald einhundertfünfzig Jahre währende, fast heilige Rudergeschichte des Traditionsvereins. An diesem Morgen waren wir dort ganz allein, nur ein junger Mann sorgte für den Service. Als die Tassen und die noch warmen Brioches vor uns standen, meldete sich mein Handy. Ich sah auf das Display. Ennio.
Mit ihm und unserem Hund lebte ich nun schon seit einiger Zeit in einer Altstadtwohnung zusammen, nicht weit weg von meiner Praxis. Was wollte er um diese Zeit von mir? Das war ungewöhnlich. Als ich am frühen Morgen aufgebrochen war, hatte er noch geschlafen, und er war auch nicht wach geworden, als ich ihm vorsichtig einen Kuss auf die Stirn gedrückt hatte, woraufhin der eifersüchtige Cesare einmal laut gebellt hatte. Ennio war Carabiniere, inzwischen hatte sein Dienst begonnen, und es kam eigentlich nicht vor, dass er mich dann anrief, es sei denn, etwas war passiert. Einmal war das der Fall, als sein Freund und Kollege Tonio erschossen worden war, am helllichten Tag mitten in Turin bei dem Versuch, einen Drogenkurier zu verhaften. Am Telefon hatte Ennio damals kaum einen Ton herausgebracht, und als ich endlich verstanden hatte, was passiert war, ging es mir genauso, obwohl ich Tonio nicht besonders gut gekannt, aber sehr gemocht hatte.
»Ciao, Camilla, wo bist du? Noch im Ruderclub?«, fragte Ennio ohne Umschweife.
»Ja, mit Franca in der Bar.«
»Ich bin nicht weit weg«, schob er sofort nach, »hier am Flussufer liegt ein toter Mann, noch ganz jung und, so wie es aussieht, ermordet. Außerdem ist hier eine junge Frau, die völlig durch den Wind ist, nicht ansprechbar und aggressiv. Wir wissen nicht, was mit ihr los ist und was sie mit der Sache zu tun hat. Könntest du vielleicht vorbeikommen und sie dir mal ansehen, versuchen, mit ihr zu reden?«
Das erklärte das frühmorgendliche Treiben, das ich am Ufer beobachtet hatte. Ennio war also mittendrin, aber auf die Entfernung aus dem Ruderboot heraus hatte ich ihn nicht erkannt. Ich zögerte. Ich hatte doch Urlaub und mir den Vormittag gewiss anders ausgemalt, mit Cesare durch den Parco del Valentino streunen, ein pinguino, ein von Schokolade umhülltes Eis, bei der Gelateria Pepino im Park essen, vielleicht sogar zur Feier meines ersten Urlaubstages ein Glas Prosecco trinken oder einfach nur auf einer Bank am Ufer sitzen, auf den Fluss schauen und an gar nichts denken. Und vor allem für nichts und niemanden Verantwortung übernehmen. Aber Ennio kannte meine Faszination für alles, was mit Verbrechen zu tun hatte, und setzte darauf. Zu Recht.
»Ich kann natürlich kommen«, sagte ich. »Aber geht das denn auch in Ordnung?«
»Ja, das ist ganz offiziell. Die Staatsanwältin, die schon kurz hier war und dich ja kennt, hat den Vorschlag gemacht, dich als Psychologin einzuschalten. Und sogar deine Freundin, Ispettore Ruggieri, hat zugestimmt, allerdings etwas widerwillig …«
Dass Ennio diese Kommissarin erwähnte, mit der ich, wie er wusste, nur unangenehme Erinnerungen verband, stimmte mich fast wieder um, aber dann sagte ich doch zu: »Okay, ich mache mich gleich auf den Weg.«
»Wir sind …«, hob Ennio noch zu einer Erläuterung an, aber ich ließ ihn gar nicht erst ausreden.
»Ich weiß, wo ihr seid, ich habe euch gesehen …«
»Hätte ich mir ja denken können«, beendete Ennio das Gespräch, und ich sah förmlich vor mir, wie er dazu grinste.
2
Als ich am Ufer ankam, waren noch immer einige Leute auf der Wiese beschäftigt, außer den Carabinieri eine Frau und zwei Männer von der Spurensicherung. An der Stelle, wo unter einem hellen Tuch vermutlich die Leiche des jungen Mannes lag, entdeckte ich Ennio im Gespräch mit der Kommissarin, beide so vertieft, dass sie meine Ankunft nicht bemerkten. Ich blickte mich um, von einer jungen, aggressiven Frau war nirgendwo etwas zu sehen. Das leicht abschüssige Ufer des Po hatte auf dieser Seite, gegenüber vom Parco del Valentino, etwas Ländliches, obwohl man doch mitten in der Stadt war. Hinter dicht stehenden Erlen, Birken und Kastanien versteckte sich die Uferstraße, und längs des Flusses öffneten sich immer wieder kleine Wiesen, die um diese Zeit noch verwaist waren, sich aber bald füllen würden. Ein Stück tiefer schlängelte sich ein schmaler Feldweg am Po entlang.
Die Sonne war nun höher gewandert, es wurde langsam heiß, und von dem fast stehenden Fluss stieg wieder der modrige Geruch auf, am Ufer lag ein toter Fisch, Mücken umschwirrten mich, und hinter den Flatterbändern hatten sich inzwischen ein paar Schaulustige eingefunden. Tatortstimmung, dachte ich. Jetzt hatte Ennio mich bemerkt und kam mit schnellen Schritten auf mich zu. Wie jedes Mal, wenn ich meinen Freund in Uniform sah, verspürte ich ein leises Kribbeln, auch wenn das zugegeben ein bisschen lächerlich, um nicht zu sagen peinlich war. Eigentlich war mir alles Militärische eher fremd, aber Ennio sah in seiner Uniform einfach supergut aus, obwohl er kein Beau war, zwar ein sportlicher Typ, sehr groß und von wuchtiger Präsenz. Sein wilder brauner Haarschopf setzte einen Kontrapunkt, ohne den er mir – ob mit oder ohne Uniform – weniger gefallen hätte. In stillem Einverständnis begrüßten wir uns, ohne uns zu berühren. Aus den Augenwinkeln warf ich einen prüfenden Blick zu der Kommissarin, vergewisserte mich, ob sie uns beobachtete, aber sie war schon wieder im Gespräch, diesmal mit der Frau von der Spurensicherung.
»Was ist denn nun eigentlich passiert?«, fiel ich mit der Tür ins Haus. »Ist das dort hinten der Tote? Und wo ist die junge Frau?«
»Piano, piano, Camilla«, sagte Ennio und strich mir jetzt doch sanft über die Schulter. »Eins nach dem anderen. Wir wissen noch nicht viel. Der junge Mann ist erschlagen worden, vor etwa zehn Stunden, also ungefähr um die Zeit, als es gerade dunkel geworden war, und zwar mit einem Stein. Er muss sich aber gewehrt haben. Den Stein, mit dem er vermutlich getötet wurde, haben wir am Ufer gefunden, aber er hat dort fast vollständig im Wasser gelegen, und die Spuren an ihm dürften alle verwischt sein, nur ein klein wenig Blut ist an einer Stelle zu erkennen.«
»Und wer ist der Tote?«
»Das wissen wir nicht. Er hat keine Papiere bei sich und auch kein Handy. Was ein bisschen seltsam ist. Vielleicht hat das jemand an sich genommen. Ich schätze, er ist um die zwanzig. Und vermutlich gehört die junge Frau zu ihm, aber aus ihr ist im Moment nichts herauszubekommen. Deshalb bist du ja jetzt da … Die Kommissarin vermutet übrigens, dass sie die Täterin ist.«
»Und wo ist sie?«
»Oben im Streifenwagen mit einem Kollegen. Ich bringe dich gleich zu ihr. Aber du solltest vorher vielleicht noch ein paar Worte mit der Kommissarin wechseln.« Grinsend fügte er hinzu: »Das könnte eurer Freundschaft dienlich sein …«
»Das wohl kaum«, erwiderte ich. »Aber vielleicht der Wahrheitsfindung …«
Ich machte die paar Schritte hinunter zum Ufer, und Ispettore Ruggieri ließ mich, anders als erwartet, nicht warten, sondern unterbrach sofort ihr Gespräch, um sich mir zuzuwenden. Es war ein paar Jahre her, dass wir uns zuletzt begegnet waren, bei einem Fall, in den ich damals ebenfalls involviert war. Mein Nachbar war ermordet worden, womit ich für sie sofort tatverdächtig war. Seither hatte sie sich nicht sehr verändert, ihre Brille war neu und extravagant wie eh und je, das sehr kurze schwarze Haar hatte jetzt einen rötlichen Schimmer, und ihre Lederjacke, die ihre ohnehin coole Ausstrahlung noch betonte, war die alte.
»Buongiorno, Dottoressa di Salvo«, empfing sie mich weniger ruppig, als ich sie in Erinnerung hatte. »Danke, dass Sie gleich hergekommen sind. Es ist wohl eher eine Formsache. Die Staatsanwältin meinte, es sei besser, wenn sich eine Psychologin die junge Frau ansieht, bevor wir sie zur Vernehmung mitnehmen. Sie ist zugegeben ziemlich fertig. Ich vermute, sie hat den Jungen im Streit umgebracht. Und dass dabei Drogen im Spiel waren.«
»Wissen Sie denn, wer sie ist?«
»Nein, keine Ahnung. Wie der tote junge Mann hat auch sie keine Papiere dabei, allerdings haben wir ihr Handy gefunden, jedenfalls haben wir es mit ihrem Fingerabdruck aktivieren können, also muss es ihres sein …«
»Dürfen Sie das?«
»Sie ist wie gesagt tatverdächtig.«
»Und es gibt niemand, der etwas beobachtet hat?«
»Nein, bisher jedenfalls nicht.«
»Okay, dann mache ich mal meinen Job.« Ich hatte es nun eilig, meine Aufgabe anzugehen, war gespannt, was mich erwartete. Was war das für eine Frau, die in dem Polizeiauto saß? Und was hatte sie mit dem erschlagenen jungen Mann zu tun? Hatte sie ihn wirklich umgebracht?
Der Streifenwagen war ein großer dunkelblauer Jeep, und die junge Frau, die auf der Rückbank saß, reagierte nicht auf meine Ankunft, vielmehr schien sie zu schlafen. Ihre langen Haare verdeckten das Gesicht, und der helle Jumpsuit, den sie trug, war über und über mit Blut und Dreck bespritzt. Ich schätzte sie auf höchstens Mitte zwanzig, sie war schlank und mit ihrem tiefschwarzen gelockten Haar und ihrem bronzefarbenen Teint unübersehbar attraktiv. Als ich mich zu ihr in den Fond des Wagens setzte, fuhr sie auf, das Haar fiel ihr in den Nacken und gab ihre dunklen Augen frei. Ich erschrak. Sie sah einer früheren Kommilitonin von mir ähnlich, Teresa, mit der ich mich vor vielen Jahren im Studium angefreundet hatte. Eine sehr intensive Freundschaft, die aber schrecklich endete. Teresa war drogenabhängig, außerdem depressiv, aber es war ihr eine Weile gelungen, das vor mir zu verbergen, und als ich plötzlich begriff, was mit ihr los war, war es zu spät, sie hatte sich mit einer Überdosis umgebracht.
Aber auf den zweiten Blick sah die Frau im Polizeiwagen meiner Teresa doch nicht so ähnlich. Es waren nur ihre sehr dunklen braunen und etwas schräg gestellten Augen, die bei mir die Erinnerung an sie wachgerufen hatten. Sonst war sie ein ganz anderer, sehr mediterraner Typ. Noch immer zeigte sie keine Regung, sah mich unverwandt an, lehnte sich dann wortlos zurück ins Polster und schloss erneut die Augen. Ich machte Ennio ein Zeichen, dass er ihr die Handschellen abnehmen solle.
»Bist du sicher?«, fragte er.
Ich nickte. »Was soll denn schon passieren? Sie hat ja wohl keine Waffe?«
»Nein, natürlich nicht, wir haben sie ja gecheckt. Die Tür bleibt aber auf, und ich und der Kollege sind in Sichtweite und haben ein Auge auf euch.«
Eine Weile saßen die junge Frau und ich schweigend Seite an Seite auf der Rückbank, sie unbewegt, geradezu erstarrt neben mir. Sie schien wieder zu schlafen, aber ich spürte, dass sie doch wach war, in einer Art Dämmerzustand. Ob ich trotzdem irgendwie an sie herankommen würde? Ich wollte es wenigstens versuchen.
»Ich bin Camilla«, sagte ich, »würden Sie mir sagen, wie Sie heißen?«
»Hau ab und lass mich in Ruhe.« Sie klang dunkel und aggressiv und schnellte bei diesen Worten so heftig nach vorn, dass sie beinahe mit dem Kopf gegen die Rücklehne des Vordersitzes geknallt wäre. Einen Moment hatte es sogar so ausgesehen, als wollte sie nach mir schlagen, Ennio war schon sprungbereit, entspannte sich aber, als die junge Frau sich wieder zurück in den Sitz fallen ließ.
Wir schwiegen erneut. Sie zitterte leicht am ganzen Körper, schwitzte, und ihre Augen waren tief verschattet. Ennio hatte recht, sie sah wirklich sehr mitgenommen aus. Ich war mir sicher, dass sie noch unter Drogen stand, außerdem traumatisiert war. Was für Drogen hatte sie wohl genommen?
»Wer sind Sie? Und was ist passiert?«, versuchte ich es noch einmal, ohne Erfolg. »Haben Sie Durst?«, fragte ich schließlich und griff zu der Wasserflasche, die ich mir von Ennios Kollegen hatte mitgeben lassen.
Sie riss sie mir fast aus der Hand und leerte den halben Inhalt in einem Zug. Schwieg dann wieder, hatte aber immerhin ihre Augen geöffnet, diese dunklen Augen, die mir so vertraut vorkamen. Erneut stieg in mir die Erinnerung an Teresa auf, und mit ihr auch die alten Schuldgefühle. Aber ich zwang mich, mich auf die verstörte Frau neben mir zu konzentrieren. Konnte es sein, dass sie eine Mörderin war? Der Augenschein sprach dafür, aber vom ersten Moment unserer Begegnung an glaubte ich nicht daran. Eher, dass sie selbst ein Opfer war.
»Ich bin keine Polizistin«, versuchte ich es erneut. »Ich bin Psychologin und kann Ihnen vielleicht helfen. Dafür müssen Sie aber mit mir sprechen. Sonst landen Sie in den Fängen der Polizei. Die glauben nämlich, dass Sie jemanden umgebracht haben.«
Ich sah sie an, wusste nicht, ob sie begriff, was ich gesagt hatte. Wohl eher nicht. Immerhin trank sie gierig fast das ganze Wasser aus und zitterte nicht mehr so heftig.
»Haben Sie was gegen Schmerzen?«, brach es dann aus ihr heraus, aber so verwaschen, dass ich sie kaum verstand.
»Was tut Ihnen denn weh?«
»Mein Kopf.« Sie fasste sich an den Hinterkopf, und jetzt sah ich, dass ihre Hand voller Blut war.
»Sind Sie geschlagen worden?«, fragte ich.
»Lass mich in Ruhe.«
Ich nahm eine Tablette aus der Packung, ein harmloses Schmerzmittel, das ich für alle Fälle immer in meiner Handtasche dabei hatte. Sie riss sie mir sofort aus der Hand und spülte sie mit dem letzten Schluck Wasser herunter. Ich machte einen letzten Versuch, um eine Reaktion bei ihr zu provozieren, indem ich die halb offene Wagentür ein Stück weiter aufstieß, als ob ich das Auto verlassen wollte. Es funktionierte. Sie packte mich so heftig am Arm, dass es fast wehtat. »Ich will nach Hause«, sagte sie.
»Das verstehe ich. Aber Sie müssen erst mit mir sprechen. Wer sind Sie? Wissen Sie, was heute Nacht passiert ist?«
»Lass mich schlafen.« Sie drehte sich weg und zitterte wieder heftiger.
»Dann sagen Sie mir doch bitte wenigstens, wie Sie heißen.«
Keine Reaktion. Es hatte keinen Zweck, ich gab auf. Sie wirkte erneut abwesend, war nicht bei sich, und es würde dauern, bis sie wieder einigermaßen zu sich käme. Jedenfalls gab es keinen Zweifel, dass sie in ein Krankenhaus gebracht und untersucht werden musste.
»Beruhigen Sie sich«, sagte ich, ohne zu wissen, ob sie mich noch hörte. »Es passiert Ihnen nichts. Ich bringe Sie gleich in ein Krankenhaus. Warten Sie einen Moment. Ich bin sofort wieder bei Ihnen.«
Auch darauf reagierte sie nicht, und ich ließ sie ziemlich besorgt im Polizeiwagen zurück.
Kaum hatte ich das Auto verlassen, stand Ispettore Ruggieri herausfordernd vor mir: »Und? Haben Sie etwas aus ihr herausbekommen?«
»Nein, sie ist nicht vernehmungsfähig. Sie muss ins Krankenhaus.«
»Das ist nicht Ihr Ernst, Dottoressa. Sie hat den Jungen wahrscheinlich umgebracht. Die simuliert doch nur … Wir nehmen sie in jedem Fall mit.«
Ich schüttelte den Kopf und griff zu meinem Handy. »Dann rufe ich jetzt die Staatsanwältin an.« Damit bluffte ich, denn ich hatte deren Nummer gar nicht gespeichert. Aber es funktionierte.
»Also, in Gottes Namen.« Ispettore Ruggieri drehte sich brüsk von mir weg. »Dann tun Sie eben, was Sie für richtig halten. Wo sollen wir sie denn hinbringen?«
»In die Notaufnahme der Città della Salute, ins Ospedale Molinette.«
»Okay. Der Carabiniere begleitet Sie und unternimmt dort alles Nötige.« Sie gab dem Polizisten, der etwas abseits mit Ennio die Szene beobachtet und mitgehört hatte, ein Zeichen, forderte ihn auf, der »Tatverdächtigen«, wie sie es ausdrückte, wieder die Handschellen anzulegen, und schärfte ihm ein, im Krankenhaus ihre Kleidung sicherzustellen und ein Drogenscreening bei ihr zu veranlassen.
Er nickte, stieg mit mir gemeinsam ins Auto, er ans Steuer, ich wieder auf die Rückbank an die Seite der jungen Frau, und wir fuhren los.
3
»Wisst ihr denn jetzt, wer die beiden vom Ufer sind?«
»Ja«, sagte Ennio und angelte sich mit der Gabel eine Scheibe von dem vitello tonnato, das wir als Vorspeise bestellt hatten, nahm sich dazu etwas Thunfischcreme und spülte alles mit einem kräftigen Schluck kalten Weißweins herunter. Wir waren um die Ecke unserer Wohnung in eines unserer Lieblingsrestaurants im Quadrilatero, der Turiner Altstadt, zum Abendessen eingekehrt.
Bis vor einem Jahr hatten Ennio und ich noch getrennt gewohnt, obwohl wir schon seit geraumer Zeit ein Paar waren, er im Süden Turins, ich in einer Wohnung auf der anderen Flussseite mit Blick auf den Po. Jetzt lebten wir zusammen in einer Altbauwohnung mit hohen Decken, großen Fenstern und einem Balkon, von dem aus man auf einen kleinen baumbestandenen Platz mit einem Brunnen in der Mitte schaute. Es war schön, nur der Fluss fehlte mir so sehr, dass es doch immer ein bisschen weh tat, wenn ich an meine alte Bleibe zurückdachte. Dafür waren meine Praxis und auch der riesige Lebensmittelmarkt an der Porta Palazzo ganz nah. Außerdem ging es im Quadrilatero lebendiger zu als in meiner alten – Franca würde sagen, sehr bourgeoisen – Heimat, für meinen Geschmack allerdings fast ein wenig zu lebendig. Seit der früher ziemlich heruntergekommene historische Stadtkern Turins trendig und schick geworden war, ballten sich in seinen Gassen Trattorien, Pizzerien und Bars, meist mit Tischen draußen, die an schönen Sommerabenden überfüllt waren. Noch immer hatte ich mich nicht ganz daran gewöhnt, dass Turin in den letzten Jahren zu einer Touristenattraktion geworden war. Meine geliebte Stadt, die man lange Zeit nur mit Fiat und allenfalls noch mit Fußball identifiziert hatte und die an abgehängter Position auf der Attraktivitätsskala rangierte, deutlich hinter Mailand, Florenz, Neapel und Rom, war auf einmal angesagt mit ihrem barocken, wie mit dem Lineal gezogenen historischen Zentrum, der an Paris erinnernden Atmosphäre, ihren harmonischen Plätzen, den eleganten Cafés und unprätentiösen, aber guten Restaurants wie das, in dem wir gerade zu Abend aßen. Dass wir einen Platz auf der Terrasse ergattert hatten, verdankten wir ausschließlich der Tatsache, dass wir oft dort einkehrten und den Wirt inzwischen gut kannten. Es war schon relativ spät am Abend, aber noch stand die heiße Luft bleiern zwischen den Häusern, und nur ab und zu kam ein leichter Luftzug auf und verschaffte uns ein wenig Kühlung.
»Bei der jungen Frau, die du ins Krankenhaus gebracht hast, sind wir noch nicht hundertprozentig sicher, aber was den erschlagenen jungen Mann angeht, ist die Sache klar«, stellte Ennio fest und angelte sich eine weitere Scheibe von dem zarten Kalbfleisch. »Es gab nämlich eine Vermisstenmeldung, die auf ihn passt. Die hat seine Mutter aufgegeben, weil er in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist und sie ihn auch auf dem Handy nicht erreichen konnte, was wohl ungewöhnlich war. Und sie hat ihn schon heute Nachmittag identifiziert.«
»Und?«
»Er heißt Domenico Falcone, ist vor zwei Wochen zwanzig geworden, Informatikstudent.«
»Und über die junge Frau wisst ihr noch nichts Genaues?«
»Da sind wir auch dran, wahrscheinlich ganz kurz davor. Die Mutter des toten Jungen glaubt nämlich, sie zu kennen, jedenfalls nach der Beschreibung, die wir ihr gegeben haben. Und da sie ziemlich markant aussieht, wird sie das wohl sein …«
Ennio griff wieder zu seinem Weinglas, und gerade fragte ich mich, ob er mir wohl etwas von dem köstlichen Erbaluce übrig lassen würde, als er mir schon großzügig nachschenkte.
»Und, wen glaubt die Mutter wiederzuerkennen?«
»Eine gewisse Samira Benchekroun. Sie lebt auch in Turin, übrigens nicht besonders weit weg von hier, in einer Wohnung zusammen mit einer anderen jungen Frau. Wahrscheinlich ist die Kommissarin gerade dahin unterwegs, um zu überprüfen, ob sie wirklich die Frau vom Po-Ufer ist, und um ihrer Mitbewohnerin gegebenenfalls ein paar Fragen zu stellen. Das war jedenfalls ihr Plan.«
»Um diese Zeit?«
»Ja, um diese Zeit. Da kennt sie nichts. Vielleicht kommt sie auf dem Weg ja noch zufällig bei uns vorbei«, Ennio grinste mich süffisant an, »und wir stoßen mit ihr an und plaudern ein bisschen …«
Ich ließ mich nicht provozieren und überging seine Bemerkung. »Was sagt denn die Mutter des Jungen über diese Samira?«, wollte ich stattdessen wissen und schnappte mir die letzten beiden Scheiben vitello.
»Oje, da stichst du in ein Wespennest. Die beiden, also Samira und Domenico, waren anscheinend kein Paar, aber sehr gut befreundet. Und wenn es nach der Mutter geht, haben wir mit ihr die Mörderin ihres Sohnes schon gefunden. Das behauptet sie mit einer Stimme, die ganz sicher gehört werden wird. Und zwar nicht nur, weil sie wirklich ziemlich laut spricht, sondern auch, weil sie eine große Nummer in Turin ist. Falcone. Sagt dir das nichts?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Beste Turiner Familie, Bauunternehmer, viel Immobilienbesitz, viel Einfluss, viel Geld. Ihr Mann war deutlich älter als sie und ist vor einigen Jahren gestorben. Sie führt jetzt das Familienunternehmen und hat allein mit dem Jungen in einer Villa in den Hügeln gelebt. Für die ist es schon ausgemacht, wer die Täterin ist. Silvia ist zwar etwas vorsichtiger, sieht das aber ähnlich.«
Ich sah Ennio fragend an: »Silvia?«
»Ispettore Ruggieri.«
»Seit wann duzt du die?«
»Schon lange, immerhin sind wir Kollegen und seit einiger Zeit im selben Team, also übertreib bitte mal nicht, Camilla. Im Übrigen, und auch wenn dir das nicht gefällt, ist sie ziemlich kompetent …«
Ennio hatte recht, brachte ich mich selbst zur Vernunft, zähmte meine Aversion gegen die Kommissarin, so gut es ging, und kam auf unser eigentliches Thema zurück. »Also, warum glaubt die Mutter, dass diese Samira ihren Sohn umgebracht hat? Hatten die beiden irgendetwas miteinander zu tun, was diesen Verdacht nahelegt?«
»Sagt dir TAV etwas?«
»Ja klar, treno ad alta velocità, der Hochgeschwindigkeitszug, der in ein paar Jahren von Turin durch die Alpen nach Lyon rasen soll und, soweit ich weiß, schon seit einiger Zeit im Bau ist. Da geht es doch schon seit Jahren heftig zur Sache …«
»Genau. Und Domenico und Samira gehören zu den Leuten, denen das Projekt vor allem aus Umweltschutzgründen nicht gefällt. Sie sind beide in einer sogenannten noTAV-Gruppe. Das sind ein paar junge Leute aus Turin, die sich zusammengeschlossen haben, um mit allen möglichen Aktionen gegen den Bau der Bahnstrecke zu protestieren. Zum Teil, wie du schon sagst, auch ziemlich militant.«
»Ja, und? Deshalb wird man doch nicht zur Mörderin? Und schon gar nicht an einem Freund und Mitstreiter.«
»Signora Falcone meint, dass Samira Benchekroun ihren Sohn verführt hat, in diese Szene einzutauchen. Der Junge ist hochintelligent, ist Autist, hat das Asperger-Syndrom. Was das bedeutet, muss ich dir ja nicht erläutern. Er war deshalb eigentlich sozial eher isoliert, aber in der Gruppe wohl wegen seiner digitalen Kompetenzen respektiert. Wie gesagt, er hat Informatik studiert, und Samira hat er verehrt, und vermutlich war er verliebt in sie. Und das, meint die Mutter, habe Samira ausgenutzt und ihren Sohn unter ihre Kontrolle gebracht, für ihre Zwecke eingespannt, ihn emotional und ideologisch missbraucht.«
»Aber warum soll sie ihn dann umgebracht haben? Wenn das stimmen sollte, war er ihr doch nützlich …«
»Signora Falcone meint, die beiden hätten sich gestritten, aber vor allem traut sie ihr das eben einfach zu, hält sie für eine berechnende, skrupellose und drogenabhängige Person, die ihren Sohn manipuliert hat. Und das Ganze hat noch die pikante Note, dass die Mama mit ihrer Baufirma auch am Bau des TAV beteiligt ist.«
»Domenico hat sich also sozusagen gegen die Interessen der eigenen Mutter gestellt?«
»Das kann man so sagen, ja. Und sie ist natürlich überzeugt, dass er das nur Samira zuliebe getan hat.«
»Dann ist es doch kein Wunder, dass sie denkt, die junge Frau habe ihren Sohn gegen sie aufgehetzt …«
An dieser Stelle wurde unser Gespräch durch den gestressten Kellner unterbrochen, der mit dem nächsten Gang an unseren Tisch kam, zwei tiefen mit agnolotti del plin gefüllten Tellern, der piemontesischen Spezialität des Hauses, die er mit Schwung vor uns auf den Tisch stellte. »Buon appetito!«, wünschte er und war im selben Moment, sich geschickt durch die eng stehenden Tische schlängelnd, wieder Richtung Küche verschwunden. Was für ein Job und das bei der Hitze!, dachte ich, um mich aber gleich über die kleinen mit gebratenem Fleisch und Gemüse gefüllten und nach Rosmarin duftenden agnolotti herzumachen. Seit der morgendlichen Brioche im Ruderclub hatte ich den ganzen Tag nichts mehr gegessen, weil mir die Begegnung mit der des Mordes verdächtigen jungen Frau nachgegangen und auf den Magen geschlagen war. Aber jetzt hatte ich einen Bärenhunger. Auch Ennio widmete sich schweigend seiner Pasta, und erst nach ein paar Bissen nahmen wir unser Gespräch wieder auf.
»Und wisst ihr denn mehr über diese Samira?«, fragte ich. »Benchekroun heißt sie mit Nachnamen, hast du gesagt, ja? Das hört sich marokkanisch an, und ein bisschen sieht sie auch aus, als hätte sie dort Wurzeln.«
»Ja, das ist wahrscheinlich so«, antwortete Ennio. »Sie hat übrigens einen ziemlich unkonventionellen Job. Sie kümmert sich nämlich um Wölfe, arbeitet als Tierpflegerin in dem Wildgehege von La Mandria.«
»In einem Wildgehege? Mit Wölfen?« Davon hatte ich noch nie gehört, was mich irritierte, da ich eigentlich davon überzeugt war, Turin, die Stadt, in der ich geboren wurde und in der ich praktisch mein ganzes Leben verbracht hatte, sehr gut zu kennen. Auch in La Mandria, der am Stadtrand bei der Savoyer-Residenz Venaria Reale gelegenen größten geschützten Parkanlage Europas, war ich schon oft gewesen und dort wild lebenden Hirschen, Füchsen, Wildschweinen und Pferden begegnet, aber niemals einem Wolf.
»Aber der Parco Naturale La Mandria sagt dir schon etwas?«, setzte Ennio nach.
»Na, hör mal! Immerhin bin ich eine waschechte Turinerin! Ich wusste nur nicht, dass es da ein Wolfsgehege gibt.«
»Das wusste ich ehrlich gesagt bis heute auch nicht.«
»Jedenfalls ist deine Freundin Silvia also nach wie vor überzeugt, dass sie die Täterin ist?«
»Jetzt mach mal halblang, Camilla. Sie ist nicht meine Freundin, sondern eine Kollegin. Und überzeugt davon ist sie sicher nicht, aber sie hält sie für tatverdächtig, ja. Das liegt auch nah, das musst du doch zugeben. Wie ist es denn eigentlich im Krankenhaus gelaufen? Was ist dein Eindruck von ihr?«
»Sie ist jetzt in der psychiatrischen Abteilung, und ich habe kurz mit einer Ärztin sprechen können. Die war wie ich der Meinung, dass sie traumatisiert ist und erst mal von den Drogen herunterkommen muss, die sie an dem Abend eingenommen hat. Außerdem hat sie vermutlich in der Nacht am Ufer einen Schlag auf den Kopf bekommen und war längere Zeit bewusstlos. Es könnte sein, dass sie eine leichte Gehirnerschütterung hat, schwerwiegende Verletzungen allerdings nicht, aber ein paar blaue Flecken. Ich bin mal gespannt«, sagte ich und lächelte Ennio herausfordernd an, »wie deine geschätzte Kollegin das mit der Tatsache in Einklang bringt, dass sie eine Mörderin sein soll …«
»Sie geht eben davon aus, dass die beiden sich gestritten haben. Das könnte eskaliert sein, und der übrigens erstaunlich kräftige Junge hat sie attackiert, sie hat sich gewehrt und schließlich zu dem Stein gegriffen …«
Ennio war nicht kleinzukriegen, und ganz unrecht hatte er nicht. Allerdings war ich mir so gut wie sicher, dass Samira Benchekroun keine Mörderin war, auch wenn ich nicht sagen konnte, woher ich diese Überzeugung nahm. Und obwohl mir natürlich klar war, zu welchen Taten jemand, dem man das vielleicht gar nicht zutraute, unter Drogeneinfluss in der Lage war. Aber es störte mich, dass Ennio nur der polizeilichen Logik folgte und nicht meiner Intuition.
Um ihm etwas entgegenzusetzen, schlüpfte ich zurück in meine Rolle als Therapeutin. »Jedenfalls wird sie im Krankenhaus jetzt engmaschig überwacht. Sie war ja wie gesagt bewusstlos, und wir wissen nicht, was für Drogen sie eingenommen hat. Deshalb muss sie genau beobachtet werden, Bewusstseinszustand, Blutdruck, Puls, Atmung und so weiter, das ganze Programm. Ich gehe dann morgen noch mal zu ihr, schaue, wie es ihr geht, und spreche mit der Ärztin.«