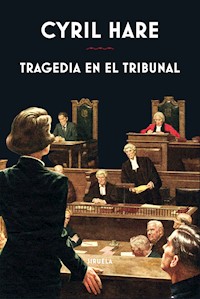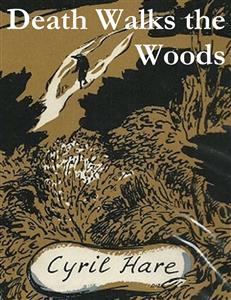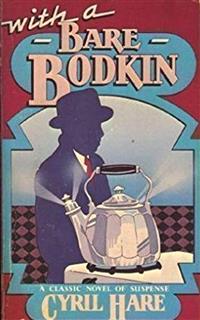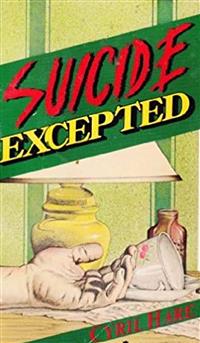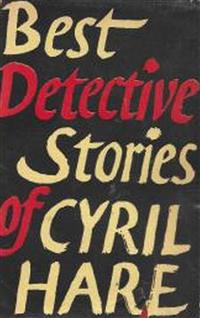7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Am Rande Londons liegt das ruhige Wohnviertel Daylesford Gardens. Hier kennt man sich, schätzt Ruhe und Privatsphäre. Das ändert sich, als zwei junge Makler eine grausige Entdeckung machen: Im Wohnzimmer eines kleinen Mietshauses liegt eine Leiche! Der Tote ist niemand Geringerer als der berüchtigte Börsenspekulant Lionel Ballantine, der nicht wenige Londoner um ihre Ersparnisse brachte. Was mag ihn nach Daylesford Gardens geführt haben? Und wer verbirgt sich hinter dem sonderbaren Mieter der Immobilie? Der Fall ist verzwickt - gerade richtig für den genialen Ermittler Inspector Mallett.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmung1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. KapitelÜber dieses Buch
Am Rande Londons liegt das ruhige Wohnviertel Daylesford Gardens. Hier kennt man sich, schätzt Ruhe und Privatsphäre. Das ändert sich, als zwei junge Makler eine grausige Entdeckung machen: Im Wohnzim mer eines kleinen Mietshauses liegt eine Leiche! Der Tote ist niemand Geringerer als der berüchtigte Börsenspekulant Lionel Ballantine, der nicht wenige Londoner um ihre Ersparnisse brachte. Was mag ihn nach Daylesford Gardens geführt haben? Und wer verbirgt sich hinter dem sonderbaren Mieter der Immobilie? Der Fall ist verzwickt – gerade rich tig für den genialen Ermittler Inspector Mallet.
Über den Autor
Cyril Hare wurde im Jahr 1900 in Mickleham, Grafschaft Surrey, als Alfred Alexander Gordon Clark geboren. Er studierte Jura am New College zu Oxford und wurde 1924 Anwalt. Daneben pflegte Clark seine schriftstellerischen Ambitionen und verfasste unter dem Pseudonym Cyril Hare neun Kriminalromane. Wie Agatha Christie und Dorothy L. Sayers zählt er zu den Vertretern des »Goldenen Zeitalters« des Detektivromans. Er starb 1958 mit nur 58 Jahren.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:
Copyright © by Sophia Jane Holroyd
Titel der englischen Originalausgabe: »Tenant for Death«
Erstmals erschienen 1937
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Angela Küpper, München
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
Umschlagmotiv: © shutterstock: Quarta | Nata_Alhontess | Alex Gontar
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6143-7
luebbe.de
lesejury.de
Für M.B.G.C.
1. Kapitel
Jackie Roach
Freitag, 13. November
Daylesford Gardens, South Western, gehört zu den Londoner Adressen, bei denen selbst der routinierteste Taxifahrer einen Moment zögert, wenn man sie ihm nennt. Nicht, dass er irgendwelche Schwierigkeiten hätte, die ungefähre Lage zu bestimmen, denn es handelt sich um das ruhige und respektable Viertel, wo South Kensington an Chelsea grenzt. Das Problem rührt eher von der Fantasielosigkeit seitens des Baukonsortiums her, das ursprünglich den Daylesford-Grundbesitz irgendwann Mitte des vergangenen Jahrhunderts entwarf. Denn abgesehen von Daylesford Gardens gibt es noch Daylesford Terrace, Daylesford Square und die Upper und Lower Daylesford Street, ganz zu schweigen von einem hohen, unverputzten Wohnblock aus rotem Backstein, bekannt als Daylesford Court Mansions, und zwei oder drei neuen, fast eleganten kleinen Häusern, die bis heute den Namen Daylesford Mews beibehalten haben. Die Häuser in Daylesford Gardens wiederum sind weder unverputzt noch hoch oder aus Backstein, sie sind auch nicht neu und nicht im Entferntesten elegant. Im Gegenteil, sie sind gedrungen, gelb und in die Jahre gekommen und weisen auf ihren eintönigen, drei Stockwerke hohen Fassaden den gleichen schäbigen Stuckmörtel auf, gelbbraun, aber – bemüht –respektabel. Das eine oder andere dieser Häuser ist zu einer Pension herabgesunken, einige stehen im Verdacht, womöglich Untermieter zu beherbergen, doch größtenteils gelingt es ihnen immer noch, den ungleichen Kampf gegen widrige Umstände fortzuführen und das Banner der Vornehmheit hochzuhalten.
Häusermakler bezeichnen dieses Viertel von jeher als »zurückgezogen«, und die Beschreibung ist in mehr als einer Hinsicht zutreffend. Sie trifft sicherlich auf fast alle Bewohner von Daylesford Gardens zu. Die Häuser sind vor allem Rückzugsort für die nicht allzu wohlhabenden Leute mittleren Alters. Pensionierte Colonels und Richter des Amtsgerichts, ehemalige Verwaltungsbeamte und Seeoffiziere mit Halbsold, darunter ein oder zwei dünne, bleichgesichtige Männer, die zu ihrer Zeit womöglich Gebiete halb so groß wie England verwalteten, sich jetzt aber das Imperium des matschigen Rasens und der verschmutzten Lorbeerschneeballbüsche teilen, welche die »Gardens« ausmachen. Auch ihre Häuser, dezent und bescheiden, scheinen sich von einer wie auch immer gearteten geschäftigen Existenz, die sie einst hatten, zurückgezogen zu haben und mit würdevoller Resignation dem Schicksal entgegenzusehen, das Londoner Häusern bevorsteht, sobald die Erbpacht erlischt.
Am nördlichen Ende von Daylesford Gardens, wo die Upper Daylesford Street, erfüllt vom Lärm der Omnibusse und Lieferwagen, die Grenze zu den ehemaligen Daylesford-Liegenschaften markiert, hatte der Zeitungsverkäufer Jackie Roach seinen Stand. Dort war er jeden Abend anzutreffen, und seine komische Triefnase wackelte unsicher oberhalb seines struppigen roten Schnauzbarts im Takt mit, wenn er mit heiserer Stimme rief: »News – Star – Standard!« Die meisten Hausbesitzer von Daylesford Gardens kannten ihn vom Sehen. Wie viel er über sie wusste, über ihre Lebensumstände, Gewohnheiten und Hausangestellten, ahnten vermutlich die wenigsten von ihnen. Sie gehörten, wie er es formulierte, zu seinen »Stammkunden«, und für ihn war es beinahe Ehrensache, mit den Gepflogenheiten dieser Leute vertraut zu sein. Er kannte – und mochte – den alten Colonel Petherington aus der Nr. 15, mit seinem verschlissenen grauen Anzug und der straffen Körperhaltung, der jeden Nachmittag pünktlich in seinen Club ging und jeden Abend genauso pünktlich zum Essen zurückkehrte. Er kannte die aufgetakelte Mrs. Brent aus der Nr. 34 – die er nicht mochte – und hätte ihrem Ehegatten etwas über den Mann erzählen können, der sie aufsuchte, wenn er nicht zu Hause war, sofern es ihm je in den Sinn gekommen wäre, in dieser Richtung nachzuforschen. Er kannte auch die stille, schüchterne Miss Penrose aus der Nr. 27, deren Dienstmädchen Rosa jeden Abend genau um sechs Uhr kam, um den Standard zu kaufen; auf sie war stets Verlass, wenn es darum ging, den neuesten Klatsch und Tratsch zu erfahren.
An diesem kühlen, windigen Abend hätte sich Roach über ein Schwätzchen mit jedem gefreut, der stehen geblieben wäre, um sich ein wenig die Zeit zu vertreiben – irgendetwas, das ihn von dem Rheuma abgelenkt hätte, das ihn zu dieser Jahreszeit immer ganz besonders plagte. Aber niemandem war im Augenblick danach, innezuhalten. Die Leute blieben gerade so lange, um Jackie eine Münze in die Hand zu drücken und sich eine Zeitung zu schnappen, als wäre ein Kerl ein Automat, um alles in der Welt! Rosa war anders. Ganz egal, wie das Wetter war, sie blieb immer kurz auf einen Schwatz an der Ecke stehen, und das konnte sie sich durchaus leisten, mit einer warmen Küche zu Hause, in die sie zurückkehren konnte.
Aber an diesem Abend würde keine Rosa kommen. Seit einem Monat war Miss Penrose nämlich verreist. Sie hielt sich im Ausland auf, und Rosa war zu ihrer Familie aufs Land gefahren. Das Haus war möbliert an einen Mr. Colin James vermietet worden. Roach kannte ihn vom Namen her, von einer flüchtigen Bekanntschaft mit Crabtree, dem Hausdiener, der Rosas Platz in Nr. 27 eingenommen hatte, gesprochen hatte er aber noch nie mit ihm und ihm auch nie eine Zeitung verkauft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bewohnern von Daylesford Gardens war Mr. James immer noch berufstätig. Zumindest nahm er fast jeden Morgen an der Ecke einen Bus in östlicher Richtung und kehrte am Abend zurück, daher war davon auszugehen, dass er geschäftlich zu tun hatte. Roach war er deswegen nicht sympathischer. Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass ein solches Verhalten auf Daylesford Gardens abfärbte.
Gegen halb sieben, als das Gedränge in der Upper Daylesford Street seinen Höhepunkt erreichte und der lang erwartete Regen herunterzuprasseln begann, erhaschte Roach, der gerade mit tauben Fingern nach elf Pence Wechselgeld kramte, einen Blick auf Mr. James auf der anderen Straßenseite. Es war unverkennbar Mr. James, wie Roach später gegenüber gewissen, daran interessierten Leuten erklärte. Zunächst war er der einzige Bewohner von Daylesford Gardens, der einen Bart hatte. Es war keineswegs ein bescheidener Haarflaum, sondern eine buschige Masse braunen Haars, die sein Gesicht vom Mund abwärts bedeckte. Dann seine äußere Erscheinung: Er war auffallend dick, wobei seine Beleibtheit in keinem Verhältnis zu seinen dünnen Beinen stand, sodass er stets mit einem vorsichtigen Watscheln ging, als befürchtete er, sein Gewicht könne ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Ohne großes Interesse nahm Roach wahr, wie die ihm vertraute, unbeholfene Gestalt vorüberging. Dann veranlasste ihn etwas, noch einmal hinzusehen, und so blickte er ihm mit neuerlicher Aufmerksamkeit hinterher. Bei diesem Etwas handelte es sich um den einfachen Umstand, dass Mr. James bei dieser Gelegenheit von einer anderen Person begleitet wurde.
»Der Alte – der für sich lebt«, lautete Roachs eigene Beschreibung für Mr. James. Die meisten Bewohner von Daylesford Gardens gehörten tatsächlich zu denjenigen, die lieber für sich blieben. Dafür achtete Roach sie umso mehr. Aber von allen war Mr. James derjenige, der vollkommen allein lebte. Während seines kurzen Aufenthalts in Nr. 27 war noch nie ein Besucher über die Türschwelle getreten, nicht einmal ein Brief oder Paket war je dort abgegeben worden, wie Crabtree zu versichern wusste. Und bislang hatte Roach Mr. Colin James immer nur allein auf der Straße gesehen.
Aber diesmal – daran bestand kein Zweifel – hatte Mr. James einen Freund gefunden. Oder falls es kein Freund war, dann doch wenigstens so etwas wie ein Bekannter, nach der Art und Weise zu urteilen, wie sie nebeneinander auf dem Gehweg liefen, die Köpfe zusammengesteckt, als wären sie in ein leises, ernstes Gespräch vertieft. Wie schade, dachte Roach, dass der Fremde auf der anderen Seite ging, als sie um die Ecke bogen, sodass James ihn vollkommen mit seiner Körperfülle verdeckte. Nur um der Neugierde willen hätte Roach gern gewusst … »Die News, Sir? Ja, Sir! Fünf Pence zurück, danke Ihnen, Sir!«
Er verrenkte sich den Hals, als er in Richtung Daylesford Gardens blickte. Gegenüber von Nr. 27 stand eine Straßenlaterne, und die beiden befanden sich gerade in ihrem Lichtkegel. Das Licht fiel auf die gelbbraune Tasche, die Mr. James immer bei sich trug. Sie blieben stehen, und Mr. James kramte offensichtlich nach seinem Schlüssel. Dann schloss er auf, trat ein, und der Fremde folgte ihm. Roach, der sich gerade umdrehte, um einem Kunden eine Zeitung in die Hand zu drücken, verspürte ein merkwürdiges Gefühl des Triumphes. Mr. James hatte Besuch! In gewisser Weise kam es ihm so vor, als wäre ein lange gehaltener Rekord gebrochen worden.
Fast eine Stunde später verließ der Zeitungsverkäufer schließlich seinen Stand. Inzwischen goss es in Strömen. Die Straße lag nass und verlassen da. In der Crown in der Lower Daylesford Street würde es hingegen warm und freundlich sein. Durchgefroren und durstig klemmte sich Roach seine Zeitungen unter den Arm und machte sich in die Richtung auf den Weg, die James vor ihm eingeschlagen hatte, aber auf der anderen Straßenseite. Er war auf halbem Weg die Straße hinunter, den Blick auf den Gehweg geheftet, mit den Gedanken bereits bei der Erfrischung, die ihn erwartete, als ihn das Geräusch einer zufallenden Haustür aufblicken ließ. Er befand sich gegenüber von Nr. 27, und eine ihm vertraute Gestalt, die unvermeidliche Tasche tragend, war soeben erschienen und ging nun in Richtung des oberen Endes von Daylesford Gardens.
»Wieder der alte rätselhafte Mann«, sprach Roach zu sich selbst. »Wo mag er seinen Kumpel gelassen haben?«
Während Roach seinen Weg fortsetzte, sann er darüber nach, dass er Mr. James noch nie so schnell hatte gehen sehen.
Zwei Minuten später fand er sich in einer ausgesprochen angenehmen, feuchtwarmen Atmosphäre an der Theke wieder, um die sich die Leute drängten.
»Wie läuft’s denn so, Jacko?«, fragte ihn ein Bekannter.
»Verdammt schlecht«, erwiderte Jackie, einen Krug an den Lippen. »Heutzutage steht ja nix mehr in der Zeitung, nur noch dieser politische Kram. Was wir denen verkaufen wollen, ist ein Mord.« Er nahm einen langen Schluck und wiederholte, wobei er mit den Lippen schmatzte: »Mord – ’n verdammter Mord, das wäre genau das Richtige!«
2. Kapitel
Die Zwölf Apostel
Samstag, 14. November
Die London and Imperial Estates Company, Ltd. und ihre elf Tochtergesellschaften, an der Börse gemeinhin bekannt als »Die Zwölf Apostel«, nahmen imposante Büroflächen in Lothbury in Beschlag. Alles in allem gab es acht Stockwerke, außen eine eindrucksvolle Fassade aus Portland-Stein, innen gewachste Eichentäfelung. Die Eingangshalle war mit Säulen aus poliertem Marmor geschmückt und wurde von dem größten und schicksten Portier der City of London bewacht. In den Stockwerken darüber beherbergten große, luftige Räume während der Geschäftszeiten ganze Regimenter von Schreibkräften, Angestellten und Laufburschen. In kleineren und luxuriöseren Zimmern verfolgten die Vorgesetzten – Manager, Buchhalter und Abteilungsleiter – ihre geheimnisvollen und vermutlich profitablen Geschäfte. Aber für den einfachen Mann, insbesondere für den Investor oder Spekulanten in der City, wurde all diese Pracht von der Persönlichkeit eines Mannes repräsentiert und gewann erst durch ihn an Bedeutung – Lionel Ballantine.
Ballantine war eine jener pittoresken Figuren, die von Zeit zu Zeit in der Londoner Finanzwelt auftauchen und mit ihren Aktivitäten Farbe in die für gewöhnlich tristen Fahrwasser des Handels bringen. Er war, in dem allgemein anerkannten Sinn des Wortes, einer der bekanntesten Männer in der City. Was bedeutete, dass eine breite Öffentlichkeit durch die Presse mit seiner äußeren Erscheinung vertraut war, auch mit der Beschaffenheit seines Landhauses, seines Rennstalls, seiner Jacht und seiner Herde von reinrassigen Jersey-Rindern. Eine kleinere Öffentlichkeit, die indes umso größere Neugier bekundete, wusste etwas über seine finanziellen Interessen, wenn auch nicht ganz so viel, wie sie es sich gewünscht hätte. Tatsächlich war über den Mann selbst herzlich wenig bekannt. Er hatte keine engen Freunde, und selbst seine engsten Geschäftspartner waren sich darüber bewusst, wie weit sie davon entfernt waren, in den Genuss seines vollen Vertrauens zu kommen. Seine Herkunft lag im Dunkeln, und wenngleich es viele Leute gab, die gerne den Schleier gelüftet hätten, in den er seine Herkunft hüllte, so gaben sich die meisten mit zynischen oder blasphemischen Prophezeiungen zufrieden, was seine Zukunft anbelangte.
Von der Allgemeinheit aber wurde Ballantine so wahrgenommen, wie er sich nach außen hin gab – als ein sensationell erfolgreicher Geschäftsmann. In vergleichsweise kurzer Zeit war er aus dem Nichts – oder zumindest von sehr wenig – zu einer Position von großer Bedeutung und sogar Macht emporgestiegen. Eine solche Karriere lässt sich nur um den Preis eines gehörigen Maßes an Eifersucht und Verleumdung erreichen, und er hatte von beidem seinen Anteil abbekommen. Mehr als einmal hatte es unangenehmes Getuschel gegeben, was seine Methoden betraf, und bei einer Gelegenheit – bei der berühmten Pleite der Fanshawe-Bank – war das Getuschel lauter geworden. Aber jedes Mal war es wieder verstummt, und Ballantine schien erfolgreicher denn je zuvor.
Doch inzwischen hob das Getuschel vielerorts erneut an, und nirgends dringlicher als in dem kleinen Vorzimmer von Ballantines privatem Büro im obersten Stockwerk des großen Gebäudes. Hier diskutierten zwei Angestellte die Angelegenheiten des Unternehmens in gedämpftem Ton.
»Ich sage Ihnen, Johnson«, meinte der eine, »mir gefällt nicht, wie die Dinge liegen. Es sind keine zwei Wochen mehr bis zur jährlichen Hauptversammlung, und der Markt reagiert nervös. Haben Sie die Zahlen von heute Morgen gesehen?«
»Der Markt!«, kam es verächtlich von dem anderen. »Der Markt reagiert immer nervös. Wir haben ganz andere Schrecken als das hier hinter uns, oder etwa nicht? Schon vergessen, was 1929 passiert ist? Tja, damals …«
»Dann werde ich Ihnen noch etwas verraten«, fuhr der erste Sprecher fort, ohne groß auf den Einwand einzugehen. »Auch Du Pine ist nervös. Haben Sie ihn heute Morgen noch nicht gesehen? Er war vollkommen bleich im Gesicht. Ich sag Ihnen was, er weiß etwas.«
»Wo steckt er jetzt?«, fragte Johnson. »Etwa da drinnen?« Er nickte in Richtung einer verglasten Tür mit der Aufschrift »Sekretariat«.
»Nein. Er ist im Büro des Alten. Ist in der letzten halben Stunde rein und wieder raus, wie eine Katze, die ganz zappelig ist. Und dabei ist der Alte gar nicht da.«
»Wie auch? Sollte er etwa hier sein, an einem Samstagmorgen?«
»Ja, sollte er – diesen Morgen. Er hat einen Termin für elf Uhr. Ich war hier, als Du Pine ihn für ihn vereinbart hat.«
»Einen Termin? Mit wem?«
»Mit Robinson von der Southern Bank. Und er bringt Prufrock mit.«
»Prufrock? Den Anwalt?«
»Genau den.«
Johnson pfiff leise durch die Zähne. Dann sagte er nach einer auffälligen Pause: »Percy, alter Knabe, ich nehme an, Sie wissen nicht zufällig, worum es geht und weswegen die ihn sprechen wollen, oder?«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Ich meine, wenn sie wegen der Redbury-Obligationsanleihen kommen sollten, und wenn Prufrock anfängt, herumzuschnüffeln …«
»Und?«, meinte Percy. »Nehmen wir an, es geht darum. Sie haben sich doch um die Anleihen gekümmert, oder nicht? Wie ist denn der Stand?«
Johnson blickte starr vor sich hin. Er sah geradewegs durch die Wand hindurch und gewahrte eine gepflegte Villa aus rotem Backstein in Ealing, stark belastet mit Hypotheken und absolut erstrebenswert, mit zwei kleinen Kindern, die auf einem winzigen Stück Rasen spielten, während seine Frau ihnen von der Tür aus dabei zusah.
»Und?«, wiederholte Percy.
Johnson wandte ihm den Kopf zu.
»Ich habe nur gerade nachgedacht«, sagte er. »Ein Kumpel von mir bei Garrisons’ hat mir erzählt, dass dort bald die Stelle des Bürovorstehers frei wird. Würde bedeuten, auf fünfzig im Jahr zu verzichten, aber – ich glaube, ich werde mich bewerben, Percy, alter Knabe.«
Die beiden Männer wechselten einen vielsagenden Blick, aber bevor einer von ihnen mit der Unterhaltung fortfahren konnte, klingelte das Telefon auf dem Tisch zwischen ihnen. Im selben Augenblick ging die Tür von Ballantines privatem Büro auf, und Du Pine, der Sekretär des Unternehmens, schritt eilig hinaus. Er nahm den Hörer ab, bellte hinein: »Sofort raufschicken!«, und war binnen weniger Sekunden wieder verschwunden.
»Verstehen Sie, was ich meine?«, murmelte Percy. »Nervös, wie?«
»Ich vermute, das waren Robinson und Prufrock«, meinte Johnson und erhob sich. »Tja, ich werde dann mal zu Garrisons’ gehen, und zwar jetzt.«
Im inneren Zimmer holte Du Pine tief Luft und straffte die schmalen Schultern, wie jemand, der sich gegen einen Angriff wappnet. Einen Moment lang stand er so da, dann entspannte er sich. Seine Hände, die er während dieser kurzen Dauer durch Willensanstrengung stillgehalten hatte, begannen, wieder um die Handgelenke zu zucken. Er durchmaß das Büro zweimal in jeder Richtung, dann blieb er vor einem Spiegel stehen. Darin sah er ein Gesicht, das man als ansprechend bezeichnet hätte, wäre da nicht die ungesunde Blässe der Wangen gewesen, das sorgsam gekämmte dunkle Haar, zwei wache, funkelnde Augen mit tiefen Falten darunter. Er starrte immer noch auf das Spiegelbild, als wäre es das Porträt eines Fremden, als die Besucher angekündigt wurden.
Du Pine wirbelte auf dem Absatz herum.
»Guten Morgen, meine Herren!«, rief er.
»Sie sind Mr. Du Pine, nehme ich an?«, kam es von dem Anwalt.
»Zu Diensten, Mr. Prufrock, richtig? Mr. Robinson habe ich ja bereits kennengelernt. Nehmen Sie doch bitte Platz.«
Mr. Prufrock nahm nicht Platz, blieb stehen und sah sich langsam in dem Raum um.
»Wir hatten einen Termin mit Mr. Ballantine«, sagte er.
»Ganz recht«, antwortete Du Pine bereitwillig. »Ganz recht. Leider kann er heute Morgen nicht persönlich hier sein, und er hat mich gebeten, mich in seiner Abwesenheit um die Angelegenheit zu kümmern.«
Mr. Prufrock hob die Augenbrauen in schockiertem Erstaunen. Mr. Robinson hingegen zog sie zu einem bedrohlichen Stirnrunzeln zusammen. Es wäre schwer zu sagen, welche der beiden Mienen Du Pine als unangenehmer empfand.
»Mr. Ballantine hat Sie gebeten – Sie –, sich in seiner Abwesenheit um die Angelegenheit zu kümmern?«, wiederholte der Anwalt ungläubig. »Um die Redbury-Obligationsanleihen? Dürfte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass wir persönlich mit Mr. Ballantine verabredet sind?«
»Richtig«, sagte Du Pine und ließ erste Anzeichen von Nervosität erkennen. »Richtig. Und ich kann Ihnen versichern, meine Herren, dass Mr. Ballantine selbstverständlich hier wäre, wenn – wenn es ihm möglich wäre.«
»Wie meinen Sie das? Fühlt er sich nicht wohl?«
Du Pine deutete Zustimmung an.
»Das erscheint mir sehr merkwürdig. Gestern machte er noch einen völlig gesunden Eindruck. Können Sie mir sagen, welcher Art seine Erkrankung ist?«
»Nein, das kann ich leider nicht.«
»Also gut. Dann gehen wir davon aus, dass es nichts Ernstes ist. Ich glaube, es wäre am besten, wir vereinbaren einen Termin, um ihn in seinem Haus aufzusuchen.«
Robinson ergriff zum ersten Mal das Wort.
»Ich bezweifle, dass wir ihn dort antreffen werden, krank oder gesund«, stellte er fest. »Wenn Sie mir den Vorschlag gestatten, es wäre zweckmäßiger, sich nach ihm im Haus von Mrs. Eales zu erkundigen – seiner Geliebten«, fügte er in einer Nebenbemerkung an Prufrock hinzu, der die Lippen schürzte und als Antwort ein Schnauben verlauten ließ.
»Das habe ich bereits gemacht«, warf Du Pine ein. »Dort ist er nicht.«
»Verstehe.« Der Anwalt sah ihn einen Moment eindringlich an, um seiner nächsten Frage Gewicht zu verleihen. »Mr. Du Pine, würden Sie mir bitte rundheraus antworten: Wissen Sie, wo Mr. Ballantine ist?«
Du Pine holte tief Luft, wie ein Schwimmer kurz vor dem Sprung ins Wasser, und begann dann sehr schnell zu sprechen.
»Nein, das weiß ich nicht. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass Mr. Ballantines Abwesenheit unter den gegebenen Umständen ziemlich … dass es eine Angelegenheit ist, die geklärt werden müsste. Aber, meine Herren, bevor Sie daraus etwas ableiten – bevor Sie irgendwelche Schritte unternehmen, die – irgendwelche unwiderruflichen Schritte … Da wäre noch eine Sache, die – aus Fairness gegenüber Mr. Ballantine – aus Fairness gegenüber mir selbst –, es könnte für die Zukunft von Bedeutung sein …«
»Ja?«
»Mr. Ballantine hatte gestern Morgen Besuch hier, der ihn sehr in Unruhe versetzt hat. Das könnte in gewisser Weise erklären, warum er sprunghaft in seinem Verhalten war …«
Prufrock wandte sich an Robinson. Ein harter Zug lag um seinen Mund.
»Wirklich, Robinson, ich glaube, wir vergeuden hier nur unsere Zeit«, sagte er.
»Aber, meine Herren, dies ist wichtig«, betonte Du Pine.
»Ich kann mir kaum einen gestrigen Besucher vorstellen, der wichtiger für Mr. Ballantine gewesen wäre als der Termin, den er für heute vereinbart hat«, merkte Prufrock trocken an.
»Aber ich kann Ihnen versichern, Sir, ich kann Ihnen versichern, dass Mr. Ballantine die feste Absicht hatte, Sie heute zu treffen. Er hatte eine perfekte Erklärung für kleine Unstimmigkeiten, die sich möglicherweise bei den Obligationsanleihen auftun. Es gibt nur eine denkbare Erklärung dafür, dass er nicht erschienen ist, und die lautet, dass er von der körperlichen Verfassung her nicht imstande war zu kommen.«
»Was soll der ganze Unsinn?«, fragte Robinson missmutig. »Und was hat der geheimnisvolle Besucher damit zu tun?«
»Vielleicht werden Sie es verstehen, wenn ich Ihnen sage, dass der Besucher Mr. Fanshawe war …«
Die beiden Männer zeigten gespanntes Interesse.
»Fanshawe?«, wiederholte Prufrock. »Der ist doch noch im Gefängnis, oder nicht?«
»Seine Haftstrafe läuft bald aus«, warf Robinson ein. »Armer Kerl, ich kannte ihn gut, ehe …«
»Und dass er ihn bedroht hat, in meiner Hörweite«, fuhr Du Pine aufgeregt fort. »Vielleicht verstehen die Herren jetzt – und – und geben Mr. Ballantine ein bisschen Zeit, um – um Vorkehrungen zu treffen«, schloss er matt, seine Stimme verlor sich, als wäre er am Ende seiner Kraft.
»Ich verstehe nur eines«, merkte Prufrock trocken an. »Keine zufriedenstellenden Sicherheiten für die Redbury-Obligationsanleihen, die Mr. Ballantine versprach, uns heute zu geben, und zwar persönlich. Ich habe die Anweisung meines Klienten, eine gerichtliche Verfügung gegen das Unternehmen zu erlassen. Er hat es versäumt, den Termin einzuhalten – ob er, wie Sie anzudeuten scheinen, von der Person, von der Sie sprechen, entführt worden ist oder nicht, ist für mich nicht weiter von Belang. Die Dinge müssen jetzt ihren Lauf nehmen. Die Verfügung wird Ihnen am Montagmorgen zugestellt. Der Bankkredit wird, wie ich vermute, zur gleichen Zeit fällig?« Er warf einen Blick auf Robinson, der zustimmend nickte. »Nun, Mr. Du Pine«, fuhr er fort, »Sie kennen jetzt die Lage. Wir brauchen Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch zu nehmen. Wünsche einen guten Tag.«
Eine Antwort blieb aus. Du Pine stützte sich mit einer Hand schwer am Tisch ab, eine Locke seines dunklen Haars war ihm in die von Schweiß glänzende Stirn gefallen, und er wirkte absolut erschöpft. Der Anwalt zuckte mit den Schultern, nahm Robinson am Arm und verließ den Raum ohne ein weiteres Wort.
Du Pine sah ihnen nach, und eine ganze Minute verstrich, ehe er sich wieder regte. Dann holte er ein Glasfläschchen mit weißen Tabletten aus seiner Tasche. Dies nahm er mit zur Toilette, die sich an Ballantines Büro anschloss. Dort füllte er ein Glas mit Wasser, gab eine Tablette hinein und verfolgte mit ungeduldigem Blick, wie sie sich auflöste. Er leerte die Mischung mit einem Schluck, und nach und nach kam wieder etwas Farbe in seine Wangen, seine Augen wurden lebhafter. Als das Medikament seine Wirkung entfaltet hatte, kehrte er mit den gewohnt raschen, federnden Schritten in das Büro zurück. Aus seiner Tasche nahm er ein Schlüsselbund, suchte einen davon heraus und steckte ihn in den Privatschreibtisch seines Arbeitgebers. Er war so gut wie leer, und von dem wenigen, was sich dort befand, interessierte ihn nichts. Als Nächstes wandte er seine Aufmerksamkeit dem Safe zu, der in die Wand eingelassen war. Auch hier blieb seine Suche erfolglos. Mit einem Achselzucken blickte er sich ein letztes Mal in dem Raum um, der so lange das Nervenzentrum eines großen Unternehmens gewesen war, und ging dann hinaus.
3. Kapitel
Mrs. Eales
Samstag, 14. November
Mr. Du Pine lag ganz richtig. Wo immer Ballantine auch sein mochte, bei Mrs. Eales war er jedenfalls nicht. Denn während Mr. Robinson und Mr. Prufrock Erkundigungen in der City einholten, begann sich jene Dame, die in der Mount Street in ihrem Schlafzimmer vor den Resten eines sehr späten Frühstücks saß, ernstlich zu fragen, warum er nicht bei ihr war. Ein Stapel Briefe lag neben ihr. Sie waren ungeöffnet und würden es wohl auch bleiben. Sie wusste, dass jeder Umschlag eine Rechnung enthielt, und im Augenblick besaß sie nicht die geistige Stärke, mit der sie es ertragen hätte festzustellen, wie viel Geld sie anderen Leuten schuldete. Vor ihrem geistigen Auge jedoch kam sie nicht umhin, einige Posten auf diesen Rechnungen vor sich zu sehen, und die ließen sie schaudern. In der Vergangenheit war ihre Extravaganz der Anlass für endlose Streitereien mit ihrem Beschützer gewesen, und jetzt, als sie auf den unheilvollen Stapel blickte, sann sie unweigerlich nach: »Das gibt einen Mordskrach, wenn er das da sieht.« Dann, mit der trostlosen Erkenntnis, ein wütender Mann sei immer noch besser als gar keiner, war sie den Tränen nahe.
Es klopfte an der Tür, und ehe sie etwas sagen konnte, trat ihr Dienstmädchen ins Zimmer.
»Was gibt es, Florence?«, erkundigte sich Mrs. Eales mit einem Lächeln, das bezaubernder war als das, was Frauen in gesicherten Verhältnissen für gewöhnlich ihren Dienstboten zukommen lassen.
Florence erwiderte das Lächeln nicht. Ihr Benehmen war schroff, beinahe anmaßend. »Wird Mr. Ballantine heute noch kommen?«, wollte sie wissen.
»Das weiß ich nicht, Florence, aber ich gehe davon aus. Warum fragst du?« Als sie keine Antwort erhielt, sprach sie hastig weiter: »Du kannst dir den Nachmittag freinehmen, wenn du möchtest. Ich werde schon zurechtkommen, wenn er hier ist.«
»Danke, Ma’am«, sagte Florence unfreundlich. »Und kann ich bitte meinen Lohn für letzte Woche haben?«
»Oh, ja, natürlich, wie dumm von mir!«, rief Mrs. Eales, eine Spur zu schrill. »Hol mein Portemonnaie von der Frisierkommode, ja? Nun, lass mich sehen … du liebe Güte! Es tut mir so leid«, rief sie aus und kramte in ihrem Portemonnaie, »ich bin wohl knapp dran. Reicht es dir, wenn ich dir zehn Shilling als Abschlag gebe und den Rest dann am Montag?«
Florence nahm den dargebotenen Schein ohne Kommentar, aber ihr Blick ruhte einen Moment auf den ungeöffneten Briefen, ehe sie fortfuhr: »Mr. Du Pine hat gerade angerufen.«
»Mr. Du Pine!«, sagte Mrs. Eales schnell. »Ich kann jetzt aber nicht mit ihm sprechen.«
»Er wollte gar nicht mit Ihnen sprechen. Er hat sich bloß nach Mr. Ballantine erkundigt. Ich habe ihm gesagt, er ist nicht hier, und dann hat er aufgelegt.«
»Verstehe. Hat er gesagt – hat er dir irgendetwas über Mr. Ballantine gesagt?«
»Nein. Er hat nur angerufen, um sich zu vergewissern, dass er nicht hier ist, meinte er. Er hat sich aber nicht so angehört, als ob er davon ausginge, dass er hier sei.«
»Das wäre dann alles, Florence«, sagte ihre Herrin kühl. »Nimm bitte die Frühstückssachen mit.«
Florence räumte das Tablett mürrisch ab. An der Tür drehte sie sich noch einmal halb um und sagte über die Schulter hinweg: »Wenn der Captain anfragt, soll ich ihn dann hereinlassen?«
»Ach, geh jetzt, geh!«, rief Mrs. Eales und war mit ihrer Geduld am Ende. In diesem Moment war Captain Eales der letzte Mensch auf Erden, an den sie erinnert werden wollte.
4. Kapitel
Die Heimkehr des verlorenen Sohnes
Samstag, 14. November
Kurz vor Mittag hielt ein Taxi vor einer kleinen weißen Villa in den Vororten von Passy und setzte einen dünnen Mann mittleren Alters ab. Von einem Fenster im ersten Stock aus wurde er von einem Dienstmädchen mit unordentlichem Haar beobachtet und erkannt. Mit einem »Tiens!« der Verärgerung und Überraschung legte es den Staubwedel beiseite und machte sich auf die Schnelle zurecht, ehe es den Besucher hereinbat.
»Bonjour, Eléonore«, sagte John Fanshawe auf der Schwelle, als ihm die Tür endlich geöffnet wurde.
»Monsieur! Mais, que cette arrivée est imprévue!«
»Unerwartet, aber nicht unwillkommen, hoffe ich«, sagte Fanshawe auf Französisch, das durch einen Mangel an Übung ein wenig unbeholfen klang.
Oh, Monsieur belieben zu scherzen! Als könnte er je unwillkommen sein! Und habe Monsieur eine angenehme Reise gehabt? Und ob es ihm gut gehe? Aber sie könne sich ja selbst davon überzeugen, dass es ihm gut gehe – nur dünn sei er. Mon Dieu! Wie dünn er doch sei! Sie habe ihn erst gar nicht erkannt.
»Und Mademoiselle?«, fragte Fanshawe, sobald er den Schwall von Worten durchdringen konnte. »Wie geht es ihr?«
Mademoiselle gehe es gut. Wie unendlich schade, dass sie nicht da sei, um ihren Vater zu begrüßen. Wenn Monsieur sie doch im Vorhinein von seinem Kommen hätte wissen lassen, wie glücklich sie dann gewesen wäre. Aber es sei eben ganz Monsieurs Art, sie mit einer so freudigen Überraschung zu bedenken. Und nun sei Mademoiselle ausgegangen und werde nicht vor dem Nachmittag zurückkehren, und nichts sei vorbereitet. Monsieur möge das Durcheinander im Haus entschuldigen, aber Mademoiselle werde das natürlich erklären. Aber was redete sie da – Eléonore? Monsieur sei gewiss hungrig, nach seiner langen Reise in dieser schrecklichen Jahreszeit. Monsieur müsse etwas essen. Es sei nicht viel im Haus, aber ein Omelette … Monsieur werde ein Omelette aux fines herbes bekommen, nicht wahr? Und etwas von dem Beaujolais, den er stets zu seinem déjeuner trinke? Wenn Monsieur nur ein Viertelstündchen warten könnte, werde er bedient.
Mit einem letzten Wortschwall eilte sie in die Küche, und Fanshawe machte sich mit einem Seufzer der Erleichterung auf den Weg in den salon und setzte sich, um auf das Essen zu warten. Sein Gesicht, das sich bei dem Klang von Eléonores altvertrauter Redegabe vor Freude aufgehellt hatte, nahm nunmehr den Ausdruck eines wachsamen Zynismus an, der typisch für ihn war. Es war ein Fehler, überlegte er, irgendwo unangemeldet einzutreffen – selbst im Haus der eigenen Tochter. Er war alt genug, um es besser zu wissen. Aber das passierte nun einmal, wenn man über Jahre seine Zeit abgesessen hatte, wenn man wartete und sich auf das eine Ereignis konzentrierte, das einen zurück ins Leben bringen sollte. Man vergaß, dass für die wirkliche, lebendige Welt da draußen die Dinge nicht stillstanden, so wie für einen selbst. In Gedanken war er schon oft in dieser Villa angekommen und hatte auf der Türschwelle seine Tochter angetroffen, die bereit war, ihm in die Arme zu fliegen. In diesem Zusammenhang wäre es ihm gar nicht eingefallen, dass es Vorkehrungen bedurft hätte, um sicherzustellen, dass sie auch da war. Eine Verabredung zum Essen, ein Termin beim Friseur – und schon war die große Wiedersehensszene gescheitert, und der verlorene Elternteil musste sein Omelette allein essen.
Fanshawe zuckte mit den schmalen Schultern. Er mache viel Aufhebens um nichts, sagte er sich selbst. Ein Mann kommt aus dem Gefängnis, ungefähr eine Woche früher als erwartet. Er besucht seine Tochter in Frankreich ohne Vorankündigung. Wenig verwunderlich, dass sie nicht zu Hause ist, wenn er eintrifft. Mehr war es nicht. Doch die andere Hälfte seines Verstandes ließ sich nicht so leicht zufriedenstellen. Wenn da nicht mehr war, warum war Eléonore dann so offenkundig aufgeregt gewesen bei seinem ersten Erscheinen? Und als sie jetzt mit der Ankündigung »Monsieur est servi!« erschien, lag da nicht ein Anflug von Mitleid in ihrem betont freundlichen Benehmen?
Fanshawe hielt sie im Esszimmer zurück, während er das Mittagessen verzehrte. In den letzten Jahren hatte er genug Einsamkeit gehabt. Bereitwillig schwatzte sie mit ihm über alle möglichen alten Bekannten und Ereignisse, aber bei dem einen Thema, das ihn im Augenblick interessierte, blieb sie zurückhaltend. Einmal, nach einer Pause in der Unterhaltung, bemerkte sie plötzlich und ohne einen bestimmten Zusammenhang: »Mademoiselle wird ihrem Vater zweifellos eine Menge zu erzählen haben.«
»Évidemment«, stimmte Fanshawe knapp zu, verfolgte das Thema aber nicht weiter.
Nach der Mahlzeit kehrte er in den salon zurück, um dort zu rauchen und den exzellenten Kaffee zu trinken, den Eléonore ihm brachte. Müde wie er war, wäre er in seinem Sessel eingeschlafen, wenn nicht ein Teil seines Bewusstseins unablässig wachsam geblieben wäre und auf das Geräusch gelauscht hätte, ob die Haustür aufging. Die Falten in seinem Gesicht vertieften sich, während er wartete, und der Ausdruck geduldiger Ernüchterung trat deutlicher zutage.
Es dauerte indes nicht lange, bis er das unverkennbare Geräusch eines Schlüssels hörte, der ins Türschloss gesteckt wurde. Er erhob sich und machte einen Schritt in Richtung Eingangshalle, kehrte dann aber leise zu seinem Sessel zurück, als er eilige Schritte im Haus vernahm. Demnach hatte auch Eléonore Wache gehalten! Die Geräusche einer geflüsterten Unterhaltung an der Haustür drangen an seine Ohren, und ohne zu verstehen, was genau gesprochen wurde, begriff er, dass Eléonore es aus irgendeinem Grund für nötig erachtete, ihrer Herrin von seiner Ankunft zu berichten. Die Verzögerung währte nur kurz, kam Fanshawe aber ziemlich lang vor, ehe die Tür aufgestoßen wurde und seine Tochter mit einem Ausruf »Vater!« in seinen Armen lag.
Sie löste sich rasch aus seiner Umarmung und hielt ihn auf Armeslänge von sich, um sein Gesicht besser sehen zu können, wobei sie gebrochene kleine Sätze der Besorgnis angesichts seiner Blässe und seiner grauen Haare vor sich hin murmelte. Er seinerseits betrachtete sie aus leicht verengten Augen. Auch sie hatte sich verändert, wie er feststellte. Sie hatte etwas von dem mädchenhaften Charme verloren, an den er sich erinnerte, dafür aber das sichere Auftreten und das gute Aussehen einer erwachsenen Frau gewonnen. »Genau der Typ, um die Aufmerksamkeit eines Franzosen auf sich zu ziehen«, sagte er zu sich selbst. Mit einem Mal waren ihre Wangen gerötet, und in ihren Augen lag ein Ausdruck, der ihn dazu veranlasste, in stummer Frage die Augenbrauen hochzuziehen.
Das fiel ihr auf, und so wich sie als Antwort ein Stück weit zurück. »Ich dachte, du würdest erst in einer Woche freikommen«, sagte sie leise. »Ich hatte dich nicht erwartet.«
»Das habe ich schon von Eléonore erfahren.«
»Dann hast du meinen Brief also nicht bekommen?«
»Offensichtlich nicht, weil ich ja hier bin. Dann gehe ich davon aus, in dem Brief stand, dass ich nicht kommen soll?«
Sie schaute weg, in offenkundiger Verzweiflung.
»Vater – das ist so entsetzlich schwierig …«
»Keineswegs.« Fanshawes trockener, nüchterner Ton klang nicht unfreundlich. »Ich bin hier nur im Weg. Das ist wohl kaum überraschend, oder?«
»Vater, das darfst du nicht sagen. Das klingt so …«
»Ich kann mir manch eine Situation vorstellen«, fuhr er fort, »in der die Rückkehr eines Ex-Sträflings für die Tochter womöglich peinlich ist. Das könnte sich zum Beispiel nachteilig auf ihre Aussicht auf eine gute Heirat auswirken …«
Sie sog scharf die Luft ein und sah ihm geradewegs in die Augen. In ihrem Gesicht las er alles, was er wissen musste.
»Wir verstehen einander«, sprach er ernst. »Bei solchen Gelegenheiten ist es die Pflicht des Vaters, so still und leise wie möglich zu verschwinden. Nur, warum hast du es mich nicht schon längst wissen lassen?«
»Ich – ich habe es versucht, mehrmals, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Ich war ein Feigling, ich weiß, aber ich habe es immer und immer wieder aufgeschoben, bis zum letzten Moment. Ich habe mich so geschämt.«
»Es gibt nichts, wofür du dich schämen müsstest«, versicherte er ihr. »Wer ist der junge Mann? Ich hoffe doch, er ist noch jung. Er ist Franzose, nehme ich an?«
»Ja. Er heißt Paillard – Roger Paillard. Er …«
»Vom Autohaus Paillard? Ich gratuliere! Und seine Familie weiß natürlich nichts von mir?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin auf dem Weg zur ersten Einladung bei ihnen«, sagte sie. »Er ist der einzige Sohn, und seine Mutter ist natürlich …«
»Sie hält natürlich große Stücke auf ihn. Und er ist un jeune homme bien élevé, très comme il faut – und alles, was sonst noch dazugehört?«
Er ahmte die Sprechweise einer älteren Französin so genau nach, dass seine Tochter gegen ihren Willen lachen musste.
»Also gut«, fuhr er fort. »Ich hoffe, du wirst glücklich, meine Liebe. Das schwarze Schaf der Familie wird sich wieder zurückziehen und unsichtbar bleiben. Wo ist Roger jetzt eigentlich?«
»Draußen, im Wagen. Wir waren zusammen zum Essen aus, und ich bin nur gekommen, um meine Tasche zu holen.«
»Dann Beeilung, meine Liebe, Beeilung. Du darfst ihn nicht warten lassen! Er wird sich schon fragen, wo du so lange bleibst.«
Er gab ihr einen flüchtigen Kuss, und sie wandte sich zum Gehen. Auf der Schwelle blieb sie stehen.
»Was ist noch?«, wollte er wissen.
»Vater, du hast nie etwas gesagt von … Ich meine, du hast doch bestimmt sehr wenig Geld. Wenn ich helfen kann …«
»Geld?«, wiederholte er gut gelaunt. »Nein, mach dir deswegen keine Gedanken. Du weißt schon, wir Gauner haben immer irgendwo etwas zur Seite gelegt.«
Sie zuckte bei dem unschönen Wort und dem ironisch herausfordernden Ton zusammen.
»Aber was wirst du tun?«, fragte sie.
»Vielleicht lässt Eléonore mich heute hier übernachten«, antwortete er. »Oder sogar zwei Nächte, wenn mir danach ist. Ich werde aber in jedem Fall weg sein, wenn du zurückkehrst. Ich fahre dann wieder nach London. Deine Tante hat mir netterweise versprochen, mich so lange bei sich aufzunehmen, wie es mir gefällt.«
»Das wird aber sehr langweilig für dich«, sagte sie leise.
»Das glaube ich nicht. Und zwei einsame Leute langweilen sich auf jeden Fall weniger zusammen als getrennt. Jetzt musst du aber los. Ich bestehe darauf. Auf Wiedersehen und – viel Glück.«
Sie verabschiedete sich von ihm, und während sie die Stufen hinunter zu dem wartenden Auto eilte, hallten die Worte »zwei einsame Leute« in ihren Ohren wie eine läutende Glocke nach.
5. Kapitel
Im Café du Soleil
Sonntag, 15. November
Das Café du Soleil in der Goodge Street ist an Sonntagen zur Mittagszeit immer gut besucht. Der schmale Raum mit seinen weißen Wänden und den zwei Reihen kleiner Tische zieht Kundschaft aus einem Umkreis an, der weitaus größer ist als das mitunter etwas schäbige Viertel, in dem das Café liegt. Die Gäste sind wahrlich bunt zusammengewürfelt. Viele sind Ausländer, einige heruntergekommen, einige wenige wohlhabend, kaum einer ist elegant. Sie alle verbindet eine Eigenschaft, und nur eine: dass sie gutes Essen kennen und zu schätzen wissen. Und Enrico Volpi, der stämmige kleine Genueser, der die Kochkunst in Marseille gelernt und in Paris verfeinert hat, sorgt dafür, dass seine Gäste nicht enttäuscht sind.
Frank Harper, Angestellter bei der Firma Inglewood, Browne & Company – Auktionatoren und Grundstücksmakler in Kensington –, hatte das Soleil bei einem Besuch des Unternehmens seines Arbeitgebers in der Tottenham Court Road entdeckt. Von jenem Essen war er angenehm überrascht und anschließend weniger angenehm überrascht von der Rechnung gewesen. Als er bezahlt hatte, hatte er mit Bedauern festgestellt, dass das Soleil kein Restaurant für arme Leute war. So hatte er beschlossen, dass man es sich, jedenfalls soweit es ihn betraf, für einen besonderen Anlass aufheben musste.
Dies war so ein Anlass. Harper hatte sich große Mühe gegeben, ein Menü zusammenzustellen, das des Anlasses würdig war, und Volpi, der sofort wusste, wenn er einen jungen verliebten Mann vor sich hatte, hatte sich bei der Ausführung selbst übertroffen. Daher murmelte Harper seiner Begleiterin beim Kaffee in einem zuversichtlichen Ton, der mehr als gerechtfertigt war, die Worte zu: »Nun, Susan, hat dir das Essen geschmeckt?«
Susan lächelte zufrieden.
»Frank, das Essen war ein Traum. Ich habe viel zu viel in mich hineingelöffelt und werde zum Dinner nichts mehr hinunterbekommen können. Wie genial von dir, dass du dieses Lokal entdeckt hast. Wenn es doch nur …« Ihre aufrichtigen grauen Augen nahmen einen besorgten Ausdruck an.
»Wenn es doch nur – was?«
»Wenn es doch nur nicht so entsetzlich teuer wäre.«
Harpers eher einfältig-glücklicher Ausdruck wich einem Ausdruck der Empörung.
»Musst du jetzt davon anfangen?«, fragte er missgelaunt. »Ich hätte gedacht …«
Susan war ganz zerknirscht.
»Darling, es tut mir leid. Ich wollte nichts sagen, was die Stimmung verdirbt. Das war gemein von mir.«
»Mein Engel, du könntest nie gemein sein, selbst wenn du es wolltest.«
»Doch, das kann ich, und ich war gemein. Aber trotzdem«, fuhr sie fort und ging wieder in die Offensive, »müssen wir manchmal realistisch bleiben.«
»Also gut«, sagte der junge Mann ein wenig schroff, »seien wir realistisch. Ich weiß, was du denkst. Ich bin ein Angestellter in einer lausigen Firma, die mir zwei Pfund und zehn Shilling pro Woche zahlt, was vermutlich zwei Pfund und neun Shilling mehr ist, als ich wert bin. Ich bin seit vier Jahren dort, und meine Aussichten, weiter aufzusteigen, gehen gegen null. Du hast ein Kleidergeld von fünfzig Pfund pro Jahr, und du kannst dich glücklich schätzen, sofern dein Vater es auf hundert erhöhen kann, wenn du heiratest. Da wir zu den besseren Kreisen gehören, können wir nicht unter siebenhundert im Jahr heiraten – sagen wir sechshundert als absolutes Minimum. Und selbst wenn wir es damit versuchen würden, würden wir es hassen, und dein Vater hätte bestimmt siebzehn Schlaganfälle, wenn wir es vorschlagen würden. Ist das realistisch genug für dich?«
»Ja«, sagte Susan mit leiser, trauriger Stimme.