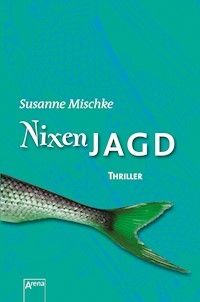8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im grünlichen Wasser des Maschsees treibt eine Leiche. Die Zunge des Toten liegt abgetrennt auf dem Stöckener Friedhof in Hannover, auf dem Grabmal der Opfer des Massenmörders Fritz Haarmann. Schnell findet die Kripo Hannover heraus, dass es sich bei dem Ermordeten um einen namhaften Psychiater handelt, einen Experten für Sexualstraftäter, dessen kühle, rationale Thesen sogar im Fernsehen für Aufregung gesorgt haben. Aber wer wollte den Mann so symbolträchtig zum Schweigen bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
4. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95568-3
© Piper Verlag GmbH, München 2008 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Hannes Jung Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Montag, 16. April
Seit Amadeus fort ist, herrscht wieder Friede. Ein Friede, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Völxen ist in nachdenklicher Stimmung. Ein wenig melancholisch sogar.
Der Tag ist warm gewesen, ein Sommertag mitten im April. Über dem jungen Gras der Schafweide hat sich Dunst gebildet, vergoldet von der untergehenden Sonne. Man müsste ein Foto machen, denkt Völxen – grasende Schafe zwischen Obstbäumen, umfriedet von einem malerisch verwitterten Bretterzaun, im Hintergrund die sanft ansteigenden Wälder des Deisters. Eine Amsel flötet herzzerreißend, im Haus jault eine Klarinette.
Letzte Woche hat es Ärger mit Sabine gegeben. Amadeus, der Schafbock, hatte eine Latte am Zaun gelockert, und die Schafe waren in den Gemüsegarten eingedrungen. Nach Völxens Einschätzung hält sich der Schaden allerdings in Grenzen, denn der Gemüsegarten ist um diese Zeit ohnehin nur ein kahler Acker. Was macht es schon, wenn Saaten und Schößlinge ein wenig durcheinandergeraten?
Salomé blökt. Völxen atmet tief durch. Der April riecht nach umgepflügter Erde, Dung und Zierkirschenblüten. Er befindet sich zwar nur fünfzehn Kilometer südlich der Landeshauptstadt, aber dennoch in einer völlig anderen Welt als der, in der er sich tagsüber bewegt: Gewalt, Tod, Akten. Wenn er abends vor der Schafweide steht, kommt ihm diese Tagwelt vor wie von einem anderen Planeten. Umgekehrt geht es ihm ähnlich, und manchmal beunruhigt ihn diese schizophrene Lebensweise ein wenig. Vielleicht, so sinniert er immer öfter, hätte ich Bauer werden sollen, wie mein Großvater. Der war Obstbauer und Pferdezüchter, zu jeder Stunde des Tages, an jedem Tag der Woche.
Nicht dass sich Völxen der Illusion hingegeben hätte, auf dem Land sei das Leben stets beschaulich und harmonisch. Das nun nicht. Aber anders ist es schon: langsamer, geordneter, überschaubarer. Die soziale Kontrollfunktion einer Dorfgemeinschaft macht es möglich, in dem sicheren Gefühl verreisen zu können, die Nachbarschaft werde ein wachsames Auge auf Haus und Hof haben. Das gilt allerdings auch dann, wenn man nicht verreist. Egal was man tut, es wird kommentiert, nichts bleibt verborgen. Als Völxen die Schafe angeschafft hat, ist er von den Alteingesessenen des Dorfes gutmütig bespöttelt worden. Denn auch nach achtzehn Jahren betrachtet man ihn noch als zugereisten Städter, deshalb verzeiht man ihm die Marotte mit den Schafen, wenngleich das Experiment mit Argusaugen verfolgt wird.
Seit es die Schafe gibt, ist hier, hinter dem Holzschuppen am Zaun, sein Lieblingsplatz. Es hat etwas Entspannendes, beinahe Meditatives, den Tieren beim Grasen und Wiederkäuen zuzusehen. Die Schafe ihrerseits scheinen ihn ebenfalls zu mögen. Zumindest erkennen sie ihn. Wenn er sich nähert, trippeln ihm Doris, Salomé, Angelina und Mathilde freudig blökend entgegen. Vielleicht liegt es auch am Zwieback, hinter dem sie her sind wie der Teufel hinter der armen Seele.
»Schönen guten Abend, der Herr Kommissar!« Jens Köpcke schlurft in seinen ewig verdreckten Gummistiefeln heran, in jeder Hand einen Blecheimer, über dessen Rand sich schillerndes Gefieder auffächert wie ein Blumenstrauß. »Willst einen abhaben?« Köpcke stellt die Eimer hin und wischt sich die Handflächen an der blutbefleckten blauen Arbeitshose ab, ehe er seinem Nachbarn zur Begrüßung die Hand schüttelt.
»Lass mal, Jens, lieber nicht.«
»Die sind ganz frisch. Halten sich noch bis zum Sonntag«, versichert Köpcke. Der Frührentner ist stolz auf seine Kleintierzucht.
»Frag Sabine«, wehrt Völxen ab.
Selbstverständlich hält sich Völxen stets vor Augen, dass Köpckes Viehzeug ein artgerechtes, vielleicht sogar glückliches Leben führt, verglichen mit den Millionen geschundener Kreaturen in den Massenställen dieser Welt. Auch ist ihm klar, dass die Konsumgewohnheiten des Durchschnittsbürgers – also auch die seinen – brutal sind, und nicht etwa sein Hühner schlachtender Nachbar. Dennoch stimmt ihn der Anblick dieser prächtigen bunten Hähne, deren Krakeelen ihm seit Monaten den Wecker ersetzt hat, mit einem Mal traurig.
»Wie kann man bei der Mordkommission arbeiten und so empfindlich sein?« Jens Köpcke schüttelt den breiten grauen Schädel.
Bodo Völxen, Erster Hauptkommissar des Dezernats 1.1.K der Polizeidirektion Hannover und zuständig für Straftaten gegen das Leben und Todesermittlungen weiß darauf keine Antwort. Beide Männer stehen schweigend am Zaun und beobachten, wie die Sonne hinter den Kamm des Deisters rutscht.
»Hab gehört, der Schafbock ist weg«, bemerkt Köpcke nach einer geraumen Weile.
»Mhm.«
»Ich hatte mal einen Hahn, der immer auf mich los ist. Wurde nicht alt, das Vieh.«
Völxen nickt bekümmert. Um vom Thema abzulenken, macht er seinem Nachbarn ein Angebot, das dieser nicht ablehnen kann: »’n Bier, Jens?«
Dr. Martin Offermann schielt auf seine goldene Panerai. Viertel nach zehn. Seit über zwei Stunden redet er. Erstaunlicherweise zeigen die gut zweihundert Zuhörer, die sich im Konferenzraum des Courtyard Marriott Hotels am Maschsee eingefunden haben, noch keine Ermüdungserscheinungen. Im Gegenteil, sie hängen an seinen Lippen wie bettelnde Hunde. Wie immer sind es in der Mehrzahl Frauen.
Von Zwängen und Trieben – Typologien von Sexualstraftätern lautet der Titel seines populärwissenschaftlich aufbereiteten Vortrags, den er mit lebendigen Beispielen aus seiner langjährigen Erfahrung als forensischer Psychiater unterfüttert. Diagnostik, Therapeutische Maßnahmen, Gefahrenprognosen, all das interessiert das Publikum sehr, doch am meisten weiß Offermann seine Hörerschaft mit den Schilderungen dessen zu fesseln, was seine Klientel einst anderen angetan hat. Natürlich ist sich der Psychiater darüber im Klaren, dass er damit eine niedere Form des Voyeurismus bedient, doch gleichzeitig genießt er es auch, wenn wieder ein kollektiver Seufzer der Erschütterung durch den Saal geht. Kein Zweifel – Sexualstraftäter sind faszinierend – und er, der Dompteur dieser Bestien, erst recht. Schon wieder sucht die Brünette in der dritten Reihe intensiven Blickkontakt. Sorry, aber er muss morgen früh am Flughafen Hannover sein, ein Symposium in Zürich.
Offermann ist zweiundsechzig, leicht übergewichtig und nicht mehr endlos belastbar. Sexuelle Ausschweifungen gönnt er sich nur noch, wenn er danach ausschlafen kann. Außerdem hat er vor nicht allzu langer Zeit eine eiserne Regel aufgestellt: keine Affären mehr in der eigenen Stadt. Da ist man hinterher viel zu greifbar. Er wird ein Taxi nehmen und schnurstracks nach Hause fahren, allein. Oder zu Fuß gehen, noch ein bisschen Luft schnappen. Obwohl das Hotel ja eine recht gut sortierte Bar hat …
Er fährt seinen Laptop herunter, an der Leinwand hinter ihm verblassen ein paar Kurven und Statistiken, ein Schlusssatz, Beifall brandet auf und hält lange an. Bestimmt wäre ich als Schauspieler oder Entertainer groß rausgekommen, denkt Offermann – nicht zum ersten Mal. In die gängigen Talkshows hat er es auch als Psychiater geschafft. Wann immer ein grässliches Verbrechen ruchbar wird, tingelt er danach tagelang als Experte quer durch alle Sender, vom Frühstücksfernsehen bis zum Talk um Mitternacht.
Ach ja, der Büchertisch. Schon hat sich eine Schlange gebildet, und vor dem kleinen Signiertisch warten bereits drei Frauen mit mehreren Büchern im Arm. Das wird dauern. Sein Mund ist trocken vom vielen Reden. Vielleicht sollte er doch noch kurz in die Bar gehen, auf einen Mojito, nur um die Zunge anzufeuchten.
Dienstag, 17. April
Walter Schmiedel hält das Gesicht in die Sonne und lauscht dem Gesang der Vögel. Im Grunde ist es eher ein ununterbrochenes, mehrstimmiges Geschrei, als wollten die Mitstreiter unter sich ausmachen, wer der Lauteste und Zäheste ist. Schmiedel mag diesen weitläufigen Friedhof, der eigentlich mehr einem mondänen Park gleicht als einem Gottesacker. Der Stöckener Friedhof erinnert an die Welfengärten im benachbarten Stadtteil Herrenhausen. Alte Bäume gibt es hier und zwischen den Grabstätten großzügige Rasenflächen. Siebzehntausend Tote auf fünfundfünfzig Hektar, bedeutende Bürger der Stadt neben zahllosen Unbekannten. Und niemand da, der einen scheucht. Nicht, dass sich Schmiedel bei seinem letzten Job im Stadtarchiv überarbeitet hätte, aber wenn er schon für nur einen Euro die Stunde arbeitet, dann sollte wenigstens kein Stress herrschen.
Mit seiner Abfallzange hebt er ein zerknülltes Papiertaschentuch auf und wirft es in den Sack, der auf seinem Handwagen steht. Seine Aufgabe besteht darin, die Wege und Rasenflächen des kommunalen Friedhofs Hannover-Stöcken sauber zu halten. Sauber von Müll, für das Laub und das Unkraut sind die Gärtner zuständig, das könnte er alleine gar nicht schaffen. Im Winter war wenig zu tun, aber nun häufen sich die Hinterlassenschaften der Besucher von Tag zu Tag: leere Flaschen – die mit Pfand drauf nimmt er natürlich mit –, Blumentöpfe, ausgebrannte Windlichter, Zigarettenschachteln, Plastiktüten, Verpackungen von Schokoriegeln, gebrauchte Kondome – und das, obwohl die Nächte noch kalt sind.
Zehn nach neun, die Sonne gewinnt an Kraft. Zeit für eine Frühstückspause. Er nähert sich dem Ehrengrabmal für die Opfer des Massenmörders Fritz Haarmann. Viel kann da nicht unter dem Efeu liegen, denkt sich Schmiedel. Ein paar Knochen höchstens, die man aus der Leine oder der Ihme gefischt oder im Hinterhof der Roten Reihe Nr. 5 ausgebuddelt hat, dem Wohnhaus des Ungeheuers.
Das Denkmal, ein großer Granitstein, hat die Form eines dreiteiligen Flügelaltars. Auf der mittleren Tafel, die ein Rundbogen ziert, ist das Relief einer Schale mit Feuer zu sehen sowie eine geknickte Rose. Dazwischen findet sich die Inschrift: Dem Gedächtnis unserer lieben, von September 1918 bis Juli 1924 verstorbenen Söhne.
Jedes Mal, wenn Schmiedel die Inschrift liest, stört er sich an dem Wort verstorbenen. Warum hat man nicht ermordeten geschrieben? Auf den beiden äußeren Tafeln sind die siebenundzwanzig Namen der Opfer aufgezählt. Haarmann selbst ist am 15. April 1925 im Gerichtsgefängnis hingerichtet worden, mit dem Fallbeil, früh um sechs. Das hat Schmiedel im Stadtarchiv nachgelesen.
Als er nun vor dem Grabmal steht, bemerkt er etwas Unförmiges, das oben auf dem rechten Steinflügel liegt. Er tritt näher heran. Das ist ein Klumpen Fleisch. Unglaublich, was man hier so alles findet. Kürzlich lagen ein totes Huhn und etliche Kerzenstummel auf einem Grab. Weiß der Teufel, welche Irren sich hier nachts herumtreiben. Aber wer legt einen rohen Fleischbatzen auf ausgerechnet diesen Grabstein? Sollte das ein makabrer Scherz sein, eine Anspielung? Die meisten Überreste von Haarmanns Opfern sind ja bekanntermaßen in den Mägen seiner Zeitgenossen gelandet. Wie ging gleich noch das Lied?
Warte, warte nur ein Weilchen,
bald kommt Haarmann auch zu dir,
mit dem kleinen Hackebeilchen,
macht er Schabefleisch aus dir.
Aus den Augen macht er Sülze,
aus dem Hintern macht er Speck,
aus den Därmen macht er Würste
und den Rest, den schmeißt er weg.
Harte Zeiten, die Zwanziger – die Stadt ein stinkender Moloch, voller Gesindel, Taschendiebe, Schmuggler, Nutten, Schwuchteln. Dazu Inflation, Wohnungsnot, und Tausende arbeitslos. Da ist man froh um jeden Brocken Fleisch und fragt nicht lange nach.
Oder hat hier ein Raubvogel seine Beute verloren? Schmiedel überwindet seinen Ekel und studiert den Klumpen genauer. Blut ist da jedenfalls keines dran. Auch kein Stück Fell oder Federn. Schieres Fleisch, je nach Lichteinfall gräulich bis violett schimmernd. Und es stinkt. Eine Fliege schwirrt ihm um den Kopf, er schüttelt sich. Her mit der Abfallzange. Was immer das ist – am besten schnell weg damit. Er hält inne, als er einen Motor knattern hört. Edwin, genannt der rasende Ede, kommt auf seinem Rasentraktor über die Wiese hinter dem Denkmal getuckert. Schmiedel winkt ihn heran. Der rasende Ede stellt sein Gefährt ab, und zu zweit begutachten sie den Fund. Dann schnauft Edwin in seinen Schnurrbart, kramt sein Mobiltelefon hervor und meint: »Ich glaub, ich ruf lieber mal die Bullen.«
Fernando Rodriguez zupft welke Blätter von der Zimmerpflanze und wirft sie in den Papierkorb. Zufrieden schaut er sich in dem kleinen Büro um. Besser geht es nicht. Zwar liegen auf seinem Schreibtisch noch Akten, Zettel und Stifte, aber schließlich arbeitet er ja hier.
»Sehr brav, sehr ordentlich, die Mama wäre begeistert.« Mit verschränkten Armen lehnt Oda Kristensen im Türrahmen und betrachtet den Raum, den sie drei Jahre lang mit Fernando Rodriguez geteilt hat. Ihren Schreibtisch hat sie schon gestern leer geräumt und die Sachen in ihr neues Büro gebracht, auf der anderen Seite des Flurs. »Endlich ein eigenes Büro. Zwar winzig, aber meins«, hat sie frohlockt. Auch Fernando ist nicht unglücklich darüber. So gut er mit Oda ausgekommen ist, der Gedanke, ihrer Kettenraucherei künftig zu entgehen, hat auch etwas Verlockendes.
Fernando hat Oda während der letzten drei Jahre nicht ein einziges Mal im Rock oder in bunter Kleidung gesehen. Sie scheint ausschließlich schwarze Pullover und schwarze Hosen zu besitzen. Das einzig Farbige an ihr sind die dunkelroten Lippen und die blaugrünen Augen. Selbst das hellblonde Haar wirkt farblos, vielleicht, weil es konsequent und ohne eine verspielte Strähne nach hinten gekämmt ist, wo es einen strengen Knoten bildet.
»Wie wär’s mit einem Blumensträußchen?«
»Ist das nötig?«, fragt Fernando verunsichert.
Oda nickt mit todernster Miene.
Fernando winkt ab. Immer wieder geht er Oda auf den Leim. »Meinst du, ich kann die Fahne da hängen lassen?« Er deutet mit einer Kopfbewegung auf die überdimensionale Hannover-96-Fahne, die die halbe Wand hinter seinem Schreibtisch einnimmt.
»Nicht, wenn sie absteigen.«
»Wo denkst du hin? Die schaffen es diese Saison in den UEFA-Cup.«
»Deswegen haben sie auch letztes Wochenende gegen Stuttgart verloren. Mit diesem Trotteltor werden sie in die Geschichte eingehen.«
»Du bist ein Ekel!«, stellt Fernando fest.
Oda wirft ihrem Kollegen eine Kusshand zu.
Der streicht sich durch seine schwarzen Locken, die für Odas Geschmack immer eine Spur zu ölig glänzen.
»Was ist das eigentlich für ein Gestank hier?«, will Oda wissen. »Ich komm mir vor wie im Ashram.«
»Räucherstäbchen. Das Büro riecht ja sonst wie die Havanna-Lounge.«
»Ja, ja, der Zeitgeist meint es nicht gut mit uns Rauchern«, seufzt Oda und macht Anstalten, sich einen Zigarillo anzuzünden.
»Wag es ja nicht! Was willst du eigentlich hier?«
»Die Neue anschauen. Aber wahrscheinlich ist sie noch mit Völxen auf Vorstellungstour.«
»Alexa Julia Wedekin. AYger Name, was?«
»Dafür kann sie ja nichts.«
Ehe das weiter ausdiskutiert werden kann, nähert sich Hauptkommissar Völxen mit seinem charakteristischen wiegenden Gang. An seinem linken Hosenbein klemmt eine Fahrradklammer. Ihm folgt eine junge Frau in schwarzen Jeans und einer weißen Bluse. Sie ist etwa einen Meter siebzig groß und wirkt schlank, besonders im Kontrast zu Völxens kompakter Silhouette.
»Guten Morgen, allerseits«, wünscht der Dezernatsleiter.
Oda und Fernando erwidern den Gruß. Oda deutet dezent auf ihr Kinn, woraufhin sich Völxen rasch einen Papierfetzen aus dem Gesicht wischt. Der Kommissar rasiert sich seit dreißig Jahren aus sentimentalen Gründen mit dem Rasiermesser seines Großvaters. Für gewöhnlich werden die blutstillenden Klopapierfetzen fortgeweht, wenn Völxen zur S-Bahn radelt, aber manche bleiben mitunter hartnäckig kleben und schaffen es bis zur Dienststelle.
»Darf ich vorstellen: Hauptkommissarin Kristensen, Oberkommissar Rodriguez – und das ist Frau Wedekin, unsere neue Kommissarin.«
Mahagonibraunes Haar umrahmt ein schmales Gesicht mit bernsteinfarbenen Katzenaugen. Unter dem linken Wangenknochen ist eine kleine, halbmondförmige Narbe sichtbar.
Ganz apart, aber nicht sein Typ, stellt Fernando mit Kennerblick und Erleichterung fest. Er hatte in dieser Hinsicht einige Bedenken gehabt, denn wie soll man sich auf die Arbeit konzentrieren, wenn einem eine zu verführerische Frau gegenübersitzt, und das jeden Tag? Diese Wedekin sieht noch jünger aus als die sechsundzwanzig Jahre, die in ihrer Personalakte stehen. Edeltraut Cebulla hat ihm dieses Sekretärinnengeheimnis verraten.
»Willkommen«, sagt Oda, und auf ihrem Gesicht erscheint plötzlich jenes warme Lächeln, das man ihren strengen Zügen nie zutrauen würde und mit dem sie andere stets dazu bringt, ihr viel mehr zu erzählen, als sie eigentlich wollen.
»Ja, willkommen«, wiederholt Fernando artig. »Das ist Ihr – äh, unser Büro.«
Er macht eine einladende Geste, aber die Neue rührt sich nicht vom Fleck. Worauf wartet sie? Dass ich sie über die Schwelle trage?
»Das Büro könnt ihr später begutachten«, sagt Völxen und fängt plötzlich an zu schnüffeln. »Was riecht hier eigentlich so? Na, egal. Wir haben einen obskuren Fund auf dem Friedhof Stöcken. Fernando, ich möchte, dass du dir das ansiehst. Und nimm Frau Wedekin gleich mit.«
»Um was geht es denn?«
»Der Kollege von der PK Stöcken meint, es liege möglicherweise ein Leichenteil auf dem Haarmann-Stein.«
Im Dienstwagen herrscht Schweigen.
Gut so, denkt Fernando. Leute, die zu viel quatschen, gehen ihm auf die Nerven. Wieso hat Völxen den pensionierten Kollegen Schulte durch eine so junge Polizistin ersetzt? Die muss entweder saugute Noten haben oder saugute Beziehungen. Oder beides.
Eine Ampel schaltet auf Rot, er dreht den Kopf in ihre Richtung, lächelt. »Ich heiße Fernando. Die meisten Kollegen bei uns duzen einander.«
»Jule.«
»Nicht Alexa Julia?«
»Jule«, kommt es mit einer Spur Schärfe in der Stimme zurück.
»Schön. Jule.«
Schweigen.
»Wo warst du vorher?«, fragt Fernando, den die Neugier drückt.
»PI Mitte.«
Das schlimmste Revier, denkt Fernando, da zur Polizei-Inspektion Hannover-Mitte das Rotlichtviertel, Teile der Drogenszene und die meisten Klubs und Diskotheken gehören. »Dann kennst du dich ja aus im Geschäft.«
»Hast du das bezweifelt?«
»Nein, natürlich nicht«, versichert Fernando eiligst.
»Hör zu, ich weiß, dass ich noch recht jung bin und noch jünger aussehe. Aber davon sollte sich niemand täuschen lassen.« Eine grimmige Falte gräbt sich zwischen ihre Augen.
Überempfindliche Zicke! Fernando presst verstimmt die Lippen aufeinander.
»Seit wann bist du in Völxens Dezernat?«, will nun Jule wissen.
»Seit drei Jahren. Davor war ich beim Rauschgift, ein Jahr lang als Undercover.«
Jule lässt diese Auskunft unkommentiert. Sie ist aufgeregt und versucht es zu verbergen, vor sich selbst, und vor allen Dingen vor diesem Männlichkeitsprotz da neben ihr.
Auch Fernando sagt nichts mehr, bis sie den Parkplatz vor dem Friedhof erreicht haben. Dort parken bereits zwei Streifenwagen.
»Hat sich eklig angehört«, meint Fernando. »Das mit dem Leichenteil. Bin mal gespannt.«
»Keine Sorge, ich kipp schon nicht um«, versetzt Jule. Was glaubt der, wer ich bin? Traut mir wohl überhaupt nichts zu. Ein Leichenteil. Warum ist die Angabe so diffus? Was für ein widerlicher Anblick wartet wohl auf sie?
Oh, Mann, stöhnt Fernando im Stillen. Wäre er nur mit Oda hier oder seinetwegen auch mit Völxen, bloß nicht mit dieser Mimose, die sich ständig angegriffen fühlt. Am besten, man redet gar nichts mehr, dann macht man am wenigsten falsch.
Sie gehen auf den Haupteingang des Friedhofs zu, der in ein imposantes Backsteingebäude integriert ist.
»Was für ein Riesenportal«, staunt Fernando, der sich selten lange an Schweigegelübde hält.
»Es ist Eingang und Kapelle zugleich. Der Friedhof wurde 1891 eröffnet, die Kapelle ein Jahr später«, kommt es aus Jule Wedekins Mund wie auf Knopfdruck.
»Warst du mal Fremdenführerin?«
»Nein. Geschichte interessiert mich einfach.«
Fernando betrachtet die spitz zulaufenden Fenster und Durchgänge. »Ist das gotisch?« Es ist die einzige architektonische Stilrichtung, die er gelegentlich zu erkennen glaubt.
»Neugotisch. Warst du noch nie hier?«
»Nein.«
Ihre Augen werden lebhaft. »Es lohnt sich, nicht nur wegen der historischen Grabmäler. Am schönsten ist der Westteil, er wurde um die Jahrhundertwende nach dem Vorbild eines englischen Landschaftsparks angelegt, mit einem Teich und riesigen Rhododendron-Sträuchern.«
Ehe sie weiter ins Schwärmen geraten kann, werden sie von einem Jüngling in Uniform begrüßt. Fernando hebt lässig die Hand, während Jule Wedekin ihren Dienstausweis zückt, der den Beamten jedoch nicht die Bohne interessiert. Wortlos begleitet er die beiden Kriminaler zum Fundort. Drei Polizisten halten eine Handvoll Leute auf Abstand.
Jule überkommt plötzlich ein Gefühl von Glück und Stolz. Noch vor drei Tagen hätte sie dort gestanden – zumindest theoretisch. Jetzt gehört sie nicht mehr zum Trachtenverein, sondern zu den anderen, zur Kripo. Jetzt ist sie dort, wo sie seit ihrer Kindheit hin gewollt hat. Und dies ist also ihr erster Fall: ein graurosa Fleischbatzen, der auf einem Gedenkstein liegt.
»Darf ich?«, fragt Jule.
»Bitte, gern«, sagt Fernando dankbar, nicht zuletzt, weil das Fleischstück unangenehm riecht. Er reicht ihr ein Paar Latexhandschuhe, denn die Neue hatte noch keine Gelegenheit, sich mit dem Wichtigsten auszurüsten.
Jule überwindet das aufsteigende Ekelgefühl und examiniert den Fund, was ein paar grün schillernde Fliegen zur Flucht veranlasst.
»Und?«, fragt Fernando.
»Eine Zunge.«
»Tier oder Mensch?«
»Mensch.«
»Bist du sicher?«
»Ziemlich. Ich schlage vor, wir lassen sie möglichst rasch in die Rechtsmedizin bringen. Oder willst du den Arzt hierher bitten?«
»Nein. Aber das Fünf-eins-Ka muss her. Das ist die Kriminaltechnik – Erkennungsdienst, Spurensicherung und so«, fügt er erklärend hinzu.
Jule weiß, was das Dezernat 5.1.K tut, aber sie nickt geflissentlich. Sicher meint er es gut. Ein bisschen Imponiergehabe ist bei Männern seines Schlages wohl unvermeidbar.
»Das ganze Gelände muss abgesucht werden, am besten mit Hunden. Vielleicht liegen da noch mehr Teile herum«, meint Fernando. Er wendet sich an die Stöckener Kollegen und bittet sie, den Friedhof für Besucher sperren zu lassen. Dann kämmt er sich mit der Hand durch die Locken, zückt sein Handy und sagt: »Ich frag lieber noch mal den Alten, ehe ich die ganze Truppe hier auflaufen lasse.«
Die neue Kollegin zuckt mit den Schultern.
Wahrscheinlich hält sie mich jetzt für inkompetent, denkt Fernando, während er seinem Chef das Problem schildert.
»Eine Zunge? Von einem Menschen?«, hört er daraufhin Völxen fragen.
»Ja, wir glauben schon. Wir sind natürlich nicht hundertprozentig sicher. Das Ding könnte auch von einem Schaf sein.«
»Ich warne dich!«, knurrt es aus dem Apparat.
»Soll ich die Fünf-eins-Ka anfordern und das Gelände von der Hundestaffel absuchen lassen, falls da noch mehr liegt?«
»Ja klar, was denn sonst?«, schnauzt Völxen.
Bis die angeforderten Einheiten eintreffen, nehmen sich Fernando und Jule die beiden Finder der Zunge, Walter Schmiedel und Edwin Elsemann, vor, die folgsam Rede und Antwort stehen: Nein, sie haben keine verdächtigen Personen gesehen, eigentlich gar niemanden. Nein, gestern hat die Zunge noch nicht auf der Grabstätte gelegen, da ist sich Walter Schmiedel ganz sicher.
Eine halbe Stunde später wimmelt es von Uniformen, Hunden und den weiß gewandeten Beamten der Spurensicherung, die ihre Ausrüstung rund um das Grab aufbauen.
Jule und Fernando beobachten die Männer, die hinter den Hunden langsam und suchend über den frisch gemähten Rasen schreiten.
»Hoffentlich irrst du dich nicht, und das Teil stammt nicht doch nur von einem Tier«, meldet Fernando leise Zweifel an.
»Ich hab mal ein Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht. Den Rasenschnitt von heute Morgen sollten wir sicherstellen«, schlägt Jule vor.
»Gute Idee.«
»Ich glaube aber nicht, dass man hier noch was findet.«
»Warum nicht?«, fragt Fernando.
»Da war nirgendwo Blut. Wenn hinter der abgeschnittenen Zunge ein Tötungsdelikt steckt, dann ist es bestimmt woanders passiert.«
»Wenn«, betont Fernando.
Beide verstummen für ein paar nachdenkliche Minuten.
»Du kannst jetzt von mir denken, was du willst, aber ich habe einen saumäßigen Hunger«, gesteht Fernando.
»Ich auch«, bekennt Jule, die ohne Frühstück aus dem Haus gegangen ist.
»Dann lass uns doch … ach, Scheiße!«, unterbricht sich Fernando und eilt zu einem der Männer in Weiß. »Muss die Zunge noch da liegen?«
»Nein, die kann weg. Wir sind schon fertig mit den Fotos.«
»Schnell, bitte. Da hinten kommt Markstein, der Arsch.«
Zwei Streifenbeamte nehmen den Plastikbeutel mit der Zunge entgegen.
»Das muss ins Rechtsmedizinische Institut. Geht hintenrum raus«, bittet Fernando.
Mit weit ausgreifenden Schritten strebt ein Mittdreißiger auf sie zu. Er trägt Cowboystiefel und sein langer, tief geschlitzter Trenchcoat flattert eindrucksvoll hinter ihm her. Er sieht aus, als wäre er gerade vom Gaul gestiegen und hätte unterwegs den Kopf in einen Brunnentrog gesteckt, aber seine schulterlangen mausbraunen Haare sind nicht nass, sondern fettig. Ihm folgt ein Fotograf, der schon auf dem Weg wild um sich knipst.
»Ich hörte etwas von einem Leichenteil, das hier liegen soll?« Marksteins Wieselaugen mustern auffordernd die Runde.
Niemand antwortet.
»Herr Kommissar, bitte, ein Statement.«
»Wenden Sie sich an die Pressestelle, Herr Markstein.«
Der Reporter wendet sich jedoch lieber an Jule Wedekin: »Oh, ein neues Gesicht bei der Kripo? Darf ich mich vorstellen? Boris Markstein von der Bild Hannover.«
Jule nickt ihm zu, macht aber keine Anstalten, sich ebenfalls vorzustellen. Sie hat den Reporter schon öfter an Tatorten erlebt und nicht in bester Erinnerung. Markstein seinerseits hat sie damals in Uniform anscheinend nicht wahrgenommen.
»Sagen Sie bloß, da lag ein Leichenteil auf dem Haarmann-Stein«, schlussfolgert Markstein aus der Szenerie rund um das Grabmal. »Ist ja hammermäßig. Was war es? Nun sagen Sie schon, ich bitte Sie«, umschwänzelt er Jule.
»Sie haben gehört, was Oberkommissar Rodriguez gesagt hat.«
»Eine Zunge. Die junge Dame hat gesagt, das ist eine Zunge. Von einem Menschen.« Das war Walter Schmiedel, der die einmalige Chance gekommen sieht, sein Konterfei in dem von ihm bevorzugten Printmedium zu sehen. »Ich habe sie gefunden.«
Markstein grinst wie eine Muräne in Fernandos Richtung, ehe er sich daran macht, Walter Schmiedel auszuquetschen.
Jule läuft knallrot an. Hätte sie doch bloß vorhin den Mund gehalten!
»Komm, wir verschwinden«, brummt Fernando missgelaunt.
»Und?« Bodo Völxen lehnt an Odas Schreibtisch, auf dem noch die Unordnung des Umzugs herrscht, und schaut sie erwartungsvoll an.
»Was und?«, fragt Oda und räumt weiter Akten aus einer Umzugskiste in ein Regal.
»Wie findest du sie?«
Oda zuckt mit den Schultern. Sie ist ein wenig eingeschnappt – der obskure Leichenteilfund klang interessant, sie wäre gerne mitgefahren anstelle der Neuen.
»Wenn ich beim Einstellungsgespräch dabei gewesen wäre, dann könnte ich jetzt vielleicht mehr über sie sagen«, antwortet Oda und bemerkt zu ihrer Genugtuung, wie sich Bodo Völxen verlegen über den allmählich immer weiter zurückweichenden Haaransatz fährt.
»Du warst in Urlaub. Hätte ich gewartet, hätte sie uns das FK weggeschnappt.« Das FK ist das Dezernat für Organisierte und Schwerst-Kriminalität.
»War sie denn so begehrt?«
»Allerdings. Sie hat als Jahrgangsbeste an der Fachhochschule abgeschlossen, und von der PI Mitte hat sie durchweg beste Beurteilungen bekommen.«
»Na, dann herzlichen Glückwunsch zu diesem Fang. Wieso fängt sie eigentlich an einem Dienstag an, und nicht schon gestern?«
»Gestern ist sie umgezogen.«
»Wedekin, Wedekin«, sinniert Oda vor sich hin. »Der Name kommt mir bekannt vor.«
»Alter Hannoverscher Stadtadel. Ihr Vater ist Jost Wedekin, Professor für Transplantationschirurgie an der Medizinischen Hochschule. Die Mutter ist Cordula Wedekin, die Pianistin. Sabine hat schon mal mit ihr gespielt.«
»Ein echtes höheres Töchterchen also. Und so was geht zur Polizei?«
»Wenn ich es richtig herausgehört habe, hat sie diese Laufbahn gegen den Willen der Eltern eingeschlagen.«
»Die selbstverständlich wollten, dass sie Medizin studiert«, vermutet Oda.
»Hat sie ja auch«, antwortet Völxen. »Vier Semester. Dann ist sie zur Polizei.«
»Moment mal«, Oda rechnet, »zwei Jahre Medizin, drei Jahre FH, drei Jahre PI Mitte …«
»Sie hat mit achtzehn Abitur gemacht. Hat wohl eine oder zwei Klassen übersprungen.«
»Heureka, ein Wunderkind. Spielt sie auch Klavier?«
»Du wirst doch keine Vorurteile pflegen, Oda?«
Oda quetscht den letzten Ordner ins Regal, stemmt die Hände in die Hüften und sieht ihren Vorgesetzten streng an.
»Schon gut«, lenkt der ein. »Es klang nur so.«
Ein Zigarillo wird angesteckt, und durch die Rauchwolke sagt Oda: »Nein, ich hege keine Vorurteile. Ich hatte nicht einmal bei Fernando welche, und dem eilte ja durchaus ein gewisser Ruf voraus.«
»Dank deines guten Einflusses auf ihn ist aus ihm ja auch ein recht brauchbarer Kriminaler geworden«, versucht Völxen sich einzuschmeicheln. »Es gab schon lange keine Beschwerde mehr über ihn. Und die Wedekin wird sich alle Mühe geben, da bin ich mir sicher.«
»Natürlich wird sie das. Wahrscheinlich wird sie die erste weibliche Polizeipräsidentin der Stadt.«
»Warum nicht? Ich hätte kein Problem damit.«
Völxens Stimme klingt beim letzten Satz ein wenig gereizt, darum lenkt Oda Kristensen ein: »Du hast vermutlich recht. Ich werde alt und stutenbissig. Du wärst ein Schaf gewesen, wenn du nicht sofort zugegriffen hättest.«
Bei dem Wort Schaf zieht ihr Chef die buschigen Brauen über seinen grauen Augen zusammen. »Vorsicht.«
»Apropos. Was macht deine Herde?«, leitet Oda ein kleines Ablenkungsmanöver ein.
»Prächtig geht’s denen, ganz prächtig.«
»Ist doch schön.«
»Ja.«
»Aber?«
Vor Oda kann man so gut wie nichts verbergen, zumindest Völxen kann es nicht: »Ich habe Amadeus weggegeben. Den Schafbock. Das Mistvieh hat mich angegriffen, mehrmals. Gegnern mit Hörnern bin ich einfach nicht gewachsen.« Sein bekümmerter Blick wirbt um Verständnis und Absolution.
»Wo ist er jetzt?«
»Bei einem Schafzüchter in der Heide. Der will ihn zur Zucht verwenden.« Völxen atmet schwer. Zucht. Das klingt ja erst mal nach Vergnügen. Aber wie lange? Was passiert, wenn Amadeus mal nicht kann?
»Ist doch in Ordnung. Ein Paradies, sozusagen«, meint Oda.
»Meinst du wirklich?«
Oda grinst.
Resigniert entfernt sich Völxen aus ihrem Büro.
Oda Kristensen dagegen fragt sich, während sie sich den nächsten Zigarillo ansteckt, ob die Wedekin, dieses junge Genie, wirklich zu ihnen passt.
Fast jeden Tag geht Heinrich Hofer mit seinem Terrier Nielsson am Ufer des Maschsees spazieren. Der Rundweg um den See beträgt gute sechs Kilometer, aber Hofer geht meist nur am Westufer entlang und kehrt vor dem Strandbad um. Das Westufer folgt dem krummen Lauf der Leine, und entlang des Flusses findet sich eine nahezu unberührte Wildnis, was besonders der Terrier sehr schätzt. Zu Weihnachten hat Hofer sich selbst eine Digitalkamera geschenkt, und nun plant er die Anfertigung eines Fotokalenders. Den wird er sich in diesem Jahr wiederum zu Weihnachten schenken, denn sonst gibt es niemanden zu beschenken, höchstens den Hund.
Auch heute hat er seine Kamera dabei, während er mit Nielsson unter den Bäumen am Wasser entlanggeht. Ein paar Segler sind auf dem Wasser, der Wind weht kühl aus Nordost. Bald wird es hier noch voller werden, sowohl auf dem Wasser als auch drum herum. Zum Glück gibt es auf dem schmalen Landstück zwischen Fluss und Ufer getrennte Wege für Fußgänger und für Radfahrer. Anderenfalls wären Karambolagen mit Radlern und Inlinern unvermeidlich. So gehen einem nur diese Idioten mit ihren klackernden Skistöcken auf den Wecker, aber von denen sind heute erst wenige unterwegs.
Er betritt einen kurzen Holzsteg und prüft die Perspektive. Ja, von hier hat man einen guten Blick über den See, der an dieser Stelle nur zwei-, dreihundert Meter breit ist. Die Südstadt liegt quasi gleich gegenüber, fast zum Greifen nah ist die Plattform des Restaurants Pier 51, auf der ein Kellner gerade die weißen Sonnenschirme aufspannt.
Interessanter ist allerdings der Blick über die nördliche Hälfte des Sees, hinüber zum schlossähnlichen Prachtbau des Neuen Rathauses, das so neu auch wieder nicht ist, und zu den verschachtelten Glaswürfeln der Nord-LB.
Hofer bringt die Kamera in Position und wartet auf ein Segelboot, das den Vordergrund des Bildes zieren soll. Nielsson kläfft.
»Sei still, Nielsson. Es geht gleich weiter.«
Aber der kleine weiße Hund gibt keine Ruhe.
Hofer lässt entnervt die Kamera sinken. »Was ist denn?«
Nielsson zieht an der Leine und bellt das Wasser an, das am Ende des Stegs höchstens knietief ist. Hofer sieht nach unten und entdeckt eine helle Fläche, etwa eine Handbreit unter der Wasseroberfläche. Er kneift die Augen zusammen und starrt in ein Gesicht. Obwohl er zurückweichen will, muss er, vor Schreck wie gelähmt, doch hinsehen: gelbgrüne Haut, spärliches dunkles Haar, das wie Seetang auf dem runden Schädel wabert, die Augen des Mannes sind weit offen und wirken gläsern, fast durchsichtig, der Mund ist eine dunkle Höhle. Ein schlammfarbener Mantel schlackert langsam, im Takt der Wellen, um den Leib, die Hände schimmern kalkweiß durch das grünliche Wasser. Unterhalb der Knie ragen die Beine bis unter den Steg, sodass Hofer im nächsten Moment klar wird, dass er sozusagen auf einer Leiche steht.
»Heiliger Strohsack!« Hastig verlässt Hofer den Steg, den widerstrebenden Nielsson hinter sich herzerrend. Nach wenigen Schritten ist er wieder auf dem sicheren Fußweg und begreift nicht, wie die Welt so normal wirken kann. Vögel zwitschern, Radfahrer flitzen ahnungslos an ihm vorbei. Er schaut sich zögernd um. Das silberne Glitzern der wellenbewegten Wasseroberfläche blendet ihn und verwehrt so den Blick auf die Leiche, die da drüben im Seichten dümpelt, ein paar Meter neben dem belebten Fußweg. Eine geradezu surreale Vorstellung. Hofer atmet schwer, greift sich an die Brust. Jetzt bloß keinen Herzanfall bekommen. Zum ersten Mal bereut er es, sich noch immer kein Mobiltelefon angeschafft zu haben. Aber wen sollte er damit normalerweise auch anrufen? Er wendet sich um. Ein Herr in einem Anzug und einem Trenchcoat, ähnlich dem, den die Leiche da unten trägt, nähert sich. Der hat bestimmt so ein Ding in seiner Aktentasche.
»Wo fahren wir eigentlich hin?«
»Was essen.«
Ist das vielleicht eine klare Antwort? Ungehobelter, selbstgefälliger Kerl, grollt Jule innerlich. Denkt wohl, er ist der große Zampano, mit seinen Espressoaugen und den Schmalzlocken. Nein, Junge, das wird sich noch erweisen müssen, ob du genug drauf hast, um auf Dauer den Ton angeben zu können. Apropos Ton: »Und warum haben wir Kerzen und Musik an und rasen wie die Verrückten?«
»Du hast gesagt, du hast Hunger.«
Jule Wedekin ist während ihres dreijährigen Berufslebens als Polizistin zu der Ansicht gelangt, dass es zwei Sorten von Polizisten gibt: Die, die mit einem mulmigen Gefühl verkrampft am Steuer sitzen, wenn sie Blaulicht und Sirene anhaben, und die, die es genießen und vermutlich deswegen Polizist geworden sind. Zu welcher Gruppe Fernando gehört, ist sonnenklar. Sie krallt sich am Sitz fest. Immerhin hat er ihr keine Vorwürfe gemacht, weil sie sich vor den beiden Zeugen verplappert und von der Zunge geredet hat. Aber wer konnte schon ahnen, dass dieser Schmiedel sein Wissen brühwarm an den Bild-Reporter weiterleiten würde? Und wie schnell dieser Boris Markstein überhaupt vor Ort gewesen ist. Solche Kerle sind wie Fliegen, die riechen das Aas kilometerweit.
Fernando ist an der Ausfahrt Linden-Mitte vom Westschnellweg abgebogen und kurvt nun mit traumwandlerischer Sicherheit durch die engen Einbahnstraßen. Wenigstens Sirene und Blaulicht hat er inzwischen abgeschaltet.
Aber der Kollege scheint sich in diesem Viertel nicht nur gut auszukennen, er ist hier offenbar auch bekannt. Jedenfalls wird er von einigen Männern auf der Straße gegrüßt. Dann fährt er Schritt und hält kurz an, es gibt einen kleinen Wortwechsel – deutsch, spanisch, ein paar Brocken türkisch. Um ungestört Konversation machen zu können, hat ihr Kollege die Seitenscheibe heruntergelassen. Sein linker Ellbogen in der schwarzen Lederjacke liegt lässig im Fensterrahmen. Machoarsch!
Schließlich parkt Fernando vor einer Einfahrt mit einem Eisentor.
»Was ist damit?« Jule weist auf ein Schild am Tor, das Autofahrern mit dem Abschlepphaken droht.
»Das geht in Ordnung«, sagt Fernando. Die Autowerkstatt hinter dem Tor gehört seinem Freund Antonio, und der kennt die Dienstwagen der PD. Nach Möglichkeit parkt Fernando fast jeden Mittag hier, und gelegentlich tun Völxen und Oda es ihm gleich.
Sie überqueren die Straße und betreten einen karg eingerichteten Laden. Metallregale, Betonfußboden, in der Mitte schnurrt eine Kühltruhe, und am Endes des lang gezogenen Raums steht eine monströse Kühltheke mit frischen Lebensmitteln: Schinken, Käse, Würste, eingelegte Oliven.
Eine Frau in Kittelschürze wieselt hinter der Theke hervor. Ihr Haar ist tiefschwarz, mit grauen Strähnen durchsetzt und zu einem dicken Zopf geflochten, der sich ihren Rücken hinunterwindet. Sie hat sichelförmige Augen, dunkel wie schwarze Oliven, und eine schmale, gebogene Nase. Augen und Nase sind gleich, registriert Jule. Auch der breite Mund zeugt von Verwandtschaft. Nur dass Fernandos Oberlippe gründlicher rasiert ist.
»Fernando, mi corazón!« Pedra Inocencia Rodriguez stellt sich auf die Zehenspitzen und küsst ihren Sohn rechts und links auf die Wangen, als hätte sie ihn seit Wochen nicht gesehen. Dann mustert sie Jule mit unverhohlenem Interesse. Fernando stellt seine neue Kollegin vor, wobei er das Wort colega betont.
»Bienvenida, Jule.« Frau Rodriguez spricht ihren Namen Chule aus, mit einem harten, kehligen Ch. Dann wird auch Jule auf beide Wangen geküsst. Frau Rodriguez’ Schnurrbart kitzelt ein wenig, und Jule Wedekin muss dabei an das Gesicht ihrer Mutter denken, das dank High-Tech-Kosmetika und plastischer Chirurgie so straff ist wie ein Bettlaken im Sheraton.
»Was wollt ihr essen? Alles frisch vom Großmarkt.« Ehe sie selbst eine Wahl treffen können, entscheidet Frau Rodriguez: »Ihr habt sicher Hunger. Ich mache euch einen Teller mit allem.« Ihr R klingt wie das Knurren eines Rottweilers.
»Und zwei Kaffee, bitte«, ordert Fernando und fügt an Jule gewandt hinzu: »Du bist natürlich eingeladen.«
»Nein, das möchte ich nicht.«
»Mama wäre sonst tödlich beleidigt.«
»Exactamente«, tönt es hinter der Theke hervor wie Donnergrollen.
»Also gut«, ergibt sich Jule.
Ein Korb mit Brot und eine riesige Platte mit Tapas werden auf einen der beiden kleinen Stehtische gestellt.
»Lang zu«, sagt Fernando und greift nach einer scharf aussehenden Wurst und einer in Speck gewickelten Dattel.
Seine Kollegin erklimmt einen der Hocker, probiert den Käse und etwas, das wie eine Pastete aussieht.
»Warum legt jemand eine Zunge auf einen Grabstein?«, fragt sie und spießt dabei eine Olive auf. »Noch dazu auf diesen Grabstein.«
»Keine Ahnung. Ich frag mich, wem man sie abgeschnitten hat. Und: tot oder lebendig?«
»Es gab wohl keine Leiche ohne Zunge die Tage?«, erkundigt sich Jule und gestattet sich ein kleines Lächeln.
Wenn sie lächelt, stellt Fernando fest, strahlt sie tatsächlich einen gewissen, wenn auch spröden Charme aus. Vielleicht ist sie doch ganz brauchbar. Zudem scheint seine Mutter sie zu mögen, und die ist wie ein Seismograph. Leute, die Pedra Rodriguez nicht gefallen, erweisen sich früher oder später immer als zweifelhafte Charaktere. Besonders Frauen.
»Nicht, dass ich wüsste«, antwortet er.
»Vielleicht ein makabrer Scherz von Medizinstudenten«, meint Jule.
»Die tun so was?«
Jule zuckt die Achseln. »Es wäre wenigstens eine harmlose Erklärung.«
»Ob es was mit einem der Opfer von Haarmann zu tun hat?«, sinniert Fernando, aber dann schüttelt er den Kopf. »Nein. Die müssten ja heute über hundert sein. Und selbst deren Kinder wären schon über achtzig. Ich glaube, das können wir vergessen, was meinst du?«
»Die werden kaum Kinder gehabt haben. Das waren alles alleinstehende junge Herumtreiber. Pupenjungs.«
»Pupen-was?«
»Haarmann hat sie im Verhör Pupenjungs genannt. Das waren doch nur Pupenjungs. Es gab letztes Jahr ein großartiges Schauspiel mit diesem Titel.«
»Ah, ja.« Fernando hat nie davon gehört, wie auch, er geht nie ins Theater. Manchmal leiht er sich ein Video aus. Entweder Action-Streifen oder – aber das würde er niemals erzählen – Bollywood-Filme. Nur seine Mutter weiß von diesem geheimen Laster, denn die beiden wohnen zusammen in der geräumigen Altbauwohnung über dem Laden. Fernando und seine Schwester sind in dieser Fünf-Zimmer-Wohnung geboren worden und aufgewachsen. Vor zwanzig Jahren ist ihr Vater verstorben, und Fernandos Schwester ist inzwischen verheiratet und Mutter eines sechsjährigen Sohnes, sodass nur Fernando und seine Mutter noch über dem Laden wohnen. Es ist eine ganz normale WG, findet Fernando. Leider sehen die Frauen das anders. Sie reagieren ausnahmslos so, als hätte er eine peinliche, unappetitliche Krankheit, sobald sie davon erfahren. Dabei ist Fernando durchaus bereit, auszuziehen und einen eigenen Hausstand zu gründen, sobald ihm die Richtige begegnet. Anmutig und sanftmütig sollte sie sein, mit langen, duftenden Haaren und braunen Mandelaugen mit langen Wimpern …
»Vielleicht stammt die Zunge von einem, der zu viel redete«, mischt sich Jule Wedekins Stimme in seine Tagträume.
»Du meinst, so ein Mafia-Ding?«
»Einer, der der Polizei zu viel erzählt hat«, spinnt Jule den Faden weiter. »Haarmann war ein Polizei-Spitzel in Sachen Schwarzhandel, Einbruch und Hehlerei. Nach seiner Festnahme 1924 hat man der Polizei vorgeworfen, frühen Hinweisen aus der Bevölkerung nicht nachgegangen zu sein und Haarmann durch seine Beschäftigung als Undercover begünstigt zu haben.«
»Klingt weit hergeholt«, bemerkt Fernando.
»Stimmt«, gibt Jule zu. »Es gibt viele Deutungsmöglichkeiten. Es kann auch was mit Schwulen zu tun haben …«
»Wieso mit Schwulen?«
»Die Pupenjungs.«
»Ah, ja. Vielleicht kann Oda was damit anfangen.«
»Wieso Oda?«
»Sie hat Psychologie studiert.« Ein Hauch von Stolz schwingt in seiner Stimme.
»Sie erinnert mich an meine Ballettlehrerin«, meint Jule zwischen zwei Bissen. »Sie hat so was Strenges.«
Mit einem spöttischen Lächeln sieht Fernando auf Jule herab. »Ballett, ja? Gab’s auch ein Reitpferd?«
Jule antwortet nicht.
Ich Idiot, denkt Fernando, hätte ich bloß den Mund gehalten! Jetzt ist sie wieder eingeschnappt, wo das Eis gerade ein paar Risse bekommen hatte.
»Oda ist schon in Ordnung«, sagt Fernando, Jules beleidigte Miene ignorierend.
Pedra Rodriguez bringt den Kaffee. Ihre Gäste haben die Platte fast leer geputzt. »Wollt ihr ein paar Dulces?«
»Nein, danke«, lehnt Jule ab.
»Was ist das – das Fleisch mit dem roten Zeug drum herum«, will Fernando von seiner Mutter wissen.
»Schafzunge in Portweingelee.«
Fernando schiebt seinen Teller angeekelt von sich.
Aus seiner Jackentasche erklingt Hells Bells. »Mist, das ist Völxen.« Hastig fingert er das Handy aus der Tasche. »Wir sind unterwegs«, ruft er hinein, während seine Mutter über seine Schulter krächzt: »El comisario! Muchos saludos de mi parte!« An Jule gewandt klagt sie: »Er war schon lange nicht mehr hier. Früher ist er jeden Tag gekommen.«
»Pscht!«, macht Fernando ärgerlich. »Was? Ja, erwischt. Wir mussten schnell was essen gehen, Frau Wedekin hatte Hunger. – Ja, ich grüße die Mama.« Nachdem Fernando Völxen noch eine Weile zugehört hat, steckt er den Apparat wieder ein und sagt zu Jule, deren Gesicht zur Faust geballt ist: »Es gibt einen Leichenfund am Maschsee.«
Den Toten hat man nahe dem Ufer abgelegt, die Wege sind abgesperrt. Dr. Bächle macht sich an der Leiche zu schaffen, während weiße Gestalten zwischen dem Fußweg und dem Steg hin und her huschen, Nummernschildchen platzieren, fotografieren, messen. Abwartend und aus einiger Entfernung sieht Hauptkommissar Völxen dem Treiben zu. Oda Kristensen unterhält sich mit dem Rentner, dessen Hund die Leiche entdeckt hat.
Der Tote hat knapp fünfhundert Euro in seiner Geldbörse, außerdem stecken sein Handy und seine Ausweispapiere im Mantel. Dr. Martin Offermann, geboren am 12. Februar 1945, wohnhaft in Hannover-Kleefeld, verrät sein Personalausweis, den Völxen soeben studiert hat. Dahinter klemmen ein paar identische Visitenkarten:
Dr. Martin Offermann – Dr. Liliane Fender
Psychiatrie
Psychoanalyse
forensische Psychiatrie
Auf der Rückseite stehen die Adresse und zwei Telefonnummern, Praxis und privat.
»Bächle, was ist denn nun?«, ruft Völxen ungehalten.
Der Angesprochene richtet sich auf und kommt auf den Kommissar zu. Er ist einen Kopf kleiner als Völxen, und obwohl Justus Bächle erst Mitte vierzig ist, hat er schlohweißes Haar, um dessen Fülle ihn Völxen allerdings beneidet. Sein Gesicht erinnert an einen beleidigten Dackel, was daran liegen mag, dass er stets den Kopf leicht gesenkt hält und einen von unten herauf ansieht. »Pressiert’s?«
»Ich schlage hier langsam Wurzeln«, mault Völxen.
»No net hudle.«
»Wie bitte?«
»Nicht so eilig«, übersetzt der Rechtsmediziner und lässt sich dann zu einer ersten Stellungnahme herab: »Todeszeitpunkt geschtern Abend zwischen dreiundzwanzig und vierundzwanzig Uhr. Plus minus eine Schtunde. Tod durch drei Schüsse, zwei in den Bauch, einer ins Herz. Außerdem wurde die Zunge entfernt.« Dr. Bächles Sprechweise hat – neben ihrem unverkennbaren schwäbischen Akzent – etwas Müdes, Schleppendes, als hätte man ihn gerade eben aus seinem Dackelschlaf gerissen.
»Wie entfernt?«, hakt Völxen nach.
»Abg’schnitte’«, präzisiert Bächle. »Wahrscheinlich poscht mortem. Die Zunge fehlt.«
»Vermutlich haben Sie die«, sagt Oda, die zu den beiden Männern getreten ist.
»Ich?« Das Dackelgesicht wird bei Odas Anblick ein wenig munterer. Sie ist die Einzige, die ihn einen schwäbischen Leichenfledderer nennen darf, ohne dass er beleidigt ist.
»Heute Morgen wurde eine Zunge auf dem Friedhof Stöcken gefunden. Sie muss mittlerweile bei Ihnen im Institut eingetroffen sein«, präzisiert Völxen.
»Darf ich mal sehen?« Dr. Bächle weist auf Offermanns Personalausweis, den Völxen ihm daraufhin überlässt.
»Gell, ich hab’s doch g’wusst!«, sagt er dann und schlägt mit der rechten Faust in seine linke Handfläche. »Des isch der Dr. Offermann.« Bächle schüttelt langsam den Kopf. »Immer so viel g’schwätzt, und jetzt so was.«
»Vielleicht genau deswegen«, murmelt Oda.
»Offermann, Offermann …«, grübelt Völxen. »Woher kenne ich den?«
»Vom Gericht und aus dem Fernsehen wahrscheinlich«, antwortet Oda. »Er ist als Gutachter in Strafprozessen aufgetreten. Sexualstraftaten waren sein Fachgebiet.«
»Schtimmt genau, Frau Krischtensen«, versichert Bächle eilig.
Dem Hauptkommissar dämmert es: »Mein Gott, ja. Der Offermann ist das?« Unwillkürlich macht Völxen Anstalten, auf die Leiche zuzugehen, wird aber sofort von Rolf Fiedler angepfiffen: »Nur zu, Völxen! Zertrampel auch du mir ruhig noch die Spuren.«
Völxen flucht leise. Er hasst es, an Tatorten herumstehen zu müssen, und hat sich nach dem Anruf der Leitstelle extra Zeit gelassen. Aber wieder heißt es warten, wie immer.
Wenigstens liefert Fiedler einen kleinen Zwischenbericht: »Am Wegrand lagen Hülsen, Kaliber 9-mm-Parabellum.« Er deutet auf eine Stelle, an der zwei seiner Kollegen gerade Scheinwerfer aufstellen. Ein dritter gießt vor dem Steg Gips aus. Fiedlers Leute würden sicherlich noch einige Stunden zu tun haben. »Die Leiche wurde vom Weg aus die paar Meter da rübergezerrt, zum Steg, und von dort aus ins Wasser geworfen, es gibt Schleifspuren und Faserspuren am Holz.« Die Stelle, von der der Leiter der Spurensicherung spricht, liegt im Schatten eines Ahorns und ist spärlich mit Gras und Unkraut bewachsen. Da es schon länger nicht mehr geregnet hat, ist die Erde zwischen Weg und Wasser ausgetrocknet. Wie kann es da Spuren geben, fragt sich Völxen. Aber die Spezialisten sehen Dinge, die der normale Mensch nicht wahrnimmt, auch das ist immer so. Zum Glück. »Oda, wollen wir eine Kleinigkeit essen gehen?«
Oda steht einen Zigarillo qualmend im grünen Dämmerlicht und scheint den Ausblick zu genießen. Eine Weide ragt übers Wasser und badet ihre Zweige darin. Kleine Wellen platschen ans Ufer, drei Enten nähern sich in der Hoffnung auf Futter, ein Segler gleitet über die silbrige Wasserfläche, im Hintergrund sonnt sich die Silhouette der Stadt.
»Oda, ich rede mit dir!«
»Ein schöner Platz zum Sterben.«
»Aber nicht auf diese Art«, widerspricht Völxen. »Außerdem hatte er um die Uhrzeit, zu der er starb, wenig von der Aussicht. Also komm jetzt, ich hab Kohldampf! Wir könnten mal wieder zu Mama Rodriguez gehen.«
Sie setzen sich in Bewegung. Vor der Absperrung zum Ohedamm steht eine Gruppe Nordic Walker. Die rüstigen Senioren diskutieren mit dem Polizisten: »Aber so sagen Sie uns doch wenigstens, was los ist!« – »Und wie lange dauert das noch?« – »Aber die da dürfen doch auch durchgehen!« Einer zeigt mit dem Stock auf die Kripobeamten.
»Kripo Hannover, es handelt sich um einen Leichenfund, und das dauert noch Stunden«, sagt Völxen, woraufhin die knallbunt gekleidete Meute aufgeregt tuschelnd den Rückzug antritt.
»Diese Stöcke, diese Klamotten«, meint Oda kopfschüttelnd, »wie kann sich ein Mensch so lächerlich machen?«
Völxen sagt nichts dazu.
»Wir gehen ins Marriott«, bestimmt Oda im Weitergehen.
»Nichts da! Bin ich Krösus?«
»Stell dich nicht so an. Du bist eine Besoldungsgruppe über mir.
»Ich muss sparen, ich habe Familie. Frau, Kind, Schafe.« – Die Schafe … Natürlich hat Sabine recht behalten. »Die werden einen Haufen Geld kosten und mehr Arbeit machen als das Mähen«, hat sie vor einem Jahr prophezeit. »Bestimmt nicht. Schafe sind genügsam und pflegeleicht«, hat Völxen entgegnet. »Du wirst schon sehen.« Ein kleines Vermögen hat er seitdem ausgegeben für bewegliche Elektrozäune, Kraftfutter, Wurmkuren, den Tierarzt, nicht zu vergessen die Gebühren für den Kursus Schafe selbst scheren. Es wäre billiger gewesen, den Rasentraktor reparieren zu lassen.
»Wir müssen doch sowieso da hin«, beharrt Oda.
»Gut, wenn es denn sein muss«, lenkt ihr Vorgesetzter irritiert ein.
»Offermann hat dort gestern Abend einen Vortrag gehalten.«
»Und das sagst du mir jetzt?«
»Wann denn sonst?«, erwidert Oda.
Völxen beißt die Zähne zusammen. »Woher weißt du von dem Vortrag?«
»Ich war dort.«
Sie setzen sich in eine windstille Ecke der Terrasse. Völxen telefoniert mit Fernando. Er soll herausfinden, ob Martin Offermann Angehörige hat, ob etwas gegen ihn vorliegt, die übliche Prozedur: »Und dann fahrt in die Praxis nach Kleefeld und redet mit einer gewissen Dr. Liliane Fender, das muss seine Kollegin sein. – Todeszeitpunkt? Mitternacht, plusminus eine. Hat sich die Pathologie schon wegen der Zunge gemeldet? – Die sollen auch die DNA überprüfen. – Ja, Offermann wurde die Zunge raus … Augenblick. Ich meld mich wieder.«
»Was darf es für die Herrschaften sein?«, erkundigt sich ein Mädchen mit einem langen blonden Pferdeschwanz, das an ihren Tisch getreten ist.
»Einen Sommersalat mit Thunfisch und eine große Apfelschorle«, bestellt Völxen.
»Wir haben heute auch Spezialitäten vom Lamm. Lammlachse auf Frühlingsgemüse mit Rucola, Lammkotelett vom Grill mit Folienkartoffel oder die Lammkeule mit Bärlauchkartoffeln und Salatteller.«
»Nein, danke!«, wehrt Völxen entrüstet ab.
»Für mich bitte den gleichen Salat und ein Pils vom Fass, ein großes«, ordert Oda.
Die Bedienung verschwindet.
»Verdammte Lämmerfresserei. Sind wir in Anatolien, oder was?«, regt sich Völxen auf.
»Scher dich nicht drum«, rät Oda.
Ihr Chef schweigt und runzelt die Stirn. Er ist diese ewigen Schafswitze leid und außerdem ärgert er sich, nicht ebenfalls ein Bier vom Fass bestellt zu haben.
Ende der Leseprobe