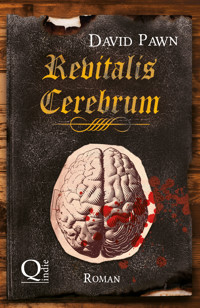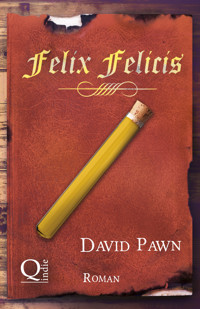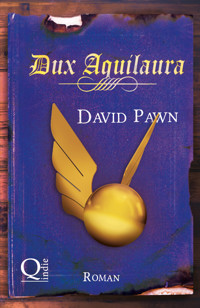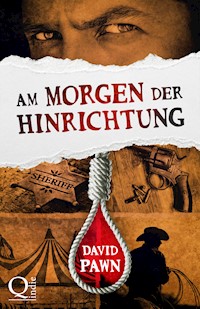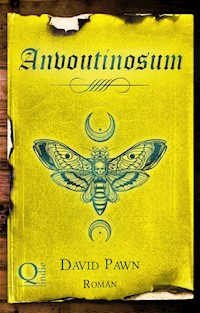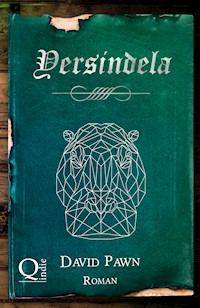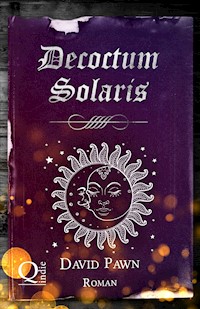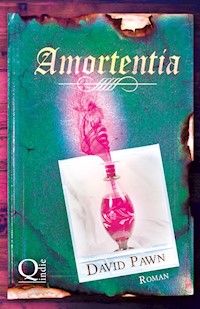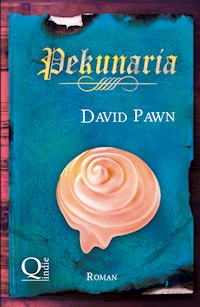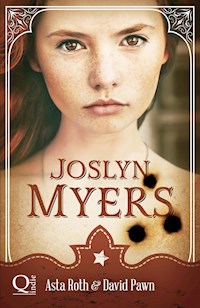Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Reich hatte der Traumlord die Macht an sich gerissen, indem er den Menschen ihre Träume stahl und noch immer stiehlt. Zurück bleiben Menschen ohne Hoffnung, ohne Ziel. Der Gute Träumer, einer dessen Träume so übermächtig sind, dass er ihrer nicht zu berauben ist, macht sich auf, den Tyrannen zu besiegen. Auf seinem Weg muss er drei Dinge finden, die ihm die Macht geben sollen, den Traumlord zu überwinden. Der Weg ist steinig. Immer neue Gegner erschafft der Traumlord dem Guten Träumer, doch auch dieser kann immer neue Träume zu seinem Schutz herbeirufen. Wird das Gute am Ende siegen, wie es sich für ein Märchen gehört? Wird der Gute Träumer seine Quest bestehen? Lesen Sie dieses Buch, wenn Sie es erfahren wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Pawn
Der Traumlord
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I.
II.
III.
IV.
V .
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.
LXXIX.
LXXX.
LXXXI.
LXXXII.
LXXXIII.
LXXXIV.
LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.
LXXXVIII.
LXXXIX.
XC.
XCI.
Impressum neobooks
I.
Der Wald wurde zunehmend dunkler und unwirklicher und Michael, der Gute Träumer, wusste, dass er ihn niemals nachts durchstreifen durfte. Aber mittlerweile sank bereits die Sonne und die Abenddämmerung kündigte sich an wie eine böse Fee. Es wäre an der Zeit gewesen, diesen Wald zu verlassen, aber um umzukehren, war es vermutlich zu spät, und eine Lichtung oder gar das Ende des Waldes waren nicht in Sicht.
Als Michael auf seinem Weg in den Wald hineingeritten war, hatte dieser sich grün, sonnig und freundlich gezeigt. Bunt schillernde Regenbogenvögel waren durch die Luft geschwirrt und hatten ihren einförmigen Ruf erschallen lassen. Ein langgestrecktes Seufzen, das an einen Liebhaber erinnerte, den es zu seiner Geliebten zieht. Man vermutete lachende Kinder, die sich hinter den hohen Stämmen verbargen und Heidelbeeren von den Büschen naschten, bis sie blaue Lippen und blaue Finger hatten.
Inzwischen aber zeigte sich der Wald als finsterer Dom, in dem Käuze und Uhus mit dumpfen Stimmen um Vergebung beteten. Die Kronen der Bäume schlossen sich über Michael zu einem festen Dach, das ewige Dämmerung für diesen Teil des Waldes bedeutete, aber er wusste, dass die Sonne tatsächlich langsam im Westen versank. Er spürte deutlich, wie die Gestalten der Nacht zögernd aus ihren Verstecken krochen und den Wald zunehmend in Besitz nahmen. Ihn fröstelte, obwohl er in warme Wollsachen gekleidet war.
Aber was der Gute Träumer wirklich fürchtete, waren nicht die realen Tiere, die in der Nacht diesen Wald bevölkern würden. was ihm zu schaffen machte, war die Vorstellung, dass ihn dieser Teil des Waldes lebhaft an einen Alptraum erinnerte. Dieser Wald sah plötzlich aus, als würde hinter jedem Stamm ein Troll oder ein Goblin hocken, als würden riesige Schlangen im Geäst der Bäume lauern und sich langsam auf einen Reiter hinabsenken. Das Unterholz, ein Verhau undurchdringlich wie die Mauern von Sameth, rückte beharrlich näher und näher dem Pfad zu. Bald würde dieser verschwunden sein, und dann wusste er wirklich nicht, wohin er sich wenden sollte. Dieses Unterholz war gewiss bevölkert von Spinnen groß wie Suppenteller. Michael wollte nicht darüber nachdenken, was eventuell noch in diesem Gewirr aus Ästen, Dornen und Schlingpflanzen hockte und lauernd aus grünen Augen auf ihn blickte. Er wusste, dass dieser Wald zuerst ein ganz gewöhnlicher Wald gewesen, aber dann düsterer und unwirklicher geworden war, je tiefer er in ihn eingedrungen war. Inzwischen war es der Wald eines furchtbaren Alptraums, und das bedeutete, dass wahrscheinlich der Traumlord hinter allem steckte, und genau das machte ihm Angst.
Es knackte hinter Michael im Unterholz und er fuhr herum. Er riss dabei so heftig am Zügel, dass sein Pferd sich aufbäumte und ihn beinahe abgeworfen hätte. Aus dem Unterholz flog etwas auf. Es war kein Kauz, aber fast so groß. Die Flügel waren allerdings die eines Hautflüglers. Michael atmete auf, als das geflügelte Tier sich in entgegengesetzter Richtung entfernte. Er war kein Kämpfer, kein Held. Er war nur ein Guter Träumer, vielleicht der letzte. Viele hatten ihre guten Träume verloren. Der Traumlord hatte sie ihnen geraubt und sie vegetierten hilflos dahin. Michael wandte den Blick von dem sich entfernenden Riesenhautflügler ab und sah wieder nach vorn auf den Pfad. Da sah er das Monster.
Das Wesen war noch fünfzig Schritt entfernt und sah gewaltig aus. Michael wusste sofort, dass es genau die Art von Gräuel war, wie sie der Traumlord ausschickte, um seine Gegner zu beseitigen. Es sah nicht nur aus, als wäre es einem Alptraum entsprungen, es war tatsächlich so. Es war groß und unförmig und aus der Entfernung wirkte es irgendwie träge. Aber der Gute Träumer war sich ziemlich sicher, dass es äußerst flink sein würde, wenn es darum ging, einem Gegner den Kopf abzubeißen oder die Gedärme herauszureißen. Das Wesen stampfte auf sechs Säulenbeinen unaufhaltsam näher und stieß die links und rechts des Weges wachsenden Bäume einfach um. Es tat dies mit der Leichtigkeit einer Kugel, die Kegel umwirft. Michael begriff, dass er nur wenig Zeit hatte, um zu handeln. Er spürte schon den heißen Atem des Monsters in seinem Gesicht. Er hätte die Ledermaske aufsetzen können, aber das würde ihm so wenig nützen wie ein Degen gegen einen Wirbelsturm. Was er jetzt wirklich brauchte, war ein Guter Traum.
Michael, der Gute Träumer, schloss die Augen und blickte tief in sich hinein.
Als er die Augen wieder öffnete, war der Weiße Ritter an seiner Seite und bereit, mit dem Monster zu kämpfen. Michael hatte den diesen schon einmal kämpfen sehen und hoffte, dass er das Untier besiegen würde.
Der Weiße Ritter saß in aufrechter Haltung, den Blick entschlossen nach vorn gerichtet auf einem schlohweißen Pferd, dessen Nüstern Feuer spien wie die des Monsters. Bei jedem ungeduldigen Hufschlag des Pferdes stoben Funken auf. Der Weiße Ritter trug eine silberglänzende Rüstung, in der sich die Strahlen einer Sonne spiegelten, die in diesem Waldesdickicht gar nicht zu sehen war. Das Visier war heruntergelassen. Nur durch die Sehschlitze erkannte Michael zwei stahlblaue Augen glänzend wie Geschosse. In der Rechten hielt der Weiße Ritter ein gewaltiges Schwert. Michael war sicher, dass er dieses nicht würde aufheben können, wenn es der Weiße Ritter im Kampf zu Boden fallen ließ. Er würde es auch nicht einen Millimeter bewegen können. Aber er hatte den Weißen Ritter noch nie dieses Schwert verlieren sehen.
Der Weiße Ritter ritt dem Monster entgegen und beide trafen zehn Schritte von Michael entfernt aufeinander. Das Traumwesen geiferte und spie Feuer aus seinen Nüstern. Wo der Geifer auf den Waldboden tropfte, verschwand zischend der Teppich aus alten Nadeln und Blättern, und nackte, verbrannt aussehende Erde blieb zurück.
Die Schwerthiebe des Weißen Ritters trafen das Monster, doch sie trafen es offenbar nicht richtig. Die Klinge, mit der man hätte einen Felsen spalten können, prallte von dessen ledriger, bläulich schimmernder Haut ab, als schlüge der Weiße Ritter mit einem Stock auf einen Lederball. Der auf einem langen, sich schlangenartig windenden Hals sitzende Kopf des Wesens stieß nach vorn auf den Angreifer zu. Gelbe, spitze Zähne, mehr als Michael je vermutet hätte, starrten aus dem dampfenden Maul heraus. Der Weiße Ritter wich den Attacken des Monsters aus, versuchte, es von der Seite her zu erwischen, aber blitzschnell hatte dieses den Kopf herumgerissen und griff seinerseits den Menschen auf dem weißen Pferd an. Michael schaute dem Kampf mehr mit Interesse als mit Furcht zu. Er war sich des Weißen Ritters sicher, wenngleich dieses Monster sich offenbar als harter Brocken erwies. Es kam darauf an, war weiter gedacht hatte. Wenn der Kampf einmal im Gange war, konnten weder er noch der Traumlord eingreifen.
Der Weiße Ritter ließ sein Pferd um das Monster herumtänzeln wie ein Kunstreiter bei einer Vorführung, Irgendwo unter dem strahlenden Helm saß ein Kopf und in diesem Kopf jagten sich fieberhaft Gedanken, auf welche Weise dieses grässliche Vieh zu besiegen war. Es musste eine verwundbare Stelle haben. Das waren die Regeln. Und denen konnte sich selbst der Traumlord nicht entziehen. Sie waren ewig und nicht zu brechen.
Vielleicht hatte sich der Weiße Ritter zu sehr in seine Überlegungen vertieft, vielleicht war er nur ein wenig unachtsam. Plötzlich und für ihn überraschend setzte das Monster seinen auf dem langen Hals pendelnden Kopf wie einen Morgenstern ein. Es schlug seinen Schädel, der die Größe eines Bären hatte, gegen die linke Seite des weißen Ritters und schleuderte ihn aus dem Sattel. Der Weiße Ritter landete mit einem Krachen auf dem Waldboden, dass Michael glaubte, die Rüstung würde in lauter kleine Splitter bersten, doch noch war der Weiße Ritter zumindest am Leben und hielt sein Schwert mit beiden Händen umklammert. Er hatte es in jenem Moment fester gepackt, als ihn die Wucht des Anpralls aus dem Sattel schleuderte. Dennoch sah die Lage plötzlich wenig gut für den Helfer des Guten Träumers aus. Als es ihm gelungen war, sich auf den Rücken zu wälzen, stand das riesige Monster über ihm. Mordlust sprang aus seinen schwefelgelben Augen hervor.
Michael sah das alles und dachte daran, dass sein Kampf mit dem Traumlord beendet sein würde, ehe er ihn richtig begonnen hatte. Er sah den Weißen Ritter zerstampft auf dem Waldboden liegen und sich selbst versengt von dem feurigen Atem des Monsters. Michael wusste, dass alle Hoffnungen für die Menschen im Reich schwanden, wenn er starb. Er hatte sich entschlossen, den Traumlord herauszufordern, weil er noch viele gute Träume hatte und wusste, sie einzusetzen. Aber der Traumlord war ein starker, verschlagener und außerdem rücksichtsloser Kontrahent. Diese Kreatur schien unbesiegbar. Es war zu Ende.
Das Monster war stark. Es war riesig. Es hatte eine Haut, die das Schwert des Weißen Ritters nicht ritzen konnte. Und es war dumm.
Da der weiße Ritter zu seinen riesigen Füßen lag, auf dem Rücken und nicht in der Lage ihm auszuweichen, hätte es einfach über ihn hinwegtrampeln und ihn zermalmen können. Aber seine Mordgier war so gewaltig, dass es ihm wohl den Kopf abreißen und diesen verschlingen wollte. Es schoss mit dem Schädel nach vorn und sperrte gleichzeitig den riesigen Rachen auf soweit es konnte. Die Zähne im Maul erinnerten an eine bewehrte Burgmauer. Da erkannte der Weiße Ritter die verwundbare Stelle. Er sah sie ganz deutlich. Am oberen Gaumen pulsierte in regelmäßigem Takt ein Blutgefäß dicht unter der Haut.
Es blieb nur eine Sekunde Zeit, aber für den Weißen Ritter war sie ausreichend. Er stieß das Schwert nach oben in den klaffenden Rachen hinein, durchbohrte die pulsierende Stelle, die er erkannt hatte und rollte sich gleich darauf behände zur Seite, damit ihn das ätzende Blut nicht traf.
Er hatte richtig gehandelt. Die Lebensflüssigkeit des Untiers schoss gleich dem scharfen Wasserstrahl eines Geysirs aus dessen Maul. Der Strahl bohrte ein Loch in den Waldboden, in dem ein Mann aufrecht stehend Platz gefunden hätte. Der Monsterschädel fiel krachend auf den Boden herab, als wäre er vom Rumpf getrennt worden. Michael spürte ein leichtes Beben, als der Kopf aufschlug und wusste, dass der Schlag selbst den Weißen Ritter zerquetscht hätte wie ein Insekt.
Die Augen des Monsters verfärbten sich in ein stumpfes grau. Ein-, zweimal noch peitschte der Schwanz den Waldboden und wirbelte Blätter, Nadeln und Erde auf, dann war es tot. Und kaum war es tot, war es auch verschwunden. Es blieb nur das Loch im Waldboden, das mit einer brodelnden gelben Flüssigkeit gefüllt war und die Spur umgestürzter Bäume auf dem Weg, den es gekommen war.
Der Weiße Ritter erhob sich schwerfällig. Rüstung und Schwert machten ihn in einer Situation wie der eben erlebten durch ihr Gewicht tatsächlich überaus verwundbar. Als er wieder auf seinen beiden Beinen stand (eine Hand stützte sich auf das Schwert), rief er in einer für Michael fremden Sprache sein Pferd. Dies weidete ein wenig abseits, kam aber nun in Windeseile zu seinem Herrn. Hatte es den Weißen Ritter Mühe gekostet, sich vom Boden zu erheben, war es ihm gänzlich unmöglich, wieder auf sein Pferd zu steigen. Also ergriff er es am Zügel und führte es fort aus dem Wald. Er passierte den Guten Träumer und hob den Kopf zu diesem auf. Hinter dem Visier vermeinte Michael zwei lächelnde Augen gesehen zu haben, die ihm viel Glück wünschten. Der Weiße Ritter führte sein Pferd an Michael vorbei und entfernte sich in der Richtung, aus der der Gute Träumer gekommen war. Gewiss war er unterwegs zu neuen Heldentaten. Als sich Michael nach zwei Minuten umwandte, war der Weiße Ritter verschwunden. So musste es sein.
II.
Aranxa lebte bei ihrem Herrn solange sie sich erinnern konnte. Und das waren mehr als zwanzig Jahre.
Ihr Herr war Gladblood. Ein Ritter der Dunklen Garde des Traumlords. Gladblood war reich und hatte nur einen Traum, diesen Reichtum zu behalten und zu vermehren. Um diesen Traum zu erfüllen, war ihm jedes Mittel recht. Solche Untertanen liebte der Traumlord, und er nahm ihnen darum auch nicht ihre Träume, denn es waren dunkle Träume. Träume, die er benutzen konnte.
Auch Aranxa hatte ihre Träume noch. Es war ein Versehen des Traumlords. Er war nicht gut, aber er war auch nicht so großartig böse, dass er unfehlbar gewesen wäre. Er hatte Aranxa übersehen, wie so viele sie in ihrem bisherigen Leben übersehen hatten. Ihr Stand war einfach zu niedrig, als dass man sie sah.
Aranxa lebte bei Gladblood seit sie denken konnte, und genau so lange war sie seine Sklavin. Sie erfüllte alle seine Wünsche, las sie ihm von den Augen ab, noch ehe er die Lippen geöffnet hatte, um sie auszusprechen. Sie schlief in Gladbloods Haus in einer Kammer, die nicht größer war als der Kleiderschrank ihres Herrn, Sie teilte diese Kammer mit Spinnen und Ratten, die Gladblood immer wieder fing und dort hineinwarf. Einmal hatte Aranxa eine Ratte getötet. Daraufhin hatte ihr Herr sie so lange geprügelt, bis sie ohnmächtig zusammengebrochen war.
„Du bist selbst eine Ratte“, hatte er dabei unablässig geschrien. „Und wenn du die Ratten tötest, werde ich dich töten wie eine Ratte.“
Sie war damals zehn oder elf Jahre alt gewesen. Sie hatte seitdem nie wieder einem Tier, das in ihrer Kammer hauste, etwas getan. Anfangs war es ein Burgfriede gewesen. Doch mit den Jahren hatte Aranxa gelernt, mit den Tieren umzugehen, die andere Menschen verabscheuten und fürchteten. Die Ratten, Spinnen und Schlangen gehorchten ihr.
Aranxa hatte nur einen einzigen, wirklich großen Traum. Dieser Traum war das Schloss. Es stand auf einem Felsen hoch über der Stadt Asgood und beherbergte die Prinzessin. Aranxa träumte davon, einmal dort hinauf zum Schloss zu gehen, durch alle Räume zu wandeln und natürlich dort zu speisen. Das, was sie von ihrem Herrn zur Nahrung bekam, taugte nicht für seine Hunde, die draußen vor dem Haus angekettet waren.
Aranxa wusste einiges über das Schloss. Außer der Prinzessin wohnte dort oben ein Mann, der Hohr hieß und mit Gladblood befreundet war. Manchen Abend hatte Aranxa die beiden bedient, wenn Hohr in Gladbloods Haus zu Gast war. Sie hatte ihnen die Stiefel von den Füßen gezogen, wobei sie ihr stets kräftig in den Hintern traten. Danach hatte sie das Essen für sie bereitet und es ihnen serviert. Sie hatte ihnen Wein kredenzt und schließlich, wenn sie dann betrunken gewesen waren, hatte sie ihnen auch noch zu Willen sein müssen wie eine Hure. Sie ekelte sich hinterher stets vor dem eigenen Körper, aber Gladbloods Schläge waren schlimmer als sein Schwanz.
Während die beiden Männer sprachen, hatte Aranxa viel über die Prinzessin und das Leben im Schloss erfahren. Es störte niemanden, wenn sie zuhörte. Man hielt sie für so bedeutungslos wie ein Möbelstück nur billiger. Und niemanden stört es, wenn ein Ohrensessel lauscht.
Aranxa träumte oft vom Schloss. Manchmal waren ihre Träume so lebhaft, dass sie sich am Morgen fragte, ob sie in der Nacht vielleicht wirklich durch die prachtvollen Säle geschritten war. Die Räume und Gänge mussten gewaltig sein. Ihre Deckengemälde und Stuckarbeiten erschienen Aranxa im Traum jedes Mal so hoch wie die Sterne am Himmel. Selbst die Möbel im Schloss waren offenbar für Riesen geschaffen, Es gelang Aranxa nie über die Tischplatten hinwegzusehen. Die Schränke waren gewaltige, hölzerne Riesen. Aber trotz all dem liebte Aranxa die Pracht des Schlosses – das warme Gold, das strahlende Silber und die bunt schillernden Edelsteine. Am meisten liebte sie aber die Prinzessin. Sie war eine Frau mit anmutigen, edlen Gesichtszügen. Ihre Augen strahlten Wärme und Liebe für Aranxa aus, die ihr zu Füßen saß. Die Prinzessin hatte langes, blondes Haar, braune Augen und eine gerade, schmale Nase. Ihr Gesichtsausdruck war stolz, doch voller Wohlwollen und Güte. Aranxa konnte nach dem Erwachen nie verstehen, weshalb die Prinzessin Menschen wie Hohr an ihrem Hof duldete. Doch dann schalt sie sich stets eine dumme Ziege, denn schließlich war alles nur ein Traum gewesen. In Wirklichkeit mochte die Prinzessin eine Hexe mit einem Buckel und schiefen Zähnen sein.
Aranxa wusste nichts von Michael, dem Guten Träumer. Michael wusste nichts von Aranxa. Doch er würde ihren Traum erfüllen.
III.
Der Traumlord stand am Fenster und blickte hinaus. Sein Blick war kalt und starr geradeaus nach Norden gerichtet. Irgendwo dort hatte sich ein kleiner Käfer aufgemacht, die Spinne aus ihrem Netz zu vertreiben. Es war verrückt, aber es war die Wahrheit. Der Traumlord war sich sicher, dass kein Mensch wusste, wer er war, wo er war und wie groß seine Macht war. Aber es gefiel ihm dennoch nicht, dass sich einer der Gemeinen aufgemacht hatte, ihn zu besiegen.
Anfangs hatte der Traumlord geglaubt, ein Besessener wäre unterwegs zu ihm. Einer, dessen Träumen er nicht hatte habhaft werden können, weil sie von seinem realen Denken nicht zu isolieren waren. Ein Besessener wäre kein Problem für ihn gewesen, denn er konnte seine Träume nicht im Zaum halten. Später hatte der Traumlord angenommen, der Wirrkopf, der ihn besiegen wollte, war einer, dessen Träume er einfach vergessen hatte zu nehmen. Dies wäre schnell nachzuholen gewesen. Schließlich begriff er, dass da einer aufgebrochen war, dessen Träume so groß und so vielfältig waren, dass er sie einfach nicht hatte nehmen können. Und genau das war ein Problem!
Der Traumlord blickte nach Norden, von wo der Wirrkopf kommen würde und dachte über seine bisher vergeblichen Bemühungen nach, diesen auszuschalten.
Er hatte es im Dorf Toulux versucht, als dieser Träumer zum Weisen Stephan vorgedrungen war. Er hatte ihm ein ganzes Rudel wilde Hunde auf den Hals gehetzt. Es waren allesamt wilde Bestien gewesen, die den Träumer ohne Probleme in Stücke gerissen hätten. Aber dieser hatte nicht gezögert, sich eines hinterhältigen Tricks zu bedienen, um ihn, den Traumlord, zu überlisten. Er hatte seinen Hunden ein Paar Löwen entgegengestellt, die auf ihre Weise genauso blutrünstig wie die Hunde waren. Es waren große, schlanke Tiere von königlicher Eleganz und tänzerischer Geschmeidigkeit. Sie waren wie Furien zwischen die Hunde gefahren und hatten das Rudel in weniger als einer Minute zerschlagen und verjagt. Der Traumlord hatte diese heroischen Löwen nur schwer verwunden. Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis ihm etwas einfiel, wogegen diese Könige der Tierwelt machtlos sein würden.
Doch das Monster, das er, der Traumlord, gesandt hatte, als der Träumer gerade im Wald der ewigen Finsternis war, hatte ein Ritter vernichtet, den man den Weißen Ritter nannte. Der Traumlord fluchte leise. Danach wandte er sich vom Fenster ab, verließ den Turm und stieg die Wendeltreppe hinab zur Maschine.
Die Maschine summte leise, so als summe sie ein monotones Lied vor sich hin. Sie blinzelte dem Traumlord aus Lampenaugen verschwörerisch zu. Nur er verstand, was sie zu sagen hatte. Er glaubte nicht, dass noch ein Mensch im Reich wusste, wie man zur Maschine sprach.
IV.
Als der Gute Träumer die Lichtung erreichte, hatte sich die Sonne bereits seit zwei Stunden hinter den Horizont zurückgezogen. Im Wald hatte die Finsternis der Ewigkeit geherrscht und Michael hatte sich bei der Suche nach dem rechten Weg vor allem auf die Instinkte seines Pferdes verlassen. Endlich hatte sich das Dach aus Ästen über seinem Kopf gelichtet und den Blick auf einen klaren Sternenhimmel und einen Mond im ersten Viertel freigegeben.
Michael hatte ein Feuer entfacht, seine Decken auf dem Boden ausgebreitet, nachdem er sich vergewissert hatte, dass es keine Skorpione und Spinnen gab, und sich danach niedergesetzt und ein einfaches, aber stärkendes Mahl begonnen.
Während er Brot und Wurst verzehrte und zwischendurch in einen Apfel biss, dachte er an den bisher zurückgelegten Weg. Er war vor nicht ganz zwei Wochen in seinem Heimatdorf Ramos aufgebrochen, um den Traumlord zum Kampf zu stellen und zu besiegen. Niemand hatte ihn ausgesandt. Die Menschen in Ramos waren alle ihrer Träume beraubt und daher nicht in der Lage, eigene Entscheidungen von solcher Tragweite zu treffen, wie jene, einen Mann auszusenden, um ihren Peiniger zu vernichten. Sie, die Männer und Frauen von Ramos, waren ebenso wie die meisten Menschen im Reich gerade noch in der Lage zu entscheiden, wann sie Essen und Trinken mussten, um nicht zu sterben, und dass sie den Befehlen des Traumlords gehorchen mussten, um keine Schmerzen oder den Tod zu erleiden.
Der Vater des Guten Träumers, ein stattlicher und schöner Mann, dessen Traum viele glückliche Kinder waren, war vom Schwert eines Ninja getötet worden, den der Traumlord ausgesandt hatte. Michaels Vater hatte einfach nicht mehr den Willen aufgebracht, sich aus dem Bett zu erheben, um seine Arbeit auf den Feldern des Traumlords zu tun. Er hatte im Bett auf seine Träume warten wollen, die ihm gestohlen worden waren. Deshalb hatte der Traumlord ihn ermorden lassen. Er nannte das ‚ein Exempel statuieren‘. Das war geschehen, bevor Michael entdeckt hatte, dass seine Träume stark genug waren, die des Traumlords zu besiegen.
Das hatte er erst begriffen, als die Sache mit Luisa geschehen war. Luisa war einmal das Mädchen des Guten Träumers gewesen. Sie hatte immer davon geträumt, Tänzerin und Schauspielerin zu werden. Sie hatte sogar Talent, jedenfalls glaubte Michael das noch immer. Aber dann hatte man ihr die Träume gestohlen, und sie war zu einer billigen Schlampe geworden. Jeder hatte sie haben können, der ihr im Wirtshaus nur einen Schnaps spendierte. Weil sie schön war, bekam sie viel Schnaps.
Trotzdem hatte Michael nie ganz aufgehört, sie zu lieben. Er hatte gewusst, dass nicht Luisa selbst, sondern der Traumlord an ihrem neuen Schicksal die Schuld trug.
Eines Tages hatte er gesehen, wie ein Ritter der Dunklen Garde Luisa aus dem Wirtshaus herauszerrte. Es war ganz offensichtlich, dass er sie zu seinem Pferd bringen wollte, um sie zu verschleppen. Luisa mochte zu einer verkommenen Hure geworden sein, doch so verdorben, dass sie es für einen von der Dunklen Garde getan hätte, war sie nicht. Michael konnte sich nicht vorstellen, dass ein Mädchen so verdorben sein könnte. Luisa hatte sich gewehrt, hatte dem Ritter das Gesicht zerkratzt und ihn gebissen. Sie hatte sich gebärdet wie eine tolle Hündin, obwohl sie sich bei anderen Männern eher wie läufig aufführte. Schließlich war sie doch auf dem Pferd des Ritters der Dunklen Garde gelandet.
Da hatte Michael zum ersten Mal den Weißen Ritter herbeizitiert. Er war erschienen, hatte den fremden, dunklen Ritter besiegt und Luisa befreit. Luisa war noch in derselben Nacht aufgebrochen und in ein Kloster gegangen. Das änderte für Michael nichts an seiner Situation bezüglich des geliebten Mädchens, aber es war dem Herz angenehmer als ihr Hurenleben.
Michael hatte begriffen, welche Macht seine Träume hatten, und ihm war zum ersten Mal der Gedanke gekommen, den Traumlord zu besiegen. Zwar vergingen noch fast vier Monate, ehe er wirklich aufbrach, aber der Grundstein zu seinem Entschluss wurde an jenem Tag gelegt. In der Zwischenzeit trainierte der Gute Träumer seine Phantasie, um für den großen Kampf gerüstet zu sein.
Michael brach von Ramos an einem Frühlingsmorgen, wie er schöner nicht hätte sein können, auf. Die Sonne erhob sich als strahlender Ball aus Gold über den fernen Bergen und goss ihr wärmendes Licht über der grünen Ebene aus. Schmetterlinge, Bienen und allerlei andere Insekten auf der Suche nach süßem Blütensaft berauschten sich an den Düften, die die Wärme weckte. Vögel jubilierten hoch in der Luft und priesen die Schönheit des Frühlings mit ihren besten Liebesliedern. Sie warben umeinander und bald würden vielfach gesprenkelte Eier in warmen, wohlbehüteten Nestern liegen, um von besorgten und eifrigen Eltern liebevoll ausgebrütet zu werden.
Michael wusste, dass auch diese Idylle um Ramos nicht mehr lange währen würde, denn der Traumlord hatte Pläne mit dem gesamten Reich und in diese Pläne passten keine unberührten Wiesen. Michael wusste nicht, woher er diese Information hatte, er wusste auch nicht, was der Traumlord genau vor hatte, aber er wusste genug über diesen Tyrannen, um die Wahrheit dieser Information nicht anzuzweifeln.
Zwei Tage später hatte der Gute Träumer Toulux erreicht. Dort hatte er zum ersten Mal erfahren müssen, dass der Traumlord über alle Aktivitäten im Reich ausgezeichnet informiert war. Er hatte ihm ein Rudel wilde Hunde auf den Hals gehetzt, wie es wilder nicht hätte sein können. Michael hatte für einen winzigen Augenblick geglaubt, seine Reisen, die zum Traumlord und die durch sein Leben im Diesseits, wären zu Ende. Doch dann war ihm ein rettender Gedanke gekommen, der sich tatsächlich als wirkungsvoll erwiesen hatte.
In Toulux hatte Michael den greisen Stephan aufgesucht, den man auch den Weisen nannte. Er hatte noch vor seinem Aufbruch aus Ramos herausgefunden, dass dieser Mann vermutlich der einzige im Reich war, der ihm sagen konnte, wo er den Traumlord fand und wie er ihn besiegen konnte. Wenn Michael jetzt im Nachhinein an seinen Besuch beim Weisen Stephan dachte, kamen ihm die gewonnenen Informationen spärlich, ja geradezu nichtig vor. Aber er wollte nicht undenkbar sein.
Als Michael das Haus des alten Mannes betreten hatte, war ihm sofort der Geruch aufgefallen. Es war nicht der Geruch, den Michael in einer Alchimistenküche oder dem Haus eines Weisen erwartet hätte. Es roch nach Urin und Schmutz. Es roch wie alter Mann.
Stephan war ein alter Mann. Vermutlich lebte er bereits weit mehr als hundert Sommer. Die Zeit hatte eine wahre Gebirgslandschaft aus Falten und Runzeln in sein Gesicht eingeprägt. Der Kopf war völlig kahl und zeigte dunkle Altersflecken. Was Michael sofort auffiel, waren Stephens wasserhelle Knopfaugen, die ihn abschätzend betrachteten, kaum dass er den Raum betreten hatte, in dem der alte Mann saß. Michael glaubte, dieser alte Mann würde in ihm lesen wie in einem offenen Buch.
Das Kinn und die nach unten gebogene Nase des Alten sprangen scharf aus dem Gesicht hervor. Sie kamen sich mit den Spitzen so nahe, dass man sofort an den Schnabel eines Vogels denken musste. Selbst wenn er sprach, war die Täuschung noch immer perfekt.
Stephan trug alte, zerlumpte Kleidung, die vermutlich auch eine geraume Weile keiner Reinigung mehr unterzogen worden war. Er saß mit untergeschlagenen Beinen auf einem kleinen Teppich mitten im Zimmer auf dem Boden. Aus einem seiner Mundwinkel rann ein wenig Speichel. Das gab ihm einen keineswegs weisen Ausdruck.
Aber die Augen, diese Augen machten Michael klar, dass man ihn nicht zum falschen Mann geschickt hatte.
„Guten Tag, mein Sohn“, begrüßte Stephan seinen Gast. Seine Stimme klang, als säßen eingerostete Scharniere in seinen Mundwinkeln.
„Guten Tag, Weiser, ich grüße dich. Ich, Michael aus Ramos, Sohn des David.“ Michael verbeugte sich so tief vor dem weisen Mann, dass sein Kopf fast den Boden berührte. Man hatte ihm gesagt, dass für Stephan Ehrerbietung alles bedeutet. Geld wollte er nicht, aber Hochachtung.
‚Wenn er mir sagen kann, wie ich den Traumlord besiege, werde ich ihm selbst den Hintern küssen, wenn er es verlangt‘, dachte Michael.
„Nimm Platz, mein Sohn und sage mir, weshalb du zu mir kamst.“
Michael sah sich hilflos um, denn da war nichts im Zimmer, wo er hätte Platz nehmen können außer auf dem Boden. Etwas ungeschickt ließ er sich fallen und versuchte eine einigermaßen bequeme Sitzhaltung zu finden. Im Gesicht des Weisen Stephan zeigte sich ein feines Lächeln, das Michael jedoch übersah. Er war zu sehr mit seinen Beinen beschäftigt.
„Sitzt du bequem?“ War das ein Anflug von Ironie? „Dann sage mir, was du von mir willst, mein Sohn“, erneuerte Stephan seine Frage.
„Ich will den Traumlord besiegen“, platzte Michael heraus „Man sagt, du kannst einem dabei helfen.“
„Ich bin alt, ich bin schwach. Wie sollte ich dir helfen können?“
Michael spürte, dass der alte Mann ihn auf die Probe stellen wollte. Er wusste nur nicht, was für eine Art Probe das sein sollte. Er fühlte sich auf den Arm genommen. ‚Ruhig bleiben, besonnen antworten‘, raunte er sich im Geiste dennoch zu. „Du bist alt, das stimmt, doch du bist weise. Alle Welt lobt und preist deine Weisheit. So sage mir also, wie ich den Traumlord besiegen kann.“
Der Alte lächelte.
‚Prüfung bestanden‘, schoss es Michael durch den Kopf.
„Du musst stark sein und mutig“, begann der Weise Stephan seine Erklärung mit Dingen, die Michael auch ohne ihn gewusst hätte. Die Prüfung dauerte an.
„Gewiss“, erwiderte Michael, „doch deine übergroße Weisheit sieht sicher mehr.“
„Ja“, nickte der Alte. „Stärke und Mut allein reichen nicht aus. Du musst gute Träume haben, nicht nur ein paar, die haben alle. Du musst so viele gute Träume haben, dass sie der Traumlord dir nicht nehmen kann. Du musst ihn ersäufen in guten Träumen.“ Plötzlich war die Stimme des alten Mannes schrill und enthusiastisch. Doch dieser Moment war so schnell vergangen wie er gekommen war. Mit seiner knarrenden Stimme fuhr er fort: „Und du brauchst drei Dinge aus dem Reich, ohne die du den Traumlord nicht besiegen kannst.“
„Welche Dinge?“, platzte Michael ungestüm heraus und dachte im gleichen Augenblick, dass er damit alles verdorben habe. Aber der Weise Stephan überhörte die Unschicklichkeit. Ihm lag auch viel am Ende des Traumlords. Mehr als ein Mensch im Reich ahnte. Er hätte den Traumlord selbst besiegt, wenn er die Kraft dazu besessen hätte.
„Gemach, mein Sohn“, rügte der alte Mann daher nur leicht. „Ich werde es dir sagen. Du brauchst für deine Aufgabe drei Dinge: den Stern von Asgood, den Fels aus der Wüste Gohan und das Buch von Nekros. Suche diese Dinge, nimm sie mit auf deine Reise und du wirst den Traumlord besiegen.“
„Du sprichst in Rätseln, weiser Mann“, sagte Michael. Er hoffte auf mehr Information.
„Dann löse sie“, antwortete der Weise Stephan nur.
„Wo finde ich den Traumlord?“, fragte Michael noch einmal genauer nach.
„Du wirst es erfahren, wenn es an der Zeit ist“, kam prompt die Antwort, die Michael befürchtet hatte.
„Gehe jetzt deines Weges, Guter Träumer, und finde die drei Dinge, die ich dir nannte. Eine Hilfe will ich dir noch geben. Asgood, die große Stadt, liegt im Süden.“ Der alte Mann nickte dem Guten Träumer, er hatte ihn als erster Mensch so genannt, zu und deutete damit an, dass die Unterredung beendet war. Michael zog sich zurück und dachte über die drei Dinge nach, die er finden sollte. Er konnte sich weder vorstellen, was dies für Dinge waren, noch konnte er erkennen, wie sie ihm helfen sollten, den Traumlord zu besiegen. Vielleicht hatte sich der Alte nur über ihn lustig gemacht? So kam ihm die ganze Sache von Anfang an vor. Vielleicht war alles nur ein subtiler Scherz des Traumlords, eine Falle weitaus raffinierter als die Attacke der wilden Hunde?
Während Michael ins Freie trat und, von der Sonne geblendet, schützend eine Hand vor seine Augen hielt, saß der Weise Stephan noch immer auf seinem Teppich und dachte über den jungen Mann nach, der ihn gerade verlassen hatte. Stephan war sich sicher, dass, wenn je einer zu ihm gekommen war, dem er zutraute, den Traumlord zu finden und zu besiegen, dieser soeben vor ihm gestanden hatte. Er hatte ihm gesagt, was es zu sagen gab. Wenn er wirklich der Richtige war, der wahre Gute Träumer, dann würde er das Rätsel um die drei Dinge lösen. Nur ein Mann, der dieses Rätsel löste, war am Ende auch wirklich fähig, dem Traumlord gegenüberzutreten, um ihn zu besiegen. Für jeden anderen war es besser, wenn er dem Traumlord niemals begegnen würde. Darum wies Stephan allen, die ihn fragten, den Weg mit diesem Rätsel. Einer würde es eines Tages bewältigen und er würde dann den Traumlord vertreiben, damit die Menschen im Reich wieder glücklich und voller Träume leben konnten.
Der alte Mann nickte still vor sich hin, die eigenen Gedanken bekräftigend. Es war richtig, diese seltsame Antwort auf die klare Frage zu geben. Sie bedeutete Leben für den Fragesteller, ob er die drei Dinge fand oder nicht. Eine direkte Antwort hätte bei vielen, die vor diesem jungen Mann gekommen waren, Tod bedeutet.
Während der Weise Stephan in seine Betrachtung der Lage vertieft war, schwang sich der Gute Träumer auf sein Pferd und ließ es in südliche Richtung traben. Dort, so hatte der alte Mann gesagt, sollte die große Stadt Asgood liegen, in deren Mauern Michael einen Stern finden musste, wenn er den Traumlord besiegen wollte.
Während er Richtung Süden ritt, begann Michael, über seine Aufgabe nachzudenken. Er sollte einen Stern in einer Stadt finden. Sicherlich war damit kein wirklicher Stern, kein glühender Feuerball vom Firmament gemeint. Aber was, in drei Teufels Namen, war dann dieser rätselhafte Stern? Gab es irgendwo in Asgood eine steinerne Nachbildung eines Sterns? Das würde sich erst klären lassen, wenn er die Stadt erreichte. Also hieß die Devise: schnell nach Asgood gelangen und dann weitersehen. Aber selbst dies war kein so leichtes Unterfangen, wie es schien.
Sicherlich war es nicht möglich, einfach stur geradeaus nach Süden zu reiten, um irgendwann einmal in Asgood anzukommen. Man musste den Wegen durch Wälder folgen, Wege, die möglicherweise verschlungen waren, sich kreuzten, ein Labyrinth bildeten. Er musste damit rechnen, dass ein Fluss seinen Weg kreuzte, so dass er gezwungen war, eine Brücke oder Furt zu finden. Nein, es war gewiss nicht so leicht, nach Asgood zu gelangen, wie der alte Mann es gesagt hatte. Einfach immer nach Süden.
Was Michael brauchte, war eine Karte. Eine Karte des ganzen Reiches, die ihm nicht nur den Weg zur Stadt Asgood wies, sondern auch einen Weg durch die Wüste Gohan und zu dem Ort, der Nekros hieß.
Von der Wüste Gohan hatte der Gute Träumer früher des Öfteren gehört, doch nie Gutes. Es musste eine gewaltige Ansammlung von Sand und Salz sein, die schon viele Karawanen verschlungen hatte, die sie bezwingen wollten. Stürme rasten ständig über das flache, leblose Gebiet und vernichteten alle Eindringlinge, die die Stille des Todes stören wollten. Michael schauerte ein wenig zusammen bei dem Gedanken, dass er sich allein in die Wüste wagen musste, um einen ominösen Felsen zu finden. Und wie, wenn er ihn denn fand, sollte er ihn aus der Wüste herausschleppen?
Ja, und dann war da noch dieses Buch von Nekros. Michael wusste weder was Nekros war, noch wo es lag. Er hatte vor seinem Besuch beim Weisen Stephan nicht einmal gewusst, dass es so einen Ort im Reich geb. In Anbetracht der anderen Rätsel konnte Nekros ebenso gut eine Bibliothek sein, die Millionen von Büchern enthielt, von denen er ein einzelnes, wirklich wichtiges finden musste, wie euch eine versunkene Insel in einem unendlich tiefen Meer.
Michael, der Gute Träumer, schüttelte ratlos den Kopf. Egal, wie es weitergehen sollte, als erstes benötigte er eine Karte des Reiches, und zwar eine gute.
Nachdem Michael einen Tag lang in Richtung Süden geritten war, verbrachte er die Nacht in einem riesigen Maisfeld. Die Sprosse waren noch jung und ihr frisches Grün übte eine belebende Wirkung auf den müden Reiter aus. Wenn aber der Sommer vorüber sein würde, blieb hier ein unheimlicher Ort. Der Wind würde beständig in den dürren Blättern rascheln, die die geldgelben Kolben umgaben. Dann wäre es hier wie in der Wüste, nur es wäre eine Wüste aus Mais.
Am nächsten Morgen brach Michael schon mit dem ersten Sonnenstrahl wieder auf und als sich die Sonne langsam dem Zenit entgegenschob, erreichte er ein Dorf, kaum größer als Ramos. Obwohl Frühling war, Zeit zu säen und auf den Feldern jetzt Sorge zu tragen, dass die Saat auch aufging, lagen die Felder um das Dorf herum in Totenruhe. Auch im Dorf selbst herrschte die Betriebsamkeit eines Friedhofes um Mitternacht. Keine Kinder liefen durch die Straßen. Fenster und Türen des Wirtshauses waren mit Brettern vernagelt. Ein einzelner Hund, hinkend und mit einem zerfetzten rechten Ohr, lief über die Straße, passierte den Guten Träumer und hob an der nächsten Straßenecke ein Bein. Nur dieser Hund und ein lauer Wind von Westen schienen noch in diesem Dorf zu Hause zu sein.
Während er sich umsah, rechnete der Gute Träumer ständig mit einem Angriff des Traumlords. Er hatte es in Toulux mit wilden Hunden versucht. Jetzt waren wohlmöglich Geister oder Zombies an der Reihe. Wachsam sah Michael sich um, doch nichts geschah. Nur der Wind wehte beständig von Westen und trieb Papier vor sich her über die Straße.
Nachdem er eine ganze Weile beobachtet hatte, entschloss sich der Gute Träumer weiterzureiten. Er drang weiter zur Mitte des Dorfes vor, doch auch dort herrschte nur der Wind. Das Zunftschild eines Barbiers schaukelte quietschend hin und her. Eine Ratte sprang behände in eine Abfalltonne, als sie den Reiter bemerkte.
Dieses Dorf war verlassen. Vielleicht hatte der Traumlord seine Bewohner als Sklaven verkauft, vielleicht hatte er sie umbringen lassen, weil sie nicht ausreichend gehorsam waren, obwohl er ihre Träume genommen hatte. Vielleicht hatten sie in einem Anfall kollektiver Massenhysterie gemeinsam Selbstmord begangen. Im Reich war alles möglich, seit der Traumlord regierte.
Michael hatte das Dorf schon fast passiert, da entdeckte er den Mann, der an der Eingangstür seines Ladens stand und offenbar auf Kunden wartete, die hier gewiss nicht sehr oft vorbeikamen. Der Laden lag in einer Nebenstraße, doch waren seine Auslagen von der Hauptstraße aus noch recht gut auszumachen.
Die Situation war grotesk. Das es in diesem Geisterdorf einen Laden gab, der geöffnet hatte und einen Ladenbesitzer, der auf Kundschaft wartete, war so vernünftig, wie sich in einen Baum zu setzen, um im Wald zu angeln. Immer stärker roch es nach einer Falle des Traumlords, doch Michael fühlte sich gewarnt und also gewappnet. Außerdem war er neugierig. Schließlich, vielleicht war es doch keine Falle, und dieser Ladenbesitzer hatte gar eine Karte des Reiches.
Michael lenkte sein Pferd vor die Eingangstür des Ladens. Er warf einen Blick auf die Auslagen, die ein buntes Gewimmel aus allen Branchen darstellten und stieg ab.
„Guten Tag, was kann ich für euch tun, edler Herr“, vernahm Michael die Stimme des Ladenbesitzers, kaum dass seine Füße den Boden berührt hatten. Die Stimme war ölig und voll von falscher Höflichkeit. Es war die Stimme eines Krämers, der alle Kunden übers Ohr hauen möchte.
Michael sah dem Ladenbesitzer ins Gesicht. Es war feist und rund und zeigte ein Lächeln, das ebenso schmierig war wie die Stimme. Das Haar war kurz geschoren und dunkel. Es stand wie die Stacheln eines Kaktus vom Kopf ab. Außerdem hatte der Mann Ohren die soweit abstanden, dass er bei Sturm gewiss nicht auf die Straße gehen durfte ohne Gefahr zu laufen, weggeweht zu werden. Das gab ihm eine lächerliche Note, doch wäre es falsch gewesen, diesen Mann für eine lächerliche Figur zu halten. Er war verschlagen, geldgierig und hinterlistig. Seine Träume waren Träume von Geld und von Kunden, die er heimtückisch ausgenommen hatte. Diese Träume waren ihm geblieben
„Habt ihr Landkarten?“, fragte der Gute Träumer nach eingehender Musterung des Ladenbesitzers.
„Landkarten sind selten geworden im Reich“, entgegnete der Ladenbesitzer. „Umso größer ist euer Glück, dass ihr gerade Mikos beehrt mit eurem Wunsch, denn Mikos kann fast alle Wünsche erfüllen und Landkarten habe ich viele.“
„Ich brauche eine neue und genaue Karte des gesamten Reiches“, präzisierte Michael seinen Wunsch.
„Sofort“, erwiderte Mikos und verschwand wieselflink in den hinteren Teil seines Ladens. Er schob seinen Körper, der ebenso rund war wie sein Gesicht, durch einen Durchgang, der mit einem roten Samtvorhang vom eigentlichen Laden abgetrennt war, und erschien kurze Zeit später mit einer Papierrolle wieder. Die Rolle war auf der für Michael sichtbaren Seite makellos weiß und wurde von einem roten Band zusammengehalten.
„Hier ist das Gewünschte“, verkündete Mikes ein wenig atemlos, als er wieder vor seinem Kunden stand.
„So eine Karte ist allerdings nicht billig“, fügte er dann hinzu, wobei er den Kopf schieflegte wie ein Vogel, der einen Wurm ins Visier nimmt. „Fünf Taler!“
„Bei diesem Preis will ich doch erst sehen, ob dies wirklich die rechte Ware ist“, erwiderte Michael. „Öffnet die Rolle, damit ich einen Blick auf die Karte werfen kann.“
Die Wahrheit war, dass Michael nicht mehr als einen Taler bei sich trug, doch er musste Zeit gewinnen, um sich etwas einfallen zu lassen,
Der Händler öffnete das rote Band und entrollte die Karte vor den Augen des Guten Träumers. Tatsächlich war es eine Karte des Reiches. Soweit Michael dies überhaupt einschätzen konnte, war es auch eine recht neue Karte. aber in dieser Hinsicht musste er Mikos vertrauen, auch wenn dieser nicht wie ein Mensch aussah, dem man vertrauen durfte.
„Gut, ich werde die Karte nehmen“, sagte Michael nach kurzer Betrachtung.
„Wie gesagt, fünf Taler.“
Fünf Taler für eine Karte waren Wucher. Als das Reich noch nicht vom Traumlord beherrscht wurde, war eine Karte für weniger als ein Zwanzigstel dieses Preises zu haben. Aber jetzt regierte der Traumlord und eine Karte hatte ihren Preis!
Michael griff in die Tasche, legte eine Münze auf den Holztisch neben der Tür zum Laden und sagte: „Bitte, aber die Preise sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.“
„Harte Zeiten“, erwiderte Mikos und nahm die Münze.
Michael hatte erst mit dem Gedanken gespielt, dem Händler eine Zehn-Taler-Goldmünze vorzugaukeln, aber dann hatte er sich entschieden, dass dies nicht nur zu dick aufgetragen wäre für seinen Aufzug (‚verdächtig, der Typ ist verdächtig‘), sondern dass es ihn auch auf eine Stufe mit diesem schmierigen Betrüger stellen würde. Also zahlte er mit einer erträumten Fünf-Taler-Goldmünze und verabschiedete sich.
„Empfehlen Sie mich weiter“, sagte Mikos, als sich Michael wieder auf sein Pferd schwang. Dabei machte er eine Verbeugung, die so tief war, als wolle er Michaels Pferd die Hufe küssen. „Es ist eine harte Zeit, es kommen nur wenige Kunden.“
‚Das glaub‘ ich gern‘, dachte Michael, dann ließ er seinem Pferd die Zügel und ritt im Galopp davon. Wenn er weit genug entfernt war, würde statt der Goldmünze ein Nickel auf dem Tisch des Händlers liegen – das Zehntel eines Talers.
Wenn Michael jetzt, jenseits des Waldes der ewigen Finsternis, an diesen Händler dachte, musste er unwillkürlich lachen. Er war ein betrogener Betrüger geworden und das bereitete dem Guten Träumer Vergnügen.
Er breitete die Karte vor sich aus, trug mit einem Rotstift die zurückgelegte Wegstrecke des vergangenen Tages ein, markierte mit blauer Farbe das neue Tagesziel und stellte fest, dass er Asgood in vermutlich drei Tagen erreichen würde. Dies setzte voraus, dass die Brücke, die in der Karte verzeichnet war, noch existierte.
Zufrieden mit dem an jenem Tag erreichten rollte der Gute Träumer die Karte wieder zusammen. Danach warf er noch etwas Holz ins Feuer und legte sich nieder. Im Wald riefen Tiere mit heiseren Stimmen, Vögel der Nacht kreischten und Zikaden musizierten auf der Wiese um die Wette. Dennoch fiel der Gute Träumer bald in tiefen Schlaf.
V .
Sylvester blickte aus dem Fenster seiner Wohnung im ersten Stock. Aufmerksam verfolgte er die Vorgänge im gegenüberliegenden Haus. Robert, dieser drahtige Mittfünfziger, hatte wieder einmal Gäste. Gut, Gäste zu haben war kein Verbrechen, aber solche Gäste …
Es waren fünf, und es waren allesamt finstere Gestalten. Es waren Männer, die sich in dunkle Umhänge hüllten. Sie trugen Masken vor den Augen, und wenn Sylvester allen seinen Büchern Glauben schenken durfte, sahen sie genauso aus wie gedungene Mörder.
Robert war vor einem halben Jahr auf die Insel gekommen, und vom ersten Tage an beobachtet Sylvester ihn voller Furcht und Misstrauen. Keiner auf der Insel wusste, woher dieser Mann gekommen war, keiner wusste, was er hier trieb und wovon er lebte.
Vor etwas mehr als zwei Wachen hatte das seltsame Treiben begonnen. Täglich waren merkwürdige Gestalten in Roberts Haus ein- und ausgegangen. Sylvester wusste nicht, ob es stets dieselben Männer waren oder immer andere, denn meist waren sie maskiert.
Einen hatte Sylvester allerdings wiedererkannt. Er war an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei Robert gewesen. Er war ein kleiner rundlicher Mann mit rundem Schädel gewesen. Auffällig war aber vor allem seine Haartracht. Am ersten Tag hatte Sylvester zunächst angenommen, der Unbekannte hätte eine Glatze, doch als der Mann dann in der zweiten Nacht direkt unter Sylvesters Fenster vorbeiging, er klimperte dabei unablässig mit Münzen in seiner Hand und lachte, erkannte Sylvester, dass die Haare nur kurz wie Stoppeln geschoren waren.
Sylvester wusste nicht, wer dieser Mann war. Er wusste auch nicht, was Robert von diesem Mann gewollt hatte. Aber Robert hatte diesem Mann Geld gegeben, dem Klang der Münzen nach zu urteilen viel Geld. Und das Lachen dieses Mannes hatte etwas so Verschlagenes an sich gehabt, dass Sylvester eine Gänsehaut bekommen hatte und ihm ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen war. So lachten nur Gauner der übelsten Sorte.
Jetzt besuchten diese schwarzen, vermummten Männer Robert, und dies war keineswegs beruhigend für Sylvester.
Er lebte seit seiner Geburt vor 45 Jahren auf der kleinen Insel. Er war ohne Beine auf die Welt gekommen. Also konnte er nicht oder nur sehr selten hinaus und verbrachte viel Zeit damit aus dem Fenster seiner Wohnung zu sehen und die Menschen zu beobachten. Außerdem las er viel. Er las Geschichten von Räubern und Mördern, von entführten Prinzessinnen, wilden Drachen und bösen Zauberern. Sein einziger wirklicher Traum war, laufen zu können, doch er war so unerfüllbar, dass ihm der Traumlord diesen ließ. Ein Mann, der nicht laufen konnte, war kein Gegner für den Traumlord.
Bevor der Traumlord gekommen war, war die Insel ein kleines Paradies gewesen. Alle Menschen waren fröhlich. Sie sangen bei der Arbeit, sie tanzten durch die sonnenhellen Straßen, statt zu gehen. Im Sommer, wenn der betäubende Duft tropischer Blüten die Insel einhüllte, kamen Menschen aus dem ganzen Reich auf die Insel, um im dunkelblauen Meer zu baden. Kinder erfüllten dann die Straßen mit ihren Rufen bei wildem Spiel. Aber die Menschen auf der Insel nahmen keinen Anstoß daran.
Jetzt war alles anders. Selbst das Meer war nicht mehr blau, sondern zeigte eine schiefergraue Färbung, die alle Menschen in eine trübsinnige Stimmung versetzte. Die meisten Leute auf der Insel waren ihrer guten Träume beraubt. Sie waren entweder apathisch, willenlos wie Vieh, das man zum Schlachthaus treibt, oder sie wurden aggressiv. Es kam täglich zu Prügeleien auf den Straßen und in den Wirtshäusern der Insel. Es genügte oft, dass einer den anderen nicht oder zu lange ansah, dann begann der Streit und fünf Minuten später prügelte man sich. Immer wieder war dann einer dabei, der ein Messer hatte und es euch hervorzog. Blut besudelte die Insel.
Sylvester sah mit verzweifeltem Blick zum Himmel hinauf. Er betete, dass sich einer fände, der dem Treiben des Traumlords ein Ende bereitete.
Selbst zu den glücklichen Zeiten des Reiches war Sylvester aufgrund seines Leidens ein recht einsamer Mensch gewesen. Aber hin und wieder blieb jemand vor seinem Fenster stehen und sprach mit ihm. Manchmal kamen Freunde zu Besuch, man spielte eine Partie Karten, trank Wein und redete über die neuesten Ereignisse und natürlich über die Träume, die jeder hatte. Jetzt hatte niemand mehr Träume und es gab also nichts, worüber man hätte reden können.
Nur Marie kam noch einmal pro Woche zu Sylvester. Sie war so etwas wie sein guter Geist. Sie versorgte ihn mit Lebensmitteln, machte in den Zimmern seiner Wohnung sauber und an den Nachmittagen fuhr sie ihn mit einem Rollstuhl durch die Straßen und am Strand entlang. In den guten Zeiten war Marie zweimal in jeder Woche zu Sylvester gekommen, doch jetzt hatte sie zu viele Sorgen mit ihrem eigenen, trunksüchtigen Mann, der sie oftmals auf brutale und hinterhältige Weise misshandelte. Marie hatte nie besonders große Träume gehabt. Sie waren bereits genommen worden, als ihre Eltern sie mit dem Sohn von Gregor verbanden. Dieser war schon immer ein grobschlächtiger, herrschsüchtiger Kerl gewesen, es hatte bei ihm nicht des Traumlords bedurft, um ihn ins Wirtshaus zu treiben.
Marie war jetzt vierunddreißig, doch sie sah fest zehn Jahre älter aus. Das Leben neben einem ungeliebten Mann, immer wieder geschlagen und gedemütigt, hatte sie geprägt. Die Angst vor diesem zweibeinigen Monster, hatte nicht gerade dazu beigetragen, sie jung und schön zu erhalten. Sie war klein und zierlich gewesen, als sie zwanzig war. Jetzt wirkte sie knochig, ausgezehrt, wie nach einem jahrelangen Marsch durch die Wüste. Durch ihr Gesicht liefen Falten wie Bewässerungsgräben, die ständig Tränen führten. Ihr Haar war dunkel gewesen, doch wies es heute schon graue Strähnen auf und täglich kamen neue hinzu. Ihr Gang war zaghaft, ihr Auftreten schüchtern. Immer hatte sie den Blick demütig zu Boden gerichtet. Sie hinterließ auf den flüchtigen Beobachter den Eindruck eines getretenen Hundes, und vielleicht fühlte sie sich auch so.
Trotz der Probleme, die Marie mit ihrer Familie hatte, war sie eine gute Frau. Sie klagte selten, fast nie. Sylvester liebte Marie wie eine Schwester. Sie war in der gegenwärtig schweren Zeit seine einzige Verbindung zur Außenwelt.
Sylvester hatte mit Marie noch nicht über Robert gesprochen. Er hatte beschlossen, zunächst genau zu beobachten, um sich klar darüber zu werden, was dieser Mann in seinem Haus trieb und ob er gefährlich war. Die vergangenen zwei Wochen hatten sein Ansicht gefestigt, dass dieser Mann sogar höchst gefährlich sein musste. Es wurde also Zeit sich einen Verbündeten zu suchen. Egal welches Handwerk dieser Robert auch betrieb, es war an der Zeit, dass es ihm gelegt wurde. Sylvester beendete seine Überlegungen und sah wieder zum Fenster hinaus. Robert stand vor seinem Haus und sah zu seinem, Sylvesters, Fenster hinauf. Ein feines Lächeln umspielte seine Lippen. Er wusste offenbar, dass er beobachtet wurde, doch es störte ihn nicht im Geringsten.
Im Grunde war Robert ein unauffälliger Typ von Mensch. In der Menge auf einem Marktplatz hätte er ohne Probleme verschwinden können wie ein Sandkorn in der Wüste. Er war ein Mann der in den Mittfünfzigern sein musste. Er war nicht besonders groß, schlank und, soweit es zu erkennen war, durchtrainiert. Sylvester konnte sich gut vorstellen, dass Robert jeden Tag im Meer schwamm oder am Strand entlanglief, obwohl er ihn nie dabei beobachtet hatte. Aber Robert war auch nicht so muskelbepackt wie ein Ringkämpfer.
Wenn Sylvester ihn sah, trug er meist einen einfachen Straßenanzug, grau oder dunkelbraun. Einmal hatte Sylvester ihn am Fenster in einem seidigen, grünen Hausmantel gesehen, und der Eindruck war, als sähe er einen Sperling im Federkleid eines Papageien.
Roberts Haar war grau meliert, kurz und links streng gescheitelt. Seine Augen hatte Sylvester noch nie gesehen, aber er stellte sie sich stahlblau und stechend vor. Sylvester wäre von der Wahrheit überrascht gewesen.
Robert blickte noch einmal nach oben zum Fenster Sylvesters, dann wandte er sich zur Eingangstür seines Hauses um und folgte seinen maskierten Besuchern.
In Sylvesters Geist zeigte sich zum ersten Mal eine Vision, die sich schnell verfestigen sollte. Noch wollte er der inneren Stimme nicht trauen, aber es war schwer, den Gedanken zurückzuweisen, da er sich so deutlich aufdrängte.
VI.
Robert wusste, dass im Haus gegenüber ein Mann wohnte, der ihn beständig beobachtete. Dieser Mann kontrollierte argwöhnisch jede Bewegung, die in Roberts eigenem Hause vor sich ging. Er hatte Mikos gesehen, und jetzt hatte er die Männer gesehen, die er auf Aranxa ansetzen wollte.
Aber Robert wusste noch mehr. Er wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, und dann würde dieser Mann, dessen Namen er nicht wusste, Mordpläne gegen ihn hegen. Gewiss, dieser Mann war im Grunde hilflos, denn er hatte keine Beine, aber ein Mensch, der einem anderen voller Hass nach dem Leben trachtet, ist immer gefährlich. Er tat also gut daran, diesem Problem Beachtung zu schenken, wenn er sein Leben nicht vorzeitig beendet sehen wollte. Andererseits hatte die Beseitigung dieses Problems noch ein wenig Zeit. Vorrangig musste er sich um den Guten Träumer kümmern. Und um Aranxa. Robert seufzte. Man hatte es nicht leicht. Selbst dann nicht, wenn einem Mächte zur Verfügung standen, die andere Menschen nicht einmal kannten.
„Wir alle folgen unserem Schicksal. Den Lauf der Dinge wirklich zu ändern, steht einem Menschen nicht zu.“ Robert sagte diese bedeutungsvollen Sätze seinem Ebenbild im Spiegel. Dieser stand im prachtvollen Foyer seines Hauses.
Er wandte sich von seinem Spiegelbild ab und stieg die Treppe in den ersten Stock des Hauses hinauf. Es war eine Treppe aus weißem Marmor. Ein Prunkstück, das jedem Schloss zur Ehre gereicht hätte. Robert war reich. Keiner außer ihm selbst wusste wie reich er war, keiner wusste woher dieser Reichtum kam.
Robert erreichte den ersten Stock seines Hauses. Vor ihm lag ein langer Korridor, von dem auf jeder Seite drei Türen abgingen. Am Ende des Korridors wurde eine weitere Tür von zwei Porzellanhunden bewacht, die furchteinflößend ihre Zähne bleckten. Hinter dieser Tür warteten bereits fünf Männer mit schwarzen Umhängen und dunklen Masken. Sie würden diese Umhänge und Masken selbst während ihres Gespräches mit ihm nicht ablegen. Es waren Männer, die für eine auereichende Summe Geld jedem folgten und alles taten. Ihr einziger Traum war Geld, ihr Gewissen war aus Diamant und ihr Herz aus Gold, nicht so wertvoll, sondern so kalt.
Robert betrat den ersten Raum auf der linken Seite. Dort stand ein kleiner, flacher Schrank mit mehreren Schubfächern. Er war reich mit Schnitzereien und Intarsien verziert und enthielt eine Sammlung der tödlichsten Waffen des gesamten Reiches. Zwei solcher Feuerwaffen nahm Robert aus dem obersten Schubfach. Mit je einer in jeder Hand verließ er das Zimmer wieder und wandte sich dann den Porzellanhunden zu. Er durchquerte den Korridor mit festen Schritten, öffnete die Tür zum hinteren Zimmer und betrat es mit auf seine Gäste gerichteten Waffen. Robert wusste, dass dies die einzige Möglichkeit war, eine Verhandlung mit diesen Männern zu führen und zu überleben.
„Sie wissen, weshalb ich sie gerufen habe“, begann Robert, nachdem er die Tür mit dem linken Fuß hinter sich zugeschoben hatte. Dabei richtete er den Blick unverwandt auf seine Gäste. Er befolgte die alte Dompteurregel: wende den Bestien nie den Rücken zu!
„Der Tag des Einsatzes ist für Sie gekommen. Objekt eins erreicht in drei, spätestens in vier Tagen Asgood. Sie verlassen noch in dieser Nacht die Insel und verfahren nach dem vorgesehenen Plan. Die Hälfte ihres Lohnes finden sie im linken Zimmer am Ende des Korridors auf dem Glastisch. Dort wird die andere Hälfte liegen, wenn ihre Mission beendet ist.“
„Woher sollen wir wissen, dass Sie uns nicht reinlegen, wenn wir die Drecksarbeit für Sie erledigt haben?“, fragte einer der Männer. Er hatte eine angenehm weiche Stimme, die so gar nicht zu seiner Erscheinung passen wollte. Vielleicht war er in seiner Freizeit Heldentenor.
„Ich vertraue ihnen. Sie vertrauen mir. So läuft das Spiel, nur so.“ Man hörte leises, unwilliges Gemurmel, aber echte Gegenstimmen blieben aus.
„Und wenn es nicht so läuft, wie ihr es vorausgesagt habt?“, wagte ein Anderer einzuwenden.
„Es wird so laufen. Man könnte glauben, ihr wollt den Auftrag nicht. Habt ihr etwa Angst?“ Es war ein gewaltiges Wagnis, so zu diesen Männern zu sprechen, doch Robert konnte es sich leisten.
„Angst ist ein Wort, das wir nicht kennen“, war die kurze Erwiderung. Eine mühsam zurückgehaltene Wut schwang in den Worten mit.
„Aranxa wird an den vorher besprochenen Ort gebracht. Sollten Sie auf die irrsinnige Idee kommen, sie auf die Insel zu bringen, um mehr Geld von mir zu erpressen, wird niemand aus ihrer Runde mit dem Leben davonkommen.“
Um seine Worte zu unterstützen, schoss Robert in die Wand hinter den fünf Vermummten. Ein faustgroßes Stück Lehm flog heraus. Der Lärm des Schusses hallte in dem großen Zimmer nach und alle hatten plötzlich ein deutliches Klingen in den Ohren, so groß war der Lärm gewesen.
„Glauben sie ja nicht, mir entkommen zu können. Ich finde jeden, egal, wo er sich auch verbirgt.“
Robert schoss noch einmal. Diesmal zersplitterte das Geschoss die Tischplatte. Holzsplitter flogen wie Schrapnel in alle Richtungen auseinander. Es sah aus, als habe ein Riese seine Faust durch die Tischplatte gestoßen. Einer der fünf Männer zitterte, doch unter dem weiten Umhang sah es niemand.
„Ich hoffe sehr, wir haben uns verstanden.“
„Ja“, antwortete der mit der weichen Stimme schlicht. Vermutlich war er der Anführer der Bande. Wenn alle ganz still gewesen wären, hätte man diesen Mann nach seiner Antwort mit den Zähnen knirschen hören können.
„Ich freue mich, das zu hören“, erwiderte Robert. „Also machen Sie sich auf den Weg.“
Die fünf Männer erhoben sich von ihren Plätzen. Robert verließ rückwärts, mit auf die Männer gerichteten Pistolen, den Raum, Er hoffte, dass er sich nicht geirrt hatte. Er hoffte, sein Plan würde funktionieren. Erst wenn er dessen sicher war, konnte er sich dem Mann aus dem gegenüberliegenden Haus zuwenden.
VII.
Michael, der Gute Träumer, erreichte den Fluss zwei Tage nach seinem Abenteuer im Wald der ewigen Finsternis. Und er fand die Brücke hinüber genau an jener Stelle, an der sie auf der Karte eingezeichnet war.
Anfänglich hatte Michael befürchtet, auf einen Trick des Traumlords hereingefallen zu sein. Er fand einfach keine andere Erklärung dafür, weshalb in einem völlig verlassenen Dorf am Rande einer Maiswüste noch ein Händler seinen Laden offenhalten sollte. Alles sah ganz so aus, als wäre dieser Händler nur dort gewesen, weil er, der Gute Träumer, dieses Dorf passieren musste. Als habe dieser Händler an diesem wüsten Ort nur auf ihn gewartet, um dann so schnell wie möglich seine sieben Sachen zu packen und zu verschwinden. Aber je länger Michael den auf der Karte eingetragenen Wegen folgte, umso mehr zweifelte er an der Fallen-Theorie. Die Karte stimmte auffallend. Sie war so gut, dass es schon verwunderlich war, dass sie hier im Reich gezeichnet worden sein sollte. Auch hatte Michael, wenn er es genau bedachte, noch nie zuvor so helles Papier gesehen oder gar in den Händen gehalten. Papier war in seiner Erinnerung immer gelblichbraun und mit Holzfasern durchsetzt, die man deutlich erkennen konnte. Für all das fand Michael keine befriedigende Erklärung.
Freilich, die Karte hatte ihn in jenen Wald geführt, wo er von einem Monster des Traumlords attackiert worden war, aber wenn er es recht bedachte, so konnte der Traumlord ebenso ein grauenhaftes Wesen auf einer blühenden Sommerwiese erscheinen lassen. Es hätte ihm sicherlich auch keine Mühe gemacht irgendeinen Drachen herbei zu zitieren, der den Guten Träumer auf seinem Weg angriff. Es war ihm aber offenbar noch nicht eingefallen.