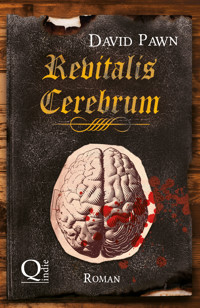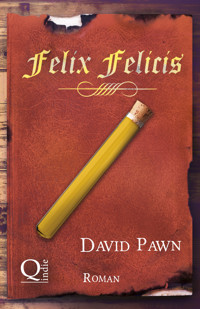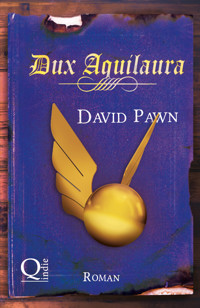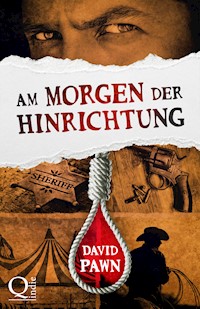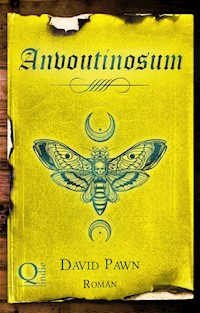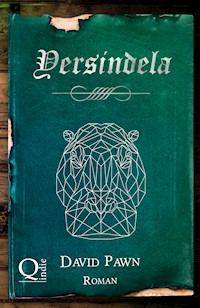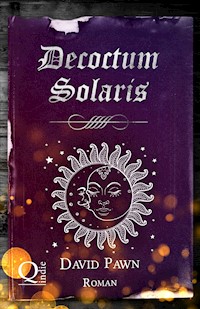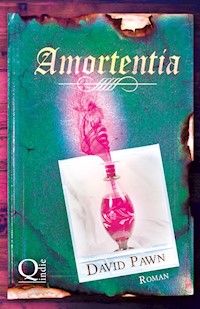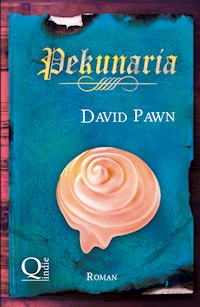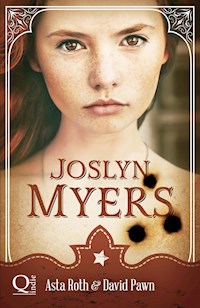Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WunderZeilen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Queere Märchenadaption mit einer ordentlichen Portion scharfzüngigen Witz! Marie Steinbach, genannt Pechmarie, schlägt sich als Taschendiebin durch. Eines Tages gerät sie beim Versuch, eine scheinbar lohnende Börse an sich zu bringen, an Adelaide von Hopfenburg, die Ex des Königs Drosselbart. Die erweist sich als ein weitaus durchtriebenerer Gauner als Marie. Sie wird von Adelaide in die Lehre genommen und in ihren Plan einbezogen, die Krone ihres ehemaligen Gatten zu stehlen, der keineswegs der nette König ist, für den er sich gern ausgibt. Zu zweit zieht das ungleiche Paar durch die Märchenreiche von Diebstahl zu Diebstahl, um sich für den finalen Coup auszurüsten. Folge den beiden auf ihrem Weg von einem Gaunerstück zum nächsten und erlebe eine rasante Reise voller Humor und Abenteuer, bis sich schließlich erweisen muss, ob ihr Plan gelingt und der böse König seine Krone verliert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAVID PAWN
Impressum
Copyright © 2023 by
WunderZeilen Verlag GbR (Vinachia Burke & Sebastian Hauer) Kanadaweg 10 22145 Hamburghttps://[email protected]
Zwei wie Pech und FlitterText © David Pawn, 2023 Story Edit: Vinachia Burke (www.vinachiaburke.com) Lektorat: Cao Krawallo (www.caokrawallo.de) Korrektorat: Monika Schulze (www.suechtignachbuechern.de) Cover & Illustration: Vinachia Burke Satz & Layout: Vianchia Burkewww.vinachiaburke.com ISBN: 978-3-98867-000-7 Alle Rechte vorbehalten.
Süß, aber plemplem
Ich dummes Ding glaubte in jenem Augenblick tatsächlich, leichtes Spiel zu haben. Wie man sich in einem Menschen doch täuschen kann.
Die junge Frau, die intensiv die Auslagen eines Juweliers am Markt studierte, wirkte ein paar Jahre älter als ich, hatte also die Zwanzig hinter sich gelassen, aber die Fünfundzwanzig noch nicht erreicht. Sie musste etwa einen Kopf kleiner sein als ich, trug ihr goldblondes Haar, um das ich sie beneidete, lang und offen, und schien, soweit ich das im Spiegelbild in der Scheibe erkennen konnte, ein hübsches, allerdings blasiert dreinblickendes Gesicht zu besitzen. Sie starrte allein auf die Geschmeide, die vor ihren Augen ausgebreitet waren, und bestimmt dachte sie gerade darüber nach, welcher ihrer Verehrer, von denen sie an jedem Finger zwei haben musste, wie alle diese blonden Hyänen, ihr eines davon schenken würde.
Ja, ich gebe zu, ich habe Vorurteile in Bezug auf blonde Geschlechtsgenossinnen, aber daran ist nur meine Stiefschwester schuld. Die trug auch so eine blonde Wolle auf dem Haupt, leuchtend und lockig und lockend für die Männerwelt. Zunächst stand wenigstens meine Mutter noch auf meiner Seite und begann nicht zu sabbern, sobald die Andere ins Zimmer trat. Aber nachdem die in ihrer Dummheit in den Brunnen vorm Haus gefallen und daraus goldbehängt zurückkehrt war, endete auch dieses Privileg. Von Stund an hieß es nur noch: Goldmarie hier, Goldmarie da. Dann erklärte mir meine Mutter gar, ich solle auch in den Brunnen springen. Und ich blödes Weib tat das tatsächlich, nur um wieder die Nummer Eins unter den Töchtern zu werden. Ich hätte gleich ahnen müssen, dass es nicht funktionieren würde. Schließlich kannte ich die Geschichte, die die andere Marie uns aufgetischt hatte. Und ich wusste genau, dass ich mir von ein paar Broten und Äpfeln nicht sagen lassen würde, was ich zu tun und zu lassen hatte. Und auch nicht von der alten Lügnerin, die ihr die Geschichte aufgetischt hatte, wenn sie die Betten aus dem Fenster ihres Hauses schüttele, schneie es auf der Welt. Entschuldigung, aber man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen: Sie lebte in einem Reich auf dem Boden eines Brunnens. Also, wenn ich es schneien sah, kam der Schnee stets von oben herab.
Sie kennen sicher das Ende vom Lied. Jeder verdammte Einwohner unseres Dorfes kannte es, und weil die es in die Welt hinaustratschten, kannte es auch bald jeder im Reich Tirgiswald. Ich schor mein Haar bis auf die Kopfhaut, denn das verklebte Gestrüpp ließ sich nicht mehr retten. Auch heutzutage trage ich meine jettschwarzen Haare kurz. Und wehe, jemand nennt es pechschwarz.
Die junge Frau vor mir aber schüttelte ihre blonden Locken. Einen Moment hatte ich den Eindruck, ihr Blick träfe mich aus dem Spiegelbild in der Scheibe, aber das war natürlich Einbildung. Sie konnte nicht wissen, dass ich an der Börse interessiert war, die locker am Gürtel ihres Kleides baumelte. Ich stand seitlich an eine Säule des Nachbarhauses gelehnt, halb dahinter verborgen. Von dort aus beobachtete ich meine Beute seit einiger Zeit. Sie war mir bereits aufgefallen, als sie quer über den Markt auf die Auslagen zuhielt. Ihr Gang besaß Zielstrebigkeit, ihr Blick verriet Interesse und die Haltung ihres Kopfs sprach von Würde. So schritten die hohen Herrschaften über den Markt, wenn sie dem Volk die Huld ihrer Anwesenheit gewährten.
Die junge Dame hatte die Geldkatze aus dem Ausschnitt gezogen, kurz nachdem sie an das Schaufenster getreten war, hineingeblickt und dann nicht wieder zurückgesteckt, sondern dort befestigt, wo sie jetzt noch hing. Aber nicht mehr lange, denn mich quälte der Hunger und vom Markt her kroch mir der Duft gebratener Würste in die Nase.
Ich weiß, dass ich die Arbeit nicht erfunden habe. Wenn ich das hätte, wäre sie nämlich nicht so anstrengend und ermüdend. Aber auch der Faulste muss hin und wieder etwas essen. Und wenn er nicht reich ist, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich der Mühsal einer Tätigkeit hinzugeben. Wie jedes einigermaßen gut aussehende Mädchen hätte ich mein Geld auf dem Rücken liegend verdienen können, aber so weit war ich nicht gesunken. Außerdem wusste ich von verschiedenen Krankheiten, die man sich dabei zuziehen konnte, und auch von Männern, die Freude dabei empfanden, Frauen zu demütigen und zu schlagen. Herzlichen Dank, darauf konnte ich genauso gut wie auf Arbeit verzichten. Also blieb noch das Beutelschneiden. Das war nicht so mühselig, aber einträglich genug, nicht jeden Tag der Tätigkeit opfern zu müssen. Man bedurfte nur für den Moment geschickter Finger und flinker Füße.
Ich zückte den schlanken Dolch, der mir stets gute Dienste leistete, wenn es darum ging, jemanden von der Last seines Besitzes zu befreien. Viele waren einfach unvorsichtig und hängten ihre Habe nur mit einem Lederriemen befestigt an den Gürtel. Wenn es ans nächste Bezahlen ging, wunderten sie sich dann, wohin das Geld verschwunden war.
Langsam trat ich um die Säule herum. Ich blickte kurz in das Gesicht des steinernen Satyrn, der seine Hände nach oben reckte, um den Balkon des Hauses gemeinsam mit seinem Partner auf der anderen Seite zu halten. Ich zwinkerte ihm zu, doch wie zu erwarten, reagierte er nicht.
Drei Schritte bis zu der Blondine. Ich stellte mich neben sie, als interessiere ich mich ebenfalls für die Auslagen.
»Hübsche Stücke«, sagte ich lapidar.
Sie hob den Blick zu mir, lächelte mich an und erwiderte: »Dachte ich auch die ganze Zeit. Man sollte sie alle besitzen.«
So siehst du auch aus, dachte ich. Inzwischen hatte meine Linke ihre Arbeit erledigt, ihr Geldbeutel ruhte in meiner Hand. Ich wandte mich ab. »Schönen Tag noch, Gnädigste«, sagte ich. Nachdem ich zwei Schritte Abstand gewonnen hatte, beschleunigte ich meinen Gang und verschwand in der erstbesten Gasse weg vom Markt. Ich wollte nicht in der Nähe sein, wenn das gnädige Fräulein seinen Verlust bemerkte. Ich lief in Richtung Fluss und Gerberviertel. Dort stank es so erbärmlich, dass eine feine Dame gewiss die Verfolgung aufgäbe, sobald die ersten Dämpfe ihr feines Näschen streiften. An der nächsten Ecke wagte ich einen kurzen Blick zurück, aber die Gasse lag still und verlassen. Und auch kein Geschrei oder Gezeter: „Haltet den Dieb!“, ließ sich hinter mir vernehmen.
Ich bog an der Ecke ab, an der nächsten erneut und verlangsamte dann meinen Schritt. Ab jetzt hatte ich gewiss nichts mehr zu befürchten. Ich durfte nur nicht wieder zum Markt zurück. Dort hatte die Blonde bestimmt die Wache alarmiert. Aber ich kannte eine Schenke am jenseitigen Flussufer, wo das Essen vertrauenerweckender als die Kundschaft war. Der Wirt achtete peinlich genau darauf, keinen Ärger mit der Stadtwache zu riskieren, denn damit würde er nur seine Stammgäste vertreiben. Darum lag unter dem Tresen ein armlanger Knüppel mit Nägeln an einem Ende. Wer den einmal zu spüren bekam, stand so schnell nicht wieder auf und schwamm am nächsten Tag flussabwärts.
Ich erreichte das Gerberviertel. Hier roch es wie jeden Tag nach Urin und Exkrementen und all jenem Zeug, das diese Leute verwendeten, um aus Tierhäuten feinstes Leder zu fabrizieren. Keine Ahnung, wie viel sie mit ihrem Tagwerk verdienten, aber wenn es nach meiner Nase ginge, war es immer zu wenig. Ich hielt die Luft an und beeilte mich, die vom Wind abgewandte Seite zu erreichen. Meine Gedanken kehrten zu der Blondine vom Markt zurück, und ich stellte mir vor, wie sie sich direkt an dieser Ecke erbrechen würde.
Über mir schepperten Dachziegel und etwas Schweres landete auf meinen Schultern. Ich stolperte vorwärts und schlug der Länge nach hin. Dabei verfehlte ich mit dem Gesicht einen Hundehaufen nur knapp. Der ruhte jetzt praktisch direkt vor meiner Nase, denn ein Gewicht lastete auf meinem kurz geschorenen Haupt und drückte es zu Boden.
»Überraschung«, säuselte eine helle Stimme in mein Ohr. Ich erkannte sie wieder. Vor ein paar Minuten hatte ich sie vor dem Schaufenster eines Juwelierladens zum ersten Mal gehört.
Verdammt! Und ich hatte geglaubt, dies wäre ein guter Tag.
Sie hockte rittlings auf mir wie auf einem Gaul. Eine Hand drückte meinen Kopf nach unten, die andere tastete mich systematisch ab. Sie fand buchstäblich jede verborgene Tasche in meinem Gewand, selbst jene auf den Innenseiten meines Ausschnitts. Ungeniert grabbelte sie an meinem Busen herum, bis sie die Schleuder geborgen hatte, die sich dort verbarg. Hin und wieder musste in einer Gasse eine Laterne gelöscht werden. Da war ein geschleuderter Stein nützlich.
Der Dolch klirrte auf den Boden neben mir, ebenso ein kleines Stemmeisen und die leere Patronenhülse, die ein Andenken an einen abenteuerlichen Ausflug ins Nachbarreich darstellte. Schließlich baumelte die Geldkatze an dem durchtrennten Lederriemen vor meiner Nase.
»Wollen wir einmal nachsehen, was du da für Beute gemacht hast?« Ihre Stimme verriet eine diebische Freude an dem Spiel, das sie gerade mit mir trieb. »Halt, nein, du darfst raten. Also, wie viel ist wohl wert, was in diesem Lederbeutel steckt?«
»Das ist mir zu blöde«, knurrte ich. »Ruf die Wache, aber spiel keine Spiele mit mir.«
»Die Wache? Sollen wir wirklich Männer mit einer Angelegenheit belästigen, die wir auch unter uns klären können? Wir wissen doch beide, wie die sind: Grob, dumm, und statt auf Tatsachen starren sie uns am Ende nur in die Ausschnitte. Findest du das wirklich erbaulich?«
»Wenn du mich nicht der Wache übergeben willst, was soll dann dieser Zinnober?«
»Ich will mit dir reden. So von Schwester zu Schwester.«
»Wir sind keine Schwestern. Ich habe keine Schwester.«
Ich spürte die Spitze des Dolches in meiner Flanke. »Keine Lügen, Pechmarie. Ich weiß genau, wer du bist.«
»Woher?«
»Oh, nennen wir es gute Beobachtungsgabe.« Aus dieser Stimme konnte man Öl gewinnen. »So, und jetzt stehen wir auf und unterhalten uns wie zivilisierte junge Damen, die einen kleinen Spaziergang durch die Stadt unternehmen. Vergiss bitte nicht, dass ich deinen Dolch habe. Stichverletzungen sind schmerzhaft und hinterlassen Narben, die den Männern nicht gefallen. Männer sind so eitel. Sogar ihre Frauen sollen ihnen als Schmuck dienen.«
»Wer bist du, verdammt?«
»Nenn mich erst einmal eine Freundin. Später habe ich vielleicht einen Namen für dich.«
Himmel, wo war ich da nur reingeraten? Diese Blondine war zweifelsohne süß, hatte aber gehörig einen an der Waffel. Wie kam ich aus dieser Sache nur wieder raus?
»Ich stehe jetzt auf. Du wirst dich gesittet erheben und dann gehen wir Seite an Seite zurück zum Markt und reden miteinander.«
»Du willst mich also doch der Wache übergeben.«
»Unsinn, ich will etwas essen. Du hast doch sicher auch Hunger, oder? Wozu sonst hättest du das klauen sollen?« Wieder tanzte das Ledersäckchen vor meiner Nase. Im nächsten Augenblick spürte ich, wie der Druck an meinem Kopf nachließ und sich auch das Gewicht von meinem Rücken löste. Nur die Spitze des Dolches bohrte sich noch ganz leicht in meine Seite. Eine Hand griff nach meiner Linken. »Lass dich nicht so gehen«, sagte die Blonde. »Du kannst nicht den ganzen Tag müßig auf der Straße liegen und nichts tun.«
»Du hast die ganze Zeit auf mir gesessen, du Schlampe.«
»Für solche Worte wurde mein Mund mit Seife ausgewaschen«, erwiderte meine Peinigerin und zog mich auf die Beine. Sie war offenbar kräftiger, als ihre Statur vermuten ließ. »Außerdem sind das nur faule Ausreden, genauso faul wie das ganze Weib.«
Ich baute mich ihr gegenüber auf, stemmte die Arme in die Hüften und funkelte sie von oben herab an. »Du siehst auch nicht aus, als hättest du dein Leben lang hart für das Brot auf deinem Teller schuften müssen.«
»Nein, das nicht. Aber glaub nur nicht, deshalb wüsste ich nicht, wie hart das Leben mit uns Weibern umgehen kann. Da kommen wir gleich zu meinem ersten Wunsch: Beklau keine Frauen!« Es klang keineswegs wie ein Wunsch, als sie das sagte. »Und mein zweiter Wunsch ist, dass du mich zu einem Essen begleitest. Es gibt am Markt eine Schenke …«
»Dachte ich mir, dass du nicht zu den armen Weibern gehörst«, fiel ich ihr ins Wort.
»Mein dritter Wunsch wäre, dass du mich aussprechen lässt.«
»Wofür hältst du mich? Für die gute Fee?«
»Nein, aber ich halte dich für eine kluge junge Frau, die nur einen Makel besitzt: Sie ist, wie die einfachen Leute sagen, stinkend faul. Aber da du in den sechs Monaten, die du dich allein in einer fremden Stadt durchschlagen musstest, weder verhungert bist, noch totgeschlagen oder in den Turm gesperrt wurdest, musst du Grips haben. Umso mehr erstaunt mich, dass du das geklaut hast.« Einmal mehr hielt sie mir das Ledersäckchen vors Gesicht. »Ist dir nichts aufgefallen?«
»Was sollte mir auffallen, außer, dass es ein prall gefüllter Geldbeutel ist?« Ich schnaubte.
»Ah, prall gefüllt. Aber womit? Sieh ihn dir an! Siehst du die Kanten von Münzen irgendwo?«
Ich beugte mich näher heran, um mir die Sache genauer zu besehen. Da gab mir Blondchen mit einem Finger von unten einen Nasenstüber. »Brauchst du ein Augenglas, mein Liebchen? Aber gut, ich werde dir helfen.« Sie nahm den Beutel wieder dichter zu sich, zog ihn auf und drehte ihn um. Sand und ein paar Kiesel rieselten heraus.
Ich verfolgte das Schauspiel mit vermutlich sehr dümmlichem Gesichtsausdruck.
»Wozu schleppst du einen Beutel Sand mit dir herum?«
»Für dich, Pechmarie.«
Bei diesen Worten kochte mein Gemüt über. »Nenn mich nicht so!« Ich stürzte mich auf sie, ohne zu bedenken, dass sie meinen Dolch bei sich trug. Sie wich meinem Angriff geradezu spielerisch aus, und als ich an ihr vorbeilief, traf ein Knie mein Gesäß. Nur mit Mühe konnte ich verhindern, erneut in der Gosse zu landen.
»Lass das.« Sie sagte die Worte, als sei ich eine lästige Töle, die sie ansprang, um an ihr zu schnüffeln.
Ich wandte mich um und funkelte sie an. »Wer bist du? Schickt meine Mutter dich? Meine Schwester?«
»Geduld, Marie, Geduld.«
»Geduld war aus, als ich geboren wurde«, giftete ich sie an.
Sie streckte die Arme zur Seite und rollte mit den Augen. »Willst du wirklich meine Lebensgeschichte hören, während wir hier in einer Gasse stehen? Mir wäre es lieber, wir säßen gepflegt in einem Gasthaus, einen Humpen Bier vor uns, und sprächen dann.«
Ich atmete tief ein und aus. In mir herrschte immer noch der Drang, sie anzuspringen und ihr an die Gurgel zu gehen, aber eine leise Stimme wiederholte die Worte Gasthaus und Bier in meinem Kopf, die durchaus verlockend klangen. Ich gab also ein Knurren von mir, verschränkte die Arme vor der Brust und stampfte an ihr vorbei weiter die Gasse entlang. Mochte sie das als Zustimmung deuten. Zumindest hatte ich nicht direkt klein beigegeben.
Bis zum Markt liefen wir schweigend nebeneinander her. In Tirgisses gab es am Markt zwei Gasthäuser. Eines trug einen großen weißen Vogel in seinem Wappenschild und hieß ›Der Schwan‹. Das andere, noch vornehmere nannte sich ›Des Königs Haupt‹. Sie steuerte direkt auf dessen Eingang zu.
Dort verkehrten nur die feinen Herrschaften der Stadt: Der Bürgermeister, die Handelsleute, die ihre Geschäfte am Markt führten, Händler, die Waren aus anderen Reichen nach Tirgiswald brachten, Beamte des Königs, Hoflieferanten. Ich sah an mir hinunter. Straßenstaub bedeckte die Vorderseite meines Kleides.
»Der Wirt wird mich für eine Dirne halten«, sagte ich.
»Dirne, Diebin? Wo ist da der Unterschied?«
»Das wird kein Unterschied für den Herrn Wirt sein, aber ich komme erstens da nicht rein, und zweitens ist es für mich durchaus ein Unterschied, denn ich gehöre niemandem.«
»Ich auch nicht mehr«, erwiderte sie. »Also sind wir doch irgendwie Schwestern. Aber für eine Stunde oder so solltest du meine Magd sein. Niemand achtet auf Dienstboten und so kommst du zu Speise und Trunk. Komm jetzt! Wenn du einen Beutel schneidest, bist du auch nicht so schüchtern.«
Der Gastraum wurde durch weit über den Tafeln schwebende Kronleuchter hell erleuchtet. Ein krasser Gegensatz zu den finsteren Spelunken mit festgetretenem Lehmboden, die ich sonst besuchte. Der Boden war aus feinen Holzbohlen, die aussahen, als würden sie jeden Tag poliert. Ich glaube, die feinen Herrschaften nennen so etwas Parkett.
Ein livrierter Herr trat auf uns zu. Das Blondchen hatte mich angewiesen, einen halben Schritt hinter ihr zu bleiben und ich, besser gesagt mein Magen, hielt mich daran.
»Gnä’ Frau, womit kann ich dienen?«
»Ich benötige einen Tisch für mich und meine Magd, an dem wir ungestört essen und reden können. Ich muss ihr Anweisungen für eine Zeit der Abwesenheit geben.« Ihre Stimme klang nach einem süßen Lächeln und der feine Kellner reagierte entsprechend. Er deutete eine Verbeugung an und forderte sie auf, ihm zu folgen. Mich streifte er nur mit einem kurzen Blick.
Er geleitete uns zu einem Tisch in einer Nische, wo wir tatsächlich nicht von anderen Gästen gesehen werden konnten. Dann fragte er nach dem Begehr meiner Begleiterin. Ich blieb Luft für ihn.
Sie bestellte zweimal das Tagesmenü und je ein Glas Bier für uns beide. Der Kellner zog sich mit einer Verbeugung zurück.
»So, Marie, und jetzt sollst du erfahren, warum ich dich brauche«, sagte die Blonde.
»Erst will ich wissen, wer du bist, verdammt!«
»Zügele deine Zunge, sonst gebe ich dir deinen Dolch mit der Schneide voran zurück. Und es ist mir völlig gleich, dass du eventuell das weiße Leinen auf dem Tisch mit deinem Blut befleckst. Ich habe schon an schmutzigeren Orten gespeist. Du glaubst, du bist eine harte, mit allen Wassern gewaschene Frau. Dann lass mich dir deinen Irrtum erklären: Ich bin das Dreckstück von uns beiden. Du bist harmlos.«
Hatte ich schon erwähnt, dass sie süß, aber plemplem sein musste?
»Wer bist du?«
»Ich bin eine Tote. Man kannte mich als Adelaide von Hopfenburg.«
Ich saß mit offenem Mund und brachte kein Wort heraus. In diesem Augenblick servierte ein Schankmädchen das Bier. Die angebliche einstige Prinzessin dieses und anschließende Königin des Nachbarreiches dankte mit einem Lächeln und nahm umgehend einen großen Schluck.
»Du kannst nicht Adelaide sein«, brachte ich schließlich heraus. »Sie ist ertrunken. Vor zwei Jahren. Alle Bänkelsänger erzählten wochenlang davon.«
Sie lachte trocken auf und stieß dann den überaus irren Satz hervor: »Wäre ich nicht ertrunken, wäre ich heute vielleicht wirklich tot.«
Mein Blick muss ihr gesagt haben, was ich von ihren Worten hielt.
»Hör schon auf so zu gucken, als sei ich ein toller Hund. Ich erzähle dir alles, dann verstehst du auch. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, eine Prinzessin zu sein? – Oh, ich sehe an deinem Blick, dass du dir gerade den Himmel auf Erden ausmalst. Kann sein, bei manchen ist das auch so. Zunächst einmal bedeutet es, keine wirklichen Eltern zu haben, sondern einen König und eine Königin, die einen an eine Kinderfrau abgeben, damit sie für die herrschaftliche Erziehung sorgt. Man redet den Vater mit mein Herr König und die Mutter mit meine Frau Königin an. Aber nur, wenn sie ein paar Minuten entbehren können. Ansonsten ist man brav, sitzt für ein Porträt steif wie ein Stock auf einem Schoß, lernt, den Reichsapfel richtig zu halten und alle Sprachen der Nachbarreiche zu beherrschen.«
So langsam gewann ich das Gefühl, eigentlich eine sehr gute Zeit bei meiner Mutter gehabt zu haben. Der Kellner brachte die Vorsuppe und für ein paar Minuten aßen wir schweigend. Anschließend hob meine Begleiterin erneut an, zu erzählen.
»Wenn man Glück hat, ist die Kinderfrau nett und freundlich und ersetzt jenen Teil, den einem Vater und Mutter nicht geben können: Liebe. Aber meine Kinderfrau liebte ihren Rohrstock anscheinend mehr als Kinder. Zu allem Unglück war ich auch noch ein aufgewecktes Kind. Ich spielte ihr allerlei Streiche und büßte jeden schmerzhaft. Sie wollte mir mein vorlautes Mundwerk austreiben, hieß es immer, wenn sie meinen Mund auswusch. Seife schmeckt eklig, kann ich dir sagen. Leider ließ sich mein Mundwerk davon nicht beeindrucken. Ich möchte eher behaupten, das Gegenteil war der Fall. Findest du nicht auch?« Sie zwinkerte mir zu.
Der Kellner kam und holte die leeren Teller ab.
»Ich wurde älter und schnippischer. Die Rolle, die mir zugedacht war, wollte mir einfach nicht gefallen. Vielleicht bin ich einfach zu klug. Was denkst du?«
»Zumindest bist du ganz hübsch eingebildet«, erwiderte ich und sah mit Freude den Tellern entgegen, die gerade gebracht wurden.
»Oh, das bekam ich auch schon oft zu hören: hoffärtig, hochnäsig, gehässig, spitzzüngig, dünkelhaft. Ich glaube, ich kann die Liste noch beliebig verlängern. Und egal wie richtig oder falsch all diese Attribute sind, was mir widerfuhr, hatte ich nicht verdient. Es begann damit, dass mein Vater beschloss, ich müsse verheiratet werden. Verschachert träfe es besser, denn es ging darum, das Reich durch eine gute Partie zu sanieren. Alle möglichen heiratswilligen Prinzen wurden auf das Schloss geladen. Die, die nicht dumm waren, waren hässlich. Wahrscheinlich wussten die wirklich gut aussehenden und liebenswerten, wie es um das Reich stand. Tja, und wahrscheinlich trug auch mein Ruf dazu bei. Der Einzige, der einigermaßen vorzeigbar gewesen wäre, kam als letzter an die Reihe. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon so außer mir, dass ich den Makel mit der Lupe suchte. Er hatte ein vorspringendes Kinn. Nicht viel, aber ich zog mich daran hoch und taufte ihn Drosselbart. Ich wusste damals noch nicht, dass ich besser den Fettklops vom Anfang genommen hätte.« An dieser Stelle deutete sie auf die Teller. »Wir sollten essen, sonst wird es kalt.«
Ich brauchte keine weitere Aufforderung. Es schmeckte köstlich. Ich glaube, ich hatte mein Lebtag kein so zartes Fleisch gegessen. Die Soße war ein Traum. Wenn ich je einen Mann fand, musste er so wohlhabend sein, dass wir uns so einen Koch leisten konnten.
»Träumst du?«
»Ja«, sagte ich. »Von einem Koch.«
Adelaide legte das Besteck zur Seite und lachte herzhaft. Dann schob sie den Teller ein Stück von sich.
»Bist du schon satt? Du kannst mir was von …«
»Psst.« Sie legte einen Finger an die Lippen, beugte sich vor und raunte: »Nicht so laut, sonst guckt nur der Kellner wieder.« Sie lehnte sich wieder zurück, langte in ihren Ausschnitt und zog ein längliches Döschen daraus hervor.
»Du hast da ja ein regelrechtes Warenlager.«
»Man muss auf alles vorbereitet sein.« Sie öffnete das Döschen und zog etwas heraus, was ich auf den ersten Blick nicht erkannte. Zum Glück, sonst wären mir vermutlich meine letzten Bissen wieder aus dem Mund gefallen, denn als ich mich ein wenig vorlehnte, erkannte ich den Schwanz einer Ratte.
»Was hast du …? – Oh, Gott!« Die Frage erübrigte sich gerade, denn ich sah, wie sie den Schwanz in der Soße wendete und unter den Rest Gemüse schob, sodass nur noch eine Spitze hervorlugte. Sie schraubte die Dose wieder zu, steckte sie zurück, woher sie gekommen war, und kreischte wie am Spieß.
Sekunden später stand der Kellner an unserem Tisch.
Mit schreckgeweiteten Augen deutete meine Begleiterin mit dem Zeigefinger anklagend auf die hervorlugende Schwanzspitze und stammelte nur immer wieder: »Da … da …«
Der Kellner besah sich das Malheur, schluckte, richtete sich wieder auf. »Das ist … Ich kann gar nicht …« Er wusste nicht, was er sagen sollte. Sein Gesicht glühte, immer wieder hüpfte sein Adamsapfel auf und ab.
»Ich werde umgehend ein neues Gedeck bringen lassen«, stammelte er schließlich und hob ihren Teller an.
»Sparen Sie sich das! Der Appetit ist uns gründlich vergangen.« Sie deutete in Richtung der Tür. »Und dieses Lokal schmückt sich mit einem Namen, der den König erwähnt. Ich frage mich, was seine Hoheit wohl davon hält, was einem hier serviert wird.«
»Gnä’ Frau, das ist ein furchtbares Unglück für unser Haus. Es ist mir unbegreiflich, wie so etwas geschehen konnte. Ich kann nur inständigst darum bitten, Stillschweigen zu bewahren. Unser Haus kommt natürlich für die entgangene Freude eines genussvollen Mahles auf.« Der Kellner verbeugte sich zweimal. »Können wir Ihnen wenigstens noch ein Dessert servieren?«
Adelaide lächelte huldvoll. »Sie scheinen an dem Vorkommnis ja keine Schuld zu tragen. Daher will ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Bringen Sie uns noch ein Dessert, dann werden wir gehen und alles vergessen, was uns hier an Gräuel widerfahren ist.«
Eine erneute Verbeugung folgte.
»Du bist ein ausgekochtes Luder«, sagte ich, als der Mann außer Hörweite war.
»Was bleibt uns armen, geplagten Weibern auch anderes übrig. Bis zu jenem Tag, als mein Vater mich endgültig verstieß, war ich nur ein wenig vorlaut, verstehst du? Aber was danach geschah, hat mich verändert. Sehr verändert, mein Liebling.« Sie zwinkerte mir anzüglich zu. »Nachdem ich auch den letzten Heiratskandidaten vergrault hatte, bekam ich den Zorn eines Königs zu spüren. Ich landete nur darum nicht auf dem Hackklotz des Henkers, weil meine Mutter um Gnade für mich bat. Aber ich undankbares Stück – Originalton des Königs – sollte dem ersten Mann zur Frau gegeben werden, der ans Schlosstor klopfte. Am nächsten Morgen erschien in aller Herrgottsfrühe ein Spielmann mit schwarzem Rauschebart vor dem Tor. Der Gesichtsbewuchs verdeckte nicht nur das auffällige Kinn, sondern sein halbes Gesicht. Ich erkannte ihn tatsächlich nicht.
Er sang unterm Fenster des Schlafgemachs meiner Eltern. Mein Vater zögerte keine Minute, ehe er entschied, dass dieser Spielmann mein Gemahl werden sollte. Ich wurde wie ein Stück Vieh weggegeben.
Danach begann mein Martyrium, denn der Mann erwies sich als ein brutaler Kerl, der offenbar Freude dabei empfand, mich zu quälen und zu demütigen. Auf Knien musste ich durchs Haus rutschen und den Boden putzen, nur damit er wieder Kautabak darauf speien konnte, oder das Essen hinabwerfen, das ich ihm kochte. Er lehrte mich kochen, flechten, spinnen, töpfern und das Fürchten.
Die Geschichte, wie er mich zum Markte sandte und jedes Mal die Waren zerstörte, die ich verkaufen sollte, dürfte bekannt sein. Aber das sind nur die Dinge, die öffentlich wurden. Wie er mich im Bett behandelte, dass er Spaß daran hatte, sich gewaltsam auf mich zu werfen, mich zu schlagen und auf jede erdenkliche Weise zu demütigen, blieb im Dunkeln der Hütte, in der wir lebten.«
Mir stockte der Atem ob dieser Grausamkeiten, die mein Gegenüber berichtete. Auch ich hatte die Geschichte vom König Drosselbart durch Bänkelsänger gehört. Damals lebte ich noch bei meiner Mutter, die andere Marie erledigte die Hausarbeit und ich konnte mich dem Müßiggang widmen, den ich so liebte. Damals war mir die Geschichte als lustige Episode erschienen.
Unser Dessert wurde gebracht und wir verzehrten es so schweigend wie die Gänge zuvor. Kurz erschien der Kellner noch einmal und fragte, ob wir ein weiteres Bier oder Wein wünschten. Wir entschieden uns für ein Bier.
Nachdem es serviert worden war, setzte Adelaide ihren Bericht fort. »Als der König sich schließlich zu erkennen gab, glaubte ich, mein Martyrium sei vorbei. Ich nahm an, nun habe der Herr seine Rache gehabt, sei glücklich und zufrieden und würde mich behandeln, wie ein guter Mann eine Frau behandeln sollte. Nie erlag ich einem größeren Irrtum.
Natürlich gab sich der König in der Öffentlichkeit höflich und liebevoll. Er lächelte mich ständig an, küsste meine Hand und mein Haar voller Zartheit. Aber wenn wir allein waren, schlug er mich, stieß mich gegen die Möbel, zwang mich, ihm zu Willen zu sein, wann immer es ihn überkam. Er scherte sich nicht, ob Dienstboten, Bittsteller oder andere Untergebene im Raum waren. Er packte mich, zwang meine Schenkel auseinander und dann … Na ja, was Männer eben tun. Manchmal glaube ich, wäre er ein wildes Tier gewesen, wäre ich besser dran gewesen.
Ich hatte geglaubt, der brutale Spielmann sei die Verstellung gewesen, aber nein, das war sein wahres Wesen. Der freundlich lächelnde, höfliche König war die Verstellung.
Immer wieder mussten Ärzte bei uns am Hofe vorstellig werden, weil ich angeblich in meiner Dummheit gegen eine geschlossene Tür oder einen Schrank gelaufen oder vom Pferd gefallen war. Als er auch noch anfing, mich bei der Sache … du weißt schon … zu würgen, sagte ich mir, ich müsse fliehen.«
Der Kellner räumte die Dessertteller fort und fragte, ob wir noch einen Wunsch hätten. Adelaide erklärte, sie würde noch fünfzig Taler für ihr Schweigen erwarten. Schließlich habe sie gute Kontakte zu einem Verwandten des Königs, dessen Haupt im Namen des Gasthauses genannt werde. Der Mann verbeugte sich und erklärte, er werde das Geld umgehend herbeibringen. Einmal mehr lächelte meine Begleiterin huldvoll. Der Kellner zog sich zurück.
»Ich konnte allerdings nicht einfach fliehen. Ich wusste, mein Ehemann würde mich jagen lassen. Mir blieb nichts anderes übrig, als meinen Tod vorzutäuschen. Eines Nachts schlich ich aus dem Schloss. Am Fluss entkleidete ich mich von Kopf bis Fuß und warf die Kleider hinein. Ich konnte nur hoffen, dass ihr Auffinden ausreichen würde, mich für tot zu halten. Zu meinem Glück geschah es so. Aber meine Not war noch lange nicht zu Ende, denn ich besaß nunmehr nicht einmal Kleider am Leibe. Auch meinen Schmuck hatte ich zurückgelassen. Ihn zu versetzen hätte nur eine neue Spur bedeutet, falls ihn jemand ausfindig machte. Die ersten Taler verdiente ich auf die denkbar schrecklichste Weise, die aber für eine Frau mit nichts außer ihrer nackten Haut die einfachste ist.«
»So tief bin ich nie gesunken«, sagte ich.
»Sei glücklich. – Vom Ersten, der mich nahm, erbat ich mir Kleidung. Der war ein naiver Kerl, der nur seinen Spaß haben wollte. Eher höflich und zurückhaltend. Und so ungeschickt, wie er sich anstellte, als es zur Sache ging, schien er auch noch nicht allzu viele Weiber gehabt zu haben. Aber er kaufte mir Kleider. Nach drei Monaten konnte ich dieses Geschäft aufgeben und verdingte mich bei einem Töpfer, der mich allerdings öfter als seinen Ton betatschte. Daher verließ ich ihn. Möglicherweise ging ein bisschen Steingut dabei zu Bruch. Danach arbeitete ich bei einem Bäcker, der das Kneten auch an meinem Busen üben wollte. Ich bin zu der Einsicht gelangt, dass alle Männer Schweine sind. Und dafür sollen sie büßen. Ich nahm also das Geld, das ich bis dahin verdient hatte, besorgte mir noch ein paar schöne Kleider und wechselte erneut den Beruf. Zu jenem, den ich noch heute ausübe.«
»Und was treibst du?«
»Ich stehle. Aber ich gebe mich nicht mit so lächerlichen Geldbörsen ab wie du. Ich steige in ihre Häuser und Läden ein und räume ihre Vitrinen und Schmuckkästen leer. Aber für das, was ich wirklich vorhabe, brauche ich wenigstens eine Verbündete. Darum habe ich deinen Werdegang verfolgt, Marie.«
»Was hast du vor?«
»Ich werde die Schatzkammer meines Herrn Gemahls ausräumen. Ich werde ins Hopfenburger Schloss einsteigen und mir nehmen, was mir nach all diesen Qualen zusteht.«
»Du bist tatsächlich irre«, sagte ich und nahm einen Schluck Bier. »Wir sind zwei Frauen. Das Schloss von Hopfenburg wird von ich weiß nicht wie vielen Gardisten bewacht. Mit Waffen.«
Sie leerte ihren Krug in einem Zug, stellte ihn polternd wieder auf den Tisch und blickte mir in die Augen. »Wir werden üben, damit ich sehe, ob du verlässlich bist.«
»Üben?«
»Was denkst du, warum ich mir diesen Juwelier genau angesehen habe? Ach ja, du dachtest, ich suche mir ein hübsches Geschmeide aus. Aber das habe ich nicht nötig. Mir werden alle gehören, die da ausla…«
Sie sprach nicht zu Ende, denn in diesem Moment erschien der Kellner wieder am Tisch. Er stellte mit einer Geste der Demut einen Stapel Münzen auf den Tisch. »Lassen Sie dem König unsere besten Wünsche ausrichten«, sagte er.
»Oh, das werde ich.« Sie neigte das Haupt, griff nach dem Geld und ließ es in einer Tasche ihres Kleides verschwinden, die sich überraschenderweise nicht in ihrem Ausschnitt befand. Danach stand sie auf. »Marie, komm, wir müssen uns eilen!«, sagte sie in herrschaftlichem Befehlston. Bei diesen Worten erkannte ich zweifelsfrei, dass sie einmal bei Hofe gelebt und den Umgang mit Dienstboten gelernt hatte.
Sie stolzierte voran, ich folgte im besprochenen Abstand. Draußen schloss ich zu ihr auf, wir bogen in eine Gasse ein und brachen wie auf Kommando in schallendes Gelächter aus.
»Die Hälfte der fünfzig Taler gehört dir, wenn du meine Partnerin wirst«, sagte sie, nachdem wir uns wieder beruhigt hatten. Das klang natürlich nicht schlecht. Aber bei einem Juwelier einzusteigen, verlangte deutlich mehr Mumm, als einem Marktbesucher den Geldbeutel vom Gürtel zu schneiden. Nur mit einem Dolch und flinken Füßen war es da nicht getan.
»Weißt du«, sagte sie, während ich noch nachdachte plötzlich, »ich habe sie studiert, die Männer. Wie sie gehen, wie sie stehen, wie sie sich bewegen und reden. Aus all dem kann ich erkennen, was sie denken, was sie als Nächstes tun werden.«
»Das ist nicht möglich.«
»Ich wusste, was du tun würdest, wusste sogar im Voraus, welchen Weg du zur Flucht wählen würdest.«
»Aber ich bin kein Mann«, wandte ich ein.
»Inzwischen weiß ich auch uns Frauen zu deuten«, entgegnete sie.
»Das ist doch verrückt«, begehrte ich auf. »Niemand kann die Gedanken eines anderen Menschen lesen.«
»Probieren wir es aus«, sagte sie, lehnte sich lässig an die Hauswand hinter ihr und sah mir in die Augen. »Denk dir eine Zahl aus, die zwischen eins und zehn liegt. – Hast du?«
Ich nickte.
»Ich werde jetzt langsam rückwärts zählen«, erklärte sie und begann. »Zehn, neun …«
Bei drei stoppte sie. »Du hast die drei gewählt.«
»Das war Glück, pures Glück.«
»Gut, versuchen wir es noch einmal. Nimm jetzt eine Zahl zwischen zehn und zwanzig. Wenn du bereit bist, nicke, dann zähle ich wieder.«
Ich gehorchte. Bei fünfzehn hörte sie mit Zählen auf und erklärte, dies sei meine gedachte Zahl.
»Das ist Magie. Du bist eine Hexe!« Anklagend zeigte ich mit dem Finger auf sie.
Sie lachte. »Weißt du, was ein Buch ist? Kannst du lesen?«
»Klar kenne ich Bücher und lesen kann ich auch.«
»Dann ist dir sicherlich klar, was es bedeutet, dass ich in deinem Gesicht lesen kann wie in einem offenen Buch. Du wolltest die Zahl so sehr verheimlichen, dass du jedes Mal den Blick gelöst hast, wenn ich sie nannte.« Sie schnippte mir mit einem Finger gegen die Stirn. »Da drin war die Zahl und deshalb konntest du sie nicht verbergen.«
»Ach, Unsinn. Du konntest ja nicht hinter meine Stirn schauen.«
Sie winkte ab, warf die Arme in die Luft und rief: »Ach, vergiss es und komm.«
»Wohin?«
»Wohin wohl?« Sie sprang um mich herum wie ein junger Hund um seinen neuen Herrn. »Zu mir nach Hause natürlich. Wir sind jetzt Schwestern. Und Schwestern wohnen zusammen, oder nicht?«
»Ich brauche keine Schwester«, wehrte ich ab, aber ihre Art zu reden war so fordernd, dass ich ihr unwillkürlich dennoch folgte. Vielleicht war ich auch einfach nur neugierig, wie das Zuhause dieser Person wohl aussehen mochte. Immerhin war sie einstmals eine Prinzessin gewesen. Sie würde gewiss nicht ein Zimmer in einer kleinen Pension bewohnen wie ich.
Wir erreichten ein zweistöckiges Stadthaus, das bereits seit Jahren nicht mehr bewohnt sein konnte. Die Fenster der unteren Etage waren mit Brettern vernagelt, bei denen in der oberen fehlten sämtliche Scheiben. Durch eines sah ich, dass die Wandbespannung teilweise verschimmelt war und sich in Streifen löste. Die Eingangstür hing schief in den Angeln, der ehemalige Vorgarten war eine Wildnis aus Brennnesseln, Kletten und Disteln.
»Ist es nicht herrlich?« Adelaide sprang in wilder Begeisterung vor dem schiefen Zaun auf und ab. Bei ihr mussten wenigstens genauso viele Latten fehlen wie bei diesem.
»Hier wohnst du?«
»Ja. Es ist perfekt! Hier kann ich tun und lassen, was ich will, und keiner kommt auf die Idee, mich zu stören.«
»Aber das ist eine Ruine.«
»Ruine? Meine Villa nennst du eine Ruine?« Sie versetzte mir einen Schlag mit der flachen Hand auf den Hinterkopf, dass mir Hören und Sehen verging.
Ich fuhr zu ihr herum und wollte sie packen, um ihr zu zeigen, dass man nicht so mit mir umsprang, aber sie war bereits über den Zaun gesprungen und lief auf den Eingang zu. Hatte ich schon erwähnt, dass sie süß, aber völlig irre war? Bestimmt, oder?
Unschlüssig blieb ich auf der Gasse stehen, während sie mir vom Eingang her winkte, ihr endlich zu folgen. Worauf ließ ich mich nur ein? Vermutlich spukte es in diesem Gemäuer auch noch.
Schließlich siegte einmal mehr meine Neugier, die bekanntlich der Katze Tod ist. Aber ich war zum Glück ja kein Mäusejäger, sondern eine erfahrene, mutige Beutelschneiderin.
Da alle Fenster vernagelt waren, empfing mich Finsternis. Ich zuckte zusammen, als aus dieser heraus eine Hand nach mir griff. Darauf erklang ein helles Lachen. »Hast du Angst? Das gefährlichste in diesem Haus sind wir, mein Liebchen.« Das wollte ich gern glauben, wenngleich es mich nicht beruhigte.
Sie führte mich zu einer Treppe, bei der ich froh war, sie nicht sehen zu müssen. Jeder Schritt ließ ein anderes Knarren und Ächzen ertönen. Im Obergeschoss fluteten Licht und Luft durch die Räume. Zur derzeitigen warmen Jahreszeit mochte das ganz nett sein, aber wie sie hier den Winter verbracht hatte, schien mir ein Rätsel.
Wir betraten einen großen Raum mit Stuckdecke und einer Wandbespannung, die besser aussah als jene, die ich durch das Fenster gesehen hatte. Ich entdeckte keinen Schimmel. Der Raum besaß die Ausmaße eines Ballsaales. Vielleicht hatte er zu besseren Zeiten dieses Hauses sogar als solcher gedient. An dreien der Wände lehnten Hellebarden und Piken.
Die vierte Wand wurde von einem riesigen Himmelbett, einem Vierposter, dominiert. Das Ding war so groß, dass sich eine ganze Familie darin zur Nachtruhe begeben konnte, ohne dass einer den anderen störte.
»Mein königliches Traumbett«, deklamierte Adelaide im Stile eines stolzen Besitzers, mit beiden Händen daraufweisend. Sie eilte an einem Tisch vorbei, der mitten im Zimmer stand. Drei Stühle waren um ihn gruppiert.
Unter den Fenstern lagen mehrere Musketen und eine Streitaxt, angesichts deren kolossaler Größe ich bezweifelte, sie anheben zu können. An einer Seite standen zwei Fässer, auf einem davon thronte ein ausgestopfter Rabe. Daneben zielte das Rohr einer kurzläufigen Kanone direkt auf die Eingangstür.
»Was hast du angestellt? Das Arsenal ausgeräumt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ist das nicht schön?«
Schön wäre bestimmt nicht das Wort gewesen, das mir angesichts einer Waffenkammer als Erstes in den Kopf gekommen wäre. Wozu brauchte sie das alles? Man könnte eine kleine Armee mit dem Inhalt dieses Raumes ausrüsten.
Mein Blick fiel auf ein Objekt, das angesichts dieser Sammlung zur Schau gestellter Kriegsgeräte ebenso absurd unpassend erschien wie das Bett. Direkt den Fenstern gegenüber an der Wand, flankiert von mehreren Morgensternen, stand ein Frisiertisch mit einem wunderschönen ovalen Spiegel, dessen Rahmen eindeutig vergoldet, wenn nicht aus purem Gold war. Auf dem Tisch standen ähnlich durcheinander wie die Waffen in diesem Raum Tiegel, Schälchen und Flacons in verschiedenen Größen und Formen.
Ich trat näher und nahm das eine oder andere Gefäß zur Hand. Adelaide tanzte, anders kann ich es nicht nennen, heran, nahm mir einen Tiegel aus der Hand und strich sich die darin enthaltene rote Farbe auf die Lippen.
»Wir sind Frauen. Wir müssen uns schminken.« Sie gab mir den Tiegel zurück. Ihr Mund leuchtete rot wie eine frische Wunde in ihrem ansonsten eher blassen Gesicht. »Aber nicht um den Männern zu gefallen, sondern uns selbst.«
Sie nahm einen weiteren Tiegel zur Hand und gab etwas von seinem Inhalt links und rechts auf ihre Wangen, die daraufhin zwei rosa Kreise zeigten. Schließlich griff sie nach einem Flacon, dessen Inhalt grün schimmerte wie ein altes Kirchendach. Sie schüttete etwas davon in ihre Linke und fuhr damit kurzerhand durch ihr Haar. Sofort zeigten sich grüne Strähnen in der blonden Mähne. Sie beugte sich vor, begutachtete sich im Spiegel und wandte sich wieder zu mir um. »Na, wie findest du das?«
»Gewöhnungsbedürftig«, sagte ich vorsichtig. Vorhin, als ich etwas ihrer Ansicht nach Falsches gesagt hatte, kassierte ich einen Schlag gegen den Hinterkopf. Inmitten all der Mordinstrumente in diesem Raum wollte ich kein Risiko eingehen.
Im nächsten Augenblick sprang sie bereits an mir vorbei. »Komm, ich zeige dir den Rest. Unten gibt es noch viel mehr zu sehen. Das wird dir gefallen.«
Das bezweifelte ich.
Adelaide verschwand in einem Nebenraum, zu dem eine schmale Tür neben dem Schminktisch führte. Bei einer späteren Besichtigung meinerseits entpuppte sich dieser Raum als Badezimmer. Sie kehrte kurz darauf mit einer Kerze in einem silbernen Leuchter zurück.
Wenn man von dem Ergebnis ihrer merkwürdigen Schminktechnik absah, die sie eher wie einen Jahrmarktsgaukler aussehen ließ, wirkte sie mit dem Leuchter in der Hand und durch den stolzen Blick in ihren Augen tatsächlich wie eine Prinzessin, die sich anschickte, ihre Räumlichkeiten für die Nacht aufzusuchen. Die Art, wie sie vor mir gemessenen Schrittes einherging, unterstrich diesen Eindruck.
Sie griff nach Stahl und Zunder auf einem Regalbrett bei der Tür, das mir bisher nicht weiter aufgefallen war. Angesichts der sonstigen Möblierung des Raumes kein Wunder. Nachdem sie die Kerze entzündet hatte, warf sie das Feuerzeug zurück und verkündete »Du wirst staunen.«
Daran wiederum hatte ich keinen Zweifel.
Sie winkte mir, ihr zu folgen. Wir stiegen die Treppe hinab, die diesmal seltsamerweise keine Geräusche von sich gab. Im Licht der Kerze konnte ich nun auch Teile der Einrichtung der unteren Etage erkennen. Sie sah bei Weitem weniger martialisch aus als jene oben. Die Räume waren allesamt finster, aber noch vollständig möbliert. Die Tische, Stühle, Schränke, Sekretäre und sonstigen Einrichtungsgegenstände mussten kostbar sein. Intarsien schmückten fast alle dem Betrachter zugewandten Flächen. Auf den meisten Tischen und Kommoden standen Vasen aus Porzellan, die mit Motiven aus der freien Natur bemalt waren. Einer der Räume beherbergte eine kleine Ausstellung porzellanener Tiere. Alle Möbel waren von den Wänden abgerückt, an denen ich hier und dort Schimmelflecken erblickte.
»In diesem Haus kannst du jetzt leben. Du bist herzlich eingeladen. Natürlich wohnen wir oben. Das hier …« Sie bereitete die Arme aus. »… ist nur für ungebetene Besucher.«
»Wo soll ich schlafen?« Ich schaute sie ratlos an.
»Oben, neben mir, im Traumbett.«
»Äh … Ich habe ein Zimmer in der Stadt.« Sollte ich wirklich mit einer Frau in einem Bett schlafen?
Sie stellte den Leuchter zu Boden und sprang um mich herum wie ein aufgeregtes Fohlen. Dabei legte sie immer wieder die Hände in bittender Geste aneinander. »Bleib, Marie, bleib. Ich habe das Alleinsein so satt.«
Ich war unschlüssig. Was ich von ihr bisher gesehen und gehört hatte, klang einfach verrückt. Um Zeit zu gewinnen, fragte ich: »Wem hat das hier alles mal gehört?«
»Dem Meisterdieb«, sagte sie, ohne zu zögern. An meiner Miene erkannte sie wohl, dass diese Auskunft ein wenig zu knapp geraten war. Doch statt einer sinnvollen weiteren Erläuterung fragte sie: »Was weißt du über Luchse?«
»Luchse?«, echote ich ziemlich dümmlich.
»Ja, Luchse. Das sind Raubkatzen, die in den Wäldern leben. Haben lustige Ohren mit einem Pinsel oben dran und so gut wie keinen Schwanz. Aber sie sehen so gut, dass es sprichwörtlich ist. Nie gehört?«
»Doch, aber wie kommst du vom Meisterdieb zu Luchsen ohne einen Zwischenhalt?«
»Luchse haben große Reviere im Wald, in dem jeweils immer nur ein Exemplar jagt. Wenn ein Luchs in das Revier eines anderen eindringt, kämpfen sie, bis einer von beiden sich zurückzieht. Und bei großen Dieben ist es ähnlich. Der Meisterdieb war ein schlauer Bursche. Er hat alles, was du hier siehst, durch ehrlichen Diebstahl erworben. Und noch viel mehr. Inzwischen besitzt er bestimmt ein ähnliches Anwesen irgendwo sonst auf der Welt.«
»Warum ist er gegangen?«
»Ein anderer Luchs hat ihn vertrieben. Ich.« Sie zeigte mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf ihre Brust.
»Wie hast du ihn vertrieben? Bist du bei Nacht und Nebel mit deiner Kanone an seinem Bett aufgetaucht?«
Sie lachte, sprang auf mich zu und umarmte mich. »Du bist lustig, weißt du das?«
»Nein, weiß ich nicht.«
Sie ließ wieder von mir ab. »Bist du aber. – Kannst du dir nicht denken, wie ich ihn losgeworden bin? Es war ganz einfach. Ich habe ihn bei der Wache verpfiffen. Aber ich bin kein Unmensch …« Sie zögerte einen Moment, neigte den Kopf und legte eine Hand nachdenklich an eine Wange. Nach kurzer Überlegung fuhr sie fort: »Jedenfalls meistens nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, dass jemand ihn angeschwärzt habe und er verduften müsse. Das tat er in jenem Augenblick, als die Stadtwache in Mannschaftsstärke an der Vorderfront des Hauses auftauchte. Man hat hierzulande nie wieder von ihm gehört. Und dann bin ich hier eingezogen, nachdem ich das Haus vorbereitet hatte.«
»Was meinst du mit vorbereitet?«
»Na, denkst du, ein Haus verfällt in so kurzer Zeit. Ich kann dir gar nicht sagen, was für eine Arbeit es war, oben alle Scheiben rauszuschlagen und den Schimmel in die Wände zu schmieren.«
»Du hast … was?«
»Ach ja, ich vergaß. Ich sollte in deiner Gegenwart das Wort Arbeit nicht allzu oft in den Mund nehmen. Es stößt dich ab.«
»Nicht so sehr wie das Wort Schimmel«, entgegnete ich.