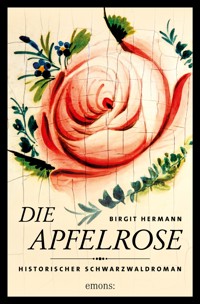Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Roman
- Sprache: Deutsch
Wie ein Schwarzwälder in den Orient zog, um ein Imperium aufzubauen. Ein fesselnd erzählter Roman voller historischer Details. Schwarzwald, 18. Jahrhundert. Als Luftikus von der Familie verstoßen, schmiedet Mathis Faller einen kühnen Plan. Er will mächtiger und reicher werden als seine fünf Brüder und die Handelskompanie zusammen. Seine besondere Kostbarkeit: der Nachbau einer Spieluhr, die er von seiner Geliebten Resle bekam. Mit seinen Uhren wagt er die Reise nach Konstantinopel, die bedeutendste Handelsmetropole des Osmanischen Reichs – und schafft es, die Gunst des Sultans zu gewinnen. Doch Mathis muss feststellen, dass der Weg zur Macht gefährlich ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Hermann lebt mit ihrem Mann in Titisee-Neustadt, ist gebürtige Schwarzwälderin und liebt die blauen Höhen und dunklen Wälder ihrer Heimat. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet als Naturparkführerin und hat bereits mehrere erfolgreiche Romane veröffentlicht.
Dieses Buch ist ein Roman mit historischem Hintergrund. Mathis Faller hat tatsächlich gelebt und wurde Ende des 18. Jahrhunderts im heutigen Istanbul ermordet. Darüber hinaus sind die beschriebenen Handlungen und die übrigen Personen teils frei erfunden.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: finken-bumiller//burkhard finken, unter Verwendung des Bildmotivs Zeke Tucker/unsplash.com
Lektorat: Vanessa Herwartz
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-311-3
Historischer Schwarzwaldroman
Überarbeitete Neuausgabe
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Der Ferman« im Schillinger Verlag Freiburg.
Dieser Roman wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Du bist nur ein Besucher in meinem Leben,deine Wurzeln liegen woanders.Und dort werden sie auch bleiben,samt ihrer Frucht,auch wenn deine Äste im Wind wehenund sich nach fernen Ländern recken,dort gar ihr Laub abwerfen.
Ambra, Wahrsagerin aus dem Volk der Roma
1
Galata, 25. Juni 1794
Nur ein fahler Lichtstrahl der untergehenden Sonne fiel auf den gestampften Boden des Gewölbekellers, der die flirrende Hitze des Sommers außerhalb seiner mächtigen Mauern hielt. Gedämpftes Stimmengewirr in allerlei Sprachen drang von der Straßenseite, die zum Marktplatz führte, an das Ohr von Mathias Faller. Er lag regungslos mit dem Gesicht zum Boden.
Blut sickerte aus zahlreichen Stichwunden in die modrig riechende Erde. Er spürte sie nicht mehr, die Einstiche. Das Letzte, was sein Schmerzempfinden noch gemeldet hatte, war dieses unsägliche Brennen der Kehle. Kurz darauf der metallene Geschmack von Blut in seinem Mund und die Panik, zu ertrinken. Seine Sinne registrierten nicht mehr, dass es sein eigener Lebenssaft war, der pulsierend seinen Hals hinunterrann, den Boden tränkte und seine Lungen füllte. Er brachte kaum ein Husten heraus. Sein Geist schien diesen geschundenen Körper verlassen zu wollen und lenkte die Gedanken weit zurück, in eine andere Zeit, in eine andere Welt. Zu den Ursprüngen seiner Angst vor dem Ertrinken.
Als etwa Zehnjähriger war er im Winter im Eis des Klosterweihers eingebrochen und hatte mit aller Kraft gegen die eisigen Fluten gekämpft, gespürt, wie seine kleinen Hände immer wieder von den Eisschollen abgerutscht waren und die dunkle Woge über seinem Kopf erneut zusammengeschlagen war. Dann, als er schon glaubte, für immer in diesem schwarzen Gewässer versinken zu müssen, rissen ihn zwei kräftige Arme aus dem bedrohlichen Grab. Es waren die Arme des alten Ganters. Ein schweigsamer, magerer Kerl mit einem angegrauten Vollbart, der fast sein ganzes Gesicht bedeckte. Damals sah Mathis, wie er früher genannt wurde, ihn das erste Mal ohne seine markante Pfeife. Das Zweite, was er wahrnahm, waren die großen braunen und vor Entsetzen geweiteten Augen von Resle, die eigentlich Theresia hieß, der Tochter des dürren Ganters. Die Familie lebte in der Nachbarschaft von Mathis, sie kannten sich von klein auf. Das Mädchen stand zusammen mit anderen Menschen auf dem Damm.
»Der Faller Mathis, wer sonst! Dein Vater ist gestraft mit dir!«, waren die einzigen Worte, die er nach seiner Rettung aus dem eisigen Klosterweiher an jenem kalten Februartag vernahm. Es waren die Worte des Ganters, der mit dem Kahn auf den Weiher gerudert war, als er Mathis um sein Leben brüllen hörte.
Der Ganter wohnte unweit des Abflusses vom Staudamm des Weihers. Es war nicht sein Kahn, er gehörte dem Kloster, genauso wie der Weiher und die Fische darin. Der Ganter war aber vom Kloster als Aufseher über den Weiher und die Fische angestellt. Zu oft verringerte sich der Bestand der Karpfen über Nacht, vor allem um die Weihnachtszeit oder um Karfreitag. Abgesehen davon gediehen die Karpfen in diesem Gewässer nicht sonderlich, es war mit seinem Durchlauf zu unruhig. Deshalb setzte das Kloster in den letzten Jahren vermehrt auf Forellen. Die Forellen waren auch schuld am Einbruch im Eis, das sich am Rand gebildet hatte.
»Wetten, dass du zu feige bist, eine Forelle aus dem Weiher des Klosters zu stehlen?« Entschlossen und mit verschränkten Armen waren sie vor ihm gestanden, seine fünf Brüder, oben in der Scheune, und hatten ihn überlegen angegrinst. Nein, ausgelacht. Zumindest hatte Mathis das so empfunden. Und wie so oft den Mund wieder einmal zu voll genommen und mit seinem Mut geprahlt, um die Gunst seiner älteren Brüder zu erlangen. Sie nahmen ihn einfach nie ernst. Für sie blieb er immer der Kleine. Was konnte er dafür, dass Gott seiner Mutter jedes Jahr einen Sohn geschenkt hatte, und ausgerechnet als er an der Reihe gewesen wäre, zuerst einem Mädchen den Vortritt ließ und dann auch noch eine Pause einlegte!
Wahrscheinlich war seinem Vater das Geplärre zu viel geworden, und er bevorzugte öfter die Schenke, statt zu seiner Frau unter die Decke zu kriechen, zumal dort meist schon jede Menge kleiner schlafender Leiber lagen und es besser war, sie nicht zu wecken, wollte man noch irgendetwas von der spärlichen Nachtruhe erhaschen.
Und so war es gekommen, dass fünf Jahre zwischen ihm und dem nächstälteren Bruder lagen. Fünf lange Jahre, die Mathis, sosehr er sich auch bemühte, einfach nicht aufholen konnte. Seine Brüder waren ihm überlegen, in jeder Hinsicht.
»Lausebengel!«, rief er ihm nach, der alte Ganter, und hob seine Faust in den Himmel, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, als Mathis schlotternd aus dem Kahn kroch. »Wenn du meiner wärst! Eine ordentliche Tracht Prügel ist es, was du jetzt verdienst!«
Mit klapperndem Unterkiefer, unfähig, auch nur ein Wort herauszubekommen, torkelte Mathis Richtung Schafhof, wo er zu Hause war. Der mächtige Hof stand in einer Mulde am Waldrand, unweit des Weihers, aber dennoch auf einer Anhöhe, während der Weiher ganz im Tal lag. Mathis fühlte seine Hände und Füße nicht mehr, als er versuchte, die Klinke der schweren Haustür zu drücken. Normalerweise stand die Tür immer offen, aber an diesem bissig kalten Tag war sie geschlossen. Zitternd umklammerte seine blaurot gefrorene Hand den Griff – auch dieser war vom eisigen Ostwind gefrostet –, und der Junge spürte nicht einmal, wie ein Stück seiner Haut am Knauf kleben blieb, weil sie im Nu festgefroren war. Er stolperte in den Hausgang und blieb vor den Füßen seines Vaters liegen.
Die nächste Erinnerung, die er hatte, war das besorgte Gesicht seiner Mutter, als er die fieberschweren Augen aufschlug und sich vor Schmerzen kaum regen konnte. Sein Rücken war blutunterlaufen von den Stockhieben seines Vaters, sein Hals eitrig und wund von der Mandelentzündung, die er sich in den eisigen Fluten geholt hatte. Seine Brüder hatte er seit seinem Einbruch ins Eis nicht mehr zu Gesicht bekommen. Auch konnte er sich nicht erinnern, dass sie bei der Menschenmenge auf dem Damm waren, als der Ganter ihn in seinen Kahn zog.
»Bub, du bringst mich noch ins Grab mit deinen unseligen Streichen. Nichts als Ärger mit dir, seit ich denken kann!« Seine Mutter drehte ihr Gesicht weg, und Mathis konnte noch sehen, wie Tränen über ihr gerötetes Gesicht rollten, ehe sie die Kammer verließ. Die Hiebe seines Vater konnte er ertragen, die Sticheleien seiner Brüder brachten ihn zur Weißglut – sie waren der Grund für seine Ausreißer –, aber die Tränen seiner Mutter trafen sein Herz, und das war schmerzlich. Und immer wieder aufs Neue schwor er, sich zu bessern.
Mathis betete oft zur Heiligen Jungfrau am Marienaltar in der Kirche, oder zu seinem Schutzengel, dessen Bild über seinem Bett hing. Seine Großmutter hatte ihm, wohlweislich und in guter Absicht, von einer Wallfahrt zu St. Märgen jenes Bildnis mitgebracht.
Es zeigte einen blond gelockten Engel mit weitem Gewand und ausgebreiteten großen Flügeln, die denen eines mächtigen Schwanes glichen; an der Hand führte er einen Jungen, der den Engel voll Vertrauen ansah, während unter ihnen ein tosender Wasserfall zu Tale stürzte. Der Engel schwebte mehr über dem schmalen Holzsteg, als dass er ging. Ein heller Strahl ging von dem Engel aus, und Mathis glaubte immer, seine Wärme zu spüren, wenn er innig um sein Seelenheil zu ihm betete.
Auch jetzt warf er wieder einen Blick zu seinem Schutzengel, entschuldigte sich stumm bei ihm für seine neue Untat, dankte ihm aber gleichzeitig für sein Leben. Der Engel schien geduldig auf seinen Schützling zu blicken und zu nicken. Mathis erahnte seinen warmen Strahl und schlief ein, vergaß seine Schmerzen.
Aber es war nicht der Strahl des Engels, der ihn berührte, es waren die letzten warmen Sonnenstrahlen, die in das Gewölbe drangen, ehe sie hinter dem anderen Ufer des Goldenen Hornes untergingen. Wie aus weiter Ferne, aus der Vergangenheit, hörte er noch den Ruf des Muezzins zum Abendgebet, den der leichte Wind vom Marmarameer her zu ihm herüberwehte. Der melodische Gesang stammte von der Süleymaniye-Moschee und war selbst hier, im Stadtteil Galata, noch zu hören, aber nur, wenn der Wind günstig stand. Das Stimmengewirr auf der Straße verstummte. Ein gnädiger Friede lag über den Dächern und Gassen Konstantinopels. Fünfmal am Tag hielt die bunte Menschenmenge den Atem an und kehrte in sich, kniete nieder, berührte mit der Stirn den Boden, um Allah, den einzig wahren Gott, zu preisen. Dieser Friede ging nun auch auf Mathias Faller über. Er musste nicht mehr kämpfen, auch nicht, als ihn die starken Arme des Ganters anhoben, des jungen Ganters, des Sohnes seines damaligen Retters.
2
Friedenweiler, Martini 1770
Mathis lief das Wasser im Mund zusammen, als er von der Werkstatt her in die gute Stube polterte. Es war der Duft der Martinsgans, der ihn davon überzeugt hatte, sein Werkzeug niederzulegen und dem Grimmen in seiner Magengegend nachzugeben. Er übersah dabei großzügig den strafenden Blick seines Vaters, was sein Zuspätkommen betraf, denn dieser hatte bereits die Rolle des Vorbeters am Tisch übernommen. Doch nicht nur deshalb galt ihm dessen vorwurfsvoller Blick; Mathis’ spätes Erscheinen war auch immer sehr geräuschvoll, und sofort flogen die Köpfe der Betenden Richtung Werkstatttür. Für einige Augenblicke war es vorbei mit der gesenkten Haltung des Gesindes, das Demut ausdrücken sollte. Erst ein deutliches Räuspern des Schafhofbauern erinnerte die Angestellten wieder an ihre Andacht. Mathis beeilte sich schleunigst, es den anderen gleichzutun, faltete seine Hände, senkte den Kopf, glitt an seinen Platz und fiel in das Gemurmel mit ein.
Nicht dass er den Beginn des Tischgebets in der Werkstatt drüben nicht vernommen hätte, doch hatte ihn die Erfahrung gelehrt, dass mit dem Beginn des Gebetes noch lange nicht der Beginn der Mahlzeit an sich angezeigt war. Das Herunterleiern des Vaterunsers, sämtlicher Glaubensbekenntnisse und Mariengelöbnisse konnte mitunter eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Zeit, die er anders zu nutzen wusste, was ihm aber als Mangel an göttlichem Respekt und Glauben unterstellt wurde. Doch Mathis war Kummer gewohnt, und so hatten sich seine Strafen für diese Verfehlungen im Laufe der Jahre von Ohrfeigen zu vernichtenden Blicken, die er seinerseits übersah, gewandelt.
Er konnte damit leben, von den Alten als gottlos bezeichnet zu werden. Was wussten denn die schon von seinen verzweifelten Zwiesprachen mit seinem Schöpfer und seinem Kampf um Respekt im Leben. Nicht die Anerkennung um den frömmsten Gesichtsausdruck war es, was er von seinen Mitmenschen erwartete, nein, die Würdigung seines Könnens.
Und dass er dazu fähig war, etwas Besonderes zu leisten, das wusste er. Technisches Geschick hatte er sich im Laufe seiner Lehrjahre spielend angeeignet, und auch das Zusammenzählen von Zahlen, die er, ohne sie niederzuschreiben, sehr schnell im Kopf errechnen konnte, erwies sich bei den Handelsreisen, die er mit seinen Brüdern unternahm, als Vorteil. Keinem war es je gelungen, ihn zu überlisten.
Aber Mathis begnügte sich auch damit nicht. Sein Ziel war ein anderes. Seit er vor einem Jahr in Säckingen auf dem Markt eine Wiener Spieluhr gesehen hatte, ließ ihn der Gedanke, solch ein Kunstwerk selbst herzustellen, nicht mehr los. Leider war jenes bezaubernde Stück viel zu teuer für seinen Geldbeutel gewesen, auch hatte ihm der Händler keinen Blick in das Innere dieser begehrten Uhr erlaubt. Doch Mathis hatte nicht lockergelassen und in Paulus Kreuz vom Hohlen Graben einen Verbündeten gefunden, der ihm wiederum auf abenteuerlichen Wegen eine alte Zeichnung über das Innenleben solch eines klingenden Kastens, der auch noch die Zeit anzeigte, beschaffen konnte. Eine seltene Rarität, denn nur wenige Meister verstanden sich auf den Bau von Spieluhren, den sich allenfalls sehr betuchte Kunden leisten konnten. Natürlich kostete ihn das eine ganze Stange Geld. Geld, das er sich im Wirtshaus einsparte und stattdessen den Heimweg antrat, wenn seine Kumpane in Feiertagslaune kamen und ihren mageren Lohn versetzten. Er galt ohnehin als Außenseiter, und so konnte er sich getrost über ihren Spott hinwegsetzen.
Was Mathis allerdings zu schaffen machte: Ein Teil der Zeichnung fehlte, und es kostete mehr als sein Vorstellungsvermögen, diese Wissenslücke zu füllen. Zumal er seine Arbeit in der Werkstatt nicht vernachlässigen durfte. Meister Ambrosius, wie er seinen Vater in der Werkstatt nannte, duldete keine Sonderbehandlung, auch nicht für seinen Sohn, und so blieb Mathis nichts anderes übrig, als seine karge Freizeit in seine Tüfteleien zu stecken. Dazu gehörte auch der Verzicht auf das aufwendige Tischgebet.
»Mathisle! Kommst du wieder nicht von deinem Spielzeug los?«, flüsterte Fidelis leise, als die letzten Verse des »Gegrüßet seiest du, Maria« noch in aller Munde waren, aber auch wiederum laut genug, dass es jeder vernehmen konnte. Denn es reichte Mathis gerade noch zur Bekreuzigung und damit zum Ende des Gebetes.
Er hütete seine Arbeit wie ein großes Geheimnis und versteckte seine Zeichnungen vor den Augen allzu neugieriger Gesichter, als habe er Angst, jemand wolle seine Pläne abpausen. Was natürlich als Misstrauen aufgefasst wurde und zu Sticheleien führte.
»Du wirst dir an meinem Spielzeug noch die Augen aus den Höhlen gaffen«, konterte Mathis, als sie sich endlich setzten, »und die Ohren werden dir abfallen!« Er runzelte die Stirn, ein untrügliches Zeichen dafür, dass er bereit war, den Kampf mit seinem Bruder aufzunehmen. Die Falten verstärkten sich noch und ließen ihn um Jahre älter wirken, als auch die anderen vier Brüder – Josef, Georg, Jakob und Simon – in ein höhnisches Gelächter ausbrachen. Das Gesinde sowie die Lehrbuben Benedikt und Sebastian verkniffen sich einen Kommentar und blickten demütig vor sich hin, ihnen war es nicht erlaubt, sich in die Familienangelegenheiten einzumischen. Doch die Zankereien unter den Brüdern waren sie gewohnt, wer schon lange genug auf dem Hof war, empfand es sogar als normal.
»Schluss jetzt!« Das Gelächter erstarb augenblicklich, und alle schauten in das steinerne Gesicht des Familienoberhauptes, als erwarte sie das Urteil des Jüngsten Gerichtes.
Ambrosius Faller, Vater der sechs Brüder und Agathes, der einzigen Tochter, war ein strenger, aber sehr gerechter Mann. Niemand, und damit waren nicht nur seine Knechte im Stall und in der Werkstatt, seine Mägde in Küche und Feld, sondern auch seine Söhne und die Tochter gemeint, wagte je, ihm zu widersprechen. Alle beugten sich seinem Kommando und zollten ihm Respekt, denn wenn man es genau nahm, war es stets ein gutes Kommando, das er führte, auch wenn man hin und wieder den Sinn seiner Anweisung nicht sofort erkannte. Aber schließlich war es die Gabe eines Anführers oder die seiner Frau, weitsichtig zu handeln.
»Ein für alle Mal: Am Tisch wird nicht gestritten! Und schon gar nicht während des Gebets. Hast du verstanden, Fidelis? Die nächste Mahlzeit nimmst du im Stall ein!«
Fidelis, obwohl schon erwachsen mit seinen siebenundzwanzig Jahren, senkte schuldbewusst das Haupt und nickte.
»Ob du mich verstanden hast?«
»Ja, Vater.«
»Dann sag das auch laut und deutlich, dass es alle hören!« Ambrosius räusperte sich. »Und du, Mathis, solltest nicht deine ganze Zeit mit Spielereien verbringen, darum wirst auch du die nächste Mahlzeit nicht mit uns verbringen, sondern draußen im Brunnengang! Nicht dass ihr euch auch noch im Stall in den Haaren habt!«
Mathis, der in der Familie für seine rebellische Natur bekannt war, wollte etwas entgegnen, aber der strenge Blick seines Vaters zeigte ihm unmissverständlich, dass es besser war, seinen Kommentar für sich zu behalten und den Bogen nicht noch weiter zu überspannen.
»Heute ist Martini, und ich habe andere Pläne mit euch«, begann Ambrosius nun selbstgefällig seine Rede, und damit war das Erziehungsthema erledigt.
»Ich habe Bilanz gezogen«, fuhr er nach einer kurzen Pause fort, »wir haben in den letzten zwei Jahren viel für neues und modernes Werkzeug ausgegeben. Für die alten Waaguhren haben uns noch Zirkel, Schnittmesser und Säge ausgereicht, aber diese Uhren kommen aus der Mode, etwas Neues ist gefragt. Die Technik hat sich verbessert, und somit auch das Werkzeug. Wir haben eine gut ausgestattete Werkstatt, Spindelbohrer, Drehstuhl, Schraubstock, Zahngeschirr, alles gut in Schuss. Seit wir unsere Messingzahnräder aus der Gießerei vom Kreuzen Paulus oben am Hohlen Graben beziehen können, sparen wir eine Menge Zeit und Geld. Die Beschaffung aus Solothurn oder Nürnberg war nicht immer einfach, und die vielen Landesgrenzen haben die Zollgebühren hochgetrieben. Und Paulus’ Qualität kann sich sehen lassen. Auch wir sind besser und schneller geworden. Seit wir die Uhren selbst vertreiben und nicht mehr den Glasträgern mitgeben, haben wir unsere Gewinnspanne fast um das Fünffache erhöhen können. Der Handel lohnt sich mehr und mehr. Wir haben zu den ersten Wagemutigen gehört, die sich hinter ihren Öfen hervorgetraut haben und in die Welt hinausgegangen sind. Und wir haben gutes Geld verdient. Es wird Zeit, in diesen Handel zu investieren, ihn auszuweiten, bevor uns andere zuvorkommen. Überall beginnen die Uhrenhändler, sich zu organisieren und Gesellschaften zu gründen. Der Fürst zu Fürstenberg hat die Zeichen der Zeit ebenfalls erkannt und will den Handel beleben, indem er die Handelssteuer aufhebt. Einen entsprechenden Vertrag mit Frankreich hat er in diesem Jahr schon unterzeichnet. Der Elsasshandel wächst, und ich bin mir sicher, die anderen Gebiete werden seinem Beispiel folgen und entsprechende Gesetze verabschieden, wenn sie erst sehen, wie ertragreich der Aufschwung für sie ist. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Auch wir müssen uns dem Lauf der Zeit anpassen. Ich werde unseren Betrieb kräftig umkrempeln. Wir gründen eine Kompanie, die Gebrüder Faller Kompanie. Gebrüder deshalb, weil ich mich von den Handelsreisen zurückziehen möchte und dafür die Fäden hier in der Hand halte. Um meinen Plan in die Tat umzusetzen, muss ich in der Werkstatt anfangen.«
Er blickte in die gespannten Gesichter an den Tischreihen. »Was ich sagen will, zum einen: Ab heute sind der Benedikt und der Sebastian keine Lehrbuben mehr, ich ernenne sie kraft meines Amtes als Meister zu Gesellen.«
Es war so still am Tisch, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören, denn die eigentliche Lehrzeit wäre erst im Frühjahr abgeschlossen gewesen, rechnete der alte Faller nicht mehr richtig? Er verlor mit dieser Entscheidung nicht nur das Ausbildungsgeld, er musste ab dem Gesellenstand auch einen Lohn, in diesem Fall sogar zwei Löhne, bezahlen.
Er blickte zu den beiden jungen Männern, die ganz am Tischende, nach den Familienmitgliedern und Knechten, ihre Plätze hatten. Ihre Augen begannen zu leuchten, ihre Wangen färbten sich rot. Man konnte ihre Freude und ihren Stolz regelrecht spüren. Benedikt, der Ältere der beiden, er war etwa siebzehn, sprang auf und stieß dabei den um ein Jahr jüngeren Sebastian an, der sich daraufhin ebenfalls ungeschickt erhob.
»Meister Ambrosius, ich – wir danken Euch recht herzlich. Wir werden unser Bestes geben, um Euer Vertrauen in uns zu rechtfertigen.« Plötzlich erstarb jedoch das Leuchten in seinen Augen, und Zweifel machten sich breit: Wollte Meister Faller sich vielleicht der Arbeiter in der Werkstatt entledigen? War das sein neuer Plan? Nur noch den Handel zu organisieren? Etwas kleinlaut fügte er deshalb hinzu: »Ihr … Ihr werdet uns doch behalten wollen, oder?«
Ein mildes Lächeln erhellte die sonst strenge Miene des Meisters. »Damit komme ich zu meiner eigentlichen Überlegung.« Er machte eine kurze Pause, um seinen Zuhörern die gebührende Aufmerksamkeit zu entlocken. Benedikt und Sebastian setzten sich wieder, wenn auch ganz angespannt auf den äußersten Rand der Holzbank.
»Ja, damit habe ich eigentlich gerechnet, das heißt«, wieder machte er eine Pause, und die Spannung im Raum stieg, »wenn ihr mit einem Wochenlohn von, sagen wir mal, achtzig Kreuzern fürs Erste zufrieden seid.«
Sogleich stieg erneut ein Leuchten in den Augen der beiden Jungen auf. Achtzig Kreuzer waren kein Spitzenlohn, aber dafür mussten sie, oder besser gesagt, ihr Vater, keine Ausbildungskosten mehr begleichen. Sie waren somit eigenständig und galten als erwachsen.
»Bei freier Kost und Logis, versteht sich«, fügte Ambrosius gönnerhaft hinzu, doch das war sowieso üblich, wohnten und lebten die beiden doch schon seit fast drei Jahren mit der Familie und den anderen Angestellten auf dem Hof.
»Gut, dann wäre das auch geklärt. Nun zu dir, Agathe, auch du als Mädchen sollst etwas anderes lernen als nur die Haus- und Hofwirtschaft. Wer weiß, welchen Bräutigam wir einmal für dich auswählen, die Uhrenmacher und Händler werden immer zahlreicher und vermögender, also auch für eine Bauerntochter interessanter, dann ist es gut, als Frau Bescheid zu wissen im Uhrengeschäft, außerdem kann eine selbstständige Frau auch auf eigenen Beinen stehen. Ich habe mich in der letzten Zeit viel umgehört, um auf dem Laufenden zu bleiben. Landauf und landab beschäftigt man sich mit einem neuen Aussehen der Uhren, den sogenannten Schilderuhren. Es gibt inzwischen wahre Künstler, die die schönsten Malereien auf diese Schilder zaubern. Und, was noch wichtiger ist, es gibt ein neues Verfahren, diese Malereien vor Nässe zu schützen, und damit werden diese Schilderuhren natürlich für den Handel bedeutsam. Was nützt es, die Uhren auf weit entfernte Märkte zu tragen; wenn dann ein Regenguss den Händler auf freier Flur überrascht, fehlt die Farbe auf den Uhren. Der Furtwanger Arzt Kajetan Kreuzer hat zusammen mit zwei Schildermachern aus Eisenbach eine Art durchsichtige Farbe entwickelt, die über die Malerei gepinselt wird und das Gemälde schützt. Es soll eine Mischung aus Kreide und Eigelb sein. Die genaue Rezeptur wird mir natürlich kein Geschäftsmann ohne Weiteres verraten. Darum, meine Tochter, werde ich dich bei einem solchen Meister in die Lehre schicken. Und danach wirst du in meiner Werkstatt dein Wissen anwenden und weitergeben.«
Agathe, die mit ihren neunzehn Jahren noch nie den Schafhof verlassen hatte, außer zum Kirchgang, schluckte erschrocken, wagte jedoch nicht, einen Einwand zu geben.
Sophie, die Ehefrau des Meisters, holte tief Luft, was ihrem Mann nicht entging, weshalb er sofort beschwichtigend hinzusetzte: »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Weib. Ich habe mich wirklich genauestens umgehört, bevor ich einen Betrieb ausgewählt habe. Die Töchter dieses Meisters zu Vöhrenbach erlernen das Schildermalerhandwerk ebenfalls in seiner Werkstatt, denn er hat keine Söhne, was in diesem Fall nicht schlecht ist. So brauchen wir uns um die Ehre unserer Tochter keine Sorgen zu machen, und ich habe außerdem die ausdrückliche Zusicherung der Frau des Meisters, dass sie selbst dafür Sorge tragen wird, auf die christliche Erziehung zu achten.«
Nepomuk, der alte Knecht des Schafhofes, dem schon der Speichel aus den Mundwinkeln rann, weil er sich endlich und sehnsüchtig auf die erkaltende Gans stürzen wollte, kicherte bei diesem Ausspruch verächtlich vor sich hin. Doch Meister Ambrosius hatte nur einen missbilligenden Blick für ihn übrig, bevor er in seinen Ausführungen um die Reform in seinen vier Wänden weiterfuhr.
»Und nun zu den eigentlich wichtigen Plänen, die euch, meine Söhne, betreffen.« Er räusperte sich, und jeder wusste, dass der offizielle Teil noch nicht beendet war. Noch mehreren am Tisch erging es wie dem alten Nepomuk. Keiner wagte jedoch, sein Besteck in die Hand zu nehmen und den Gelüsten nachzugeben, obwohl die Mägen schon zu knurren begannen, angesichts der wartenden Leckereien.
»Ambrosius«, unterbrach ihn da Sophie endlich, um die ihnen Anvertrauten von ihrem Leiden zu befreien, »verdreht unseren Buben nicht auch noch gleich den Kopf. Es reicht, wenn die frischgebackenen Gesellen glühende Ohren haben und unserer Agathe der Bissen im Halse stecken bleibt. Wir sollten erst essen, die Gans wird kalt. Ihr könnt ihnen Eure Geschäftsidee nachher ausführlich erklären. Meine Küchenmagd und ich haben Stunden in der Küche verbracht, es wäre schade darum.«
Zum Zeichen der Untergebenheit senkte sie den Blick leicht, was ihr, vielleicht gerade deshalb, keine Widerrede vonseiten ihres Gatten einbrachte. Sophie war eine kluge Frau und wusste natürlich längst, was ihr Mann ausgebrütet hatte, auch wenn er ihr nichts über seine Machenschaften erzählt hatte, aber das war auch gar nicht nötig. In der letzten Zeit waren nämlich immer öfter ihr zum Teil fremde Personen aufgetaucht und mit einem geheimnisvollen Blick in der guten Stube des Meisters verschwunden. Stundenlang hörte sie sie dann reden und verhandeln, doch kam sie mit Gebäck oder Tee in den Raum, verstummten die Gespräche, als käme ein feindlicher Spion herein, was auch nicht gänzlich falsch war.
In all den Ehejahren hatte sie gelernt, auch ohne nachzufragen, an Neuigkeiten heranzukommen und sich die eine oder andere Sache zusammenzureimen, denn sie war immer auf dem Stand der Dinge und wusste, was draußen in der Welt – und nicht nur in den nächsten drei Dörfern – gespielt wurde. Sie hatte nicht nur die Landwirtschaft im Blick, sondern auch die Uhrenproduktion und deren Vertrieb, auch wenn sie die technischen Einzelheiten nicht kannte und wohl nie in der Lage gewesen wäre, eine Uhr zusammenzubauen. Aber die Geschäftsabläufe blieben ihr nicht verborgen, und wenn sie dafür auch manchmal rein zufällig an der Tür vorbeikommen musste, um das eine oder andere zu hören, was in der Männerwelt gesprochen wurde. So war sie auch in der Lage, rechtzeitig, aber unmerklich, einzugreifen, wenn sie glaubte, dass Meister Ambrosius wieder einmal zu hochtrabende Pläne verfolgte.
Für sein Alter, er war immerhin schon ein Endfünfziger, hatte er noch immer Flausen im Kopf und schreckte vor einer neuen Idee, und war sie noch so haarsträubend, nicht zurück. Stand dann nach wochenlangen Geheimniskrämereien dieses gewisse Leuchten in seinen Augen, ahnte Sophie, dass er einen Entschluss gefasst hatte. Meist, so wusste sie, hatte er alle Für und Wider abgewogen und sich rückversichert, dass, sollte etwas schiefgehen, die Verluste ihm nicht über den Kopf wuchsen. Nie würde er seine Familie leichtfertig in den Ruin stürzen. Aber ein gewisses Risiko war er immer bereit, einzugehen. »Wer nicht wagt, gewinnt nicht«, war sein Spruch, wenn sie mit einem leichten Seufzer auf den Lippen seiner Euphorie den Wind aus den Segeln zu nehmen versuchte.
»Du hast recht, meine Teuerste. Essen wir.« Mit einer gewissen Ironie, aber ohne den Blick in die Runde zu heben, begann Meister Ambrosius, mit dem Besteck zu hantieren, wohl wissend, dass die Anwesenden über seine fast schon intimen Anrede schmunzelten oder er ihnen die Schamesröte ins Gesicht steigen ließ. »Teuerste« war keine Anrede für eine Normalsterbliche, schon gar nicht für eine Bauersfrau, auch nicht, wenn man die Fallers in der Gegend zu den besser betuchten Familien zählen konnte, da sie neben der Landwirtschaft auch eine Uhrenwerkstatt betrieben.
»Teuerste«, ein Ausspruch wie sonst nur in fürstlichen Gemächern üblich, das ging Sophie wie Öl hinunter, und auch sie spürte die Euphorie des Besonderen. Sie war zufrieden mit seinem Entschluss, die Buben auf die eigenen Beine stellen zu wollen, die Luft wurde zu eng für sechs mehr oder weniger erwachsene Männer. Die Konkurrenzkämpfe unter ihnen nahmen immer größere Ausmaße an. Man musste sie mit einer gemeinsamen Aufgabe aus dem Nest werfen, sollten sie einmal eine eingeschworene Einheit bilden und dabei auch noch vernünftig werden.
Nur die Entscheidung, die Tochter ebenfalls in die Welt hinauszuschicken, steckte ihr noch in den Gliedern. Davon hatte sie nichts gewusst, trotz ihrer Bemühungen, Ambrosius’ Plänen heimlich zu folgen. Doch sie ließ sich nichts von ihrer Überraschung und dem leichten Ärger darüber anmerken, dass es ihm gelungen war, in aller Heimlichkeit zu verhandeln. Diese Geschäfte musste er in den Wirtshäusern oder auf seinen Touren durch die Märkte der weiteren Umgebung geplant und beschlossen haben. Hier auf dem Hof war jedenfalls nie die Rede davon gewesen, das wüsste sie. Doch das zeigte auch, dass ihm offensichtlich in all den Jahren nicht entgangen war, dass die Wände manchmal Ohren hatten.
Aber der Stolz legte sich schließlich über den Ärger. Wer hatte schon eine Tochter mit Ausbildung, es war etwas ganz Besonderes und Neues. Sie sah vor ihrem geistigen Auge schon, wie die Frauen nach der Kirche ihre Köpfe zusammensteckten und sich über diese Ungeheuerlichkeit die Mäuler zerrissen. Es erfüllte sie mit Genugtuung.
***
Nicht überall verlief der Martiniabend so glücklich. Martini, der 11. November, bedeutete auch, dass es auf den Höfen wieder ruhiger wurde. Die Ernten waren eingefahren. Im Winter wurden keine Tagelöhner mehr benötigt. Die Arbeit reichte noch für die fest angestellten Knechte und Mägde, alle anderen bezahlte man aus und schickte sie nach Hause. So auch Pirmin Ganter.
Nach dem Nebel, der den Nachmittag schon sehr früh verfinsterte, legte sich nun übergangslos die Dunkelheit auf den Klosterweiher, kroch links und rechts die Wälder hoch und verschluckte schließlich das ganze armselige Dorf Friedenweiler, das sich um das mächtige Frauenkloster drängte. Die Glocke, die zur Vesper läutete, klang wie aus weiter Ferne gespenstisch über die Häuser und Hütten und verhallte in der Weite des unendlichen Klosterwaldes, als Pirmin seine Schritte zum elterlichen Haus lenkte.
Die Flamme des rußenden Kienspans über dem Herd im Hause Ganter flackerte plötzlich auf und neigte sich bedenklich zur Seite, als wolle sie dem eisigen Wind entschwinden, der durch die Tür in den Raum eindrang, als diese knarrend geöffnet wurde. Mit dem Wind wirbelten Schneeflocken herein und schmolzen sogleich auf dem Steinboden vor dem Herd. Langsam, als plage ihn ein schlechtes Gewissen, schob sich die hagere Gestalt Pirmins durch die Tür.
»Vater.« Er blieb stehen und blickte zu dem schwach beleuchteten Tisch, an dem seine Familie saß, oder besser das, was davon übrig war: sein Vater und seine kleine Schwester Resle.
»Es zieht, mach die Tür zu.« Der alte Ganter hob seinen Blick und nahm einen kräftigen Zug aus seiner Pfeife, stieß den Rauch in Ringen gegen die Decke, ehe er fortfuhr: »Hab dich früher erwartet, warst noch in der Schenke?«
»Ihr habt mich erwartet, Vater?« Pirmin schob die Tür zu, und die Flamme des Kienspans stand dankbar auf und leuchtete umso kräftiger.
»Der Oberroturacher ist ein sparsamer Bauer, er leistet sich kein unnötiges Gesinde. Hast wenigstens einen Lohn mitgebracht?«
»Ja, schon. Es sind aber nur ein paar Kreuzer.« Pirmin stellte den Sack mit seinen Habseligkeiten neben die Tür und nestelte in seiner Hosentasche.
»Die Hälfte gibst ab, den Rest kannst behalten. Aber schmeiß es nicht zum Fenster raus, der Winter ist lang, und wer weiß, was noch kommt.«
Pirmin zählte die Münzen auf den Tisch, steckte die Hälfte wieder ein und schob dem Vater den anderen Teil zu, den dieser wiederum einsteckte. Damit war das Thema beendet, und der alte Ganter lehnte sich zurück und tat einen weiteren Zug aus seiner Pfeife.
»Grüß dich, Resle.« Pirmin wandte sich an seine Schwester, die sich nicht getraut hatte, ihren Bruder vor dem Vater zu begrüßen, obwohl sie darauf brannte, ihn zu sehen. Denn den ganzen Winter allein mit dem wortkargen Vater im Haus zu verbringen, war eine schreckliche Vorstellung.
Ihre dunklen großen Augen begannen zu leuchten, mehr noch, als er in die Joppentasche griff und ein Bündel herauszog.
»Hier, mein Schwesterherz, hab dir etwas mitgebracht.«
Hastig wickelte sie es aus. Zum Vorschein kam ein grauer Stein, durch den quer ein dünner hell schimmernder Streifen lief. Er hatte ihn bei Eisenbach, in der Nähe der alten, stillgelegten Silbermine gefunden. Resle lief zum Herd und betrachtete den Stein von allen Seiten unter dem flackernden Licht des Kienspans.
»Er glänzt, schau doch, Pirmin, wie er glänzt!« Ihre Augen leuchteten wie der Streifen des Steins.
»Es ist auch kein gewöhnlicher Stein«, Pirmins Stimme klang geheimnisvoll, »es ist ein Wunschstein. Eine Fee hat die Sichel des Mondes darin eingeschlossen, in einer ganz besonderen Nacht, und nur einmal im Leben wird er seiner Besitzerin einen ganz besonderen Wunsch erfüllen. Du darfst aber mit niemandem darüber sprechen, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung. Hüte ihn gut, du wirst ihn sicherlich einmal dringend brauchen.«
Pirmin setzte sich an den Tisch und genoss es, dass seine Schwester, die diesen Herbst elf Jahre alt geworden war und allein die Last eines Haushaltes tragen musste, wieder zu einem kleinen Kind wurde, das sich freuen konnte, auf seinen Schoß rutschte und sich an ihn schmiegte. Seit dem Tod der Mutter im letzten Winter vermisste sie diese Fürsorge. Ihr Vater, selbst in seiner Gefühlswelt gefangen, war nicht fähig, dem Kind die nötige Wärme zu geben.
Ein harmloser Schnitt im Finger war es gewesen, der sich, fast verheilt, plötzlich entzündete und in wenigen Tagen die sonst so gesunde Mutter dahingerafft hatte. Seither war nichts mehr, wie es einmal war. Die unerträgliche Schwere der Trauer lastete über dem kleinen Haus, und an trüben Tagen glaubte Resle fast, ersticken zu müssen. Tage, in denen sie sich nicht in den Wäldern herumtreiben konnte, niemand, mit dem sie spielen konnte. Ihre Freundinnen zogen die Gemütlichkeit in ihren Stuben bei ihren Geschwistern vor und wärmten sich am Kachelofen. Resle war allein, ohne weitere Geschwister, außer Pirmin, der mit seinen knapp sechzehn Jahren zum Lebensunterhalt der Familie beitragen musste, denn für die Aufsicht, die sein Vater über den Klosterweiher führte, gab es außer Karpfen zu Weihnachten und Forellen zu Karfreitag nicht genug, um sich davon ernähren zu können. Selbst die Hütte war Eigentum des Klosters und gewährte ihnen nur Unterschlupf als Gegenleistung für die Weiheraufsicht und Fischerarbeit. Auch Pius Ganter lebte nebenbei von Gelegenheitsarbeiten und den zwei Ziegen, dem Schwein und den Hühnern im Stall. Einst gehörte ein blühender Garten mit Blumen, Kräutern, Salaten und Gemüse dazu. Doch in diesem Jahr wucherte dort nur mannshohes Unkraut, dessen Anblick jetzt gnädigerweise der Schnee bedeckte.
Wäre die Meierin nicht gewesen, die sich bereit erklärt hatte, die gesammelten Beeren von Resle zu Mus zu verarbeiten, gäbe es jetzt auch nur Butter aufs Sonntagsbrot. Dem Vater war es einerlei. Ihm hätte wahrscheinlich seine Pfeife genügt.
»Erzähl mir eine Geschichte, von der Fee!«, bettelte Resle.
»Bist du dafür nicht schon zu alt?«
»Du hast mir den Feenstein geschenkt, also musst du mir auch seine Geschichte erzählen«, verlangte Resle fast schon trotzig von ihrem Bruder.
»Also gut, nachher, wenn ich dich ins Bett bringe, aber erst hab ich noch Hunger. Gibt es etwas Essbares in deiner Zauberküche?« Pirmin war zwar zuvor tatsächlich noch in der Schenke gewesen, weil er sich nicht heimtraute ohne Arbeit, aber seinen mühsam erarbeiteten Lohn für eine Mahlzeit zu verplempern, war ihm doch zu schade. Ein Humpen Bier war alles, was er sich leistete, einen Humpen, der seine Laune hob und es ihm leichter machte, die Erwartungen seines Vaters enttäuschen zu müssen.
»Auf dem Herd ist noch Hafermus.«
»Hafermus? Oh, wie köstlich. Sonst noch was?«
»Du kannst noch etwas Rahm darunterrühren.«
»Und die Martinsgans?«
»Soll ich den Zauberstein darum bitten?« Resle hob ihm den Stein unter die Nase.
»Bloß nicht, der ist für viel wichtigere Dinge im Leben. Hast wohl extra eine Portion Mus für mich aufgehoben, was?«
»Hab ich immer, falls du kommst.«
Pirmin war beeindruckt; er wusste, dass sie das wirklich tat.
»Ist das nicht Verschwendung?«, hakte er deshalb nochmals nach.
»Nein, die Sau hat es am nächsten Tag immer bekommen. Aber morgen kriegt sie nichts. Du bist ja jetzt da.«
»So, dann werd ich dafür sorgen müssen, dass die Sau trotzdem noch etwas bekommt, sonst können wir zu Weihnachten kein Schlachtfest veranstalten. Schau doch mal in meinen Sack, Kleines.«
Sofort sprang Resle auf und wühlte in seinem Stoffbeutel, der achtlos am Boden lag. Ihre Augen strahlten, als ein ganzer geräucherter Hinterschinken zum Vorschein kam.
Selbst der alte Ganter schob sich jetzt näher an den Tisch, um auf den Boden davor spähen zu können.
»Woher hast du den?« Seine Stimme klang streng.
»Von der Bäuerin.« Pirmin wagte nicht, den Kopf zu heben und seinem Vater in die Augen zu schauen. In seinem Kopf hämmerte das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen!
Aber in seinem Magen knurrte seit dem Morgen der Hunger, und nicht nur seit dem Morgen. Den ganzen Sommer über waren für ihn, den Tagelöhner, höchstens noch die Soßen und andere Reste in den Schüsseln abgefallen, als sie endlich das Tischende und damit die Geringsten unter dem arbeitenden Volk erreicht hatten. Zuerst durfte die Familie des Bauern schöpfen, dann die Knechte, die Mägde und ganz zum Schluss die Hirtenbuben, Kindsmägde und Tagelöhner.
An den Zahltagen war es meist üblich, den Helfern ihren Dank in zusätzlichen Naturalien auszudrücken. Aber nicht alle hielten sich an diese Sitte.
Da Pirmin ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden besaß, verurteilte er den geizigen Bauern stillschweigend zur Zahlung eines Schinkens, nur dass der Verurteilte davon nichts wusste und der Schinken ganz wie von allein in den Sack des Tagelöhners wanderte.
Pirmin tischte den Schinken auf und schnitt jedem eine dicke Scheibe herunter. Schweigend, aber gierig, verschlangen die drei einen Großteil des Leckerbissens, obwohl der Blick des alten Ganters einer Verurteilung gleichkam. Doch er schwieg und aß.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, redete er sich ein und schenkte seinem Sohn zu gern den Glauben an die Belohnung für seine Mühe, obwohl sein Gewissen etwas anderes sagte.
3
Friedenweiler, Winter 1771
Mathis beschleunigte seinen Schritt, denn das heftige Einsetzen der Orgelmusik war bis weit außerhalb des Dorfes zu hören und läutete das Ende des sonntäglichen Gottesdienstes ein.
Schon strömten die Menschen aus dem Gotteshaus, standen beisammen und schwatzten, traten ihren Heimweg an oder verzogen sich in die nahe gelegene Schenke.
Mathis war wieder einmal zu spät. Er senkte den Blick schuldbewusst, während die Menschen kopfschüttelnd an ihm vorübergingen oder ihn einfach großzügig übersahen, so wie es einem Sünder gebührte. Nur die Tatsache, dass er einer angesehenen Familie angehörte, hielt die Leute davon ab, sich lauthals über ihn auszulassen. Man tuschelte hinter vorgehaltener Hand.
Mathis hatte andere Sorgen, er zermarterte sich das Hirn, aber er kam bei seiner Tüftelei einfach nicht weiter, und schon wieder musste seine Frömmigkeit darunter leiden. Weshalb ihn auch ein schlechtes Gewissen plagte, denn eigentlich hatte er sich vorgenommen, den Gottesdienst zu besuchen, aber die Zeit war wie im Flug vergangen, und er war kein Stück weiter. In der Werkstatt konnte man beim alltäglichen Betrieb keinen ruhigen Moment mehr finden, seit Ambrosius die Gründung der Kompanie verkündet hatte. Es war ein Kommen und Gehen. In den Ecken stapelten sich die Uhrwerke fast zu Hunderten, die ihnen die Uhrenmacher aus der ganzen Umgebung anvertrauten, in der Hoffnung, große Gewinne einzufahren. Der alte Faller war ein Fuchs, was das Geschäftliche anbelangte, das war jedem bekannt, und seine Idee, sich dem Südosten zu öffnen, statt wie die meisten nach Frankreich und ins Elsass zu marschieren, weckte sogar bei den bodenständigsten Uhrenmachern eine gewisse Abenteuerlust.
Der Südosten, das hieß die Grafschaft Tirol, die Herzogtümer Kärnten und Steiermark, Österreich, die Königreiche Böhmen und Ungarn, die Republik Venedig, deren Ländereien sich von den Alpen bis nach Montenegro erstreckten und die ihren Reichtum vor allem dem Arsenal, der Kriegsschiffswerft, verdankte, und dahinter, was niemand auszusprechen wagte, herrschte der osmanische Sultan Mustafa III. über unendlich weite Gebiete Vorderasiens.
Die Schreckensherrschaft der Muselmanen sorgte nicht nur beim einfachen Volk des christlichen Abendlandes für Furcht und Respekt, denn zu unbeschreiblich waren die Gräueltaten der abendländischen Herrscher über die letzten Jahrhunderte, als dass sich ein Christenmensch in seiner dunkelsten Phantasie sie auszumalen im Stande gewesen wäre. Da half es auch nicht, dass sich das Reich und die Macht des Sultans zu schmälern schienen. Erstmals gelang es letzten Sommer, also im Juli 1770, einer russischen Flotte mit mehreren englischen Offizieren an Bord an die kleinasiatische Küste zu segeln und die Marine des Sultans in die Flucht zu schlagen. Aber auch nur, weil die Landoperation der aufständischen Russen scheiterte und die veraltete osmanische Flotte nicht standhielt. Doch damit war dem Vordringen der Russen auch schon Einhalt geboten. Konstantinopel erreichten sie nicht.
Nun marschierte Mathis mit hochgezogenem Kragen gegen den eisigen Ostwind und schlechtem Gewissen in Richtung Klosterkirche, auch wenn die Messfeier schon zu Ende war. Wenigstens einen Augenblick der Andacht und Besinnung wollte er sich und seinem Schöpfer gönnen.
In der Kirche angekommen, erschlug ihn fast die Leere des weihrauchgeschwängerten Gotteshauses, und er zog es vor, sich in die kleine Marienkapelle am Ende des Klosterkreuzganges, die von der eigentlichen Kirche aus über zwei Stufen zu erreichen war, zu begeben.
Mathis kniete in der letzten Bank nieder, schlug das Kreuzzeichen und versenkte sein Haupt in den Händen. Seine Lippen bewegten sich stumm, als er die Muttergottes aufrichtig um Verzeihung und Mithilfe bei seiner Besserung zu einem guten Christen erbat.
Er wusste nicht, wie lange er schon so verharrte, zu groß war die Liste seiner Verfehlungen, als er plötzlich ein merkwürdiges Geräusch vernahm. Er hob den Kopf unmerklich an und lauschte angestrengt. Die Messgänger hatten das Gotteshaus ja schon längst verlassen. Selbst der Pater, der aus dem Nachbarorden kam, um die Messe zu lesen – denn das Kloster zu Friedenweiler hatte keine eigene Pfarrei –, die Ministranten und sogar der Messner, der die letzten Kerzen gelöscht hatte, mussten schon längst weg sein. Es war auch ein ganz anderes Geräusch, kein menschliches, eher das – Mathis erschrak bei dem Gedanken – Schnarchen eines Tieres.
Mit einem Schlag war sein Geist hellwach und sein Körper angespannt. Vorsichtig, um keine Geräusche zu verursachen, drehte er sich um. Es war in der ganzen karg eingerichteten Kapelle nichts zu sehen, dennoch wurde das Schnarchen lauter. Mathis klopfte das Herz bis zum Hals, als er schließlich glaubte, den Entstehungsort des seltsamen Geräusches entdeckt zu haben: Es konnte nur von dem kleinen Marienaltar her kommen. Er war bis zum Boden mit einem kostbar bestickten Leinen bedeckt. Doch an einer Ecke warf es verdächtige Falten, als habe sich darunter etwas verkrochen. Ängstlich wanderte der Blick des sonst so mutigen Mathis Faller im Raum umher, er suchte eine geeignete Waffe.
Sein Blick blieb schließlich an einem gusseisernen Kerzenständer haften. Lautlos schlich Mathis die wenigen Schritte zum Ständer, packte ihn mit beiden Händen, wobei die darauf befindliche Kerze, immerhin mit einem armdicken Umfang und gut kleinkindgroß, herunterstürzte und selbst in diesem kleinen Gewölbe schrecklich laut hallte. Die Kerze brach entzwei, und dem Schnarchen folgte ein schrecklicher Laut, der eindeutig aus der Richtung des Altars kam. Bewaffnet und aufs Äußerste gespannt, aber mit zitternden Knien, stand Mathis da und harrte der Dinge, die gleich über ihn hereinbrechen würden. Aber nichts geschah. Es wurde totenstill in der Kapelle.
Nach unendlich langer Zeit, die Mathis mit erhobenen Armen dagestanden hatte, begann sich der Vorhang langsam zu heben. Aber es war kein Ungeheuer, kein verirrtes wildes Tier. Das Erste, was Mathis sah, waren zwei riesig wirkende braune Augen, die vor Angst und Entsetzen weit aufgerissen waren. Sie gehörten einem käsebleichen elfjährigen Mädchen. Dem Mädchen, das er schon vor Jahren nach seinem Einbruch im Eis mit großen Augen auf dem Damm stehend gesehen hatte. Seither hatten sie kaum Kontakt, vielleicht weil sie wesentlich jünger war und unten im Dorf wohnte.
Erleichtert senkte Mathis seine Arme und ließ den Kerzenständer letztendlich, da ihn die Kräfte nun ganz verließen, zu Boden fallen, was noch ein weitaus lauteres Scheppern auslöste als die Kerze, die entzweibrach, und hätte sich der Konvent der Ordensschwestern nicht gerade beim Mittagstisch auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes befunden, wäre sicher die ganze Nonnenschaft gerannt gekommen, um den armen Sünder zu verurteilen.
»Resle, bist du es?« Seine Stimme klang piepsig, als wüsste sie noch nicht, ob sie erlöst oder erstaunt klingen sollte. »Was um alles in der Welt machst du unter dem Marienaltar?«
»Mathis! Du … du verrätst mich nicht, oder?« Langsam kroch sie unter dem wie ein Vorhang wirkenden Leinentuch hervor. »Ich … ich wollte einfach nur bei der Muttergottes sein, weißt du? Sie«, Resle hob ihren Blick zur Marienstatue, »sie hat dieselben Haare wie meine Mutter selig, und da dachte ich mir, wenn sie schon den kleinen Jesus auf dem Arm hat, beschützt sie mich bestimmt auch, wenn ich mich ganz nah zu ihr lege und ganz still und brav bin. Dann kann sie doch nichts sagen, oder? Ich hab mich auch etwas versteckt, so halt, dass mich keiner sieht. Aber das darf man nicht, hier schlafen, oder?«
Mathis holte tief Luft, was sollte er dazu sagen? Suchte er nicht auch die Nähe der Gottesmutter? Hatte Resle gar auch ein schlechtes Gewissen? Er hielt ihr die Hand entgegen.
»Komm erst einmal heraus, der Steinboden ist eiskalt, du holst dir den Tod da unten.«
Langsam wagte sie sich vor und ging vertrauensselig auf ihn zu. Mathis setzte sich auf die erste Bank, die sich direkt hinter ihm befand, und Resle tat es ihm gleich. Sie rutschte sogar ganz eng zu ihm heran, um sich zu wärmen.
Für einige Augenblicke saßen sie stumm nebeneinander, dann begann Mathis: »Willst du mir erzählen, warum du nicht bei deinem Vater bist? Er macht sich sicher Sorgen.«
Resle nestelte an ihrem Rockzipfel und hielt den Blick gesenkt. »Nein, ich glaub nicht, dass er sich Sorgen macht. Er sieht mich nicht, egal, ob ich da bin oder nicht. Er redet nicht mit mir. Vielleicht ist er böse auf mich. Vielleicht glaubt er, ich bin schuld, dass mein Bruder den Schinken gestohlen hat, weil ich nicht kochen kann.«
Hilfesuchend sah sie nun zu ihm auf, als sie sich trotzig verteidigte. »Aber er hat mir auch noch nie einen Schinken mitgebracht, dass ich es hätte einmal probieren können.«
Mathis wusste um die Armut der Ganters, darum ging er nicht auf ihre Anspielung ein. Stattdessen fragte er: »Hast du etwas von Pirmin gehört? Weißt du, wo er ist?«
Resle schüttelte heftig den Kopf, dann senkte sie ihren Blick wieder, und Mathis glaubte, dass sie weinte. Schweigend betrachtete er sie von der Seite. Ihre Kleidung war dünn und abgetragen, niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie auszubessern. Ihre Füße steckten in löchrigen Schuhen, man konnte sogar den Nagel der großen Zehe sehen, folglich mussten auch die Strümpfe löchrig sein. Ihre Hände, die sie in ihrem Schoß hielt, waren von der Kälte ganz blau. Mathis schnürte es das Herz zu, wenn er sah, wie sie, gleich einem Häuflein Elend, dasaß und offensichtlich nicht nur um den Verlust der Mutter, sondern auch um den Verbleib des Bruders trauerte.
Pirmin, ihr Bruder, war der andere Sünder im Dorf. Es hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, als noch in der Martininacht der Oberroturachbauer mit einem Gendarm in der Fischerhütte des Ganters aufgetaucht war, um den Schinkendieb zu verhaften. Doch dieser hatte den Braten gerochen und war aus dem Fenster getürmt und auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Der Oberroturacher gab erst auf, als der alte Ganter den eingesteckten halben Lohn seines Sohnes herausrückte.
Unwillkürlich griff Mathis nach Resles Hand und wärmte sie in seiner. Sie schenkte ihm dafür ein dankbares, tränenunterlaufenes Lächeln.
»Mein Bruder ist ein Dieb.«
»Wer sagt das?«
»Alle.«
»Wer ist alle?«
»Der Oberroturacher, der Gendarm und die Leute.«
»Und dein Vater?«
»Der sagt nichts. Der starrt nur vor sich her.« Resles Stimme klang wütend. »Ich halt das nicht mehr aus!«
Sie schluchzte auf, und Mathis nahm sie in den Arm. Er strich ihr über das lange, ungekämmte Haar, bis sie sich etwas beruhigte. Schließlich blickte sie zu ihm auf, wischte sich mit dem Ärmel über das feuchte Gesicht und fragte ihn kleinlaut: »Und du? Glaubst du auch, dass mein Bruder ein Dieb ist?«
»Ja, dein Bruder ist ein Dieb. Aber er hat für dich und deinen Vater gestohlen. Er wollte euren Hunger stillen, das ist Mundraub, und Gott verzeiht das. Ich dagegen bin ein richtiger Dieb oder wäre einer gewesen, wenn dein Vater mich damals nicht gerettet hätte.«
»Mein Vater?«
»Ja, erinnerst du dich noch, als ich vor vielen Jahren im Klosterweiher eingebrochen bin?«
»Natürlich, ich war zwar noch klein, aber es ist mir noch in Erinnerung, als wäre es erst gestern gewesen. Aber warum bist du ein Dieb? Was hat das mit dem Klosterweiher zu tun?«
»Ich wollte Forellen stehlen, die Forellen des Klosters, aber nicht aus Hunger, sondern weil ich beweisen wollte, wie mutig ich bin. Ich war überheblich und selbstgefällig, Gott hat mich dafür bestraft, und wäre dein Vater nicht gewesen, läge ich schon längst auf dem Gottesacker draußen.«
»Dann hat dich Gott doch nicht bestraft, sondern meinen Vater geschickt. Er wollte dir bestimmt nur einen Schrecken einjagen.«
»Den Rest der Strafe hat dafür mein Vater übernommen.«
»Dein Vater?«
»Ja, er hat mich windelweich geprügelt, dass ich drei Tage nicht sitzen konnte.«
»Dann ist dein Vater also auch nicht besser.«
»Damals war ich wütend auf ihn, heute verstehe ich seine Gründe. Auch dein Vater hat seine Gründe, er zeigt sie nur anders. Er ist traurig über seine Lage, darum redet er nicht mehr. Das ist nicht deine Schuld. Aber wenn du jetzt auch noch abhaust, wie dein Bruder, dann hat er niemanden mehr. Dann hat sein Leben keinen Sinn mehr.«
Resle überlegte eine Weile. »Du meinst also, ich sollte wieder zu ihm gehen?«, fragte sie schließlich.
Mathis nickte. »Er würde sich sicher freuen, auch wenn er es nicht zeigt.«
Resle seufzte. »Aber ich hab Angst.«
Mathis stand auf. »Komm, ich geh mit dir. Vielleicht wäre es jetzt auch endlich an der Zeit, mich für meine Rettung von damals zu bedanken.«
Und so kam es, dass man den siebzehnjährigen Mathis und das elfjährige Resle eng umschlungen von der Kirche weg Richtung Klosterweiher, mitten durch den Ort, gehen sah. Sie kämpften gegen den einsetzenden Schneesturm und die Ostwindböen, die über den Wald fegten und die Flocken über den Gassen vor sich herwirbelten.
4
Böhmen, Sommer 1771
Es war der Duft von getrocknetem Heu, der über der Hügellandschaft, den Vorboten des Erzgebirges, lag und ein gewisses Heimatgefühl bei den drei Faller-Brüdern Josef, Jakob und Mathis auslöste. Ein Geruch, der den kurzen Sommer in einer rauen Gegend verhieß und zum Verweilen einlud. Der Schatten eines Haselstrauches am Ufer der Eger schien geradezu einzuladen, die Mittagszeit zu überbrücken. Die Brüder hatten die gleichnamige Marktstadt in ihrem Rücken gelassen, eine Handelslizenz in der Tasche, und warteten nur noch auf den Markttag. Drei Tage noch und drei Nächte, für die sie eine Unterkunft brauchten. Hier draußen, auf einem der Bauernhöfe, die ihren Heimathöfen glichen, wollten sie um eine Unterkunft fragen. Doch dafür mussten sie den Abend abwarten, denn die Bewohner befanden sich alle auf den Feldern bei der Ernte.
Sie mieden meist die großen Städte. Das lag nicht an ihrem bäuerlichen Naturell, sondern an den billigeren Unterkünften. Wortlos ließen sie sich deshalb ganz in der Nähe einer Wagenfurt nieder, und niemand vom Bauernvolk, das ebenfalls seine Mittagspause am gegenüberliegenden Ufer im Schatten eines großen Ahorns abhielt, hatte sie bislang entdeckt. So aber konnten alle, die Fremden und Einheimischen, die Mittagspause genießen, denn kein Wölkchen stand am Himmel und hätte sie zur Eile getrieben.
Die gleichmäßigen Atemzüge seiner Brüder zeigten Mathis, dass sie in einen leichten Schlaf gefallen waren. Er genoss die Ruhe, die nicht immer gegeben war, wenn die Brüder zusammen waren. Absichtlich hatte Meister Ambrosius ihm, dem Achtzehnjährigen, den Sechsundzwanzig- und Fünfundzwanzigjährigen mitgegeben. Josef, als der Älteste dieser Gruppe, hatte die Verantwortung übertragen bekommen. Ambrosius hoffte, ihre Vernunft wäre größer als bei den anderen beiden Brüdern, die sich Richtung Süden, nach Tirol, aufgemacht hatten. Beide Gruppen sollten die Möglichkeit einer Niederlassung in einer größeren Stadt erkunden. Prag wäre so ein Ziel und in greifbarer Nähe.
Was die Geschäfte anging, konnten sie bisher zufrieden sein. Seit drei Monaten zogen sie nun schon in östlicher Richtung, von einer Marktstadt zur nächsten, und nie wurde ihnen die Marktlizenz, die sie in den Städten erkauften, vorenthalten.
Inzwischen hatten sie die Landesgrenze nach Böhmen, das zum habsburgischen Erbland gehörte und somit der österreichischen Kaiserin Maria Theresia unterstand, überschritten.
Mathis drehte sich auf den Bauch, wo er den ausgefahrenen Schotterweg Richtung Franzensbad, einer neu angelegten Kurresidenz, im Blick hatte. Dieser unbefestigte Pfad war aber nicht die offizielle Straße, sondern für die Fuhrwerke der Bauern gedacht. Die Prachtstraße ging direkt über die Eger ins Kurzentrum. Dort stiegen die besseren Herrschaften ab, um sich einer Bäderkur in den schwefelhaltigen Thermen zu unterziehen. Mathis versuchte, sich solch eine Badekur vorzustellen. Man sollte in diesem warmen Wasser, das heiß aus der Erde kam und nach faulen Eiern roch, sogar entspannen können. Bei Mathis löste solch eine Vorstellung eher Panik aus. Wasser bis an den Hals, das war für ihn kurz vor dem Ertrinken. Keine zehn Pferde würden ihn je in ein wassergefülltes Becken bringen.
Noch während er vor sich hindöste, glaubte er in der flirrenden Hitze am Horizont eine Bewegung auszumachen. Mathis richtete sich leicht auf. In unendlicher Langsamkeit schaukelte ein Karren, gezogen von einem Maultier, durch die abgeernteten Heuwiesen. Hin und wieder blitzte das Sonnenlicht auf blankem Metall und warf seine grellen Lichtkegel über das Land. Offensichtlich war dieses Gefährt nicht unbemerkt geblieben, denn Scharen von barfüßigen Kindern machten sich auf den Weg. Noch konnte Mathis nichts hören, denn das sanfte Plätschern der Eger übertönte die entfernten Laute. Augenblicke später war der Wagen umringt und hielt an.
Die Neugier siegte schließlich, und vorsichtig ging Mathis das Ufer ab, hinunter zu der Wagenfurt. Sie war breit und mit großen abgeflachten Steinen ausgelegt, um bequem einen Wagen durchzulassen. Und damit auch einen Menschen. Mathis zögerte kurz, dann zog er seine Stiefel und die Wollsocken aus, ebenso seine leuchtend rote Weste, die ihn gleich als fremden Händler ausgewiesen hätte, und legte alles sorgsam unter einen Strauch. Dann watete er vorsichtig durch das kalte Wasser. Er konzentrierte sich dabei so sehr auf den Untergrund, dass er die beiden Mädchen, die ihn neugierig am anderen Ufer erwarteten, nicht sah.
Erst als diese begannen, den Fremden mit Wasser zu bespritzen, blickte er erschrocken auf, rutschte dabei auf einem glatten Stein aus und fiel der Länge nach ins seichte Wasser, was ein Heidengelächter auslöste. Mathis hingegen hatte alle Mühe, seine Angst vor dem Wasser zu verbergen und gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Triefend wie ein begossener Pudel setzte er zum Spurt an und versuchte seinerseits, die Mädchen mit einer ausladenden Wasserfontäne zu treffen. Was ihm auch gelang.
»So wie du daherstakst, gleichst du eher einem Storch als einem Poseidon, Fremder!«, spottete eines der Mädchen. Erst jetzt bemerkte Mathis, dass ihre Kleidung nicht dem Stand der Bauern entsprach.
»Ich bin weder das eine noch das andere«, rief ihnen Mathis zu, um sich auf keine Diskussion einzulassen, denn was ein Storch war, wusste er. Doch die Gestalten der griechischen Mythologie hatten noch nicht die Schwarzwaldhöhen erreicht, zumindest nicht den Schafhof. Und so glaubte Mathis, bei Poseidon müsste es sich um einen ihm unbekannten Vogel handeln. Und diese Blöße wollte er sich nicht geben.
Mathis hatte das rettende Ufer erreicht und stand dicht vor den Mädchen. Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen und waren etwas jünger als er. Ihre langen dunklen Haare hatten sie zu einem festen Zopf gebunden, der mit bunten Bändern durchzogen war, passend zu den schlichten, aber guten Stoffen ihrer Kleider. Sie mussten Schwestern sein, wenn nicht sogar Zwillingsschwestern. Über ihren lustigen Stupsnasen tummelten sich unzählige Sommersprossen und verliehen ihren eher zart geschnittenen Gesichtern etwas Freches. In ihren grünen Augen leuchtete die Abenteuerlust. Mathis fühlte sich sofort zu ihnen hingezogen.
»Was bist du dann? Jedenfalls nicht von hier! Deine Sprache klingt so merkwürdig hart.«
»Hart?« Mathis fuhr sich verlegen durch die nassen Haare.
»Ja, fast wie ein Schweizer. Wir haben Verwandte in St. Gallen, die reden ähnlich. Etwas zumindest.«
»Schweizer? Oh, bis an die Schweizer Grenze ist es von mir zu Hause aus aber noch ein ganzes Stück.«
»So weit wie von hier nach Prag?« Nun meldete sich die etwas schüchterner wirkende der beiden zu Wort.
»Prag?« Mathis blickte hilfesuchend ans andere Ufer, wo seine Brüder noch immer im Gras schliefen. Er hatte keine Ahnung, wie weit Prag von hier noch entfernt lag. In diesem Moment verfluchte er seine Nachlässigkeit, sich mit den Landkarten, die seine Brüder mitführten, noch nicht befasst zu haben.
»Hm, Prag, nun, ich war noch nie in Prag. Ich will erst nach Eger.«
»Was machst du hier?«
»Ich komme aus dem Schwarzwald und bin auf Handelsreise.«
»Barfuß und im Hemd?«
»Stimmt. So kann ich nicht auf den Markt nach Eger.« Er versuchte, ihr Bedauern zu wecken, und blickte an seinen nassen Kleidern herunter.
»Dazu bist du auch in der falschen Richtung unterwegs. Eger liegt über dem Fluss.« Das unerschrockenere Mädchen deutete dahin, wo er herkam. »Außerdem ist der Markt erst in drei Tagen, bis dahin dürftest du wieder getrocknet sein.«
»Nun ja, die Damen, vielleicht wollte ich auch zuvor noch eine Badekur machen, aber das ist jetzt wohl nicht mehr nötig.« Mathis hob die Arme und genoss abermals die Aufmerksamkeit, dann kam ihm der eigentliche Grund seiner Flussüberquerung wieder in den Sinn. Er zeigte auf die mittlerweile deutlich angeschwollene Menschentraube um den Wagen, der noch ein gutes Stück von ihnen entfernt auf dem Hügel haltgemacht hatte. »Was ist da los?«
»Ach, das ist der alte Nikolai. Er hat allerlei Krempel dabei, den er feilbietet. Er will sicherlich auch nach Eger zum Markt. Sein garstiges Weib sitzt hinten im Wagen und zieht den Leuten das Geld aus der Tasche, indem sie ihnen die Zukunft aus dem Kaffeesatz liest oder die Karten legt.«
»Eine Wahrsagerin?«
»Ja, eine Wahrsagerin. Aus dem Volk der Roma.« Das Mädchen sah die Neugier in Mathis’ Augen aufflackern und fragte deshalb: »Sag bloß, du hast noch nie eine Wahrsagerin gesehen? Die gibt es doch auf allen Märkten!«
»Ja, schon, aber ich hatte noch nie Gelegenheit …«
»Soll sie dir die Zukunft deuten?« Bereit, ein neues Abenteuer einzugehen, griff die Forschere der beiden nach seiner Hand. Mathis wollte erst abwehren. Etwas Unheimliches schien plötzlich von dem Wagen auszugehen, er konnte es sich selbst nicht erklären. Obwohl die Sonne warm auf seinen Rücken brannte und das Hemd schon wieder antrocknete, lief ein kalter Schauder seine Wirbelsäule hinunter.
Doch er wollte sich vor den Mädchen nicht blamieren, und deshalb sagte er: »Ja, warum nicht, ich wollte schon immer mal wissen, auf welchem Schloss ich einst regieren werde!«
Die Warnungen seiner längst verstorbenen Großmutter vor solchen Frauen saßen ihm im Nacken, doch er konnte nicht zurück, wollte er sein Gesicht nicht verlieren.
Nun standen sie also vor diesem Wagen, ein dunkles Tuch verwehrte den Blick ins Innere, wo diese seltsame Frau sein musste. Der alte Nikolai, ein ungepflegt wirkender Kerl mit zotteligem Bart und langem, strähnigem Haar, bot seine Waren an, und dabei ging sein Mundwerk mit diesem für Mathis fremdartig klingenden Dialekt wie ein Wasserfall. Er verstand die Hälfte nicht, und das Mädchen musste ihn anstoßen, damit er bemerkte, dass der Alte soeben ihn angesprochen hatte.
»Mein Freund kommt von weit her und versteht Euch nicht, Meister Nikolai«, entschuldigte sie ihn.
»Doch, doch, ich kann Euch nur nicht so schnell folgen«, stammelte Mathis.
»Einen halben Gulden für deine Zukunft, junger Herr!« Der alte Nikolai hielt Mathis seine offene Hand hin.
Alle starrten staunend auf den fremden jungen Mann mit den nassen Kleidern, doch keiner wagte nach dem Grund für sein Äußeres zu fragen, denn er war in Begleitung der beiden Töchter des Gutsherrn, er musste also zu den besseren Herrschaften gehören.
Mathis spielte mit, um seine wahre Herkunft nicht zu verraten und als Aufschneider dazustehen, obwohl ihn der Preis zweimal schlucken ließ.
»Du bist ein Halsabschneider, Nikolai! Wenn mein Vater von deinen Wucherpreisen hört, wird er dafür sorgen, dass du keine Marktlizenz erhältst.«
Mathis war beeindruckt von dem selbstsicheren Auftreten des Mädchens, und die Reaktion ließ ihn erkennen, dass er es mit Töchtern aus einer wohl sehr einflussreichen Familie zu tun hatte.
»Entschuldigt, Fräulein von Weißenstein, entschuldigt, ich wusste nicht, dass es sich bei diesem Herrn um einen Freund Eurer Familie handelt. Meinem Weib wird es eine Ehre sein, ihm die Zukunft zu deuten.« Nikolai verbeugte sich, und Mathis tat es ihm gleich, auch wenn er irritiert war.
Schon hob sich der dunkle Vorhang etwas zur Seite, und eine winkende Hand bedeutete ihm, einzutreten. Mathis wischte seine schweißfeuchten Hände an der noch feuchteren Hose ab und schaute in die Runde, die ihn aufmunternd und erwartungsvoll anblickte. Er gab sich einen Ruck und redete sich ein, die Wahrsagerin werde ihm schon nicht den Kopf abreißen.
Seine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit im Inneren des Wagens gewöhnen. Ein fremdartiger Geruch hing in der Luft, er erinnerte ihn an Weihrauch, den er von den Kirchenbesuchen her kannte. Er musste von der Schale auf dem Tischchen vor ihm stammen, wo winzige Kohlestückchen glommen und schwacher Rauch aufstieg. Er blieb stehen, ohne den Blick von dem Räucherwerk zu nehmen.
»Was qualmt hier?«, fragte er erstaunt.
»Man sagt dem Rauch des Olibanum-Harzes nach, dass er die Sinne schärft, den Blick für das Spirituelle öffnet. Olibanum gehört zu den Weihrauchharzen«, antwortete eine rauchige Stimme aus dem Halbdunkeln. Sie klang geheimnisvoll. Mathis fühlte sich von ihr angezogen.