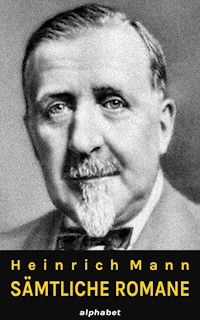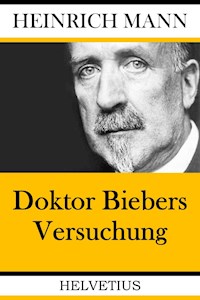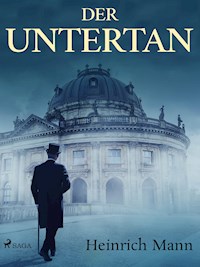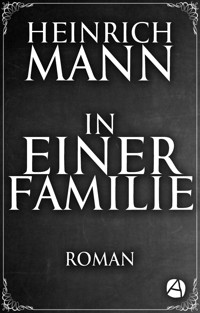Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit der Besprechung von Kurt Tucholsky Diederich Hessling ist ein katzbuckelnder obrigkeitshöriger Opportunist, ganz so, wie es ihn zur wilhelminischen Zeit massenweise gab. Schon in der Jugend zeigt er sich feige und ohne jegliche Courage. Ob als Student, als Familienoberhaupt oder (schließlich sogar) als Fabrikbesitzer, immer zeigt er sich als kriecherischer Mann ohne Charakter. Er nutzt und verehrt die Macht aufgrund eigener Schwäche und ist damit jederzeit das passende Rädchen im Obrigkeitsstaat. Sein einziges Prinzip ist das der grenzenlosen Kaiserverehrung und der Huldigung eines deutschen Nationalismus. Er sieht das deutsche Kaiserreich unter Wilhelm Zwo als absolute Weltmacht. Auch dieses prophetische Buch landete bei den Nazis auf dem Scheiterhaufen. Kurt Tucholsky, dessen bekannte Rezension hier ebenfalls veröffentlich ist, lobte Manns Werk als ein "Herbarium des deutschen Mannes", in dem er (der Mann) sich zeigt, in seiner "Sucht, zu befehlen und zu gehorchen." Der typische Deutsche Mann seiner Zeit dachte nur in Gewaltstrukturen: Gewalt von oben oder Gewalt nach unten. Für Tucholsky war Hessling nur ein "Herrscherchen" Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Der Untertan
Geschichte der öffentlichen Seele unter Wilhelm II.
Heinrich Mann
Der Untertan
Geschichte der öffentlichen Seele unter Wilhelm II.
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Kurt Wolff Verlag, Leipzig, 1918 2. Auflage, ISBN 978-3-962818-23-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Anmerkungen zur Bearbeitung
Besprechung von Kurt Tucholsky
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Anmerkungen zur Bearbeitung
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert.
Die Orthografie wurde der heutigen Schreibweise behutsam angeglichen.
Grundlage dieser Veröffentlichungen bilden folgende Ausgaben:
Kurt Wolff Verlag, Leipzig, 1918
Verlag Philipp Reclam jun., 1919
Besprechung von Kurt Tucholsky
Aber es wäre unnütz, euch zu raten. Die Geschlechter müssen vorübergehen, der Typus, den ihr darstellt, muss sich abnutzen: dieser widerwärtig interessante Typus des imperialistischen Untertanen, des Chauvinisten ohne Mitverantwortung, des in der Masse verschwindenden Machtanbeters, des Autoritätsgläubigen wider besseres Wissen und politischen Selbstkasteiers. Noch ist er nicht abgenutzt. Nach den Vätern, die sich zerrackerten und Hurra schrien, kommen Söhne mit Armbändern und Monokeln, ein Stand von formvollen Freigelassenen, der sehnsüchtig im Schatten des Adels lebt …
Heinrich Mann 1911
Dieses Buch Heinrich Manns, heute, gottseidank, in aller Hände, ist das Herbarium des deutschen Mannes. Hier ist er ganz: in seiner Sucht, zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Roheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolganbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit. Leider: es ist der deutsche Mann schlechthin gewesen; wer anders war, hatte nichts zu sagen, hieß Vaterlandsverräter und war kaiserlicherseits angewiesen, den Staub des Landes von den Pantoffeln zu schütteln.
Das erstaunlichste an dem Buch ist sicherlich die Vorbemerkung: »Der Roman wurde abgeschlossen Anfang Juli 1914.« Wenn ein Künstler dieses Ranges das schreibt, ist es wahr: bei jedem anderen würde man an Mystifikation1 denken, so überraschend ist die Sehergabe, so haarscharf ist das Urteil, bestätigt von der Geschichte, bestätigt von dem, was die Untertanen als allein maßgebend betrachten: vom Erfolg. Und es muss immerhin bemerkt werden, dass die alten Machthaber – ach, wären sie alt! – dieses Buch von ihrem Standpunkt aus mit Recht verboten haben: denn es ist ein gefährliches Buch.
Ein Stück Lebensgeschichte eines Deutschen wird aufgerollt: Diederich Hessling, Sohn eines kleinen Papierfabrikanten, wächst auf, studiert und geht zu den Korpsstudenten, dient und geht zu den Drückebergern, macht seinen Doktor, übernimmt die väterliche Fabrik, heiratet reich und zeugt Kinder. Aber das ist nicht nur Diederich Hessling oder ein Typ.
Das ist der Kaiser, wie er leibte und lebte. Das ist die Inkarnation des deutschen Machtgedankens, das ist einer der kleinen Könige, wie sie zu Hunderten und Tausenden in Deutschland lebten und leben, getreu dem kaiserlichen Vorbild, ganze Herrscherchen und ganze Untertanen.
Diese Parallele mit dem Staatsoberhaupt ist erstaunlich durchgearbeitet. Diederich Hessling gebraucht nicht nur dieselben Tropen und Ausdrücke, wenn er redet wie sein kaiserliches Vorbild – am lustigsten einmal in der Antrittsrede zu den Arbeitern (»Leute! Da ihr meine Untergebenen seid, will ich euch nur sagen, dass hier künftig forsch gearbeitet wird.« Und: »Mein Kurs ist der richtige, ich führe euch herrlichen Tagen entgegen.«) – er handelt auch im Sinne des Gewaltigen, er beugt sich nach oben, wie der seinem Gotte, so er seinem Regierungspräsidenten, und tritt nach unten.
Denn diese beiden Charaktereigenschaften sind an Hessling, sind am Deutschen auf das subtilste ausgebildet: sklavisches Unterordnungsgefühl und sklavisches Herrschaftsgelüst. Er braucht Gewalten, Gewalten, denen er sich beugt, wie der Naturmensch vor dem Gewitter, Gewalten, die er selbst zu erringen sucht, um andere zu ducken. Er weiß: sie ducken sich, hat er erst einmal das ›Amt‹ verliehen bekommen und den Erfolg für sich. Nichts wird so respektiert wie der Erfolg; einmal heißt es gradezu: »Er behandelte Magda mit Achtung, denn sie hatte Erfolg gehabt.« Aber wie wird dieser Erfolg geachtet! Würde er es mit nüchternem Tatsachensinn, so hätten wir den Amerikanismus, und das wäre nicht schön. Aber er wird geachtet auf ganz verlogne Art: man schämt sich der alten Vergangenheit und beschwört die alten Götter, die den wirklichen Dichtern und Denkern von einst noch etwas bedeuteten, zitiert sie, legt Metaphysik in den Erfolg und donnert voll Überzeugung: »Die Weltgeschichte ist das Weltgericht!« Und appelliert an keine höhere Instanz, weil man keine andere kennt.
Das ganze bombastische und doch so kleine Wesen des kaiserlichen Deutschland wird schonungslos in diesem Buch aufgerollt. Seine Sucht, Amüsiervergnügen an Stelle der Freude zu setzen, seine Unfähigkeit, in der Gegenwart zu leben, ohne auf die Lesebücher der Zukunft hinzuweisen, und seine Unfähigkeit, anders als nur in der Gegenwart zu leben, seine Lust am rauschenden Gepränge – tiefer ist nie die Popularität Wagners enthüllt worden als hier an einer ›Lohengrin‹- Aufführung, die voll witziger Beziehungen zur deutschen Politik strotzt (»denn hier erscheinen ihm, in Text und Musik, alle nationalen Forderungen erfüllt. Empörung war hier dasselbe wie Verbrechen, das Bestehende, Legitime ward glanzvoll gefeiert, auf Adel und Gottesgnadentum höchster Wert gelegt, und das Volk, ein von den Ereignissen ewig überraschter Chor, schlug sich willig gegen die Feinde seiner Herren«) –, und vor allem zeigt Heinrich Mann, wonach eben das Buch seinen Namen führt: die Unfreiheit des Deutschen.
Die alte Ordnung, die heute noch genau so besteht wie damals, nahm und gab dem Deutschen: sie nahm ihm die persönliche Freiheit, und sie gab ihm Gewalt über andere. Und sie ließen sich alle so willig beherrschen, wenn sie nur herrschen durften! Sie durften. Der Schutzmann über den Passanten, der Unteroffizier über den Rekruten, der Landrat über den Dörfler, der Gutsverwalter über den Bauern, der Beamte über Leute, die sachlich mit ihm zu tun hatten. Und jeder strebte nur immer danach, so ein Amt, so eine Stel-lung zu bekommen – hatte er die, ergab sich das Übrige von selbst. Das Übrige war: sich ducken und regieren und herrschen und befehlen.
Die vollkommene Unfähigkeit, anders zu denken als in solchem Apparat, der weit wichtiger war denn alles Leben, die Stupidität, zwischen Beamtenmisswirtschaft und Anarchie nicht die einzig mögliche dritte Verfassung zu sehen, die es für anständige Menschen gibt: sie bildet den Grundbass des Buches. (Und offenbart sie sich nicht heute wieder aufs herr-lichste?) Sie können alle nur ihre Pflicht tun, wenn man sie ducken und geduckt werden lässt; unzertrennlich erscheint Bildung und Sklaventum, Besitz und Duodezregierung, bürgerliches Leben und Untergebene und Vorgesetzte. Sie fassen es nicht, dass es wohl Leute geben mag, die sachlich Weisungen erteilen, aber nimmermehr: Vorgesetzte; wohl Menschen, die für Geld ausführen, was andere haben wollen, aber nimmermehr: Untergebene. Das Land war – war … – ein einziger Kasernenhof.
Und noch eins scheint mir in diesem Werk, das auch noch die kleinen und kleinsten Züge der Hurramiene mit dem aufgebürsteten Katerschnurrbart eingefangen hat, auf das glücklichste dargestellt zu sein; das Rätsel der Kollektivität. Was der Jurist Otto Gierke einst die reale Verbandspersönlichkeit benannte, diese Erscheinung, dass ein Verein nicht die Summe seiner Mitglieder ist, sondern mehr, sondern etwas andres, über ihnen Schwebendes: das ist hier in nuce aufgemalt und dargetan. Neuteutonen und Soldaten und Juristen und schließlich Deutsche – es sind alles Kollektivitäten, die den einzelnen von jeder Verantwortung frei machen, und denen anzugehören Ruhm und Ehre einbringt, Achtung erheischt und kein Verdienst beansprucht. Man ist es eben, und damit fertig. Der Musketier Lyck, der den Arbeiter erschießt – historisch – und dafür Gefreiter wird; der Bürger Hessling, der – nicht historisch, aber mehr als das: typisch – alle andersgearteten wie Wilde ansieht: sie sind Sklaven der rätselvollen Kollektivität, die diesem Lande und dieser Zeit so unendlich Schmachvolles aufgebürdet hat. »Dem Europäer ist nicht wohl, wenn ihm nicht etwas voranweht«, hat Meyrink mal gesagt. Es wehte ihnen allen etwas voran, und sie schwören auf die Fahne.
Kleine und kleinste Züge belustigen, böse Blink-feuer der Erotik blitzen auf, der Kampf der Geschlechter in Flanell und möblierten Zimmern ist hier ein Guerillakrieg, es wird mit vergifteten Pfeilen geschossen, und es ist bitterlich spaßig, wie Liebe schließlich zum legitimen Geschlechtsgenuss wird. Eine bunte Fülle Leben zieht vorbei, und alles ist auf die letzte Formulierung gebracht, und alles ist typisch, alles ein für alle Mal. Die alte Forderung ist ganz erfüllt: »Wenn nun gleich der Dichter uns immer nur das einzelne, individuelle vorführt, so ist, was er erkannte und uns dadurch erkennen lassen will, doch die Idee, die ganze Gattung.« Leider: so ist die ganze Gattung.
Aus kleinen Ereignissen wird die letzte Enthüllung des deutschen Seelenzustandes: am fünfundzwanzigsten Februar 1892 demonstrierten die Arbeitslosen vor dem Königlichen Schloss in Berlin, und daraus wird in dem Buch eine grandiose Szene mit dem opernhaften Kaiser als Mittelstaffage, einer begeisterten Menge Volks und in ihnen, unter ihnen und ganz mit ihnen: Hessling, der Deutsche, der Claqueur, der junge Mann, der das Staatserhaltende liebt, der Untertan.
Und aus all dem Tohuwabohu, aus dem Gewirr der spießigen Kleinstadt, aus den Klatschprozessen und aus den Schiebungen – man sagt: Verordnungen; und meint: Grundstücksspekulation –, aus lächerlichen Ehrenkodexen und simpeln Gaunereien strahlt die Figur des alten Buck. Man muss so hassen können wie Mann, umso lieben zu können. Der alte Buck ist ein alter Achtundvierziger, ein Mann von damals, wo man die heute geschmähten Ideale hatte, sie zwar nicht verwirklichte, schlecht verwirklichte, verworren war – gewiss, aber es waren doch Ideale. Wie schön ist das, wenn der alte Mann dem neuen Hessling sein altes Gedichtbuch in die Hand drückt: »Da, nehmen Sie! Es sind meine ›Sturmglocken‹! Man war auch Dichter – damals!« Die von heute sinds nicht mehr. Sie sind Realpolitiker, verlachen den Idealisten, weil er – scheinbar – nichts erreicht, und wissen nicht, dass sie ihre kümmerlichen kleinen Erfolge neben den charakterlosen Pakten jenen verdanken, die einst wahr gewesen sind und unerschütterlich.
Und das Buch ›Der Untertan‹ (erschienen bei Kurt Wolff in Leipzig) zeigt uns wieder, dass wir auf dem rechten Wege sind, und bestätigt uns, dass Liebe, die nach außen in Hass umschlagen kann, das einzige ist, um in diesem Volke durchzudringen, um diesem Volke zu helfen, um endlich, endlich einmal die Farben Schwarz-Weiß-Rot, in die sie sich verrannt haben wie die Stiere, von dem Deutschland abzutrennen, das wir lieben, und das die Besten aller Alter geliebt haben. Es ist ja nicht wahr, dass versipptes Cliquentum und gehorsame Lügner ewig und untrennbar mit unserm Lande verknüpft sein müssen. Beschimpfen wir die, loben wir doch das andere Deutschland; lästern wir die, beseelt uns doch die Liebe zum Deutschen. Allerdings: nicht zu diesem Deutschen da. Nicht zu dem Burschen, der untertänig und respektvoll nach oben himmelt und niederträchtig und geschwollen nach unten tritt, der Radfahrer des lieben Gottes, eine entartete Spezies der gens humana.
Weil aber Heinrich Mann der erste deutsche Literat ist, der dem Geist eine entscheidende und mitbestimmende Stellung fern aller Literatur eingeräumt hat, grüßen wir ihn. Und wissen wohl, dass diese wenigen Zeilen seine künstlerische Größe nicht ausgeschöpft haben, nicht die Kraft seiner Darstellung und nicht das seltsame Rätsel seines gemischten Blutes.
So wollen wir kämpfen. Nicht gegen die Herrscher, die es immer geben wird, nicht gegen Menschen, die Verordnungen für andere machen, Lasten den anderen aufbürden und Arbeit den anderen. Wir wollen ihnen die entziehen, auf deren Rücken sie tanzten, die, die stumpfsinnig und immer zufrieden das Unheil dieses Landes verschuldet haben, die, die wir den Staub der Heimat von den beblümten Pantoffeln gerne schütteln sähen: die Untertanen!
Ignaz Wrobel Die Weltbühne, 20.03.1919, Nr. 13, S. 317.
Verschleierung, Verdunkelung <<<
I.
Diederich Hessling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen Goldregen- und Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand. Wenn Diederich vom Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst! Oder an der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom und schielte her!
Fürchterlicher als Gnom und Kröte war der Vater, und obendrein sollte man ihn lieben. Diederich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis Herr Hessling etwas merkte und den Stock von der Wand nahm. Jede nicht herausgekommene Untat mischte in Diederichs Ergebenheit und Vertrauen einen Zweifel. Als der Vater einmal mit seinem invaliden Bein die Treppe herunterfiel, klatschte der Sohn wie toll in die Hände – worauf er weglief.
Kam er nach einer Abstrafung mit gedunsenem Gesicht und unter Geheul an der Werkstätte vorbei, dann lachten die Arbeiter. Sofort aber streckte Diederich nach ihnen die Zunge aus und stampfte. Er war sich bewusst: »Ich habe Prügel bekommen, aber von meinem Papa. Ihr wäret froh, wenn ihr auch Prügel von ihm bekommen könntet. Aber dafür seid ihr viel zu wenig.«
Er bewegte sich zwischen ihnen wie ein launenhafter Pascha; drohte ihnen bald, es dem Vater zu melden, dass sie sich Bier holten, und bald ließ er kokett aus sich die Stunde herausschmeicheln, zu der Herr Hessling zurückkehren sollte. Sie waren auf der Hut vor dem Prinzipal:1 er kannte sie, er hatte selbst gearbeitet. Er war Büttenschöpfer gewesen in den alten Mühlen, wo jeder Bogen mit der Hand geformt ward; hatte dazwischen alle Kriege mitgemacht und nach dem letzten, als jeder Geld fand, eine Papiermaschine kaufen können. Ein Holländer und eine Schneidemaschine vervollständigten die Einrichtung. Er selbst zählte die Bogen nach. Die von den Lumpen abgetrennten Knöpfe durften ihm nicht entgehen. Sein kleiner Sohn ließ sich oft von den Frauen welche zustecken, dafür, dass er die nicht angab, die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, dass ihm der Gedanke kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen. Es gelang – aber am Abend kniete Diederich, indes er den letzten Malzzucker zerlutschte, sich ins Bett und betete, angstgeschüttelt, zu dem schrecklichen lieben Gott, er möge das Verbrechen unentdeckt lassen. Er brachte es dennoch an den Tag. Dem Vater, der immer nur methodisch, Ehrenfestigkeit und Pflicht auf dem verwitterten Unteroffiziersgesicht, den Stock geführt hatte, zuckte diesmal die Hand, und in die eine Bürste seines silberigen Kaiserbartes lief, über die Runzeln hüpfend, eine Träne. »Mein Sohn hat gestohlen«, sagte er außer Atem, mit dumpfer Stimme, und sah sich das Kind an wie einen verdächtigen Eindringling. »Du betrügst und stiehlst. Du brauchst nur noch einen Menschen totzuschlagen.«
Frau Hessling wollte Diederich nötigen, vor dem Vater hinzufallen und ihn um Verzeihung zu bitten, weil der Vater seinetwegen geweint habe! Aber Diederichs Instinkt sagte ihm, dass dies den Vater nur noch mehr erbost haben würde. Mit der gefühlsseligen Art seiner Frau war Hessling durchaus nicht einverstanden. Sie verdarb das Kind fürs Leben. Übrigens ertappte er sie geradeso auf Lügen wie den Diedel. Kein Wunder, da sie Romane las! Am Sonnabendabend war nicht immer die Wochenarbeit getan, die ihr aufgegeben war. Sie klatschte, anstatt sich zu rühren, mit dem Dienstmädchen … Und Hessling wusste noch nicht einmal, dass seine Frau auch naschte, gerade wie das Kind. Bei Tisch wagte sie sich nicht satt zu essen und schlich nachträglich an den Schrank. Hätte sie sich in die Werkstatt getraut, würde sie auch Knöpfe gestohlen haben.
Sie betete mit dem Kind »aus dem Herzen«, nicht nach Formeln, und bekam dabei gerötete Wangenknochen. Sie schlug es auch, aber Hals über Kopf und verzerrt von Rachsucht. Oft war sie dabei im Unrecht. Dann drohte Diederich, sie beim Vater zu verklagen; tat so, als ginge er ins Kontor, und freute sich irgendwo hinter einer Mauer, dass sie nun Angst hatte. Ihre zärtlichen Stunden nützte er aus; aber er fühlte gar keine Achtung vor seiner Mutter. Ihre Ähnlichkeit mit ihm selbst verbot es ihm. Denn er achtete sich selbst nicht, dafür ging er mit einem zu schlechten Gewissen durch sein Leben, das vor den Augen des Herrn nicht hätte bestehen können.
Dennoch hatten die beiden von Gemüt überfließende Dämmerstunden. Aus den Festen pressten sie gemeinsam, vermittels Gesang, Klavierspiel und Märchenerzählen, den letzten Tropfen Stimmung heraus. Als Diederich am Christkind zu zweifeln anfing, ließ er sich von der Mutter bewegen, noch ein Weilchen zu glauben, und er fühlte sich dadurch erleichtert, treu und gut. Auch an ein Gespenst, droben auf der Burg, glaubte er hartnäckig, und der Vater, der hiervon nichts hören wollte, schien zu stolz, beinahe strafwürdig. Die Mutter nährte ihn mit Märchen. Sie teilte ihm ihre Angst mit vor den neuen, belebten Straßen und der Pferdebahn, die hindurchfuhr, und führte ihn über den Wall nach der Burg. Dort genossen sie das wohlige Grausen.
Ecke der Meisestraße hinwieder musste man an einem Polizisten vorüber, der, wen er wollte, ins Gefängnis abführen konnte! Diederichs Herz klopfte beweglich; wie gern hätte er einen weiten Bogen gemacht! Aber dann würde der Polizist sein schlechtes Gewissen erkannt und ihn aufgegriffen haben. Es war vielmehr geboten, zu beweisen, dass man sich rein und ohne Schuld fühlte – und mit zitternder Stimme fragte Diederich den Schutzmann nach der Uhr.
*
Nach so vielen furchtbaren Gewalten, denen man unterworfen war, nach den Märchenkröten, dem Vater, dem lieben Gott, dem Burggespenst und der Polizei, nach dem Schornsteinfeger, der einen durch den ganzen Schlot schleifen konnte, bis man auch ein schwarzer Mann war, und dem Doktor, der einen im Hals pinseln durfte und schütteln, wenn man schrie – nach allen diesen Gewalten geriet nun Diederich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal ganz verschlingende: die Schule. Diederich betrat sie heulend, und auch die Antworten, die er wusste, konnte er nicht geben, weil er heulen musste. Allmählich lernte er den Drang zum Weinen gerade dann auszunutzen, wenn er nicht gelernt hatte – denn alle Angst machte ihn nicht fleißiger oder weniger träumerisch – und vermied so, bis die Lehrer sein System durchschaut hatten, manche üblen Folgen. Dem ersten, der es durchschaute, schenkte er seine ganze Achtung; er war plötzlich still und sah ihn, über den gekrümmten und vors Gesicht gehaltenen Arm hinweg, voll scheuer Hingabe an. Immer blieb er den scharfen Lehrern ergeben und willfährig. Den gutmütigen spielte er kleine, schwer nachweisbare Streiche, deren er sich nicht rühmte. Mit viel größerer Genugtuung sprach er von einer Verheerung in den Zeugnissen, von einem riesigen Strafgericht. Bei Tisch berichtete er: »Heute hat Herr Behnke wieder drei durchgehauen.« Und wenn gefragt ward, wen?
»Einer war ich.«
Denn Diederich war so beschaffen, dass die Zugehörigkeit zu einem unpersönlichen Ganzen, zu diesem unerbittlichen, menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war, ihn beglückte, dass die Macht, die kalte Macht, an der er selbst, wenn auch nur leidend, teilhatte, sein Stolz war. Am Geburtstag des Ordinarius bekränzte man Katheder und Tafel. Diederich umwand sogar den Rohrstock.
Im Lauf der Jahre berührten zwei über Machthaber hereingebrochene Katastrophen ihn mit heiligem und süßem Schauder. Ein Hilfslehrer ward vor der Klasse vom Direktor heruntergemacht und entlassen. Ein Oberlehrer ward wahnsinnig. Noch höhere Gewalten, der Direktor und das Irrenhaus, waren hier grässlich mit denen abgefahren, die bis eben so hohe Gewalt hatten. Von unten, klein aber unversehrt, durfte man die Leichen betrachten und aus ihnen eine die eigene Lage mildernde Lehre ziehen.
Die Macht, die ihn in ihrem Räderwerk hatte, vor seinen jüngeren Schwestern vertrat Diederich sie. Sie mussten nach seinem Diktat schreiben und künstlich noch mehr Fehler machen, als ihnen von selbst gelangen, damit er mit roter Tinte wüten und Strafen austeilen konnte. Sie waren grausam. Die Kleinen schrien – und dann war es an Diederich, sich zu demütigen, um nicht verraten zu werden.
Er hatte, den Machthabern nachzuahmen, keinen Menschen nötig; ihm genügten Tiere, sogar Dinge. Er stand am Rande des Holländers und sah die Trommel die Lumpen ausschlagen. »Den hast du weg! Untersteht euch noch mal! Infame Bande!« murmelte Diederich, und in seinen blassen Augen glomm es. Plötzlich duckte er sich; fast fiel er in das Chlorbad. Der Schritt eines Arbeiters hatte ihn aufgestört aus seinem lästerlichen Genuss.
Denn recht geheuer und seiner Sache gewiss fühlte er sich nur, wenn er selbst die Prügel bekam. Kaum je widerstand er dem Übel. Höchstens bat er den Kameraden: »Nicht auf den Rücken, das ist ungesund.«
Nicht, dass es ihm am Sinn für sein Recht und an Liebe zum eigenen Vorteil fehlte. Aber Diederich hielt dafür, dass Prügel, die er bekam, dem Schlagenden keinen praktischen Gewinn, ihm selbst keinen realen Verlust zufügten. Ernster als diese bloß idealen Werte nahm er die Schaumrolle, die der Oberkellner vom »Netziger Hof« ihm schon längst versprochen hatte und mit der er nie herausrückte. Diederich machte unzählige Male ernsten Schrittes den Geschäftsweg die Meisestraße hinauf zum Markt, um seinen befrackten Freund zu mahnen. Als der aber eines Tages von seiner Verpflichtung überhaupt nichts mehr wissen wollte, erklärte Diederich und stampfte ehrlich entrüstet auf: »Jetzt wird mir’s doch zu bunt! Wenn Sie nun nicht gleich herausrücken, sag’ ich’s Ihrem Herrn!« Darauf lachte Schorsch und brachte die Schaumrolle.
Das war ein greifbarer Erfolg. Leider konnte Diederich ihn nur hastig und in Sorge genießen, denn es war zu fürchten, dass Wolfgang Buck, der draußen wartete, darüber zukam und den Anteil verlangte, der ihm versprochen war. Indes fand er Zeit, sich sauber den Mund zu wischen, und vor der Tür brach er in heftige Schimpfreden auf Schorsch aus, der ein Schwindler sei und gar keine Schaumrolle habe. Diederichs Gerechtigkeitsgefühl, das sich zu seinen Gunsten noch eben so kräftig geäußert hatte, schwieg vor den Ansprüchen des anderen – die man freilich nicht einfach außer acht lassen durfte, dafür war Wolfgangs Vater eine viel zu achtunggebietende Persönlichkeit. Der alte Herr Buck trug keinen steifen Kragen, sondern eine weißseidene Halsbinde und darüber einen großen weißen Knebelbart. Wie langsam und majestätisch er seinen oben goldenen Stock aufs Pflaster setzte! Und er hatte einen Zylinder auf, und unter seinem Überzieher sahen häufig Frackschöße hervor, mitten am Tage! Denn er ging in Versammlungen, er bekümmerte sich um die ganze Stadt. Von der Badeanstalt, vom Gefängnis, von allem, was öffentlich war, dachte Diederich: »Das gehört dem Herrn Buck.« Er musste ungeheuer reich und mächtig sein. Alle, auch Herr Hessling, entblößten vor ihm lange den Kopf. Seinem Sohn mit Gewalt etwas abzunehmen, wäre eine Tat voll unabsehbarer Gefahren gewesen. Um von den großen Mächten, die er so sehr verehrte, nicht ganz erdrückt zu werden, musste Diederich leise und listig zu Werk gehen.
Einmal nur, in Untertertia, geschah es, dass Diederich jede Rücksicht vergaß, sich blindlings betätigte und zum siegestrunkenen Unterdrücker ward. Er hatte, wie es üblich und geboten war, den einzigen Juden seiner Klasse gehänselt, nun aber schritt er zu einer ungewöhnlichen Kundgebung. Aus Klötzen, die zum Zeichnen dienten, erbaute er auf dem Katheder ein Kreuz und drückte den Juden davor in die Knie. Er hielt ihn fest, trotz allem Widerstand; er war stark! Was Diederich stark machte, war der Beifall ringsum, die Menge, aus der heraus Arme ihm halfen, die überwältigende Mehrheit drinnen und draußen. Denn durch ihn handelte die Christenheit von Netzig. Wie wohl man sich fühlte bei geteilter Verantwortlichkeit und einem Schuldbewusstsein, das kollektiv war!
Nach dem Verrauchen des Rausches stellte wohl leichtes Bangen sich ein, aber das erste Lehrergesicht, dem Diederich begegnete, gab ihm allen Mut zurück; es war voll verlegenen Wohlwollens. Andere bewiesen ihm offen ihre Zustimmung. Diederich lächelte mit demütigem Einverständnis zu ihnen auf. Er bekam es leichter seitdem. Die Klasse konnte die Ehrung dem nicht versagen, der die Gunst des neuen Ordinarius besaß. Unter ihm brachte Diederich es zum Primus und zum geheimen Aufseher. Wenigstens die zweite dieser Ehrenstellen behauptete er auch später. Er war gut Freund mit allen, lachte, wenn sie ihre Streiche ausplauderten, ein ungetrübtes, aber herzliches Lachen, als ernster junger Mensch, der Nachsicht hat mit dem Leichtsinn – und dann in der Pause, wenn er dem Professor das Klassenbuch vorlegte, berichtete er. Auch hinterbrachte er die Spitznamen der Lehrer und die aufrührerischen Reden, die gegen sie geführt worden waren. In seiner Stimme bebte, nun er sie wiederholte, noch etwas von dem wollüstigen Erschrecken, womit er sie, hinter gesenkten Lidern, angehört hatte. Denn er spürte, ward irgendwie an den Herrschenden gerüttelt, eine gewisse lasterhafte Befriedigung, etwas ganz unter sich Bewegendes, fast wie ein Hass, der zu seiner Sättigung rasch und verstohlen ein paar Bissen nahm. Durch die Anzeige der anderen sühnte er die eigene sündhafte Regung.
Andererseits empfand er gegen die Mitschüler, deren Fortkommen seine Tätigkeit in Frage stellte, zumeist keine persönliche Abneigung. Er benahm sich als pflichtmäßiger Vollstrecker einer harten Notwendigkeit. Nachher konnte er zu dem Getroffenen hintreten und ihn, fast ganz aufrichtig, beklagen. Einst ward mit seiner Hilfe einer gefasst, der schon längst verdächtig war, alles abzuschreiben. Diederich überließ ihm, mit Wissen des Lehrers, eine mathematische Aufgabe, die in der Mitte absichtlich gefälscht und deren Endergebnis dennoch richtig war. Am Abend nach dem Zusammenbruch des Betrügers saßen einige Primaner vor dem Tor in einer Gartenwirtschaft, was zum Schluss der Turnspiele erlaubt war, und sangen. Diederich hatte den Platz neben seinem Opfer gesucht. Einmal, als ausgetrunken war, ließ er die Rechte vom Krug herab auf die des anderen gleiten, sah ihm treu in die Augen und stimmte in Basstönen, die von Gemüt schleppten, ganz allein an:
»Ich hatt’ einen Kameraden, einen bessern findst du nit …«
Übrigens genügte er bei zunehmender Schulpraxis in allen Fächern, ohne in einem das Maß des Geforderten zu überschreiten, oder auf der Welt irgendetwas zu wissen, was nicht im Pensum vorkam. Der deutsche Aufsatz war ihm das Fremdeste, und wer sich darin auszeichnete, gab ihm ein unerklärtes Misstrauen ein.
Seit seiner Versetzung nach Prima galt seine Gymnasialkarriere für gesichert, und bei Lehrern und Vater drang der Gedanke durch, er solle studieren. Der alte Hessling, der 66 und 71 durch das Brandenburger Tor eingezogen war, schickte Diederich nach Berlin.
*
Weil er sich aus der Nähe der Friedrichstraße nicht fortgetraute, mietete er sein Zimmer droben in der Tieckstraße. Jetzt hatte er nur in gerader Linie hinunterzugehen und konnte die Universität nicht verfehlen. Er besuchte sie, da er nichts anderes vorhatte, täglich zweimal, und in der Zwischenzeit weinte er oft vor Heimweh. Er schrieb einen Brief an Vater und Mutter und dankte ihnen für seine glückliche Kindheit. Ohne Not ging er nur selten aus. Kaum, dass er zu essen wagte; er fürchtete, sein Geld vor dem Ende des Monats auszugeben. Und immerfort musste er nach der Tasche fassen, ob es noch da sei.
So verlassen ihm um das Herz war, ging er doch noch immer nicht mit dem Brief des Vaters in die Blücherstraße zu Herrn Göppel, dem Zellulosefabrikanten, der aus Netzig war und auch an Hessling lieferte. Am vierten Sonntag besiegte er seine Scheu – und kaum watschelte der gedrungene, gerötete Mann, den er schon so oft beim Vater im Kontor gesehen hatte, auf ihn zu, da wunderte Diederich sich schon, dass er nicht früher gekommen sei. Herr Göppel fragte gleich nach ganz Netzig und vor allem nach dem alten Buck. Denn obwohl sein Kinnbart nun auch ergraut war, hatte er doch, wie Diederich, nur, wie es schien, aus anderen Gründen, schon als Knabe den alten Buck verehrt. Das war ein Mann: Hut ab! Einer von denen, die das deutsche Volk hochhalten sollte, höher als gewisse Leute, die immer alles mit Blut und Eisen kurieren wollten und dafür der Nation riesige Rechnungen schrieben. Der alte Buck war schon achtundvierzig dabeigewesen, er war sogar zum Tode verurteilt worden. »Ja, dass wir hier als freie Männer sitzen können«, sagte Herr Göppel, »das verdanken wir solchen Leuten wie dem alten Buck.« Und er öffnete noch eine Flasche Bier. »Heute sollen wir uns mit Kürassierstiefeln treten lassen …«
Herr Göppel bekannte sich als freisinniger Gegner Bismarcks. Diederich bestätigte alles, was Göppel wollte; er hatte über den Kanzler, die Freiheit, den jungen Kaiser keinerlei Meinung. Da aber ward er peinlich berührt, denn ein junges Mädchen war eingetreten, das ihm auf den ersten Blick durch Schönheit und Eleganz gleich furchtbar erschien.
»Meine Tochter Agnes«, sagte Herr Göppel.
Diederich stand da, in seinem faltenreichen Gehrock, als magerer Kadett, und war rosig überzogen. Das junge Mädchen gab ihm die Hand. Sie wollte wohl nett sein, aber was war mit ihr anzufangen? Diederich antwortete ja, als sie fragte, ob Berlin ihm gefalle; und als sie fragte, ob er schon im Theater gewesen sei, antwortete er nein. Er fühlte sich feucht vor Ungemütlichkeit und war fest überzeugt, sein Aufbruch sei das einzige, womit er das junge Mädchen interessieren könne. Aber wie war von hier fortzukommen? Zum Glück stellte ein anderer sich ein, ein breiter Mensch namens Mahlmann, der mit ungeheurer Stimme Mecklenburgisch sprach, stud. ing. zu sein schien und bei Göppels Zimmerherr sein sollte. Er erinnerte Fräulein Agnes an einen Spaziergang, den sie verabredet hätten. Diederich ward aufgefordert, mitzukommen. Entsetzt schützte er einen Bekannten vor, der draußen auf ihn warte, und machte sich sofort davon. »Gott sei Dank«, dachte er, während es ihm einen Stich gab, »sie hat schon einen.«
Herr Göppel öffnete ihm im Dunkeln die Flurtür und fragte, ob sein Freund auch Berlin kenne. Diederich log, der Freund sei Berliner. »Denn wenn Sie es beide nicht kennen, kommen Sie noch in den falschen Omnibus. Sie haben sich gewiss schon mal verirrt in Berlin.« Und als Diederich es zugab, zeigte Herr Göppel sich befriedigt. »Das ist nicht wie in Netzig. Hier laufen Sie gleich halbe Tage. Was glauben Sie wohl, wenn Sie von Ihrer Tieckstraße bis hierher zum Halleschen Tor gehen, dann sind Sie ja schon dreimal durch ganz Netzig gestiegen … Na, nächsten Sonntag kommen Sie nun aber zum Mittagessen!«
Diederich versprach es. Als es so weit war, hätte er lieber abgesagt; nur aus Furcht vor seinem Vater ging er hin. Diesmal galt es sogar, ein Alleinsein mit dem Fräulein zu bestehen. Diederich tat geschäftig und als sei er nicht aufgelegt, sich mit ihr zu befassen. Sie wollte wieder vom Theater anfangen, aber er schnitt mit rauer Stimme ab: er habe für so etwas keine Zeit. Ach ja, ihr Papa habe ihr gesagt, Herr Hessling studiere Chemie?
»Ja. Das ist überhaupt die einzige Wissenschaft, die Berechtigung hat«, behauptete Diederich, ohne zu wissen, wie er dazu kam.
Fräulein Göppel ließ ihren Beutel fallen; er bückte sich so nachlässig, dass sie ihn wieder hatte, bevor er zur Stelle war. Trotzdem sagte sie danke, ganz weich, fast beschämt – was Diederich ärgerte. »Kokette Weiber sind etwas Grässliches«, dachte er. Sie suchte in ihrem Beutel.
»Jetzt hab’ ich es doch verloren. Mein englisches Pflaster nämlich. Es blutet wieder.«
Sie wickelte ihren Finger aus dem Taschentuch. Er hatte so sehr die Weiße des Schnees, dass Diederich der Gedanke kam, das Blut, das darauf lag, müsse hineinsickern.
»Ich habe welches«, sagte er, mit einem Ruck.
Er ergriff ihren Finger, und bevor sie das Blut wegwischen konnte, hatte er es abgeleckt.
»Was machen Sie denn?«
Er war selbst erschrocken. Er sagte mit streng gefalteten Brauen: »Oh, ich als Chemiker probiere noch ganz andere Sachen.«
Sie lächelte. »Ach ja, Sie sind eine Art Doktor … Wie gut Sie das können«, bemerkte sie und sah ihm beim Aufkleben des Pflasters zu.
»So«, machte er ablehnend, und trat zurück. Ihm war es schwül geworden, er dachte: »Wenn man nur nicht immer ihre Haut anfassen müsste! Sie ist widerlich weich.« Agnes sah an ihm vorbei. Nach einer Pause versuchte sie: »Haben wir nicht eigentlich in Netzig gemeinschaftliche Verwandte?« Und sie nötigte ihn, mit ihr ein paar Familien durchzugehen. Es stellte sich Vetternschaft heraus.
»Sie haben auch noch Ihre Mutter, nicht? Dann können Sie sich freuen. Meine ist längst tot. Ich werde wohl auch nicht lange leben. Man hat so Ahnungen« – und sie lächelte wehmütig und entschuldigend.
Diederich beschloss schweigend, diese Sentimentalität albern zu finden. Noch eine Pause – und wie sie beide eilig zum Sprechen ansetzten, kam der Mecklenburger dazwischen. Die Hand Diederichs drückte er so kraftvoll, dass Diederichs Gesicht sich verzerrte, und zugleich lächelte er ihm sieghaft in die Augen. Ohne weiteres zog er einen Stuhl bis vor Agnes’ Knie und fragte heiter und mit Autorität nach allem Möglichen, was nur sie beide anging. Diederich war sich selbst überlassen und entdeckte, dass Agnes, so in Ruhe betrachtet, viel von ihren Schrecken verlor. Eigentlich war sie nicht hübsch. Sie hatte eine zu kleine, nach innen gebogene Nase, auf deren freilich sehr schmalem Rücken Sommersprossen saßen. Ihre gelbbraunen Augen lagen zu nahe beieinander und zuckten, wenn sie einen ansah. Die Lippen waren zu schmal, das ganze Gesicht war zu schmal. »Wenn sie nicht so viel braunrotes Haar über der Stirn hätte und dazu den weißen Teint …« Auch bereitete es ihm Genugtuung, dass der Nagel des Fingers, den er beleckt hatte, nicht ganz sauber gewesen war.
Herr Göppel kam mit seinen drei Schwestern. Eine von ihnen hatte Mann und Kinder mit. Der Vater und die Tanten umarmten und küssten Agnes. Sie taten es mit dringlicher Innigkeit und hatten dabei behutsame Mienen. Das junge Mädchen war schlanker und größer als sie alle und blickte ein wenig zerstreut auf sie hinab, die eben an ihren schmächtigen Schultern hing. Nur ihrem Vater erwiderte sie langsam und ernst seinen Kuss. Diederich sah dem zu und sah in der Sonne die hellblauen Adern, überzogen von roten Haaren, ihre Schläfe kreuzen.
Er musste eine der Tanten ins Esszimmer führen. Der Mecklenburger hatte Agnes’ Arm in den seinen gehängt. Um den langen Familientisch raschelten die seidenen Sonntagskleider. Die Gehröcke wurden über den Knien zusammengelegt. Man räusperte sich, die Herren rieben die Hände. Dann kam die Suppe.
Diederich saß von Agnes weit weg und konnte sie nicht sehen, wenn er sich nicht vorbeugte – was er sorgfältig vermied. Da seine Nachbarin ihn in Ruhe ließ, aß er große Mengen Kalbsbraten und Blumenkohl. Er hörte ausführlich das Essen besprechen und musste bestätigen, dass es schön schmecke. Agnes ward vor dem Salat gewarnt, ihr ward zu Rotwein geraten, und sie sollte Auskunft geben, ob sie heute Morgen Gummischuhe angehabt habe. Herr Göppel erzählte, Diederich zugewandt, dass er und seine Schwestern vorhin in der Friedrichstraße, weiß Gott, auseinander gekommen seien und sich erst im Omnibus wiedergefunden hätten. »So etwas kann Ihnen in Netzig auch nicht passieren«, rief er voll Stolz über den Tisch. Mahlmann und Agnes sprachen von einem Konzert. Sie wollte bestimmt hin, ihr Papa werde es schon erlauben. Herr Göppel machte zärtliche Einwände, und der Chor der Tanten begleitete sie. Agnes müsse früh schlafen gehen und bald in gute Luft hinaus; sie habe sich im Winter überanstrengt. Sie bestritt es. »Ihr lasst mich niemals aus dem Hause. Ihr seid schrecklich.«
Diederich nahm innerlich Partei für sie. Er hatte eine Wallung von Heldentum: er hätte machen wollen, dass sie alles dürfte, dass sie glücklich war und es ihm dankte … Da fragte Herr Göppel ihn, ob er in das Konzert wolle. »Ich weiß nicht«, sagte er verächtlich und sah Agnes an, die sich vorbeugte. »Was ist das für eins? Ich gehe nur in Konzerte, wo ich Bier trinken kann.«
»Sehr vernünftig«, sagte der Schwager des Herrn Göppel.
Agnes hatte sich zurückgezogen, und Diederich bereute seinen Ausspruch.
Aber die Creme, auf die alle gespannt waren, blieb aus. Herr Göppel riet seiner Tochter, einmal nachzusehen. Bevor sie ihren Kompotteller hingesetzt hatte, war Diederich aufgesprungen – sein Stuhl flog an die Wand – und festen Schritts zur Tür geeilt. »Marie! Der Krehm!« rief er hinaus. Rot und ohne jemand anzusehen, ging er wieder an seinen Platz. Aber er merkte ganz gut, sie blinzelten sich zu. Mahlmann stieß sogar höhnisch den Atem aus. Der Schwager äußerte mit künstlicher Harmlosigkeit: »Immer galant! So soll es sein.« Herr Göppel lächelte zärtlich zu Agnes hin, die nicht von ihrem Kompott aufsah. Diederich stemmte das Knie gegen die Tischplatte, dass sie anfing sich zu heben. Er dachte: »Gott, o Gott, hätte ich nur das nicht getan!«
Beim Mahlzeitsagen gab er allen die Hand, nur um Agnes drückte er sich herum. Im Berliner Zimmer beim Kaffee wählte er seinen Sitz mit Sorgfalt dort, wo Mahlmanns breiter Rücken sie ihm verdeckte. Eine der Tanten wollte sich seiner annehmen.
»Was studieren Sie denn, junger Mann?« fragte sie.
»Chemie.«
»Ach so, Physik?«
»Nein, Chemie.«
»Ach so.«
Und so imposant sie angefangen hatte, hierüber kam sie nicht hinweg. Diederich nannte sie im Stillen eine dumme Gans. Die ganze Gesellschaft passte ihm nicht. Von feindseliger Schwermut erfüllt, sah er darein, bis die letzten Verwandten aufgebrochen waren. Agnes und ihr Vater hatten sie hinausbegleitet. Herr Göppel kehrte zurück, erstaunt, den jungen Mann allein noch im Zimmer zu finden. Er schwieg forschend, einmal fasste er in die Tasche. Als Diederich unvermittelt, ohne um Geld gebeten zu haben, Abschied nahm, bekundete Göppel große Herzlichkeit. »Meine Tochter werd’ ich von Ihnen grüßen«, sagte er sogar, und an der Tür, nachdem er ein wenig überlegt hatte: »Kommen Sie doch nächsten Sonntag wieder!«
Diederich war fest entschlossen, das Haus nicht mehr zu betreten. Dennoch ließ er tags darauf alles stehen und liegen, um sich durch die Stadt bis zu einem Geschäft zu fragen, wo er für Agnes das Konzertbillett kaufen konnte. Vorher musste er auf den Zetteln, die dort hingen, den Namen des Virtuosen herausfinden, den Agnes erwähnt hatte. War es der? Hatte er so geklungen? Diederich entschloss sich. Als er dann erfuhr, es koste vier Mark fünfzig, riss er vor Schrecken die Augen weit auf. So viel Geld, um einen zu sehen, der Musik machte! Wenn man nur einfach wieder fortgekonnt hätte! Als er bezahlt hatte und draußen war, entrüstete er sich zunächst über den Schwindel. Dann bedachte er, dass es für Agnes geschehen sei, und ward von sich selbst erschüttert. Immer weicher und glücklicher ging er durch das Gewühl. Es war das erste Geld, das er für einen anderen Menschen ausgegeben hatte.
Er legte das Billett in einen Umschlag, in den er nichts weiter legte, und schrieb die Adresse, um sich nicht zu verraten, mit Schönschrift. Wie er dann am Briefkasten stand, kam Mahlmann daher und lachte höhnisch. Diederich fühlte sich durchschaut; er besah die Hand, die er aus dem Kasten zurückgezogen hatte. Aber Mahlmann bekundete nur die Absicht, sich Diederichs Bude anzusehen. Er fand, es sähe drinnen aus wie bei einer älteren Dame. Sogar die Kaffeekanne hatte Diederich von zu Hause mitgebracht! Diederich schämte sich heiß. Als Mahlmann die Chemiebücher verächtlich auf- und zuklappte, schämte Diederich sich seines Faches. Der Mecklenburger wälzte sich ins Sofa und fragte: »Wie gefällt Ihnen denn die Göppel? Netter Käfer, was? Nun wird er wieder rot! Poussieren Sie doch! Ich trete zurück, wenn Sie Wert darauf legen. Ich habe Aussicht bei fünfzehn verschiedenen.«
Da Diederich nachlässig abwehrte:
»Sie, da ist nämlich was zu machen. Ich müsste gar nichts von Weibern verstehen. Die roten Haare! – und haben Sie nicht gemerkt, wie sie einen ansieht, wenn sie meint, man weiß es nicht?«
»Mich nicht«, sagte Diederich noch geringschätziger. »Ich pfeife auch darauf.«
»Ihr Schade!« Mahlmann lachte tobend – worauf er vorschlug, einen Bummel zu machen. Daraus wurde eine Bierreise. Die ersten Gaslichter sahen sie beide betrunken. Etwas später, in der Leipziger Straße, bekam Diederich ohne Anlass von Mahlmann eine mächtige Ohrfeige. Er sagte: »Au! Das ist aber doch eine –« Vor dem Wort »Frechheit« schrak er zurück. Der Mecklenburger klopfte ihm auf die Schulter. »Recht freundlich, Kleiner! Alles bloß Freundschaft!« – und überdies nahm er Diederich die letzten zehn Mark ab … Vier Tage später fand er ihn schwach vor Hunger und teilte ihm von dem, was er inzwischen anderswo gepumpt hatte, großmütig drei Mark mit. Am Sonntag bei Göppels – mit weniger leerem Magen wäre Diederich vielleicht nicht hingegangen – erzählte Mahlmann, dass Hessling all sein Geld verlumpt habe und sich heute mal satt essen müsse. Herr Göppel und sein Schwager lachten verständnisvoll, aber Diederich hätte lieber nie geboren sein wollen, als von Agnes so traurig prüfend angesehen werden. Sie verachtete ihn! Verzweifelt tröstete er sich: »Es ist alles eins, sie hat es schon immer getan!« Da fragte sie, ob das Konzertbillett vielleicht von ihm gewesen sei. Alle wandten sich ihm zu.
»Unsinn! Wie sollte ich dazu wohl kommen«, entgegnete er so unliebenswürdig, dass sie ihm glaubten. Agnes zögerte ein wenig, bevor sie wegsah. Mahlmann bot den Damen Pralinés an und stellte die übrigen vor Agnes hin. Diederich kümmerte sich nicht um sie. Er aß noch mehr als das vorige Mal. Da doch alle meinten, er sei nur deswegen da! Als es hieß, der Kaffee solle im Grunewald getrunken werden, erfand Diederich sofort eine Verabredung. Er setzte sogar hinzu: »Mit jemand, den ich unmöglich warten lassen kann.« Herr Göppel legte ihm seine gedrungene Hand auf die Schulter, blinzelte ihn aus gesenktem Kopf an und sagte halblaut: »Keine Angst, Sie sind natürlich eingeladen!« Aber Diederich beteuerte entrüstet, dass es nicht daran liege. »Na, wenigstens kommen Sie wieder, sobald Sie Lust haben«, schloss Göppel, und Agnes nickte dazu. Sie schien sogar etwas sagen zu wollen, aber Diederich wartete es nicht ab. Er ging den Rest des Tages in selbstzufriedener Trauer umher, wie nach Vollziehung eines großen Opfers. Am Abend in einem überfüllten Bierlokal saß er, den Kopf aufgestützt, und nickte von Zeit zu Zeit auf sein einsames Glas hinab, als verstehe er jetzt das Schicksal.
Was war zu machen gegen die gewalttätige Art, in der Mahlmann seine Anleihen aufnahm? Am Sonntag hatte dann der Mecklenburger einen Blumenstrauß für Agnes, und Diederich, der mit leeren Händen kam, hätte sagen können: »Der ist eigentlich von mir, Fräulein.« Indessen schwieg er, mit noch mehr Groll gegen Agnes als gegen Mahlmann. Denn Mahlmann forderte zur Bewunderung heraus, wenn er des Nachts einem Unbekannten nachlief, um ihm den Zylinder einzuschlagen – obwohl Diederich keineswegs die Warnung verkannte, die solch ein Vorgang für ihn selbst enthielt.
Ende des Monats, zu seinem Geburtstag, bekam er eine unvorhergesehene Summe, die seine Mutter ihm erspart hatte, und erschien bei Göppels mit einem Bouquet, keinem zu großen, um sich nicht bloßzustellen, und auch, um Mahlmann nicht herauszufordern. Das junge Mädchen hatte, wie sie es nahm, ein ergriffenes Gesicht; und Diederich lächelte herablassend und verlegen zugleich. Dieser Sonntag deuchte ihm unerhört festlich; er war nicht überrascht, als man in den Zoologischen Garten gehen wollte.
Die Gesellschaft rückte aus, nachdem Mahlmann sie abgezählt hatte: elf Personen. Alle Frauen unterwegs waren, wie Göppels Schwestern, vollständig anders angezogen als in der Woche: als seien sie heute von einer höheren Klasse oder hätten geerbt. Die Männer trugen Gehröcke: nur wenige in Verbindung mit schwarzen Hosen, wie Diederich, aber viele mit Strohhüten. Kam man durch eine Seitenstraße, war sie breit, gleichförmig und leer, ohne einen Menschen, ohne einen Pferdeapfel. Einmal doch tanzte ein Kreis kleiner Mädchen in weißen Kleidern, schwarzen Strümpfen und ganz behangen mit Schleifen, schrill singend, einen Ringelreihen. Gleich darauf, in der Verkehrsader, stürmten schwitzende Matronen einen Omnibus; und die Gesichter der Kommis,2 die unnachsichtlich mit ihnen um die Plätze rangen, sahen neben ihren heftig roten zum Umfallen blass aus. Alles drängte vorwärts, alles stürzte einem Ziel zu, wo endlich das Vergnügen anfangen sollte. Alle Mienen sagten hart: »Nu los, gearbeitet haben wir genug!«
Diederich kehrte vor den Damen den Berliner heraus. In der Stadtbahn eroberte er ihnen mehrere Sitze. Einen Herrn, der im Begriff stand, einen wegzunehmen, hinderte er daran, indem er ihn heftig auf den Fuß trat. Der Herr schrie: »Flegel!« Diederich antwortete ihm im selben Sinn. Da zeigte es sich, dass Herr Göppel ihn kannte – und kaum einander vorgestellt, bekundeten Diederich und der andere die ritterlichsten Sitten. Keiner wollte sitzen, um den anderen nicht stehen zu lassen.
Am Tisch im Zoologischen Garten geriet Diederich neben Agnes – warum ging heute alles glücklich? –, und als sie gleich nach dem Kaffee zu den Tieren wollte, unterstützte er sie stürmisch. Er war voll Unternehmungslust. Vor dem engen Gang zwischen den Raubtierkäfigen kehrten die Damen um. Diederich trug Agnes seine Begleitung an. »Da nehmen Sie doch lieber mich mit hinein«, sagte Mahlmann. »Wenn wirklich eine Stange losgehen sollte –«
»Dann machen Sie sie auch nicht wieder fest«, entgegnete Agnes und trat ein, während Mahlmann sein Gelächter aufschlug. Diederich blieb hinter ihr. Ihm war bange: vor den Bestien, die von rechts und links auf ihn zustürzten, ohne anderen Laut als den des Atems, den sie über ihn hinstießen – und vor dem jungen Mädchen, dessen Blumenduft ihm voranzog. Ganz hinten wandte sie sich um und sagte:
»Ich mag das Renommieren nicht!«
»Wirklich?« fragte Diederich, vor Freude gerührt.
»Heute sind Sie mal nett«, sagte Agnes; und er:
»Ich möchte es eigentlich immer sein.«
»Wirklich?« – Und jetzt war es an ihrer Stimme, ein wenig zu schwanken. Sie sahen einander an, jeder mit einer Miene, als verdiente er das alles nicht. Das junge Mädchen sagte klagend:
»Die Tiere riechen aber furchtbar.«
Und sie gingen zurück.
Mahlmann empfing sie. »Ich wollte nur sehen, ob Sie nicht ausreißen würden.« Dann nahm er Diederich beiseite. »Na? Was macht die Kleine? Geht es bei Ihnen auch? Ich hab’ es gleich gesagt, dass es keine Kunst ist.«
Da Diederich stumm blieb:
»Sie sind wohl scharf ins Zeug gegangen? Wissen Sie was? Ich bin nur noch ein Semester in Berlin; dann können Sie mich beerben. Aber so lange warten Sie gefälligst –« Auf seinem ungeheuren Rumpf ward sein kleiner Kopf plötzlich tückisch anzusehen. »– Freundchen!«
Und Diederich war entlassen. Er hatte einen heftigen Schrecken bekommen und wagte sich gar nicht mehr in Agnes’ Nähe. Sie hörte nicht sehr aufmerksam auf Mahlmann, sie rief rückwärts: »Papa! Heute ist es schön, heute geht es mir aber wirklich gut.«
Herr Göppel nahm ihren Arm zwischen seine beiden Hände und tat, als wollte er fest zudrücken, aber er berührte sie kaum. Seine blanken Augen lachten und waren feucht. Als die Familie Abschied genommen hatte, versammelte er seine Tochter und die beiden jungen Leute um sich und erklärte ihnen, der Tag müsse gefeiert werden; sie wollten die Linden entlanggehen und nachher irgendwo essen.
»Papa wird leichtsinnig!« rief Agnes und sah sich nach Diederich um. Aber er hielt die Augen gesenkt. In der Stadtbahn benahm er sich so ungeschickt, dass er weit von den anderen getrennt ward; und im Gedränge der Friedrichstadt blieb er mit Herrn Göppel allein zurück. Plötzlich hielt Göppel an, tastete verstört auf seinem Magen umher und fragte:
»Wo ist meine Uhr?«
Sie war fort mitsamt der Kette. Mahlmann sagte:
»Wie lange sind Sie schon in Berlin, Herr Göppel?«
»Jawohl!« – und Göppel wendete sich an Diederich. »Dreißig Jahre bin ich hier, aber das ist mir denn doch noch nicht passiert.« Und stolz trotz allem: »Sehen Sie, das gibt’s in Netzig überhaupt nicht!«
Nun musste man, statt zu essen, auf das Polizeirevier und ein Verhör bestehen. Und Agnes hustete. Göppel zuckte zusammen. »Wir wären jetzt doch zu müde«, murmelte er. Mit künstlicher Jovialität verabschiedete er Diederich, der Agnes’ Hand übersah und linkisch den Hut zog. Auf einmal, mit überraschender Geschicklichkeit und ehe Mahlmann begriff, was vorging, schwang er sich auf einen vorbeifahrenden Omnibus. Er war entkommen! Und jetzt fingen die Ferien an! Er war alles los! Zu Hause freilich warf er die schwersten seiner Chemiebände mit Krachen auf den Boden. Er hielt sogar schon die Kaffeekanne in der Hand. Aber bei dem Geräusch einer Tür begann er sofort, alles wieder aufzulesen. Dann setzte er sich still in die Sofaecke, stützte den Kopf und weinte. Wäre es nicht vorher so schön gewesen! Er war ihr auf den Leim gegangen. So machten es die Mädchen: dass sie manchmal mit einem so taten, und dabei wollten sie einen nur mit einem Kerl auslachen. Diederich war sich tief bewusst, dass er es mit so einem Kerl nicht aufnehmen könne. Er sah sich neben Mahlmann und würde es nicht begriffen haben, hätte eine sich für ihn entschieden. »Was hab’ ich mir nur eingebildet?« dachte er. »Eine, die sich in mich verliebt, muss wirklich dumm sein.« Er litt große Angst, der Mecklenburger könne kommen und ihn noch ärger bedrohen. »Ich will sie gar nicht mehr. Wäre ich nur schon fort!« Die nächsten Tage saß er in tödlicher Spannung bei verschlossener Tür. Kaum war sein Geld da, reiste er.
Seine Mutter fragte, befremdet und eifersüchtig, was er habe. Nach so kurzer Zeit sei er kein Junge mehr. »Ja, das Berliner Pflaster!«
Diederich griff zu, als sie verlangte, er solle an eine kleine Universität, nicht wieder nach Berlin. Der Vater fand, dass es ein Für und ein Wider gäbe. Diederich musste ihm viel von Göppels berichten. Ob er die Fabrik gesehen habe. Und war er bei den anderen Geschäftsfreunden gewesen? Herr Hessling wünschte, dass Diederich die Ferien benutze, um in der väterlichen Werkstätte den Gang der Papierverfertigung kennenzulernen. »Ich bin nicht mehr der Jüngste, und mein Granatsplitter hat mich auch schon lange nicht so gekitzelt.«
Diederich entwischte, sobald er konnte, um im Wald von Gäbbelchen oder längs des Nuggebaches bei Gohse spazierenzugehen und sich mit der Natur eins zu fühlen. Denn das konnte er jetzt. Zum ersten Mal fiel es ihm auf, dass die Hügel dahinten traurig oder wie eine große Sehnsucht aussahen, und was als Sonne oder Regen vom Himmel fiel, waren Diederichs heiße Liebe und seine Tränen. Denn er weinte viel. Er versuchte sogar zu dichten.
Als er einmal die Löwenapotheke betrat, stand hinter dem Ladentisch sein Schulkamerad Gottlieb Hornung. »Ja, ich spiel’ hier den Sommer über ’n bisschen Apotheker«, erklärte er. Er hatte sich sogar schon aus Versehen vergiftet und sich dabei nach hinten zusammengerollt wie ein Aal. Die ganze Stadt hatte davon gesprochen! Aber zum Herbst ging er nun nach Berlin, um die Sache wissenschaftlich anzufassen. Ob denn in Berlin was los sei. Hocherfreut über den Besitz seiner Überlegenheit fing Diederich an, mit seinen Berliner Erlebnissen zu prahlen. Der Apotheker verhieß: »Wir beide zusammen stellen Berlin auf den Kopf.«
Und Diederich war schwach genug, zuzusagen. Die kleine Universität ward verworfen. Am Ende des Sommers – Hornung hatte noch einige Tage zu praktizieren – kehrte Diederich nach Berlin zurück. Er mied das Zimmer in der Tieckstraße. Vor Mahlmann und den Göppels flüchtete er bis nach Gesundbrunnen hinaus. Dort wartete er auf Hornung. Aber Hornung, der seine Abreise gemeldet hatte, blieb aus; und als er endlich kam, trug er eine grün-gelb-rote Mütze. Er war sofort von einem Kollegen für eine Verbindung gekeilt worden. Auch Diederich sollte ihr beitreten; es waren die Neuteutonen, eine hochfeine Korporation, sagte Hornung; allein sechs Pharmazeuten waren dabei. Diederich verbarg seinen Schrecken unter der Maske der Geringschätzung, aber es half nichts. Er solle Hornung nicht blamieren, der von ihm gesprochen habe; einen Besuch wenigstens müsse er machen.
»Aber nur einen«, sagte er fest.
Der eine dauerte, bis Diederich unter dem Tisch lag und sie ihn fortschafften. Als er ausgeschlafen hatte, holten sie ihn zum Frühschoppen; Diederich war Konkneipant geworden.
Und für diesen Posten fühlte er sich bestimmt. Er sah sich in einen großen Kreis von Menschen versetzt, deren keiner ihm etwas tat oder etwas anderes von ihm verlangte, als dass er trinke. Voll Dankbarkeit und Wohlwollen erhob er gegen jeden, der ihn dazu anregte, sein Glas. Das Trinken und Nichttrinken, das Sitzen, Stehen, Sprechen oder Singen hing meistens nicht von ihm selbst ab. Alles ward laut kommandiert, und wenn man es richtig befolgte, lebte man mit sich und der Welt in Frieden. Als Diederich beim Salamander zum ersten Male nicht nachklappte, lächelte er in die Runde, beinahe verschämt durch die eigene Vollkommenheit!
Und das war noch nichts gegen seine Sicherheit im Gesang! Diederich hatte in der Schule zu den besten Sängern gehört und schon in seinem ersten Liederheft die Seitenzahlen auswendig gewusst, wo jedes Lied zu finden war. Jetzt brauchte er in das Kommersbuch, das auf großen Nägeln in der Lache von Bier lag, nur den Finger zu schieben, und traf vor allen anderen die Nummer, die gesungen werden sollte. Oft hing er den ganzen Abend mit Ehrerbietung am Munde des Präses: ob vielleicht sein Lieblingsstück drankäme. Dann dröhnte er tapfer: »Sie wissen den Teufel, was Freiheit heißt«, hörte neben sich den dicken Delitzsch brummen und fühlte sich wohlig geborgen in dem Halbdunkel des niedrigen altdeutschen Lokals, mit den Mützen an der Wand, angesichts des Kranzes geöffneter Münder, die alle dasselbe tranken und sangen, bei dem Geruch des Bieres und der Körper, die es in der Wärme wieder ausschwitzten. Ihm war, wenn es spät ward, als schwitze er mit ihnen allen aus demselben Körper. Er war untergegangen in der Korporation, die für ihn dachte und wollte. Und er war ein Mann, durfte sich selbst hochachten und hatte eine Ehre, weil er dazugehörte! Ihn herausreißen, ihm einzeln etwas anhaben, das konnte keiner! Mahlmann hätte sich einmal herwagen und es versuchen sollen: zwanzig Mann wären statt Diederichs gegen ihn aufgestanden! Diederich wünschte ihn geradezu herbei, so furchtlos war er. Womöglich sollte er mit Göppel kommen, dann mochten sie sehen, was aus Diederich geworden war, dann war er gerächt!
Gleichwohl gab ihm die meiste Sympathie der Harmloseste von allen ein, sein Nachbar, der dicke Delitzsch. Etwas tief Beruhigendes, Vertrauengestattendes wohnte in dieser glatten, weißen und humorvollen Speckmasse, die unten breit über die Stuhlränder quoll, in mehreren Wülsten die Tischhöhe erreichte und dort, als sei nun das Äußerste getan, aufgestützt blieb, ohne eine andere Bewegung als das Heben und Hinstellen des Bierglases. Delitzsch war, wie niemand sonst, an seinem Platz; wer ihn dasitzen sah, vergaß, dass er ihn je auf den Beinen erblickt hatte. Er war ausschließlich zum Sitzen am Biertisch eingerichtet. Sein Hosenboden, der in jedem anderen Zustand tief und melancholisch herabhing, fand nun seine wahre Gestalt und blähte sich machtvoll. Erst mit Delitzsch’ hinterem Gesicht blühte auch sein vorderes auf. Lebensfreude überglänzte es, und er ward witzig.
Ein Drama entstand, wenn ein junger Fuchs sich den Scherz machte, ihm das Bierglas wegzunehmen. Delitzsch rührte kein Glied, aber seine Miene, die dem geraubten Glase überallhin folgte, enthielt plötzlich den ganzen, stürmisch bewegten Ernst des Daseins, und er rief in sächsischem Schreitenor: »Junge, dass de mir nischt verschüttest! Was entziehst de mir überhaupt mein’ Läbensunterhalt! Das ist ’ne ganz gemeine, böswilliche Existenzschädichung, und ich kann dich glatt verklaachen!«
Dauerte der Spaß zu lange, senkten sich Delitzsch’ weiße Fettwangen, und er bat, er machte sich klein. Sobald er aber das Bier zurück hatte: welche allumfassende Aussöhnung in seinem Lächeln, welche Verklärung! Er sagte: »De bist doch ä gutes Luder, de sollst läm, prost!« – trank aus und klopfte mit dem Deckel nach dem Korpsdiener: »Herr Oberkörper!«
Nach einigen Stunden geschah es wohl, dass sein Stuhl sich mit ihm umdrehte und Delitzsch den Kopf über das Becken der Wasserleitung hielt. Das Wasser plätscherte, Delitzsch gurgelte erstickt, und ein paar andere stürzten, durch seine Laute angeregt, in die Toilette. Noch ein wenig sauer von Gesicht, aber schon mit frischer Schelmerei, rückte Delitzsch an den Tisch zurück.
»Na, nu geht’s ja wieder«, sagte er; und: »Wovon habt ’r denn geredt, während ich anderweitig beschäftigt war? Wisst ihr denn egal nischt wie Weibergeschichten? Was koof’ ich mir für die Weiber?« Immer lauter: »Nich mal ä sauern Schoppen kann ’ch mir dafür koofen. Sie, Herr Oberkörper!«
Diederich gab ihm recht. Er hatte die Weiber kennengelernt, er war mit ihnen fertig. Unvergleichlich idealere Werte enthielt das Bier.
Das Bier! Der Alkohol! Da saß man und konnte immer noch mehr davon haben, das Bier war nicht wie kokette Weiber, sondern treu und gemütlich. Beim Bier brauchte man nicht zu handeln, nichts zu wollen und zu erreichen, wie bei den Weibern. Alles kam von selbst. Man schluckte: und da hatte man es schon zu etwas gebracht, fühlte sich auf die Höhen des Lebens befördert und war ein freier Mann, innerlich frei. Das Lokal hätte von Polizisten umstellt sein dürfen: das Bier, das man schluckte, verwandelte sich in innere Freiheit. Und man hatte sein Examen so gut wie bestanden. Man war »fertig«, war Doktor! Man füllte im bürgerlichen Leben eine Stellung aus, war reich und von Wichtigkeit: Chef einer mächtigen Fabrik von Ansichtskarten oder Toilettenpapier. Was man mit seiner Lebensarbeit schuf, war in tausend Händen. Man breitete sich, vom Biertisch her, über die Welt aus, ahnte große Zusammenhänge, ward eins mit dem Weltgeist. Ja, das Bier erhob einen so sehr über das Selbst, dass man Gott fand!
Gern hätte er es jahrelang so weitergetrieben. Aber die Neuteutonen ließen ihn nicht. Fast vom ersten Tage an hatten sie ihm den moralischen und materiellen Wert einer völligen Zugehörigkeit zur Verbindung geschildert; allmählich aber gingen sie immer unverblümter darauf aus, ihn zu keilen. Vergebens berief sich Diederich auf seine anerkannte Stellung als Konkneipant, in die er sich eingelebt habe und die ihn befriedige. Sie entgegneten, dass der Zweck des studentischen Zusammenschlusses, nämlich die Erziehung zur Mannhaftigkeit und zum Idealismus, durch das Kneipen allein, so viel es auch beitrage, noch nicht ganz erfüllt werde. Diederich zitterte; nur zu gut erkannte er, worauf dieses hinauslief. Er sollte pauken! Schon immer hatte es ihn unheimlich angeweht, wenn sie mit ihren Stöcken in der Luft ihm die Schläge vorgeführt hatten, die sie einander beigebracht haben wollten; oder wenn einer von ihnen eine schwarze Mütze um den Kopf hatte und nach Jodoform roch. Jetzt dachte er gepresst: »Warum bin ich dabeigeblieben und Konkneipant geworden! Nun muss ich ’ran.«
Er musste. Aber gleich die ersten Erfahrungen beruhigten ihn. Er war so sorgsam eingewickelt, behelmt und bebrillt worden, dass ihm unmöglich viel geschehen konnte. Da er keinen Grund hatte, den Kommandos nicht gerade so willig und gelehrig nachzukommen wie in der Kneipe, lernte er fechten, schneller als andere. Beim ersten Durchzieher ward ihm schwach: über die Wange fühlte er es rinnen. Als er dann genäht war, hätte er am liebsten getanzt vor Glück. Er warf es sich vor, dass er diesen gutmütigen Menschen gefährliche Absichten zugetraut hatte. Gerade der, den er am meisten gefürchtet hatte, nahm ihn unter seinen Schutz und ward ihm ein wohlgesinnter Erzieher.
Wiebel war Jurist, was ihm allein schon Diederichs Unterordnung gesichert hätte. Nicht ohne Selbstzerknirschung sah er die englischen Stoffe an, in die Wiebel sich kleidete, und die farbigen Hemden, von denen er immer mehrere abwechselnd trug, bis sie alle in die Wäsche mussten. Das Beklemmendste aber waren Wiebels Manieren. Wenn er mit leichter, eleganter Verbeugung Diederich zutrank, klappte Diederich – und seine Miene war leidend vor Anstrengung – tief zusammen, verschüttete die eine Hälfte und verschluckte sich mit der anderen. Wiebel sprach mit leiser, arroganter Feudalstimme.
»Man kann sagen, was man will«, bemerkte er gern, »Formen sind kein leerer Wahn.«
Für das F in »Formen« machte er seinen Mund zu einem kleinen schwarzen Mausloch und stieß es langsam geschwellt heraus. Diederich unterlag jedes Mal wieder dem Schauer von so viel Vornehmheit. Alles an Wiebel dünkte ihm erlesen: dass die rötlichen Barthaare ganz oben auf der Lippe wuchsen, und seine langen, gekrümmten Nägel – nach unten gekrümmt, nicht, wie bei Diederich, nach oben; der starke männliche Duft, der von Wiebel ausging, auch seine abstehenden Ohren, die die Wirkung des durchgezogenen Scheitels erhöhten, und die katerhaft in Schläfenwulste gebetteten Augen. Diederich hatte das alles immer nur im unbedingten Gefühl des eigenen Unwertes mit angesehen. Seit aber Wiebel ihn anredete und sich sogar zu seinem Gönner machte, war es Diederich, als sei ihm erst jetzt das Recht aufs Dasein bestätigt. Er hatte Lust, dankbar zu wedeln. Sein Herz weitete sich vor glücklicher Bewunderung. Wenn seine Wünsche sich so hoch hinausgewagt hätten, auch er hätte gern solchen roten Hals gehabt und immer geschwitzt. Welch ein Traum, säuseln zu können wie Wiebel!
Und nun durfte Diederich ihm dienen, er war sein Leibfuchs! Stets wohnte er Wiebels Erwachen bei, suchte ihm seine Sachen zusammen – und da Wiebel infolge unregelmäßiger Bezahlung mit der Wirtin schlecht stand, besorgte Diederich ihm den Kaffee und reinigte ihm die Schuhe. Dafür durfte er mitgehen auf allen Wegen. Wenn Wiebel ein Bedürfnis verrichtete, hielt Diederich draußen Wache, und er wünschte sich nur, seinen Schläger dazuhaben, um ihn schultern zu können.