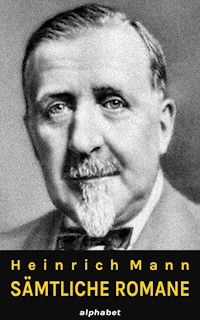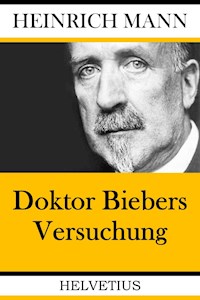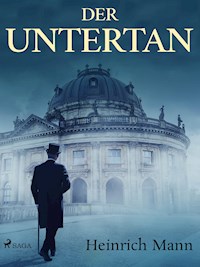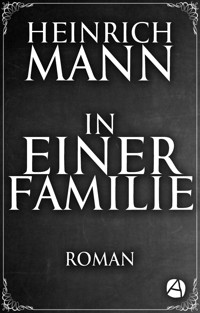Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein dreibändiger Roman über die Erlebnisse der Herzogin von Assy, die wahlweise mit den Göttinnen der römischen Mythologie – Diana, Minerva oder Venus – beschrieben wird: Nachdem sie politisch motivierte Aufstände in ihrer Heimat Dalmatien angezettelt hat, flieht die jung verwitwete Herzogin über das Meer nach Italien. Dort begibt sie sich in viele, auch erotische, Abenteuer, doch ihre Suche nach Freiheit und der Liebe ist nicht immer nur schön – Vergewaltigung und Tod machen auch vor ihr keinen Halt...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1049
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy
Saga
Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1932, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726885460
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Diana
I
Im Juli des Jahres 1876 war die europäische Presse voll von den Reizen und den Taten der Herzogin Violante von Assy. Sie hieß »ein hocharistokratisches Rasseweib mit pikanten Launen im schönen Köpfchen, deren politische Abenteuer die Geschichte verzeichne, ohne sie ernst zu nehmen«.
Es wäre unbillig gewesen, sie ernst zu nehmen, da sie erfolglos verlaufen waren. Ehemals als eine der stolzesten Erscheinungen der internationalen hohen Gesellschaft bekannt, war die Herzogin neuerdings auf den Gedanken verfallen, im Königreiche Dalmatien, ihrem Heimatlande, eine Revolution anzuzetteln. Die Schlußszene dieses romantischen Komplotts, die mißlungene Verhaftung der Herzogin und ihre Flucht, ging durch alle Blätter.
Um Mitternacht, die Stunde der Verschwörer, ist im Palais Assy, an der Piazza della Colonna zu Zara, eine glänzende Gesellschaft versammelt. Das Entscheidende soll geschehen; alle der kühnen Frau Ergebenen treten ihr in letzter Stunde unter die Augen; Würdenträger, die Sitz und Stimme im Rat der neuen Königin erhoffen, zwanzigjährige Leutnants, die um einen Blick aus ihren Augen ihre Laufbahn und ihr Leben wagen. Der Marchese di San Bacco ist herbeigeeilt, der alte Garibaldiner, ohne den in keinem der fünf Weltteile konspiriert werden kann. Auch fehlt nicht das Faktotum der Herzogin, der Baron Christian Rustschuk, mehrfach getauft und obendrein mit dem Freiherrntitel geschmückt.
Sie selbst verzieht noch, alle suchen sie mit den Augen. Man tritt von der Tür in zwei Reihen zurück, die erregten Flüstergespräche schweigen. Da erscheint sie, ein Hochruf will losbrechen. Aber sie steht im – Hemd und lächelt. Man drängt, murmelt, reißt die Augen auf. Die Verwegensten, Unbedingtesten der Getreuen wollen alles übersehen: aber es ist ein Nachthemd, – bis über die Füße wallend und mit Point d'Angleterre reich behangen, aber doch ein Nachthemd.
Plötzlich sinkt es. Ein Herr wehrt erschrocken mit der Hand ab, mehrere Damen kreischen leise. Es gleitet über die Büste zurück: ein Augenblick hoher Spannung, die Herzogin steht in Balltoilette und lächelt. Sie tritt über das Hemd weg, das jemand fortträgt, sie beginnt zu sprechen, es ist nichts geschehen.
Ein Brief wird ihr gebracht. Sie liest ihn und wirft ihn, mit dem Fuß stampfend, den Nächsten zu. Ihr Intimer, der temperamentvolle Volkstribun Pavic oder Pavese schreibt ihr, es sei alles verloren und schleunige Flucht geboten. Er erwarte sie am Hafen.
Sie zieht sich zurück. Ein Offizier, den Helm auf dem Kopf, betritt den Saal: »Im Namen des Königs.« Er sieht sich um, er wird mit Fragen umringt, er weist den Haftbefehl vor. Gegenüber steckt die Herzogin, im Nachthemd, den Kopf zur Tür herein. Der Oberst erschrickt und salutiert. »Ich bin nicht wohl«, sagt sie, »ich habe mich zurückgezogen. Wollen Sie mir erlauben, mich anzukleiden? Eine halbe Stunde?« Gleich darauf drängen aus allen Gemächern die Gäste ins Treppenhaus. Eine Dame in gelber Atlasrobe, den Spitzenschleier übers Gesicht gezogen, bricht draußen in Lachen aus. Ein Haufe von Herren umsteht sie eng bei jedem ihrer Schritte. Sie wird in einen Wagen gehoben. Wie die Pferde schon anziehen, winkt sie aus dem Fenster dem keuchenden Rustschuk zu: »Adieu, Hausjud!« – und fährt im Galopp davon.
Schloß Assy, wo sie groß ward, stand einen Büchsenschuß vor der Küste im Meer, auf zwei durch einen schmalen Kanal getrennten Scoglien. Aus diesen Riffen schien es erwachsen, grau und zackig wie sie. Kein Vorbeifahrender sah, wo Fels und Mauerwerk sich schieden. Aber an den düster gehäuften Steinmassen entlang schwebte etwas Weißes: eine kleine weiße Gestalt schmiegte sich an den vordersten der vier eckigen Türme. Sie bewegte sich über einer Galerie spitzer Klippen zierlich und sicher auf dem schmalen Steig zwischen der Mauer und dem Abgrund. Die Schiffer kannten sie, und auch das Kind erkannte jeden in der Weite, an seiner Tracht, am Anstrich und Segelwerk seiner Barke. Der Mann im Turban, der über seinen schwarzen Bart strich, während er sich fernher verneigte, sie erwartete ihn seit acht Tagen: er kam jeden dritten Monat daher, sein Boot tanzte, es trug nur Schwämme. Jener mit Faltenhose und roter Zipfelmütze hatte ein gelbes Segel mit drei Flicken. Aber der dort zog, wie er näher trieb, den braunen Mantel bis über den Kopfbund hinaus: er hielt das Weiße da oben für die Mora, die Hexe, die an den Scoglien in Höhlen wohnte und Schuhe aus Menschenadern trug. Der Teufel flog, anzusehen wie ein Schmetterling, aus ihr heraus und fraß Herzen aus Brüsten. Durch die Vertraulichkeit einer Kammerfrau hatte Violante von dieser Sage erfahren; sie lächelte erstaunt, sooft ein unverständliches Wesen ihr begegnete, das daran glaubte. Und indes der Scirocco mit Toben die Wogen bis zu ihrem verwitterten, durchnäßten Bollwerk hinauf und ihr vor die Füße peitschte, träumte das Kind in unsicheren Bildern voller Fragen von den fernen fremden Schicksalen der Schatten, die hinter einem Schleier von Gischt, still und zögernd, an ihr vorüberglitten.
Zuweilen überraschte ihren einsamen Kindersinn eine Herrinnenlaune: sie befahl ihr Gesinde in den Wappensaal. Er ruhte, ungeheuer lang, mit zertretenen Fliesen und brauner Balkendecke, die sich senkte, über der Tiefe zwischen den beiden Felsriffen, die das Schloß trugen. Unter den Füßen fühlte man das Meer sich wälzen; das Meer schien, stahlgrau in schwüler Nebelsonne, an drei Seiten zu neun Fenstern herein. Auf der vierten Seite sanken die gewirkten Stoffe von der Mauer, die Türen knarrten im Zugwind, über ihren Simsen hingen schief und geborsten die Wappenschilde: ein weißer Greif vor einem halboffenen Tor, in schwarzblauem Felde. Jemand räusperte sich, dann verstummten alle. Vor dem spitz bedachten Kamin stand der Schloßvogt, ein Buckliger, der mit großen Schlüsseln klapperte und den wichtigsten, den Schlüssel zum Brunnen, auch im Schlaf nicht losließ. Drüben ängstigte ein winziger Gänsejunge sich vor dem starren Holzbild des Herrn Guy von Assy, vor dem braunen Rot hoch oben auf seinen entfleischten Wangen und vor dem eisernen Blick unter seinem schwarzen Helm. Wie ein weißer Turm reckte sich in der Mitte der riesige Koch. Die Schaffnerin mit Flügelhaube und Spitzbauch lugte hinter ihm heraus, und links und rechts entwickelte sich die bunt geordnete Reihe der Zofen, Lakaien, Küchenmägde und Viehdirnen, der Knechte, Wäscherinnen und Gondolieri. Violante raffte ihr langes Seidenkleidchen zusammen, die Schnur kleiner Türkise klimperte in der Stille auf ihren schwarzen Locken; und sie ging mit anmutigen festen Schritten über den wankenden Boden, an wackelnden Weiblein und geblähten Tressendienern vorbei, die ehrerbietige und groteske Flucht des Hofstaates entlang, der nur für sie arbeitete und nur vor ihr zitterte. Sie tippte dem Koch mit dem Fächer auf den Wanst und belobte ihn für seine mit Marzipan gefüllten Pfirsiche. Sie fragte einen Lakaien, was er eigentlich tue, sie sehe ihn nie. Zu einem Mädchen sagte sie gnädig: »Du bist eine gute Dienerin«, – ohne daß jene wußte warum.
Das Meer ward still; dann ließ sie sich nach dem Festlande übersetzen. Ein Stück Pinienwald, unter dem Schutze des Schlosses stehengeblieben, führte zu bebuschten Hügeln; sie umschlossen einen kleinen See. Platanen und Pappeln krönten ihn spärlich, seltene Weiden neigten sich hinein, doch wanderte das Kind wie im dichten Walde unter den Sträuchern, unter Wacholder mit großen Beeren und Erdbeerbäumen voll hellroter, klebriger Früchte. Von einer leeren Wiese fielen fette gelbe Widerscheine auf den stillen Spiegel. In der feuchten Tiefe erstarb das Himmelsblau. Dicht beim Ufer türmten sich im grünen Wasser große grüne Steine, und Silberfische schwammen umher in diesen schweigsamen Palästen. Über einen steinernen Brückenbogen ging es zu einer schmalen Insel, darauf erhob sich das weiße Gartenhaus im Schmuck seiner Rosetten und flachen Pilaster von buntem Marmor. Drinnen barsten die schlanken Säulchen, die rosigen Muscheln füllte Staub, die Trumeaus erblindeten unter ihren Kränzen aus Porzellan.
Ein lautes Krachen kam aus der Ecke, wo die Bergère von Rosenholz stand. Das Kind erschrak nicht, es lehnte an Sommermittagen den Kopf ins Kissen und erwiderte das Lächeln zweier heiterer Bildnisse. Die Dame hatte eine milchweiße Haut, verblichen violette Bänder lagen in der weichen Senkung zwischen Schulter und Brust und im graublonden Haar, eine schwarze Fliege hatte sich schelmisch in den Winkel ihres blassen Mündchens gesetzt. Ihr koketter, zärtlicher Hals wendete sich nach dem seidenen rosigen Kavalier, der jene Dame hier so liebgehabt haben sollte. Er war gepudert, auf der geschürzten Lippe saß ihm ein dunkles Bärtchen. Violante wußte viel von ihm: es war Pierluigi von Assy. In Turin, Warschau, Wien und Neapel hatte er Allianzen ertändelt und Höfe entzweit. Die Königin von Polen war ihm hold, er brachte ihretwegen fünf Schlachtschitzen um und ward halbtot gestochen. Wo er vorbeikam, da klingelte Gold in hellen Haufen. War es zu Ende, so verstand er neues zu machen. Sein Leben war voll von Flitter, Intrigen, Duellen und verliebten Frauen. Er diente der Republik Venedig; sie ernannte ihn zu ihrem Proveditor für Dalmatien, und er regierte das Land wie die glückliche Cythere: unter Rosengewinden, mit erhobenem Kelchglas, und den Arm um jene milchweiße Schulter. Er starb unter Scherzen, höflich, nachsichtig mit den Sünden der andern und zur Reue über die eigenen nicht geneigt.
Auch Sansone von Assy stand in Diensten der Republik, als ihr General. Für eine kunstreich gegossene Kanone mit zwei Löwen darauf verkaufte er die Stadt Bergamo dem König von Frankreich. Dann eroberte er sie zurück, weil er auch den Gießer haben wollte, der drinnen saß. Aber die Erstürmung kostete ihn zu viele von seinen teuer bezahlten, reich und schön gerüsteten Soldaten; im Zorn ließ er die Kanone einschmelzen und den Künstler aufhängen. Eine goldene Pallas Athene stand auf seinem Helm, aus seinem Brustpanzer sprang gräßlich schreiend ein Medusenhaupt. Sein Leben war erfüllt von purpurnen Zelten auf verbrannten Feldern, den Fackelzügen nackter Knaben und Marmorbildern, besprengt mit Blut. Er starb stehend, eine Kugel in der Seite und auf den Lippen einen horazischen Vers.
Guy und Gautier von Assy verließen die Normandie, sie zogen aus zur Eroberung des Heiligen Grabes. Durch ihr Leben wälzten sich Massen zerstückelter Leiber, verzerrter Häupter in Turbanen, bleicher Frauen mit flehend emporgehaltenen Säuglingen, in weißen Städten, die schaudernd hinabblickten auf blutgerötete Meere. Ihre Seele atmete in lichten Wolken, ihre eisernen Füße traten auf menschliche Gedärme. Sie sahen brünstige Sultaninnen sich winden und dachten an ein keusches Kind mit fest geschlossenem Munde, das zu Hause wartete. Auf dem Heimwege, prunkend mit den Fürstentiteln von Fabelreichen, und ohne einen Heller und mit ausgezehrten Gliedern, erfuhren sie, daß es dasselbe Kind war, an das sie beide dachten. Darum erschlug Guy seinen Bruder Gautier. Er baute auf den Riffen im Meer sein Schloß und starb als Pirat angesichts einer Übermacht krummer Säbel, die ihn nicht erreichten; denn sein Schiff brannte.
Aus dem tiefsten Dunkel der Zeiten schien geisterweiß bis in die Träumerei der kleinen Violante hinein eine Halbgottmaske: das steinerne Antlitz ihres ersten Ahnen, jenes Björn Jernside, der von Norden kam. Kräftige Tränke, die seine Mutter ihm eingab, machten aus ihm einen Bären mit eiserner Seite, der in Frankreich den Seinigen Land nahm und an Spaniens und Italiens Küsten den Christen und den Muselmännern das Andenken einbrannte an heidnische Riesen voll Tücke und mit schicksalsschweren Händen. Er ankerte im Ligurischen Meer vor einer Stadt, die ihm stark schien. Deshalb schickte er Boten hinein an Graf und Bischof: er sei ihr Freund, er wolle sich taufen lassen und im Dom begraben werden, denn er liege todkrank. Die dummen Christen tauften ihn. Der Trauerzug der Seinigen trug den Toten zur Kathedrale. Da sprang er aus dem Sarge, aus den Mänteln flogen Schwerter, es begann ein fröhliches Gemetzel unter den entsetzten Christenlämmern. Aber als Björn der Herr war, sagte man ihm zu seinem Schmerz, daß es nicht Rom sei, das er unterworfen habe. Er hatte Rom erobern und sich krönen lassen wollen zum Herrscher aller Welt. Nun zerstörte seine enttäuschte Sehnsucht die arme Stadt Luna so furchtbar, wie er Rom zerstört haben würde, wenn er es gefunden hätte. Er suchte es lange. Und er starb, niemand wußte wie und wo: unter zufälligen Rächerhieben, während einer Kirchenschändung oder beim Plündern eines Hühnerhofs, vielleicht im Straßengraben, und vielleicht entrückt und unsichtbar emporgehoben zu den Asen, den heiligen Vätern der Assy.
So wie diese fünf waren alle Assy über die Erde geschritten. Sie alle waren Menschen der Entzweiung, der Schwärmerei, des Raubes und der heißen, plötzlichen Liebe. Ihre festen Burgen standen in Frankreich, in Italien, auf Sizilien und in Dalmatien. Überall empfanden die Schwachen, das weiche und feige Volk, ihre lachende Grausamkeit und ihre harte, fremde Verachtung. Unter ihresgleichen bewährten sie sich opfermütig, ehrfürchtig, zartsinnig und dankbar. Sie waren unbedenkliche Abenteurer wie der Libertin Pierluigi, stolz und dürstend nach Größe gleich Simson dem Condottiere, blutbefleckte Halluzinierte wie Guy und Gautier die Kreuzfahrer, und wie der Heide Björn Jernside so frei und unverwundbar.
Dem Heere von Männern und Frauen, die in tausend Jahren den Namen Assy getragen hatten, folgten nur noch drei Nachzügler, der Herzog und sein jüngerer Bruder, der Graf, mit einem Töchterchen, Violante. Das Kind wußte von seinem Vater nichts weiter, als daß er irgendwo in der Welt lebe. Der arme Graf war ein Verschwender, er vergeudete die Reste seines Vermögens ganz ohne Rücksicht auf die Zukunft des jungen Mädchens. Er ließ sie an seiner Verschwendung teilnehmen, er ließ das einsame Kind im schrankenlosen Luxus eines fürstlichen Haushaltes aufwachsen: das beschwichtigte sein Gewissen. Übrigens baute er auf den Familiensinn des unverheirateten Herzogs.
Violante sah den Vater nur einmal im Jahr. Ihre Mutter hatte sie nie gekannt, doch brachte er immer eine Mama mit, jedesmal eine andere. Im Laufe der Zeit zogen blonde und braune Mamas an dem Kinde vorüber, magere und sehr dicke; Mamas, die sie zwei Sekunden lang durch ein Lorgnon betrachteten und weitergingen, und andere Mamas, die anfangs beinahe schüchtern schienen und am Ende ihres Aufenthaltes fast zu Spielgefährtinnen geworden waren.
Das Kind gewöhnte sich, den Mamas mit leisem Spott zu begegnen. Warum führte der Papa sie her? Sie überlegte:
›Zur Schwester möchte ich keine von ihnen.
Aber auch nicht als Kammerfrau‹, setzte sie hinzu.
Mit dreizehn Jahren erkundigte sie sich: »Papa, warum bringst du immer nur eine mit?«
Der Graf lachte; er fragte:
»Weißt du noch, die bunten Scheiben?«
Die Mama des vorigen Sommers hatte die Sucht gehabt, überall farbige Gläser einsetzen zu lassen. Sie mußte das Meer rosig sehen und den Himmel gelb.
»Es war eine gute Person«, sagte Violante.
Plötzlich reckte sie sich stocksteif, tat ein paar vor Vornehmheit behinderte Schritte und führte mit lächerlich gespreizten Fingern das Spitzentuch an den Mund.
»Das war vor drei Jahren. Die Feine, weißt du.«
Graf Assy krümmte sich. Er machte sich, zusammen mit seinem Kinde, über die Mamas lustig, doch immer nur über die der vergangenen Jahre, niemals über die gegenwärtige. Er versäumte nie, nachzuforschen, ob die Kleine mit ihren Dienern zufrieden sei.
»Das Schlimmste«, so betonte er, »wäre, wenn einer es an Ehrerbietung gegen dich fehlen ließe. Ich würde ihn schwer bestrafen.«
Er zog ernsthaft die Brauen empor.
»Nötigenfalls würde ich ihm den Kopf abschlagen lassen.«
Es war seine Absicht, dem Kinde eine möglichst hohe Achtung vor der eigenen Person beizubringen, und es gelang ihm. Violante verachtete nicht einmal; es kam ihr niemals der Gedanke, daß außer ihr etwas Nennenswertes vorhanden sein könne. Welchem Lande gehörte sie an? Welchem Volke? Welchem Stande? Wo war ihre Familie? Wo ihre Liebe und wo ein mitschlagendes Herz? Auf keine dieser Fragen hätte sie eine Antwort gewußt. Ihre natürlichste Überzeugung war, daß sie einzig, dem Rest der Menschheit unzugänglich, und unfähig sich ihm zu nähern sei. Draußen sollten die Türken gehaust haben. Auch gab es keine Assy mehr. Es lohnte sich nicht der Mühe, hinauszulugen zwischen den Gitterstäben des verschlossenen Gartens, worin sie weilte. In ihrem Kinderhirn herrschte eine verständige Resignation. Allem Geheimnisvollen, allem, was sich versteckte, brachte sie eine gleichmütige Ironie entgegen: den Mamas von unbekannter Herkunft und Daseinsberechtigung und auch demjenigen, den ihre Gouvernante den lieben Gott nannte. Die Gouvernante war eine flüchtige Deutsche, die lieber mit einem schönen Lakaien aus dem Hause lief, als daß sie lässig von biblischen Geschichten erzählte. Violante suchte den alten Franzosen auf, der in einem Turmzimmer unter Büchern saß. Er trug die Haube des Alten von Ferney, einen bunten Schlafrock, voll von Schnupftabak, und machte den Essai sur les Mœurs zur Grundlage von Violantes Weltanschauung.
»Die christliche Religion ist zweifellos göttlich, da trotz allen Unsinns, den sie enthält, so viele an sie geglaubt haben«, so lautete die Apologie des Christentums durch Monsieur Henry. Über wichtige Fragen, wie die Auferstehung, äußert? er sich nur indirekt, mit boshafter Hinterhältigkeit.
»Der Heilige Geist«, sagte er, »läßt sich, um überflüssige Worte zu sparen, zuweilen herbei, die Vorurteile des Volkes gutzuheißen. Der Heiland selbst bemerkt, daß das Korn in der Erde verwesen muß, damit es reif werden kann, und Sankt Paulus schreibt an die Korinther: ›Ihr Unverständigen, wißt ihr nicht, daß das Korn sterben muß, um wieder lebendig zu werden?‹ Heute weiß man wohl, daß das Korn in der Erde weder verwest noch stirbt, um darauf wieder aufzustehen; wenn es verwesen würde, stände es sicher nicht wieder auf ...«
Nach diesen Worten machte Monsieur Henry eine Pause, kniff die Lippen zusammen und sah seine Schülerin scharf an.
»Aber damals«, so setzte er mit sachlicher Ruhe hinzu, »befand man sich in diesem Irrtum.«
In solchen Gesprächen bildeten sich Violantes religiöse Meinungen.
»Das Land ist von den Türken verwüstet?« fragte sie.
»Das sagt das Volk. Man findet diese irrige Meinung in sogenannten Volksliedern ausgesprochen, einfältigen Machwerken ganz ohne Kunst ... Wollen Sie wissen, wer es verwüstet hat? Dummheit, Aberglaube und Trägheit, die geistigen Türken und unerbittlichen Feinde des menschlichen Fortschritts.«
»Aber als Pierluigi von Assy Proveditor für Dalmatien war, da haben die Dinge sicher anders gestanden. Und die Republik Venedig, die ist nun auch verschwunden? Wer hat sie vernichtet?«
Der alte Franzose wies mit dem Finger auf seine Brust:
»Wir.«
»Ah!«
Sie wandte ihm die Schulter zu.
»Da haben Sie etwas sehr Überflüssiges getan ... Waren Sie übrigens selbst dabei, Monsieur Henry?«
»Vor achtundsechzig Jahren. Ich war damals ein fester Kerl.«
»Das glaube ich Ihnen nicht.«
»Sie sollen es auch nicht glauben. Von allem, was man Ihnen sagt, sollen Sie höchstens die Hälfte glauben, und die nur bis auf weiteres.«
Violantes Auffassung des Weltlaufs ergänzte sich mit Hilfe dieser Lehren.
Alle Kenntnisse wurden, kaum daß sie ihr vorgelegt waren, schon wieder in Frage gestellt. Sie fand es ganz natürlich, an keine Tatsachen zu glauben; sie glaubte nur an Träume. Wenn sie an den blauen Tagen nach ihrem Garten übersetzte, so fuhr die Sonne mit ihr, als ein goldener Reiter. Er saß auf einem Delphin, der trug ihn von einer Welle zur andern. Und er landete mit ihr, und sie spielte mit ihrem Freunde. Sie haschten sich. Er erkletterte einen Maulbeerbaum oder eine Fichte; seine Tritte hinterließen lauter gelbe Spuren. Dann ward aus ihm ein Hirte, er hieß Daphnis. Sie selber war Chloe. Sie wand einen Kranz von Veilchen und krönte ihn damit. Er war nackt. Er spielte Flöte um die Wette mit den Pinien, die der Wind erklingen ließ. Sie sang, süßer schallend als die Nachtigall. Sie badeten zusammen in dem Bach, der die Wiese hinabrann, zwischen Säumen von Narzissen und Margeriten. Sie küßten die Blumen, wie die Bienen es taten, die summten im warmen Grase. Sie sahen auf dem Hügel die Lämmer springen und sprangen ebenso. Beide waren sie berauscht vom Frühling, Violante und ihr heller Gefährte.
Schließlich nahm er Abschied. Seine Fußtapfen lagen nur noch als flüchtiges Gold in den Wegen; gleich zerrann es. Sie rief noch: »Auf Morgen!« Von Pierluigis Pavillon her antwortete es, mit verhallendem Lachen: »Auf Morgen!« ... Nun war er fort. Sie streckte sich, müde und stillen Sinnes, unter dem Hange in den Ginster und schaute hinab auf ihren See. Eine Libelle mit breitem behaartem Rücken stand bläulich vor ihr in der Luft. Die gelben Blüten verneigten sich. Sie wandte sich um; auf einem Stein saß eine Eidechse und sah sie mit spitzen Äuglein an. Das Kind legte den Kopf auf die Arme, und lange belauschten sie einander in Freundschaft, die letzte, zerbrechliche Tochter sagenhafter Riesenkönige und der urweltlichen Ungeheuer schwache kleine Verwandte.
II
An einem Sommertage ihres fünfzehnten Jahres sprang sie einmal, noch verschlafen, ans Fenster von Pierluigis Lusthäuschen. Sie hatte im Traum ein scheußliches Kreischen gehört, wie von einem großen, häßlichen Vogel. Der Lärm entsetzte sie noch im Wachen. Da lag im See, in ihrem armen See, ein riesiges Weibsbild. Ihre Brüste schwammen auf dem Wasser als ungeheure Fettberge, sie reckte Beine wie Säulen in die Luft, peitschte Schaum mit wuchtigen Armen und schrie dazu aus weit und schwarz nach oben gerichtetem Munde. Am Ufer trieb geknicktes Schilf, die grünen Paläste, in denen die Fische wohnten, waren zertrümmert; ihre Bewohner huschten angstvoll umher, die Libellen waren entflohen. Das Weib hatte Verwüstung und Schrecken bis in die getrübte Tiefe getragen.
Violante rief mit Tränen in der Stimme:
»Wer hat Ihnen denn erlaubt, meinen See zu beschmutzen! Wie sind Sie widerwärtig!«
Am Ufer lachte jemand, sie bemerkte ihren Vater.
»Fahr nur fort«, sagte er, »sie versteht kein Französisch.«
»Wie sind Sie widerwärtig!«
»Italienisch und Deutsch versteht die Mama auch nicht.«
»Es ist gewiß eine Wilde.«
»Sei artig und begrüße deinen Vater.«
Das junge Mädchen gehorchte.
»Die Mama wünschte zu baden«, erklärte Graf Assy, »sie ist ungemein sauberkeitsliebend, es ist eine Holländerin. Ich komme nämlich aus Holland, meine Liebe, und wenn du deinen Vater gut behandelst, nimmt er dich einmal mit dorthin.«
Sie widersetzte sich entrüstet:
»In ein Land, wo es solche ... solche ... Damen gibt? Niemals!«
»Bestimmt?«
Er nahm freundschaftlich ihren Arm. Die Holländerin war ans Ufer gestiegen, sie hatte sich notdürftig bekleidet und kam herbei, schnaufend, mit wogendem Busen und zärtlicher Miene.
»O das süße Kind!« rief sie. »Darf ich sie küssen?«
Violante ahnte, was jene vorhatte. Ein jäher Ekel beraubte sie des Atems; sie riß sich los, mit wahrer Kinderangst rannte sie und rannte. »Was hat die Kleine?« fragte ganz erschrocken die Fremde. »Schämt sie sich?«
Violante schämte sich nicht. Das Erscheinen eines nackten Frauenzimmers an der Seite ihres Vaters berührte gar nicht ihre Würde. Aber die Plumpheit, die unschöne Masse dieses Weibskörpers empörte ihre Mädchennerven zu einem Stolz, den zu bezwingen ein ganzes Leben sich verschwören mochte: es hätte sich umsonst verschworen.
»Wie darf sie es wagen, sich mir zu zeigen!« stöhnte sie, eingeschlossen in ihrem Zimmer. Sie verließ es erst nach Graf Assys Abreise, und den See mied sie; er war entweiht und für sie verloren. Sie versuchte in Gedanken einem Schmetterlinge zu folgen auf seinem Fluge über die leise Fläche und das Himmelsblau hinabtauchen zu sehen in die gläserne Tiefe, – da plumpste etwas Grobes, Rötlichweißes hinein: zerpeitscht war die gespiegelte Bläue und der Falter entflattert.
Sie grämte sich in tiefer Stille und blieb standhaft, ein halbes Jahr lang. Dann beruhigte sie sich; die lieben Plätze ihres Kinderlebens gingen nur noch durch ihre Träume. Eines Nachts stand Pierluigi von Assy mit seiner Geliebten vor ihrem Bett. Die Dame verzog schelmisch den Mund, die schwarze Fliege hüpfte in eine weiße Grube. Er bat Violante mit zierlicher Verbeugung, mit ihnen zu kommen. Sie erwachte; neben dem weißen Mondlicht lagen blaue Schatten, im Nebenzimmer stand das Bett der Gouvernante leer. Lächelnd schlief sie wieder ein.
Am nächsten Tage trat ein Herr in ihr Zimmer.
»Papa?«
Sie war fast erschrocken, sie hatte ihn erst in Monaten erwartet.
»Es ist nicht Ihr Papa, liebe Violante, es ist Ihr Onkel.«
»Und der Papa?«
»Dem Papa ist leider ein Unglück zugestoßen – oh, ein leichtes.«
Sie sah nur erwartungsvoll aus, nicht ängstlich.
»Er schickt mich zu Ihnen. Er hat mich schon längst gebeten, mich Ihrer anzunehmen, falls er einmal nicht mehr dazu imstande sein sollte.«
»Nicht mehr imstande?« wiederholte sie traurig, ohne Erregung.
»Ist er –«
»Abberufen.«
»Tot.«
Sie senkte den Kopf, sie dachte an das letzte unerfreuliche Zusammentreffen. Sie bekundete keinen Schmerz.
Der Herzog küßte ihr die Hand, er sprach ihr zu und betrachtete sie dabei. Sie war schlank, feingliedrig und voll Spannkraft, mit den schweren, schwarzen Haaren des Südens, in dem ihr Geschlecht gewachsen war, und Augen blaugrau wie das nordische Meer ihres Ahnherrn. Der alte Kenner überlegte: ›Sie ist eine Assy. Sie hat noch etwas von der kalten Kraft, die wir hatten, und Siziliens entnervtes Feuer, das wir auch hatten.‹
Er war trotz seines hohen Alters noch ein sehr achtbarer Reiter, verbarg es aber, sooft er mit dem ungeschulten jungen Mädchen ausritt, nach Kräften. Sie jagten den Strand entlang hintereinander her, auf dem harten Sande und im Wasser. Muscheln und Fetzen von Seesternen spritzten von den Hufen.
»Ich bin ein recht ausgelassener Kamerad«, seufzte der Herzog für sich. »Aber es heißt die Hundekapriolen mitmachen. Stolzer Tritt, Passagieren oder Redopp würde die Kleine nötigen, zu mir und meiner Kunst emporzublicken. Und gegen das Emporblicken hat sie, glaube ich, von Hause aus eine Abneigung.«
Nur als einmal ihr Hut ins Meer wehte, und Violante kommandierte: »Hinein!« – Da widersetzte er sich.
»Ein Schnupfen ... in meinen Jahren ...«
Sie sprengte hinein, sie saß auf dem Rücken des schwimmenden Pferdes zusammengekrümmt wie ein Äffchen. Bei der Rückkehr zeigte sie ihre nasse Schleppe vor.
»Das ist alles. Warum haben denn Sie das nicht fertiggebracht?«
»Weil ich Ihnen bei weitem nicht gewachsen bin, liebe Kleine.«
Sie lachte glücklich.
Er ließ die Zeit verstreichen, bis es ihm schien, daß das Leben zu zweien ihr zur Gewohnheit geworden sei. Da sagte er:
»Wissen Sie, daß ich fünf Wochen hier bin? Ich muß einmal wieder nach meinen Freunden sehen.«
»Wo denn?«
»In Paris, in Wien, überall.«
»Ah!«
»Bedauern Sie es, Violante?«
»Nun –«
»Sie können ja mitkommen, wenn Sie Lust haben.«
›Habe ich Lust?‹ fragte sie sich.
»Wenn der See noch wäre wie früher, hätte ich gar keinen Grund, fortzugehen; aber so ...«
Sie dachte an Pierluigis nächtlichen Besuch, seine einladende Verbeugung und das liebliche Lächeln der Dame.
»Muß ich euch nun ganz verlassen?« meinte sie im stillen, tiefernst geworden.
»Als meine Frau?« setzte der Herzog ruhig hinzu.
»Als Ihre ... Warum denn?«
»Weil es das einfachste ist.«
»Nun, dann ...«
Unvermittelt fing sie zu lachen an. Die Werbung war genehmigt.
Den Winter des Trauerjahres verbrachten sie in Cannes, streng zurückgezogen in eine Villa, die, hinter Lorbeermauern und dichten Rosenhecken hervorscheinend, in dem Vorübergehenden Ahnungen erregte von versunkenen Innigkeiten. Die Herzogin langweilte sich und schrieb Briefe an Monsieur Henry.
Sie reisten im Sommer durch Deutschland und trafen Ende September in Biarritz des Herzogs Pariser Freunde. Bei ihrer Ankunft in Paris stand Violante bereits in einem engen Verhältnis zur Fürstin Urussow und zur Gräfin Pourtalès. Pauline Metternich, der sie eine kleine Schwester ward, vermittelte ihre Bekanntschaft mit Wien. Es war das Jahr 1867. Für einige aus dieser Gesellschaft ging eine gerade Lustallee von Paris nach Wien. Was links und rechts dazwischenlag, waren Dörfer, gerade gut genug, die Pferde zu wechseln. Denn man verschmähte eine volkstümliche Beförderungsart; der Graf d'Osmond und die Herzogin von Assy mit ihrem Gemahl trafen in zwei Viererzügen aus Paris ein und fuhren ins Hotel Erzherzog Karl. Violante folgte einer Einladung der Gräfin Clam-Gallas in ihre Hofburgloge; sie bestieg in Paris ihren Wagen, um durch das Wiener Fernrohr der Astronomin Therese Herberstein zu sehen.
Die Leichtigkeit ihres Wesens, die Abwesenheit gemeiner Eitelkeiten in ihrem ungesuchten Hochmut erregten Begeisterung; sie entzückten vor allem den Herzog. Er war Sechsundsechzig, und seit sechs Jahren betrachtete er, seiner Gesundheit zuliebe, die Frauen nur noch als glänzende und verwickelte Dekorationsstücke. Nun sah er, näher als andere, dem schönen, freien Geschöpfe zu, dem in einem Dunstkreis von Begierden, dunklen Nachträgereien, ängstlichen Gespinsten und geheimen Lüsten alles klar und lichtvoll blieb, das nirgends Tiefen und Nöte ahnte. Es beglückte ihn eigenartig, wie sie durch das überanstrengte Gewühl der legitimierten Glücksritter und der in schwierigen Genüssen Altgewordenen mit harmlosen, sicheren Kinderschritten dahinging. Sie aufzuwecken erschien der welken Feinheit des Kreises wie ein törichtes Verbrechen. Übrigens sagte er sich, daß er ein Narr wäre, sie in Freuden einzuführen, deren Fortsetzung sie notwendig bei andern suchen müßte.
Er führte sie nicht ein. Man erzählte ihr, daß die Marquise de Châtigny von ihrem Mann keine Kinder zu erwarten habe.
»Woher weiß man das?« fragte Violante.
»Von Mademoiselle Zozie.«
»Ah, der von der Oper?«
»Ja.«
Sie wollte weiterfragen, woher denn Mademoiselle Zozie das wissen könne, doch fühlte sie, daß diese Frage nicht zu denen gehöre, die man äußern dürfe.
Die schlanke Gräfin d'Aulnaie erschien eines Abends auf der österreichischen Botschaft mit einem ungeheuren Bauch; es handelte sich um einen vereinzelten Versuch, die Mode der andern Umstände, wie sie in den fünfziger Jahren bestanden hatte, wieder einzuführen. Die Herzogin belustigte sich sehr; dann folgten einige nachdenkliche Tage, nach deren Verlauf sie dem Herzog erklärte, daß sie sich Mutter glaube. Er schien heiter überrascht und ließ den Doktor Barbasson rufen. Der Arzt untersuchte sie mit der zarten Hand, die aus Klientinnen Geliebte machte. Sie blickte gespannt auf: er hatte sein Lächeln rechtzeitig unterdrückt und erklärte, daß hier nichts zu fürchten und nichts zu hoffen sei.
Sie ritt im Prater und im Bois mit immer neuen Anbetern spazieren, und ohne von den Endzwecken der Anbetung etwas zu wissen, erhielt sie, mit der Geschicklichkeit einer Nachtwandlerin, alle in Atem. Der Conte Paul Papini bekam ihretwegen eine Kugel vom Baron Leopold Tauna, und er lag noch im Sterben, als Raffael Rigaud sich vor ihrem eben vollendeten Bildnis erschoß. Das waren ihr unverständliche Dummheiten, und sie sprach es aus, mit einer Miene so ruhig und ohne Mitleid, daß abgehärteten Roués ein Schauer über den Rücken lief. Man fing an, sie zu fürchten. Sie aber empfand das lebhafteste Vergnügen über eine noch nicht gekostete Art von Gefrorenem oder über den Schnee, der, dichter als sie ihn je gesehen hatte, auf dem Pelzkragen ihres Kutschers liegenblieb. Und eine größere Teilnahme als allen ihren Liebhabern brachte sie dem Lord Eppom entgegen, jenem alten Herrn, der das ganze Jahr hindurch eine weiße Hose und eine rote Nelke trug. Er fuhr im schäbigsten Einspänner bei ihr vor, und es erheiterte sie bis zu Tränen, wie er den argwöhnischen Widerstand ihrer Dienerschaft zu überwinden hatte, ehe er bis zu ihr vordringen und ihr sein kostbares Cadeau zu Füßen legen konnte. Sie besuchte ihn und betrat sein Schlafzimmer: er schlief in seinem Sarge. Er überreichte ihr galant einen seiner im voraus gedruckten Partenzettel und spielte ihr zu Ehren auf einem Leierkasten seinen selbst verfertigten Trauermarsch.
Sie begann Moden zu machen. Ein Bacchantinnenkostüm, im Januar 1870 auf dem Opernball getragen, krönte ihre Berühmtheit. Die fliegenden Tandkrämer verkauften ihre Karikatur, die Boulevards entlang leuchtete in den Schaufenstern auf großen Photographien die Büste der Herzogin von Assy. Bei einem Feste in den Tuilerien ruhte auf ihr mit einer langen, schwer scheidenden Sehnsucht das glanzlose Auge des Kaisers.
Der Krieg mit Deutschland brachte sie zum Stillstehen inmitten eines Tanzes, dessen Musik jäh abbrach. Den von Melodien gewiegten Kopf noch wollüstig im Nacken, fühlten die Tänzerinnen von ihren Lippen das Lächeln gleiten und ein Zittern um sie her von fernem Donner.
Der Herzog brach sofort mit ihr auf. Am Morgen nach ihrer Ankunft in Wien lag er tot im Bett. Sie reiste weiter, von der Leiche begleitet, und sie begrub sie in der Assyschen Gruft zu Zara, auf jenem feierlichen Friedhofe, dem entgegen mit düsterm Pomp der Zug der Zypressen schreitet. Dann verschloß sie sich in ihrem Palais. Die Gesellschaft der dalmatinischen Hauptstadt rückte vor ihrer Tür an, doch beobachtete die Herzogin ein strenges Trauerjahr.
Sie fühlte sich aufgerüttelt und mehr verwundert als erschreckt durch die Ereignisse. Zum erstenmal hatte sie die beunruhigende Empfindung von etwas Unbekanntem, nicht ganz leicht zu Nehmendem, das irgendwo auf sie wartete. Sie meinte die verflossenen Jahre dort hingebracht zu haben, wo das Leben am stärksten pulste; nun war es ihr, als hätten Ballmusik und leeres Lachen alles übertönt, was des Gehörtwerdens wert war. Und in der plötzlich eingetretenen Stille begann sie zu lauschen.
»Nun bin ich allein. Was ist es nun, was gibt es zu verstehen?«
An der Piazza della Colonna in Zara gab es offenbar nichts zu verstehen. Sie begann wieder, sich zu langweilen, woran sie seit Cannes nicht mehr gewöhnt war, und sah gleich andern Frauen hinter den geschlossenen Läden auf das eingeschlafene besonnte Pflaster hinunter. Zuweilen kamen Leute vom Hof vorbei, Gesichter, die sie bei ihrem raschen Besuche mit dem Herzog gesehen zu haben meinte. Der König saß im Wagen mit Beate Schnaken; die Herzogin lachte, ganz allein in ihren leeren Sälen, über die spaßhaften Geschichten, die man in allen Residenzen weitererzählte.
Die Dalmatiner wurden durch die Eifersucht der einheimischen Geschlechter daran gehindert, einen Fürsten in ihrer Mitte zu suchen. Die Mächte, der unter den früheren Verwaltungen nie beendeten Rassen- und Bürgerkriege müde, lenkten die Wahl des dalmatinischen Volkes auf Nikolaus, einen noch verfügbaren Koburger. Um ihm die Krone anzutragen, drang man bis in ein verstecktes Jagdhäuschen, wo er mit Treibern und Hunden in einer Küche lebte. Er war ein anspruchsloser Rauschebart, der mit Pelzmantel, Kappe und kurzer Pfeife durch die Wälder ging wie der Weihnachtsmann. Die Übersiedlung als Herrscher in ein fernes Reich, von dessen Lage er keine sichere Kenntnis besaß, ward dem Alten nicht leicht; doch entsann er sich seiner Fürstenpflicht. Der Bundeskanzler sollte ihm beim Abschied gesagt haben: »Reisen Sie mit Gott, und sehen Sie zu, daß wir von Ihrem Lande nichts mehr hören.«
Nikolaus sah zu. Er regierte still und bescheiden. Und wenn sich im Laufe der Jahre niemals herausstellte, ob er klug, gewalttätig, verschlagen oder edelmütig sei, so wurde eines sehr bald klar: er war ehrwürdig. Seine Völker, die sich gegenseitig Verarmung und gänzliche Ausrottung wünschten, waren darin einig, auf ihren greisen König mit gerührter Liebe zu blicken. Nikolaus war ein Muster als Familienvater. Eine tiefe, unzweifelhafte Ehrbarkeit hüllte alle, die ihm nahestanden, wie in einen Mantel ein, unter dessen Falten ihre Gebrechen verschwanden. Niemand entrüstete sich über den Thronfolger, den jungen Philipp, der, seit im Wiener Theresianum seine Erziehung beendigt war, einem hanswurstmäßigen Vergnügungstrieb lebte; und die schöne Freundin des Königs empfing überall wohlwollende Anerkennung.
Beate Schnaken war eine kleine Schauspielerin, die, von Wien nach Zara verschlagen, niemand fand, der gern ihre Schulden bezahlt hätte. In ihrer Not schlich sie früh um fünf aus dem Hause, um in der Jesuitenkirche zu beten. Sobald Nikolaus von Koburg die Führung des katholischen Volkes übernommen hatte, war er voll Frömmigkeit mit seinem ganzen Hause in die römische Kirche zurückgekehrt. Auch in der Ausübung seiner religiösen Pflichten ging er allen seinen Untertanen voran; in kalter Morgendämmerung verrichtete im Tempel der Jesuitenväter der greise Herr seine Andacht. Beaten war dieser Umstand bekannt. Sie faltete die Hände und verhielt sich ganz ruhig. Der König sah im Winkel etwas Schwarzes und achtete nicht weiter darauf. Am Morgen danach bemerkte er, daß aus dem schwarzen Schleier, der über einem Betstuhl lag, ein bleiches Profil in den Weihrauch hineinstarrte. Als ihm am dritten, vierten und fünften Tage immer dasselbe Bild auffiel, konnte der Alte sich einer herzlichen Rührung nicht enthalten, und Beate Schnakens Glück war gemacht.
Außer ihrer Gage empfing sie eine anständige Apanage. Nikolaus besuchte sie jeden Abend. Geheime Agenten lauschten an den Türen, doch selten fiel ein politisches und niemals ein unpassendes Wort. Im Wagen saß Beate immer an der Seite des königlichen Freundes, weiß und rosig, das sich entwickelnde Doppelkinn in den schwarzen Spitzenkragen gedrückt. Graf Bittermann, Nikolaus' Jugendfreund, hatte sie kniefällig gebeten, sich ihm antrauen zu lassen; mit der Gräfin Bittermann dürfe der König verkehren. Beate aber wies den treuen Diener der Dynastie Koburg ab; sie glaubte, der von ihm gewünschten Ehrenrettung gar nicht zu benötigen. In der Tat verlangte sie niemand von ihr. Die Königin sogar hatte Beate ins Herz geschlossen; man erzählte in dieser Beziehung rührende Züge.
Beate fand sich in ihre zarte Stellung mit der größten Gewandtheit, ohne jeden Rückfall in frühere Lebensphasen. Hier und da nahm sie kurzen Urlaub zu einem Stelldichein in Nizza mit einem Wiener Pferdejuden, oder um jenseits der Schwarzen Berge einen Kollegen von der Hofbühne zu treffen. Dann kam sie zurück, vernünftig, schlicht, mit stiller Würde; innerhalb der Landesgrenzen geschah nie das geringste.
Die Herzogin unterrichtete sich manchmal sogar aus den Zeitungen über die Taten und Gebärden dieser Herrschaften. Wer ihr in Paris vor fünf Monaten gesagt hätte, daß sie, um ihre Stunden hinzubringen, zu solchen Mitteln greifen werde.
Prinz Phili ritt eines Tages über den Platz. Sie stand leicht und lässig auf dem monumentalen Balkon ihres ersten Stockwerks und sah an den langen Säulen hinab, an deren Fuß zwei Greifen das Portal bewachten. Links saß ein eleganter Kavalier, rechts ein Hüne in Uniform, in der Mitte aber ein Männchen von schlechter Haltung, das fahrige Blicke umherwarf und unablässig mit kleinen bleichen Händen in den dünnen schwarzen Haaren grub, die auf seinen Wangen keimten. Die Herzogin wollte sich zurückziehen; Phili hatte sie schon erblickt. Er schleuderte die Arme in die Luft, in seinem Gesicht leuchtete es rosig auf. Er wollte anhalten. Sein eleganter Begleiter blieb gefällig stehen, doch der riesige Krieger riß rauh am Zügel des Prinzen. Phili zog den Kopf tief zwischen die Schultern zurück und folgte ohne Klage. Seine bemitleidenswerte Rückenlinie verschwand um die Ecke.
Es war im Dezember. Sie setzte einmal über die Hafenbucht. Die helle, feine Stadt, geformt mit der Anmut Italiens, blieb zurück; gegenüber lag unter dem schweren Sturmhimmel nichts als eine graue Steinwüste mit zerbröckelnden Hütten. Der Anblick, der sie kränkte, stachelte etwas in ihr auf, ein Bedürfnis, zu wagen, zu handeln und die Kräfte zu messen: sie ließ sich die Ruder reichen, sie tauchte in die lärmenden Wellen, die das Boot herumrissen. Sie sah sich machtlos und kämpfte aus Trotz. Da bemerkte sie am Strande einige Männer mit aufgesperrten Mündern und wild umhergeworfenen Armen. Sie schienen zornig; ein Alter mit gesträubtem weißem Bart drohte ihr mit den Fäusten und sprang dabei von einem Bein auf das andere.
»Was haben die Leute?« fragte sie ihren Gondolier.
Der Mann schwieg. Der Jäger erklärte zögernd:
»Es ist ihnen nicht recht, daß die Frau Herzogin rudern will.«
»Ah!«
Was konnte ihnen das machen? Es mußte eine kleine Eigenheit des Volkes sein, diese seltsame Eifersucht. Sie erinnerte sich jener unverständlichen Menschen, von denen sie als Kind für eine Hexe gehalten wurde. Das Volk besaß lauter Marotten. Es sang in sogenannten Volksliedern von Türkenkriegen, die niemals stattgefunden hatten.
Sie hatte die Ruder weggelegt, das Boot war ans Land geschleudert. Sie stieg aus. Der Alte kreischte noch einmal auf und schlich scheu davon. Sie besah sich durchs Lorgnon die jungen Burschen, die ungeschickt stehenblieben.
»Haßt ihr mich denn sehr?« forschte sie wißbegierig.
»Prosper, warum antworten die Leute nicht?«
Der Jäger wiederholte ihnen die Frage in ihrer Sprache. Schließlich sagte eine Stimme, die noch heiser vom Fluchen war:
»Wir lieben dich, Mütterchen. Gib uns Geld für Schnaps.«
»Prosper, frage sie, wer der Alte ist.«
»Unser Vater.«
»Trinkt ihr viel Schnaps?«
»Selten. Wenn wir Geld haben.«
»Ich gebe euch welches. Aber die Hälfte gebt ihr eurem Vater.«
»Ja, Mütterchen. Alles, was du befiehlst.«
»Prosper, geben Sie ihnen –«
Sie wollte sagen: zwanzig Franken, überlegte aber, daß das Volk sich tottrinken könnte.
»Fünf Franken.«
»Die Hälfte dem Vater«, wiederholte sie und stieg schnell ins Boot.
›Wenn ich zusehe, werden sie es ihm natürlich geben‹, dachte sie. ›Wie aber, wenn sie unbeobachtet sind?‹
Sie war gespannt, obwohl sie sich sagte, daß es gleichgültig sei, wie eine schmutzige Familie sich um fünf Franken vertrage.
Tags darauf wollte sie den Jäger hinschicken, doch meldete ihr Prosper, der Alte sei gekommen. Sie ließ ihn vor; er küßte ihren Rocksaum.
»Dein Knecht küßt deinen Saum, Mütterchen, du hast ihm einen Franken geschenkt«, sagte er und sah sie lauernd an. Sie lächelte. Ah, er traute den Burschen nicht und hatte recht. Er hätte ja zwei und einen halben Franken bekommen sollen. Aber daß sie ihm doch etwas gegeben hatten!
»Erwartete ich das?«
Sie war belustigt und sagte:
»Es ist gut, Alter, ich komme morgen wieder an euer Ufer.«
Der folgende Tag war blau. Sie stand zum Ausgehen bereit, als draußen sich Stimmen erhoben. Prinz Phili stolperte an fünf Lakaien vorbei, über die Schwelle.
»Einem Freunde ihres Gemahls, des seligen Herzogs«, so rief er aufgeregt, »Frau Herzogin werden doch einem lieben Freund des Herzogs nicht die Tür weisen. Küß die Hand, Frau Herzogin.«
»Königliche Hoheit, ich empfange niemand.«
»Aber einen lieben Freund. Wir hatten uns ja so lieb. Und dann, wie geht es der lieben Fürstin Pauline? Ach ja, Paris. Und die gute Lady Olympia, a so a herzigs Weiberl.«
Die Herzogin lachte. Lady Olympia Ragg war gerade noch einmal so groß und breit wie Prinz Phili.
»Ist sie noch in Paris, die Olympia? Ist gewiß schon wieder in Arabien oder am Nordpol. Eine wirklich liebe, überaus leicht zugängliche Frau. Es hat mich gar keine Mühe gekostet«, sagte er schäkernd. »Aber gar keine. Schauen Sie, jetzt werden Sie schon munterer.«
»Königliche Hoheit, es ist schwer, Ihnen zu widerstehen.«
»Trauern ist schon recht, aber nicht gar so arg. Ich trauere ja auch. Da schaun's.«
Er berührte seinen umflorten Ärmel.
»Der Herzog war doch mein Busenfreund. Das letztemal, als ich ihn sah, wissen Sie, in Paris, ermahnte er mich so rührend zur Vernunft, aber so rührend, sage ich Ihnen. ›Phili‹, sagte er, ›Mäßigkeit im Genuß von Wein und Weibern.‹ Er hatte nur zu recht, aber kann ich ihm folgen?«
»Königliche Hoheit können sicher, wenn Sie wollen.«
»Das gehört zu Ihren Vorurteilen. Mit achtzehn Jahren bekam ich von einem Hofmeister Portwein; er stahl ihn mir eigenhändig von der Hoftafel. Heute bin ich zweiundzwanzig und trinke schon nur noch Kognak. Erschrecken bitte nicht, Frau Herzogin, ich verdünne ihn mit Sekt. Ein Wasserglas voll, halb Sekt, halb Kognak. Meinen Sie, daß es schadet?«
»Ich weiß wirklich nicht.«
»Mein Arzt sagt mir, es schadet gar nichts.«
»Dann können Sie's ja tun.«
»Das denken Sie doch auch wirklich?«
»Aber warum trinken Sie? Es gibt für einen Thronfolger doch so viele andere Beschäftigungen.«
»Das gehört zu Ihren Vorurteilen. Ich bin unbefriedigt wie alle Thronfolger. Erinnern Sie sich an Don Carlos. Ich möchte nützlich sein, und man verurteilt mich zur Untätigkeit; ich bin ehrgeizig, und jeder Lorbeer wird vor der Nase weggeschnitten.«
Er stand auf und trollte gebeugt durchs Zimmer. Seine Arme waren immer erhoben wie Flügel, die Hände wippten in der Höhe der Brust an den Gelenken auf und ab.
»Sie Ärmster«, sagte die Herzogin und blickte auf die Uhr.
»Die Schranzen verdächtigen mich bei dem Könige, meinem Vater, als könne ich die Zeit meiner Thronbesteigung nicht erwarten.«
»Aber Sie können es doch?«
»Mein Gott, ich wünsche dem König langes Leben. Aber ich möchte auch leben, und man will es nicht.«
Er schlich auf den Fußspitzen nahe zu ihr hin und flüsterte mit Anstrengung dicht an ihrem Gesicht:
»Wollen Sie wissen, wer es nicht will?«
Sie hustete; ein scharfer Alkoholduft wehte sie an.
»Nun?«
»Die Je-su-iten!«
»Ah!«
»Ich bin ihnen zu aufgeklärt, darum verderben sie mich. Wer ist denn heute fromm? Die Klugen geben vor, es zu sein: ich bin zu stolz dazu. Glauben Sie, Frau Herzogin, etwa an die Auferstehung oder an die unbefleckte Empfängnis oder überhaupt an das ganze Himmelreich? Ich persönlich bin über das alles hinaus.«
»Ich habe mich nie dafür interessiert.«
»Vorurteile habe ich keine mehr, sage ich Ihnen. Die Kirche fürchtet mich, darum verdirbt sie mich.«
»Bitte, wie macht sie das?«
»Sie fördert meine Laster. Sie besticht meine Umgebung, daß man mir zu trinken gibt. Wenn ich irgendwo einem schönen Weibe begegne, so haben die Schwarzen mir's in den Weg gestellt. Ich bin nicht einmal sicher, Frau Herzogin, ob nicht Sie ... Sie selbst ... Sie sind vielleicht doch fromm?«
Er schielte sie von der Seite an. Sie begriff nicht.
»Warum standen Sie neulich auf dem Balkon, gerade als ich vorbeiritt?«
»Ach, Sie glauben?«
Er zögerte, dann stimmte er in ihr Lachen ein. Er rückte auf seinem Sessel zutraulich näher.
»Ich fürchtete nur, weil Sie gar so schön sind. Phili, hab ich zu mir gesagt, da ist eine Falle. Schau, daß du weiterkommst. Aber Sie sehen, ich bin nicht weitergekommen: da sitze ich.«
Er kam noch näher, seine wippenden Händchen streiften schon die Spitzen vor ihrer Brust. Sie erhob sich.
»Gelt, ich darf da sitzen bleiben?« lallte er, erregt und unsicher.
»Aber mir erlauben Königliche Hoheit, daß ich ausgehe?«
»Aber wozu denn! Gehn's, Frau Herzogin, sein's gemütlich.«
Er trollte ihr nach, von einem Stuhl zum andern, demütig und ausdauernd.
»Aber das alte Empiregerümpel müssen Sie hinaustun und was Molliges da hereingeben, daß man lieb plauschen kann und sich auswärmen. Dann komm ich alle Tage zu Ihnen. Sie glauben nicht, wie ich zu Hause kalt hab bei meiner Frau. Muß man mir auch eine Frau aus Schweden holen, die zu predigen anfängt, sobald sie meiner gewahr wird. Quelle scie, Madame! Ein Sägefisch aus Schweden: das ist ein selbsterfundenes Wortspiel. Und ein französisches auch noch! Ach Paris!«
Er redete langsamer, ängstlich horchend. Der Vorhang öffnete sich, der elegante Begleiter des Prinzen erschien auf der Schwelle. Er verneigte sich tief vor der Herzogin und vor Phili und sprach:
»Königliche Hoheit erlaube mir zu erinnern, daß Seine Majestät Eure Königliche Hoheit um elf Uhr zum Frühstück erwarten.«
Er verneigte sich abermals. Phili murmelte: »Gleich, mein lieber Percossini.« Die Tür ging zu.
Der Prinz wurde plötzlich beweglich.
»Haben Sie ihn wohl gesehen, den Schuft? Das war der Baron Percossini, so ein Italiener. Der Schuft, er wird ja gezahlt von den Je-su-iten. Er hat gewartet, bis ich hier bei Ihnen recht warm geworden bin. Jetzt holt er mich fort, gerade im schönsten Moment, wo ich anfange zu hoffen. Ich soll närrisch werden, die Jesuiten zahlen's. Sagen Sie, liebste Herzogin, darf ich morgen wiederkommen?«
»Unmöglich, Königliche Hoheit.«
»Bitte, bitte.«
Er flehte, tränenerstickt.
»Sie sind zu schön, ich kann doch nicht anders.«
Dann plauderte er wieder.
»Der Major von Hinnerich, mein Adjutant, ah, das ist ganz was anderes. So ein braver Mann! Ein wirklich braver Mann, er hindert mich an jedem Vergnügen. Aber an jedem, sag ich Ihnen. Haben Sie neulich gesehen, wie er an meinem Zügel zog? Ein so treuer Diener meines Hauses. Seien Sie lieb, Frau Herzogin, besuchen Sie meine Frau, kommen Sie zu unserm cercle intime. Ich muß Sie doch wiedersehen, ich kann doch nicht anders. Gelt, Sie kommen? Der Prinzessin machen Sie solche Freude, sie spricht immerfort von Ihnen. Gelt, Sie kommen?«
Sie machte ungeduldig ein paar Schritte auf die Tür zu.
»Ich komme.«
Der Vorhang rauschte von neuem. Phili legte unvermutet eine gnädige Anmut an den Tag.
»Mein lieber Percossini, ich gehöre Ihnen. Küß die Hand, Frau Herzogin, und auf Wiedersehen beim cercle intime.«
Die Herzogin begab sich zu Fuß nach dem Hafen. Ein reiner Nordwind strich über das violette Meer. Beim Landen fand sie drüben am Strande einen bunten Volkshaufen, der auf sie zu warten schien. Allen voran leuchtete unter dem kraßblauen Himmel der kupferrote, schöne Bart eines feingekleideten, stattlichen Herrn. Der graue Schlapphut war von seinem Anzuge das einzige nicht der Mode entnommene Stück. Er verneigte sich: im selben Augenblick schrien und plärrten Männer, Frauen und Kinder im Chor, wie etwas Eingelerntes:
»Das ist Pavic, unser Retter, unser Väterchen, unser Brot und unsere Hoffnung!«
Die Herzogin ließ sich sagen, was es bedeute. Dann betrachtete sie den Herrn; sie hatte von ihm gehört. Er stellte sich vor:
»Doktor Pavic.«
»Ich bin gekommen, Hoheit, Ihnen zu danken. Ihnen ist gedankt, denn Sie wissen: ›Was ihr dem ärmsten meiner Brüder tut, das tut ihr mir.‹«
Sie verstand ihn nicht, sie dachte: ›Mir? Wem denn? Ich habe ja überhaupt niemandem etwas tun wollen.‹ Da sie nichts erwiderte, setzte er hinzu:
»Ich spreche, Hoheit, zu Ihnen im Namen dieses unmündigen Volkes, dessen Menschwerdung ich mein ganzes Leben geweiht habe. Mein ganzes Leben«, wiederholte er mit Hingebung.
Sie erkundigte sich:
»Was ist es mit diesen Leuten? Ich möchte etwas über sie wissen.«
»Dies arme Volk, es liebt mich sehr. Sie bemerken, Hoheit, wie dicht es mich umdrängt?«
Sie hatte es bemerkt: das Volk roch übel.
»Ah! Um mich spinnt sich ein gutes Stück Romantik!«
Er breitete die Arme aus, den Kopf im Nacken, daß der schöne breite Bart keilförmig in die Luft stand. Sie erklärte sich seine Gebärde nicht ganz.
»Wenn Sie wüßten, Hoheit, wie das süß ist: vom Hasse einer Welt umtobt, sich auf einen Wall von Liebe zu stützen.«
Sie erinnerte ihn:
»Und das Volk, das Volk?«
»Es ist arm und unmündig, darum liebe ich es, darum schenke ich ihm meine Tage und meine Nächte. Die Umarmungen eines Volkes, Sie mögen mir glauben, Hoheit, sind heißer, sind weicher und beglückender als die einer Geliebten. Ich entreiße mich ihnen manchmal, zu langen, einsamen Fußwanderungen durch mein trauriges Land.«
So schloß er, stiller und getragener.
Er war entschieden von der Darlegung der eigenen Persönlichkeit nicht abzulenken. Sie hatte die Lippen zu einem spöttischen Wort geöffnet, aber sein Organ, dies erstaunliche Organ, das dem Könige und seiner Regierung Furcht einflößte, bezwang ihren Widerspruch. In seiner Stimme schmolz Liebe, die Liebe zu seinem Volk, wie eine köstliche Dragée. Ein Duft, fade und berauschend, entströmte seinen leersten Worten, ein ihr peinlicher Duft; aber er wirkte auf sie.
Einige Schritte landeinwärts äußerte sie:
»Sie sind ein Tribun? Man fürchtet Sie sogar?«
»Man fürchtet mich. O ja, ich glaube wohl, daß jene vornehmen Herren mich fürchten, die damals, als ich die schamlosen, verworfenen Sitten des Thronfolgers nach Verdienst öffentlich gebrandmarkt hatte, in mein Haus gedrungen sind.«
»Ach, wie ist das abgelaufen?« fragte sie, begierig auf Geschichten.
Er blieb stehen.
»Sie mußten sich in der nächsten Apotheke die Köpfe verbinden lassen. Die Polizei vermied es ängstlich, sich einzumischen«, sagte er kalt und ging weiter.
Er gab ihr zehn Sekunden zum Nachdenken; dann hielt er wieder an.
»Aber niemand, der ein gutes Gewissen besitzt, braucht mich zu fürchten. Man weiß ja gar nicht, wie weich ich bin, wieviel von meinem Zorn aus einer zu zärtlichen Seele kommt, und wie dankbar und treu ich dem Mächtigen, Frau Herzogin, wäre, der für meine Sache seine Hand erhöbe.«
»Und Ihre Sache?«
»Ist mein Volk«, sagte Pavic und setzte seinen Weg fort.
Sie wanderten über spitze Kiesel. In einem armseligen Acker standen gebückte Gestalten, sie warfen unablässig, mit immer gleichen Bewegungen, Steine auf die Straße hinaus. Der Weg lag voll, und das Feld ward nicht leer. Ein Bauer sagte:
»So werfen wir das ganze Jahr. Gott weiß, wo der Teufel all die Steine hernimmt.«
»Das ist auch mein Los«, versetzte Pavic sofort. »Jahrein jahraus schleudere ich Ungerechtigkeit und Frevel an meinem Volk aus dem Acker meines Vaterlandes – aber Gott weiß, woher der Teufel immer neue Steine nimmt.«
Die Öffnung einer Lehmhöhle klaffte. Die Herzogin trat, um dem immer nachdrängenden Volke auszuweichen, auf die Schwelle. Ungeheure irdene Krüge ragten in den Ecken, auf dem Boden von hartgestampfter gelber Erde. Durch den schwarzen Raum zog der Geruch von gebratenem Öl. Vor dem schwelenden Feuer eines feuchten Reisigbündels froren drei Männer in braunen Mänteln. Einer sprang auf und kam mit einem tönernen Gefäß auf die Gäste zu. Die Herzogin wich hastig zurück, aber der Tribun ergriff den Weinkelch.
»Das ist der Saft meines Mutterbodens«, sagte er zärtlich und trank.
»Das ist Blut von meinem Blut.«
Er verlangte ein Stück Maisbrot, zerbrach es und teilte mit den Umstehenden. Die Herzogin sah einem großen Seevogel zu, der kreischend durch die Nacht der Höhle flatterte. Eine kleine Natter ringelte sich auf dem Tisch.
»Wahrscheinlich ist mir jetzt alles vorgeführt«, sagte die Herzogin. Sie wandte sich wieder dem Ufer zu.
»Sie wollen zur Stadt, Herr Doktor, und haben kein eigenes Boot? Steigen Sie bitte in meines.«
Er nahm einen Knaben mit hinein, ein kränkliches Wesen mit schwachen Augen, weißen Ringellöckchen und von käsiger Farbe.
»Sie haben einen Knaben bei sich?«
»Es ist mein Kind. Ich habe es sehr lieb.«
Sie dachte: ›Das brauchte nicht gesagt zu werden. Und mitzunehmen brauchte er es auch nicht.‹
Nach einer Pause fragte sie:
»Sie werden doch Pavese genannt?«
»Ich habe mich so nennen müssen. Ohne die Sitten und sogar die Namen unserer Feinde anzunehmen, können wir in unserm eigenen Lande nicht gedeihen.«
»Wer, wir?«
»Wir ...«
Er errötete. Sie bemerkte, daß er eine eigentümlich zarte Haut und rosige Nüstern hatte.
»Wir Morlaken«, ergänzte er rasch.
›Morlaken?‹ dachte sie. So nannte man also jene Bunten, Schmutzigen dort drüben. Das war also ein Volk. Sie hatte es für eine namenlose Herde gehalten. Sie vergewisserte sich:
»Und die Leute am Strande, das waren wohl auch –«
»Morlaken, Hoheit.«
»Warum verstehen sie nicht Italienisch?«
»Weil es nicht ihre Sprache ist.«
»Ihre Sprache?«
»Das Morlakische, Hoheit.«
Also besaßen sie auch eine Sprache. Sie hatte, sooft jene die Münder öffneten, ein ungeregeltes Grunzen zu hören gemeint, aus dem Eingeweihte möglichenfalls allerlei traumdunkle Absichten herausahnten, wie aus den Lebensäußerungen der Tiere. Pavic versetzte:
»Wie ich sehe, ist Ihnen, Frau Herzogin, dieses Volk noch unbekannt.«
»Ich habe unter meiner Dienerschaft nie welche gehabt. Ich erinnere mich, mein Vater nannte sie –«
Sie besann sich und schwieg. Er schluckte hinunter. Plötzlich gerade aufgerichtet und eine Hand in der Nähe des Herzens, mit der ganzen Spannung eines vielleicht einzigen Augenblickes begann er zu reden.
»Wir Morlaken sehen zu, wie zwei fremde Räuber sich um unser Land vertragen. Wir sind der Kettenhund, den zwei Wölfe anfallen; und der Bauer schläft.«
»Die beiden Wölfe?«
»Sind die Italiener, unsere alten Bedrücker, und der König Nikolaus mit seinen fremden Schergen. O Hoheit, mißverstehen Sie mich nicht. Es hat der Dynastie Koburg niemals ein treueres Herz geschlagen als hier in dieser slawischen Brust. Als die Mächte den Prinzen Nikolaus von Koburg auf Dalmatiens Thron setzten, da ging ein Aufatmen durch die slawische Welt. Die vielhundertjährige Schmach wird nun doch gesühnt werden, so hieß es von Archangel bis Cattaro: denn von Cattaro bis Archangel und vom Eismeer bis zu der öligen Flut des Südens schlagen die slawischen Herzen im gleichen Takt. Die lateinischen Räuber, die ein heiliges Slawenvolk schänden, man wird ihnen endlich den Stein um den Hals binden und sie im Meer versenken. So jauchzten wir! So jauchzten wir voreilig. Denn, Frau Herzogin, wie es war, so ist es geblieben: die Fremden herrschen.«
»Welche Fremden?«
»Die Italiener.«
»Die nennen Sie fremd? Hier ist doch alles italienisch. In eine Wildnis, an ein ödes Meer haben die Italiener schöne Städte gebaut ...«
»Und nun sitzen – Sie sehen, Hoheit, wie wund Ihre Worte mein Herz trafen, daß ich Sie, Frau Herzogin, zu unterbrechen wage – und nun sitzen sie in diesen schönen Städten als Spinnen und trinken das arme Blut des slawischen Landes. In den Städten am Meer wird auf italienisch geschrien, genossen und Theater gespielt. Man führt den Neugierigen, die vorbeifahren, die Komödie einer Wohlhabenheit, einer Gesittung und Zufriedenheit vor, die dieses Land nicht kennt. Dahinter aber, in den langgestreckten, traurigen Gefilden, geht es ernst und stille zu. Dort wird auf slawisch geschwiegen, gehungert und gelitten. Das Reich, Frau Herzogin, ist nicht derer, die genießen, es ist der Leidenden.«
Sie fragte sich: ›Hält er leiden für ein Verdienst?‹
Der Tribun fuhr fort:
»Die Barbarei und das Elend in ein Land tragen, wo nur Genügsamkeit und Unschuld waren; in den Leibern der Armen nach Gold graben und um Gold ihre unsterblichen Seelen verkaufen – das nannten unsere einstigen Herren, die Venezianer: kolonisieren. Zum Ersatz für alles, was sie uns nahmen, sandten sie uns ihre Künstler, die bauten uns einige nichtsnutzige Monumente; daran durften die Hungernden sich satt sehen.«
Er sprang auf. Die gespreizte Rechte ausgestreckt nach der weißen Stadt, die vor ihnen sich aus dem Wasser erhob, rief er in den Wind hinein:
»Wie ich sie verabscheue, diese ruchlose Schönheit!«
Die Herzogin wendete, leicht angewidert, den Kopf weg. Pavic vermochte sich in dem heftig schwankenden Boot nicht lange auf den Beinen zu halten; er taumelte und saß hart nieder. Dann legten sie an. Pavic seufzte tief:
»Der König Nikolaus weiß von alledem nichts. Ich achte ihn, er ist fromm, und auch ich war als einfaches Slawenherz immer ein gläubiger Sohn der Kirche. Aber er steckt im Lügengarn der Italiener. Hätte er sonst einen treuen Untertanen wie mich verfolgt und eingekerkert?«
Ihr Wagen war vorgefahren, sie stand schon am geöffneten Schlage; plötzlich sah sie sich nochmals nach ihm um.
»Sie haben im Kerker gesessen?«
»Hoheit, zwei Jahre lang.«
Die Herzogin erhob das Lorgnon: sie hatte noch niemals einen Staatsverbrecher gesehen. Pavic stand barhäuptig im Schmuck seiner kurzen braunroten Locken, das Licht flimmerte in seinem rotblonden Bart, er blickte ihr freimütig in die Augen.
»Sie müssen unversöhnlich sein«, versetzte sie endlich. »Ich wäre es.«
»Gott verhüte es. Aber immer fromm und immer loyal gewesen, und bloß weil ich mein Volk liebe, verfolgt und eingekerkert – Hoheit, das schmerzt«, sagte er innig.
»Schmerzt? Sie müssen doch wütend sein!«
»Hoheit, ich vergebe ihnen –«
Er hielt die Rechte mit nach außen gekehrter Handfläche ein Stück seitwärts von der Hüfte weg. Er blickte gen Himmel.
»Denn sie wissen nicht, was sie tun.«
»Erzählen Sie mir gelegentlich mehr, Herr Doktor.«
Sie grüßte ihn aus dem Wagen.
Es war Mittag, in den windgeschützten Straßen brannte die Sonne. Die Herzogin fühlte sich aufgeweicht und eingeschläfert von lauter auf sie herniedergegangenen Worten, einfangenden, umstrickenden, entkräftenden Worten. Noch in ihren kühlen Sälen umspann sie ein ungesunder Zauber. Alle Gegenstände, die sie anfaßte, waren zu weich, das Schweigen im Hause zu schmeichelnd und zu träumerisch. Ein kleiner Vogel, der sich an ihrem Fenster den Kopf einstieß, hätte ihr fast leid getan, als er schon tot war. Sie brauchte eine Nacht, um wieder gelassen und vernünftig zu werden.
Acht Tage später kam ein verzweifelter Brief vom Prinzen Phili. Von Hinnerich sei zu treu, er lasse ihn keinen Schritt mehr allein gehen. Wenn sie ihm ein Wiedersehen beim cercle intime versage, so verliere er den letzten moralischen Halt. Das werde sie nicht wollen, nur die Jesuiten könnten das wünschen.
Sie gab bei der Prinzessin ihre Karte ab. Darauf erschien bei ihr ein Hofjäger mit einer schriftlichen Einladung zu Ihrer Königlichen Hoheit.
Als der Lakai vor ihr die Flügeltür aufriß, warf Phili einen Handarbeitstisch um. Zwei Teetassen gingen in Scherben. Die in dem weiten, kalten Gemach einsam frierenden Personen erhoben sich eifrig, erlöst aus trüber Langerweile. Die Prinzessin zog liebenswürdig einen zweiten Sessel neben den ihrigen, in dessen warmen Tiefen sie mit frostigem Beben ganz verschwand. Sie war lang, beängstigend schmal und mager, und weißlich von Haaren, Haut, Augen und Wesen. Ellenbogen und Knie stachen wie Lanzen durch den Stoff des schlichten, geschlossenen Kleides, die Handgelenke wollten abbrechen in den Spitzenmanschetten.
»Sie haben uns aber lange warten lassen«, äußerte sie.
Sie sprach langsam, leise klagend. Man wußte beim ersten Wort, ihr sei auf keine Weise beizukommen.
»Mit Bedauern, Königliche Hoheit«, entgegnete die Herzogin.
»Dennoch hätte ich meine Zurückgezogenheit noch lange nicht aufgegeben, nur der Wunsch Eurer Königlichen Hoheit konnte mich dazu bewegen.«
»Sie tun es mir zuliebe, Hoheit? Gott lohne es Ihnen. Wie habe ich mich danach gesehnt, mit einem Menschen der großen Welt, mit Ihnen, liebe Herzogin, von da draußen reden zu dürfen – von Paris ...«
Dies Wort erregte ein Stöhnen, es pflanzte sich fort durch den Raum. Phili wiederholte dumpf: »Paris.« »Paris«, lispelten zwei reichgeputzte Damen, deren kunstvolle Locken, von großen Rosen gekrönt, über porzellanweiße Nacken fielen. Hinter ihnen warfen ihre Männer die blaßbraunen Köpfe zurück, daß die gewichsten Stacheln ihrer dicken schwarzen Schnurrbärte zur Decke starrten: »Paris.« »Paris«, murmelte Percossini mit angenehmem, sehnsuchtstiefem Bariton. Aus einem wenig erhellten Winkel, von Seidenkissen erstickt, drang der matte Seufzer einer dicken, schönen Frau: »Paris.« Und nur von Hinnerich blieb, ohne eine Miene zu verziehen, aufmerksam und pflichtgetreu neben dem Stuhl stehen, auf dem des Thronfolgers kümmerliche Glieder zappelten.
Die Prinzessin sagte:
»Hoheit erlauben, daß ich Sie mit unsern Freunden bekannt mache.«
»Mes dames Paliojoulai und Tintinovitsch.«
Die beiden Damen beschrieben in ihren hinten zentaurenmäßig entwickelten Roben weite Komplimente. Ein anmutiges Lächeln wollte die milchige Fettschicht auf ihren Gesichtern in Fluß bringen. Die Herzogin bemerkte, daß Madame Tintinovitsch schön sei mit ihrer feinen Adlernase und den schwarzen Brauen unter den blondgefärbten Locken.
»Prinzessin Fatme«, sagte Friederike von Schweden, »meine liebe Fatme, die Gemahlin Ismael Iben Paschas, des Gesandten Seiner Majestät des Sultans bei unserm Könige.«
» Eine