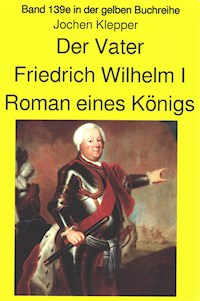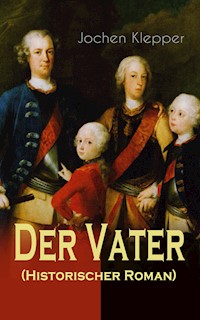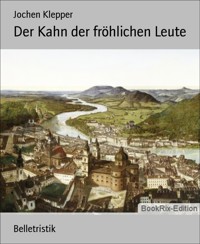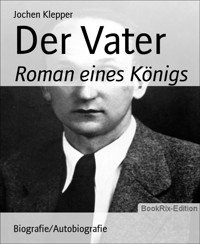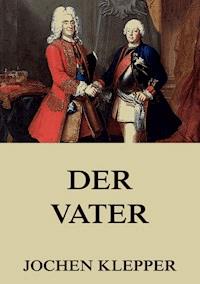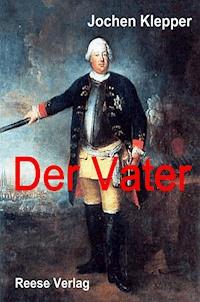
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Jahre lang schrieb Jochen Klepper in schwieriger Zeit an seinem Roman vom Soldatenkönig. Darin bearbeitete er nicht nur anhand des Konflikts zwischen dem preußischen Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm I., und dessen Sohn Friedrich II. dem Großen seinen eigenen Vater-Sohn-Konflikt, sondern entwarf im Bild eines Königs, der in allem nach Gott fragt und sich als "ersten Diener im Staat" begreift, das Gegenbild zum Führerkult des Nationalsozialismus. Der Roman erschien im Februar 1937 im Buchhandel und wurde ein Verkaufsschlager, besonders in preußisch gesinnten Kreisen; er wurde Pflichtlektüre für Offiziere der Wehrmacht. Andererseits erfolgte kurz nach Erscheinen des Romans am 25. März 1937 der Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer, was Berufsverbot und Arbeitslosigkeit gleichkam. Klepper erwog die Flucht ins Ausland, konnte sich aber nicht dazu überwinden. (Quelle: Wikipedia)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1627
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
ZEITTAFEL
ERSTER TEIL
KÖNIG MIDAS
DER PLUSMACHER
SEGEL AUF DEM WINTERMEER
WIRTE UND GÄSTE
HEERSCHAU UND LANDFAHRT
DER KÖNIG UND DER ABENTEURER
DIE HÜTTE GOTTES BEI DEN MENSCHEN
ZWEITER TEIL
DIE AUFGEHENDE SONNE
KÖNIG RAGOTINS SCHLOSS
DAS KIND DER SCHMERZEN ODER DIE GALEERE
DER GOTT VON GELDERN
DIE HIRTINNEN
GESPRÄCHE AUS DEM TOTENREICH
MIJNHEER VAN HOENSLARDYCK
DER SPIEGEL
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag (Auswahl):
E-Books Edition Loreart:
Jochen Klepper
Der Vater
Roman des Soldatenkönigs
Reese Verlag
ZEITTAFEL
1688: Geburt Friedrich Wilhelms, des späteren Soldatenkönigs (Sohn des Kurprinzen Friedrich von Brandenburg, des nachmaligen ersten preußischen Königs, und seiner Gemahlin Sophie Charlotte)
1706: Vermählung Friedrich Wilhelms mit Sophie Dorothea von Hannover
1713: Thronbesteigung als Friedrich Wilhelm I. von Preußen
1740: Tod des Königs und Thronbesteigung seines Sohnes Friedrich als Friedrich II. (Friedrich der Große)
SEINE 14 KINDER: Prinz Friedrich (* 1707 † 1708), Prinzessin Wilhelmine, die spätere Markgräfin von Bayreuth (* 1709 † 1758), Prinz Friedrich Wilhelm (* 1710 † 1711), Kronprinz Friedrich, der spätere König Friedrich II. (* 1712 † 1786), Prinzessin Charlotte (* 1713 † 1714), Prinzessin Friederike Luise (* 1714 † 1784), Prinzessin Philippine Charlotte, die spätere Herzogin von Braunschweig (* 1716 † 1801), Prinz Karl (*1717 † 1719), Prinzessin Sofia, die spätere Markgräfin von Brandenburg Schwedt (* 1719 † 1734), Prinzessin Ulrike, die spätere Königin von Schweden (* 1720 † 1782), Prinz August Wilhelm (* 1722 † 1758), Prinzessin Amalie (* 1723 † 1787 als Äbtissin in Quedlinburg), Prinz Heinrich, später einer der fähigsten Generale seines königlichen Bruders (*1726 † 1802), Prinz Ferdinand (* 1730 † 1755)
Könige müssen mehr leiden können als andere Menschen
Friedrich Wilhelm 1.
ERSTER TEIL
KÖNIG MIDAS
Den Königen ist Unrecht tun ein Greuel; denn durch Gerechtigkeit wird der Thron befestigt.
Die Bibel
Es ging um den Taufspruch für den Knaben, der als erster im Brandenburgischen Hause unter der Würde des königlichen Purpurs geboren war. Keinem der Herren war es zweifelhaft. Bis in die letzte Einzelheit war die Zeremonie vom königlichen Großvater selbst vorbereitet. Nur das Bibelwort, das über das Leben des hohen Kindes gestellt werden sollte, war noch ungewiß. König Friedrich hatte dem Hofmarschall sehr feierlich, doch mit einem huldreichen Lächeln einen Brief übergeben. «Eine Überraschung für Seine Königliche Hoheit», hatte er hinzugefügt. Der Hofmarschall sagte es seinen Kammerjunkern wie ein köstliches Geheimnis weiter, und schon eilten sie zu den Gemächern des jungen Herrn. Aber die Lakaien dort meldeten, Königliche Hoheit seien weder anwesend noch hätten sie hinterlassen, wo man sie finden könne. Wenn man sich nicht täusche, hätten Hoheit sich nach dem Quergebäude zwischen den Haupthöfen begeben.
Das war rätselhaft. Dort lag die Konditorei mit den Küchen. Doch der Auftrag war unverzüglich auszuführen. Der jüngste Kammerherr mußte mit dem Personal der Zuckerbäckerei verhandeln. Man wagte es ihm nur zuzuflüstern, der Kronprinz sei vorübergegangen, noch eine Treppe tiefer, zur alten Gesindeküche.
Die war lange außer Gebrauch gesetzt und diente nur noch zum Gewölbe. Gerät, das zu nichts mehr taugen mochte, wurde hier abgestellt, bis die Verwandtschaft der Küchenmägde es abholen kam. Dann war es wieder zu mancherlei nützlich. Über den Fenstergittern hingen alte Lappen. Der mächtige Ziegelherd war an vielen Stellen schon zerfallen. Vom verrußten Rauchfang wehten dichte Spinnweben herab. Im Halbdämmer des Wintervormittags war der Kellerraum sehr düster. Die Kälte drunten war bitter.
Aber Kronprinz Friedrich Wilhelm hatte sogar den Rock abgeworfen; im Wams kniete er vor dem Ofen, so heiß war ihm bei seiner Arbeit geworden. Er besserte den Herd aus und hatte keinen Gehilfen. Die Höflinge gerieten in Verlegenheit. Wie sollten sie sich vor der Hoheit verneigen, wenn diese dem Herdwinkel zugewandt war? Und welche Stellung hatte man einzunehmen, wenn der Königssohn am Boden hockte? Friedrich Wilhelm endete ihre Not sehr rasch. Er stand auf und schritt mit flüchtiger Entschuldigung zu einem Schemel mit einem Becken, goß sich aus der Zinnkanne eisiges Wasser ein, wusch sich, immer wieder zu den Herren blickend, die Hände und trocknete sie an seiner Schürze ab.
«Nachricht über die Pest in Litauen?»
Seine rauhe Stimme klang in dem Gewölbe noch tonloser als sonst. Der Hofmarschall hielt ihm mit Anmut und Achtung den Brief des Königs entgegen, und der Kronprinz trat auf die Kavaliere zu, das Schreiben des königlichen Vaters aufzubrechen. Zornig fühlte er beim Lesen, daß wieder eine Blutwelle sein verdammt weißes Gesicht überlief. Er haßte seine schöne Haut, das Erbe einer zarten Mutter. Was hatte er nicht schon alles getan, um braun zu werden wie des Dessauers Grenadiere. Seit seiner Knabenzeit hatte er das Gesicht immer wieder mit Speckschwarte eingerieben und sich in die prallste Sonne gelegt; doch es wurde nicht besser.
Die Herren sahen die Röte des Unwillens; sie hörten die tiefe Verstimmung aus seinen Worten.
«Mein Vater überrascht mich damit, daß ich selbst den Taufspruch für meinen Sohn auswählen darf. Übermitteln Sie dem König meinen Dank und melden Sie, 1. Könige 10 Vers 21 schiene mir geeignet. Im übrigen sehen Sie mich im Augenblick nicht in der Lage, eine Abordnung zu empfangen. Sie finden mich beschäftigt. Auch ist dies kein Ort für Sie.»
Der Hofmarschall versuchte sich in höflichen Einwänden.
«Wenn Königliche Hoheit die Stätte nicht für zu gering befinden —»
Der Kronprinz schüttelte lachend den Kopf, legte seine Hand auf den Arm des Hofmarschalls und führte ihn nicht unfreundschaftlich hinaus. Schließlich war der ja einer der ganz wenigen Männer hier, die er noch für ehrliche Leute ansehen konnte. An der Schwelle hielt er ihn noch einen Augenblick zurück und sagte, allerdings mehr zu den Kammerjunkern gewendet: «Wißt ihr, was in diesem Spruch steht? Aber die Bibel kennt ihr ja alle nicht, trotz eurer frömmlerischen Reden. So werde ich es euch sagen: ‹Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße im Hause vom Wald Libanon waren auch lauter Gold; denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts›.»
Von dem Schwarm der Höflinge war er nun befreit. Die Gegenäußerung mied jeder. Mit finsterer Miene warf Friedrich Wilhelm wieder Holzscheit um Holzscheit in die Feueröffnung des Herdes. Seltsames Tun für einen Königssohn! Und wunderliche Gedanken für ein der Krone bestimmtes Haupt!
Verstünde der Goldmacher den Spruch — er würde sich gar nicht erst hierhergetrauen. —
Besser noch, der König selbst begriffe dieses Wort der Schrift. Gab es denn wirklich in ganz Brandenburg einen einzigen Menschen, der mit dem König an ein Heil vom Goldmacher her glaubte?
Die Antwort erteilte der Kronprinz sich selbst: Zum mindesten sind drei, die das ganze Volk an solchen Zauber glauben machen wollen. Drei sind es, immer wieder die drei, bei denen alle seine Gedanken münden: das dreifache «W’eh», die drei Minister Wittgenstein, Wartenberg und Wartensleben — des Königs Auge, des Königs Ohr, des Königs Mund!
Ach, wäre des Königs Sohn seine rechte Hand. — Das dachte der Kronprinz verbittert. Was galt des Königs einziger Sohn. — Verurteilt war er, das Haupt einer lächerlichen kleinen Garde im Kastell Wusterhausen zu sein, während in der ständigen und unmittelbaren Nähe des Herrschers diese drei Männer mit allen Vollmachten schalteten und walteten zum eigenen Nutzen, zum Leiden des Volkes und zur Verblendung des Königs, eines Königs in geliehenem Prunk und ohne Macht.
Nur Klagen und Wüten war dem Thronfolger vergönnt; Rechenschaft durfte er nicht fordern. Schuldlose Gegenstände mußten seinen Zorn ertragen. Aber der Arbeit seiner Hände kam es zugute. Er riß den alten Blasebalg herunter. Einen neuen wollte er anbringen für den Goldmacher seines Vaters, ihm einen guten Wind zu machen für seine Schaumschlägereien. Mit aller seiner Kraft hängte sich der junge Mann in die Lederfetzen und Balken; in einer einzigen gewaltigen Anstrengung zerrte er das Gebläse herab. Das Holz zersplitterte, das Leder ächzte, Staubwolken flogen auf, rostige Nägel klirrten auf den Steinboden.
Nun wird ja alles gut werden. Gold wird da sein in Hülle und Fülle, den Pestkranken Lazarette zu errichten, niedergebrannte Städte neu aufzubauen, die Kriegsschulden des Kaisers zu bezahlen dafür, daß man sich König nennen darf draußen vor den Grenzen des Reiches. Mein Sohn ist in herrliche Zeiten geboren! Mein Vater ist Midas, dem die Welt zu Golde wurde!
Das redete der Königssohn vor sich hin, und dabei geschah alles, eine Alchimistenküche herzurichten, der es an nichts mangelte.
Noch vor der Taufe des kleinen Prinzen sollte der Versuch des Goldmachers stattfinden. Daß der Kronprinz selbst ihn vorbereiten und ihm vorstehen durfte, hing mit Geburt und Taufe des Stammhalters eng zusammen. Was war für König Friedrichs Freundlichkeit selbstverständlicher als die Gewährung einer, nein, jeder Bitte, die der junge Vater nach der Geburt des nächsten Thronfolgers an ihn richtete?
Friedrich I. hätte seinen Einzigen besser kennen müssen. Er glaubte, mit einer Verstärkung der kleinen Wusterhausener Kronprinzentruppe davonzukommen. Und vielleicht würde noch die Erhöhung seines militärischen Ranges von dem Sohn in Frage gezogen werden.
Aber nun hatte sich alles ganz anders entwickelt. Der Sohn hatte sich ausbedungen, den Grafen Gaëtano überwachen zu dürfen. Welch peinliche Angelegenheit für den Herrscher! Wie überlegen hatte doch der Graf gelächelt, als der König ihn auf die Absonderlichkeiten seines mißtrauischen Sohnes vorzubereiten suchte.
Gerade durch diesen Argwohn der Königlichen Hoheit, hatte der Graf ihm weltmännisch versichert, gerade durch die Überwachungsmaßregeln des Kronprinzen hoffe er seine Leistung in desto helleres Licht setzen zu können. Er selbst, fügte er mit allem Respekt hinzu, sei auch ein solcher Feuerkopf gewesen; nur jungen Feuerköpfen gelinge später Außergewöhnliches; kurzum, er hatte die Majestät die Peinlichkeit solcher Unterredung kaum spüren lassen. Das verpflichtete ihm den König sehr. Denn Friedrich I. haßte nichts derart wie unangenehme Situationen. Die Vorgänge seines Tages waren nach einem feierlichen Zeremoniell festgelegt. Wo sollten da die Widrigkeiten des Lebens einen Raum behalten?
Jenes Zeremoniell half dem König aber gerade auch die unabweisbaren Schicksalsschläge ertragen. Er hatte zwei Gattinnen und einen Sohn verloren. Er verklärte ihren Tod. Mit seinem Volke feierte er an den fürstlichen Bahren Feste des Todes mit Fahnen von schwarzem Samt und Fackeln auf Leuchtern von Alabaster und Porphyr. Auch war er zum Sieger über die Vergänglichkeit geworden, begründete er doch eine gelehrte Akademie, um den Unsterblichen im Reiche des Geistes eine Heimstatt im neuen Lande Preußen zu schaffen.
Graf Gaëtano interessierte sich lebhaft für diese Königliche Akademie der Wissenschaften. Ob auch Naturgelehrte sich unter ihren Forschem und Weisen befänden, die man teilnehmen lassen könne an der Entdeckung des Steines der Weisen?
Den König schauerte es, wenn er an dieses zurückliegende Gespräch und das Ereignis, das bevorstand, dachte; Majestät hatten viel Zartes und Empfindsames an sich. Das und nichts Geringeres lag vor dem ersten «König in Preußen»: in seinem jungen Königreich würde für alle Welt, für alle Zeit der Stein der Weisen, das Geheimnis Gold zu machen, gefunden werden! Der ärmste und jüngste König Europas sollte ein Herrscher größer denn Salomo sein, zu dessen Zeiten man das Silber für nichts achtete. Er würde sein Volk beglücken, wie noch nie ein Volk beglückt worden war. Die Armut sollte in seinem Lande nur noch eine Drohung sein, ungeratene Kinder zu erschrecken und zu mahnen. Alles Böse würde allmählich erlöschen, denn wo des Goldes kein Maß und Ende mehr war, hatten Verbrechen und Haß den Sinn verloren. Das Gold war die Tugend. Wie hätte man auch sonst die Kunst, es zu schaffen, den ¡Stein der Weisen nennen können? Der König empfand edel. Graf Gaëtano bestätigte es ihm ergriffen, und der König war entschlossen, ihn nun endgültig als Weisen in den Mächten der Materie und des Geistes zugleich in seine Akademie zu berufen. Da aber die Einführungsfeierlichkeiten für dieses Jahr bereits stattgefunden hatten und zur Zeit kein freier Platz verfügbar war, den der Graf nach den Gesetzen dieser erlauchten Gesellschaft hätte einnehmen können, ernannte die Majestät den Conte vorerst zum Generalmajor der Artillerie ohne Dienst. Nur daß der König bei solcher Erinnerung im Gedanken an seinen Sohn von einem unbehaglichen Gefühl nicht freikam.
Seit Friedrich Wilhelm zum Staatsrat zugelassen war, zeigte er manchmal eine geradezu verhängnisvolle Art, Zwischenfragen zu tun, die einen beinahe aus der Fassung bringen konnten. Sechs Jahre ging es nun schon so. Den Fünfzehnjährigen hatte der König in schöner Geste und Floskel zu den Beratungen der Minister hinzugezogen, und der junge Mensch machte sich seitdem einen Zwang daraus und versäumte keine Sitzung. Ja, mitunter nahm er bei aller Achtung vor dem König dem Vater das Wort aus dem Mund und gab, ohne daß die Majestät noch widersprechen konnte, der ganzen Verhandlung eine völlig andere Richtung als geplant war. Manchmal wußte man nicht, wer hier der Vater, wer der Sohn war. Fest stand nur, daß der Herrscher mitunter den Thronfolger, niemals aber der Kronprinz den König fürchte. Man bangte sich vor seiner mißtrauischen Art, die man von Kindheit an bei ihm wahrnahm; man bangte sich auch namentlich vor seinem kriegerischen Geiste, der sich nun auch im Staatsrat offenbarte. Der Unterricht in den Fächern der Kriegswissenschaft war darum immer weiter eingeschränkt worden; denn allein schon um dem Prinzen die lateinischen Konjugationen einprägen zu können, hatte sein Lehrer Rebeur sie ihm als Armeen auf marschieren lassen müssen, weil er ja so sehr für den Krieg wäre. Jeder Modus war ein Regiment, jedes Tempus eine Kompanie; die Gerundive waren Marketender, die Infinitive und Futura waren Tamboure wegen des «rum» und «rus». Seinen Ephorus Cramer aber hatte bereits der Siebenjährige als Lehrer abgelehnt, einmal weil er einäugig, dann aber, weil er ihm zu «effeminiert» war. Während Cramers Unterricht warf der Prinz sich auf ein Ruhebett, las oder schlief, da Cramer ihm zum Munde redete, im übrigen aber über seine militärischen Interessen hinweg unterrichtete.
In den fremden Residenzen war schon dies und das über den jungen Wilden durchgesickert, und die verstorbene Mutter hatte sich einst alle Mühe gegeben, seine Härten zu mildern und ihn durch verzweifelte Dispute über Bücher für die Große Welt zu retten. Denn er lauschte von der frühesten Knabenzeit an den Pferdeknechten und Domestiken ihr grobes Deutsch ab, obwohl er das artigste Französisch sprach, das einer sich nur denken konnte.
Sonst ahmte er die gemeinen Soldaten nach, rauchte Tabak, fluchte, band sich einen Riesensäbel um und redete mit Vorliebe die niedrigsten Soldaten an, und zwar in ihrem Umgangston. Alle Frauen, auch die eigene Stiefschwester, nannte er Huren. Wenn er nicht fluchte, sprach er schnarrend, leise, kurz und abgerissen, sprach überhaupt ungern; fand er eine Antwort nicht, so runzelte er die Stirn; beim Sprechen nahm er stets, wie ein kleines, verängstetes Kind, den Daumen in die linke Hand; aber es kränkte ihn aufs tiefste, als sein großer Degen einmal durch einen passenderen, kleinen ersetzt wurde. Er ging einwärts, lief mit unsauberen Handschuhen und ungeputzten Zähnen umher; und immer hatte er Hunde um sich, gleichgültig, ob sie dem König Möbel und Gärten verdarben oder nicht. Im Zimmer ging er lieber durchs Fenster als durch die Tür, und in den Räumen des Vaters durfte er sich überhaupt nur aufhalten, wenn er das ausdrückliche Versprechen gab, nichts darin zu verderben. Einen Entrüstungssturm rief es hervor, daß der Prinz im Schloß mit Reitstiefeln umherging, statt in leichten, eleganten Schuhen, wie die gesamte Hofgesellschaft es ausnahmslos tat. Auf die Schleppen der Damen hatte er es ebenso abgesehen wie auf die Schienbeine seiner markgräflichen Onkel. So hatte es seinen guten Grund, daß die Königin, weilte sie in Berlin, den Sohn täglich einmal sehen wollte; hielt sie sich aber auf ihrem geliebten Lietzenburger Schloß Charlottenburg auf, so mußte er doch wenigstens einmal in der Woche zu ihr hinauskommen. Dafür hatte er einen eigenen kleinen Wagen, mit dem er auch wirklich regelmäßig zu antikischem Dialoge nach Lietzenburg und den er endlich auch in Trümmer fuhr. Ritt er aber, so umgab man ihn angstvoll mit vier Wächtern; denn der Knabe nannte sich selbst zwar dick und verschlafen, war aber in seiner, ihm selbst immer viel zu geringen Tollkühnheit so zart, daß er unter der geringsten Hitze sehr litt, zu jäh sein Gewicht verlor, rasch in hohes Fieber fiel und dauernd quälende Kopfschmerzen zu verschweigen hatte.
Sorgfältig wählte Königin Sophie Charlotte alle Lektüre für ihn aus; immer wieder griff sie auf Fenelons «Telemach», den schwärmerischen Fürstenspiegel, zurück. Friedrich Wilhelm wollte — abgesehen von der Selbstüberwindung, die er an ihm anerkannte — ganz und gar kein Telemach in Fenelons, der Königin und ihrer bewunderten Antike Sinne werden und wartete bei den wöchentlichen Dialogen mit seiner Mutter recht beharrlich mit demselben Satz aus Xenophons moralisch-politischen Schriften auf; was dort vom rastlos tätigen König Kyros ausgesprochen wurde, bedeutete ihm die höchste Weisheit aller Bücher: «Die sichersten Mittel, einem Volk, einem Land, einem Königreich eine dauerhafte Glückseligkeit zu verschaffen, sind ein Heer auserlesener Soldaten und eine gute Wirtschaft der Bürger.» Allenfalls wollte er Titus sein: der küßte die Guten und bedachte die Bösen mit Nasenstübern. Die Guten aber waren dem Knaben die Fleißigen und Geringen, die Bösen die Vornehmen und Müßiggänger. Darauf gab man bei Hofe acht; ein Schneider hatte bei dem Thronfolger den Vortritt vor einem Baron.
Der Prinz verstand nur wenig von der Meinung seiner Eltern, daß Gold einen Besitz erst bedeute als Fest oder Kunstwerk oder geistige Schöpfung. Der Zehnjährige schon führte zum Entsetzen der hohen Familie und ihrer Höflinge ein Kontobuch, dem er die Aufschrift gab: «Rechnung über meine Dukaten.» Er schien nur das Rechnen gelernt zu haben—und war doch immer ein ganz besonders schlechter Rechenschüler gewesen. Alles war in seinem Kassenbuche vermerkt: die Neujahrsgeschenke an die Dienerschaft genauso wie eine gelegentliche Anleihe von einem Taler bei dem Küchenmeister Jochen, der Preis für ein paar junge Füchse genauso wie Ausgaben für Blumen und Farben zum Malen. Damit trieb er es eigentlich recht arg. Lediglich die Großmama in Hannover lachte darüber, und man wußte nicht gewiß, ob über den kleinen Geizhals oder die dauernde Wiederkehr eines Postens junger Füchse, Hasen und Farbentöpfe. Sie, die schon den Neugeborenen, Starken, Gesunden gleich nach der Geburt nach Hannover zu entführen gedachte, schien ihn mit anderen Augen zu sehen als das hohe Haus und der Hof.
«Er weiß die Details von alles, er weiß wie ein Dreißigjähriger zu reden; idwedem sagt er etwas Obligants», so schrieb sie von dem dreizehnjährigen Gast auf ihrem Lieblingsschlosse Herrenhausen, «er sieht aus wie man die Engeltien malt, hatt ein Hauffen blundt her; wan die frisirt sein, sieht er aus wie man Cupido malt.»
Seltsamerweise hat auch Leibniz, der große philosophische Freund der Mutter, mit solcher Zartheit von ihm geurteilt — und mußte doch eigentlich bangen für den weisen Erziehungsplan, den er für den jungen Wilden auf gestellt hatte!
Schließlich mußte aber auch die Königin, die verschwenderischste, leichtsinnigste, schöngeistigste aller Mütter, den jungen Wilden über alles geliebt haben. Denn als der Siebzehnjährige seine Prinzenreise an die fremden Höfe antrat, die Fahrt nach Brüssel, Holland und Italien, stand in ihrem Tagebuche ein einziges trauriges «parti». Doch schien ihr die Große Tour des jungen Herrn aus hohem Hause der letzte Versuch, seine Rauheit zu glätten.
Nach dieser Reise sollten Mutter und Sohn sich nicht Wiedersehen. Die Königin starb nach ihrem großen Karneval, um dessen Freuden sie sich durch Krankheit nicht betrügen lassen wollte. Das Leben war ihr Traum und Feier und Gedanke gewesen. Lesend, musizierend, diskutierend, tanzend und für ungefährliche Liebschaften schwärmend, hatte sie es hingebracht. Nach dem Tode der Mutter wurde Friedrich Wilhelm sichtlich noch schroffer. Der König war seitdem um den Sohn sehr besorgt. Nur jetzt, in den Ereignissen um Gaëtano, hätte der König ihn mehr als nur «parti» gewünscht, um bloß den Unannehmlichkeiten bei der Begegnung zwischen dem Kronprinzen und dem Conte enthoben zu sein.
Friedrich I. zog, als bedeute es Abwehr und Schutz, seinen Zobelmantel fest um die Schultern und Hüften, daß man die Seide knistern hörte, mit der er gefüttert war. Der Hofmarschall war froh, daß der König sich nach so langem Sinnen wieder regte. Solange die Majestät in düstere Gedanken versunken schien, wagte der Marschall nicht zu sprechen; und ihn beschwerten so dringliche Fragen. Endlich wandte ihm der Monarch sein lockenschweres Haupt wieder zu, und über seinen Zügen lag die alte Freundlichkeit. Der Herrscher sah es ein. Die Sorgen des Oberhofmeisters waren nicht leicht zu nehmen. Wie hatte man die Stätte des alchimistischen Laboratoriums, für die der Kronprinz nun einmal eigensinnig die alte Gesindeküche bestimmte, für den königlichen Zuschauer und seine Gäste herzurichten? Welche Treppen durften Majestät benützen, wenn sie zum Keller hinabschritten? Welcher Anzug war für solchen Anlaß angebracht?
König Friedrich gab sich äußerst vertraulich. Er sei ebenfalls ratlos. Man möge sich mit der Prinzessin von Brandenburg-Ansbach, die als liebster Gast bei Hofe weilte, ins Benehmen setzen. Die wisse in solch schwierigen Lagen stets einen Ausweg. Die habe, von der verstorbenen Königin selbst für das Hofleben erzogen, das feinste Gefühl für derartige Besonderheiten.
Die Ansbacherin half. Mit ihren großen, grauen Augen sah sie einen Augenblick den König schweigend an. Dann war, wie immer bei ihr, die Lösung schon gefunden. Der Akt in der Gesindeküche sei eine Angelegenheit der Forschung und müsse in allem Ernste vor sich gehen.
Friedrich I. empfand beglückt, daß er sich immer und in allem auf das Geschick und die Klugheit jener jungen Kusine verlassen durfte. Er war entschlossen, sie mit einer kleinen Statue aus lauterem Golde zu überraschen. Das Kunstwerk sollte sie selbst als Pythia am Delphischen Orakel darstellen; es würde entzückend werden; er sah es vor sich. Immer war der Spruch der Ansbacherin unfehlbar, und vor noch schwereren Aufgaben hatte sich die Sicherheit ihrer Entschlüsse bewährt. Selbst Friedrich Wilhelm, ihn, der unbeeinflußbar schien, hatte sie allein zu lenken vermocht; und das in den schwersten Wirrnissen und Widerständen, denen des Herzens.
Es war schwierig gewesen mit dem Kronprinzen und den Frauen. Den Versuch der Mutter, ihn nach der von ihr her auf beschworenen, schmerzvollen Knabentorheit ein zweitesmal durch anmutige Liebesgeschichten gefügiger zu machen, trat er mit offener Ablehnung und unverhohlenem Spott entgegen. Die Verführung durch das Fräulein von Pöllnitz, von der Königin veranlaßt, reizte ihn zu maßlosem Zorn und stürzte ihn in tiefste Scham. Kam er von den Festen der Mutter aus ihrem neuen Schloß Charlottenburg, für die Königin und ihre Damen wie ein Kavalier gekleidet, warf er Brokatrock und Perücke zornig in einen Winkel und trat die weiße Lockenpracht mit Füßen. Die Diener berichteten es zuverlässig.
Verlangte es aber die höfische Sitte, daß jüngere Damen des Hofes der kronprinzlichen Hoheit die Hand küßten, so errötete der breitschultrige junge Mann über das ganze Gesicht.
Aber dann war des Vaters Ansbacher Kusine zum Berliner Karneval gekommen: liebenswürdig an allen Veranstaltungen des hohen Vetternpaares Anteil nehmend und doch ein wenig abwesend in ihren Gedanken; mit hellen, leuchtenden Augen und dennoch einem ernsten Schatten um die Lider; mit einem süßen und sehr weichen, jungen Mund, doch einer Stirn von männlicher Kühnheit. Und plötzlich errötete Kronprinz Friedrich Wilhelm nicht mehr vor den jungen Damen des Hofstaates, sondern nur, wenn die Ansbacher Brandenburgerin ihn ansah, flammte die jähe Röte über sein weißes Gesicht, dessen Zartheit er haßte.
«Sie sind mein Neffe, gewiß», bemerkte lächelnd die Ansbacherin, «aber ich bin kaum fünf Jahre älter als Sie, und Sie tun mir fast ein wenig zu viel Ehre an.»
«Sie haben sehr groß gehandelt, Madame», antwortete er, und seine Stimme war nicht rauh und schnarrend wie sonst; die Röte war wieder verflogen.
Aber nun trieb es der Ansbacherin das Blut in die Wangen. Denn war sie auch die Ältere, so war sie doch sehr jung. Er sprach von der spanischen Affäre!
Friedrich Wilhelm fuhr ruhig fort: «Um des evangelischen Glaubens willen auf die Krone Spaniens, ja, die Hoffnung auf den Thron der deutschen Kaiserin, zu verzichten, dazu waren unter den Fürstentöchtern nur Sie fähig.»
Der Ansbacherin entging es nicht, daß das gewählte Französisch, das der preußische Thronfolger sprach, einen besonderen Klang hatte. Aber es war mehr der Ausdruck, den er seiner Rede gab, was sie so anzog. Der Kronprinz war so voller Widersprüche und in all den Gegensätzen seines Auftretens und Wesens so bezwingend, wenn man nur nicht sein Leben an den Unsteten zu heften brauchte; wenn man nur nicht seinen eigenen Willen unter seinen Starrsinn beugen mußte; denn der Wille galt der jungen Fürstin viel.
Sie sah ihn lange an, und dabei gewann sie ihre Festigkeit und Kühle wieder. Er hatte die ernstesten und klügsten Augen, in die sie je blickte, und schmale, lange, feste, leicht gebräunte Hände, wie sie im Brandenburgischen Hause vor ihm noch keiner besaß.
Als ihr dann der Prinz von seiner Liebe zu sprechen begann, hatte die Ansbacherin von seinen Händen und Augen schon Abschied genommen. Es war nicht nötig, daß der Generalmajor und Obermundschenk von Grumbkow ihr die Gründe der Staatsräson auseinandersetzte. Niemals hatte er, der nur für die unentwirrbarsten Geschäfte bemüht wurde, es leichter gehabt. Die Ansbacherin nahm ihm die Worte von den Lippen, ehe er sie aussprechen konnte. Ihm blieb nur übrig, zu bewundern, anzuerkennen und im Namen Seiner Majestät zu danken.
Zwei Tage, nachdem ihre Entschlüsse gefaßt waren, redete Friedrich Wilhelm die Ansbacherin plötzlich deutsch an. Sie wüßten beide, daß ihr Weg nicht wie der anderer junger Leute sein könne; zwischen ihnen bedürfe es keiner diplomatischen Spiegelfechtereien. Wenn sie sich trennen wollten, so sei es immer noch allein zwischen ihnen selbst auszumachen. Er schloß: «Es geht um unsere Häuser, unsere Liebe.»
Einen Augenblick kam es über die Prinzeß, daß sie an seine Brust sinken wollte. Doch blieb sie ruhig stehen, lächelte und meinte nur: «Mein ältester Neffe ist der unverständigste. Er kennt noch nicht einmal die Spielregeln unserer Höfe. Dieser eine Satz durfte nicht mehr gesagt sein.»
Don Domenico Gaëtano Conte di Ruggiero aus dem Königreich Neapel fuhr zu seiner Probe vor. O nein, der König brauchte es nicht zu bereuen, daß er ihm das Fürstenhaus am Friedrichswerder, das sonst nur fremden Fürstlichkeiten auf getan wurde, als Quartier eingeräumt hatte. Der Conte trat durchaus wie einer dieser großen Herren auf.
Hundert Dukaten verbrauchte er die Woche. Seine Kutsche war reich verziert mit Gold, und seine zwanzig Pagen, die ihn mit zwei oder drei Dutzend Pistolen bewachten, trugen eine Livree von Scharlach mit leuchtend gelben Samt auf Schlägen.
Auf alles Beiwerk des berühmten Magiers hatte der Graf jedoch verzichtet; er wählte einen Brokatrock, verschmähte den Alchimistenmantel, und all sein Zaubergerät bestand in ein paar Fläschchen, Retorten und Mixturengläsern. Auf einem Silbertablett wurden sie ihm in verschlossenem Kasten vorangetragen.
Gaëtano ließ sich nicht das leiseste Erstaunen anmerken, daß man ihn nicht die breiten Treppen zu den Audienzsälen hinauf führte, sondern tiefer und tiefer nach unten geleitete. Zum Schluß waren es so schmale und gewundene Stiegen, daß man sie nicht mehr hatte mit Teppichen belegen können. Aber Majestät würden auch geruhen, sie zu benützen, versicherte ihm der Hofmarschall.
Der König traf auch kurz nach dem Italiener ein, begleitet nur von den Höchsten seines Hofes, den Grafen Wartenberg, Wittgenstein und Wartensleben, den markgräflichen Brüdern sowie den berühmtesten Professoren seiner Akademie. Als die Majestät sich niedergelassen hatte, winkte der Kronprinz, man möge auf ihn keine Rücksicht nehmen und seine Plätze wählen. Er selbst stand in Wams und Schürze am Ofen. Die Herren Markgrafen setzten sich sofort; sie waren sehr gespannt und wünschten, daß die Vorführung sofort beginne. Die Herren Markgrafen hatten eine außerordentliche Vorliebe für dergleichen. Es kam ihnen gar nicht einmal sehr zum Bewußtsein, daß es hier um die Auffindung des Steines der Weisen ging. Ein wenig entsetzt waren sie nur, daß man den Keller wirklich allein mit einem Prunksessel und ein paar Armstühlen hergerichtet hatte.
Doch Graf Gaëtano bot ihnen kein prunkvolles Schauspiel. Er ließ keine Tribüne auf stellen und mit figurenbestickten Tüchern Überhängen. Er baute ihnen keine Hexenmeisterküche hin, ließ nicht von Dienern und Adepten rätselhafte Gegenstände und schlösserverwahrte Truhen herbeischleppen. Er versank nicht in schweigendes Grübeln und mied die klingenden Beschwörungsformeln. Lediglich sieben Pfund Quecksilber und mohnsamengroße Körner von Kupfer wurden in eine gläserne bauchige Flasche gegossen und in der Sandkapelle des Windofens vor aller Augen abgestellt; und auf einer Tafel waren alle Testimonia publica und Patente ausgebreitet, nach denen der Magier das Gold nicht nach Loten und Unzen, sondern zu zwanzig und dreißig Pfund zu produzieren imstande war.
Lebhaft plaudernd, dabei mit aufmerksamer Bescheidenheit die Fragen und Gegenreden König Friedrichs abwartend, saß der Graf neben der Majestät. Der Lakai stand mit dem silbernen Tablett an seiner Seite. Das Kästchen war jetzt geöffnet, der Goldmacher ließ sich diese und jene Phiole mit einem Arcanum oder Spiritus vini rectificatissimi und der Tinctura universalis, die nur er besaß, reichen und war bei alledem eigentlich eifrig damit befaßt, das Wunder, das er vollbringen würde, von vornherein zu entzaubern. Er pries mehr die chemische Wissenschaft, als daß er Schauer einflößte vor seinen Mixturen. Er leitete mehr zu den letzten Schlüssen der Logik, als daß er seine geheimen Kräfte ahnen ließ. Die erst ein wenig inquisitorischen Fragen der Herren Professoren verwandelten sich sehr bald in nahezu ehrfürchtige Erkundigungen. Der König in seinen weißen, wallenden Locken und im weichen Faltenwurf seines himmelblauen Mantels schien in einer Wolke des Glückes und der Erkenntnis zu ruhen. Er hatte seinem Sohne längst vergeben, ja, er nickte ihm bei den Erklärungen des Grafen freundlich zu und sagte einmal über das andere: «Da — Sie sehen es, mein Sohn — Sie hören selbst.» Dabei gestikulierte er lebhaft. Seine Ringe funkelten. Die weichen Spitzen um die Handgelenke flatterten.
Der Kronprinz stand unbeweglich vor dem Herd. Jede Bewegung und jedes Wort des Italieners verfolgte er mit nicht aussetzender Aufmerksamkeit. Graf Gaëtano besaß die Höflichkeit, sobald er dem König Rede und Antwort gestanden hatte, auch zu dem stummen Prinzen hinüberzusprechen. Ganz nebenbei, ganz zwischendurch fragte er dann einen Diener, wie lange das Feuer schon brenne.
Friedrich Wilhelm mischte sich ein. «Seit zwei Stunden. Ich selbst habe die Kohlen aufgeschüttet. Ich selbst werde den Blasebalg bedienen, um Ihnen nahe zu sein, Graf. Ich selbst habe die Tiegel, den Lehm und das Kupfer besorgt, das Sie verlangten.»
«Ich danke Euer Königlichen Hoheit für alle diese Anteilnahme» — der Graf verneigte sich im Sitzen —, «aber wenn Hoheit die Vorgänge nahe neben mir verfolgen wollen, müssen Sie geruhen, hier an meiner Seite Platz zu nehmen. — Tu Er Lehm in den ersten Tiegel», befahl er dem nächsten Lakaien. Aber der Kronprinz breitete seine Hände vor das Werkzeug. Er tat selbst, was Gaëtano gebot. Bald ließ der Goldmacher, mit dem Friedrich Wilhelm sich überaus schnell zu verständigen schien, alle weitschweifigen Höflichkeitsbezeigungen. Knapp gab er seine Anweisungen; rasch und genau führte der Königssohn sie aus. In schneller Folge ließ Gaëtano dem Kronprinzen Mixturglas um Mixturglas reichen, sie prüfen, in den zweiten Tiegel gießen. Danach hatte Friedrich Wilhelm das eine Ende der Kupferstange in den Tiegel mit dem Lehm zu tauchen. Der Münzmeister sollte sich bereit halten; der war der Prüfer des Goldes.
Der Graf erhob sich — leicht, unbefangen, behende. Er nahm das letzte, das kleinste Fläschchen von dem Tablett. Als die Blicke des Kronprinzen ihn nahezu verschlangen, hielt er einen Augenblick lächelnd ein.
Die Züge König Friedrichs wurden schlaffer. Der König war sehr bleich. Die drei Minister Wittgenstein, Wartenberg und Wartensleben hatten sich erhoben und standen hochgereckt hinter der Majestät, stets das gleiche Bild ehrfurchtgebietender, aber recht gefährlicher Einmütigkeit. Die Herren Markgrafen wurden wieder aufgeregter. Sicher, jetzt gab es endlich etwas zu sehen! Wenn nur der Italiener den Neffen sichtlich demütigte!
Friedrich Wilhelm befolgte schweigend die Befehle des Magiers. Er senkte die Kupferstange mit dem vom Lehm nicht bedeckten Ende in den Tiegel, in dem die Mixturen schäumten. Er ließ keinen Blick von dem Werk. Das Kupfer blieb rot.
Der Graf trat dicht neben ihn. Er drehte den Glasverschluß seines Flakons auf und träufelte, als wäre es nur ein zartes Parfüm, einige Tropfen in den Schaum. Der Kronprinz hielt die Stange ganz ruhig. Das Kupfer blieb rot.
Alle umdrängten sie wortlos den Herd. Der König hatte tiefe Schatten um die Augen. Die redseligen Herren Markgrafen brachten keinen Laut über die Lippen. Das Kupfer blieb rot.
Graf Gaëtano reichte dem Kronprinzen ein kleines Messer und ließ ihn die Lehmkruste vom oberen Ende des Barrens lösen. Die weichen Schichten des abgeschälten Lehmes zischten auf dem Herde. Der König schlug die Hände vors Gesicht. Die Markgrafen hielten einander umklammert. Der Graf sagte etwas heiser: «Hoheit — ich danke.»
Friedrich Wilhelm schloß die Augen vor dem übermächtigen Glanz des Goldes, das er nun in Händen hielt. Er ließ den Barren auf die Herdplatte sinken. Halb war es Kupfer, halb war es Gold.
«Es kann nicht sein, Graf.»
Gaëtano kam zu keiner Antwort. König Friedrich zog ihn an seine Brust. Da schob der Kronprinz das Häuflein der Markgrafen beiseite und stürmte die Kellertreppe empor. Wohin — er wußte es nicht. Er fand sich selbst erst wieder, als er an der Wiege seines Sohnes stand und die Kronprinzessin, aus dem Nebenzimmer tretend, ihn mit einem erstaunten «Sie hier?» wie aus Traum und Fieber weckte.
«Es ist Gold», stammelte Friedrich Wilhelm, «und das kann nicht sein.»
«Danken Sie Gott, daß es Gold ist. Sie brauchen einmal Gold.»
Der Kronprinz starrte die Gattin fassungslos an. Aber er nahm nur wahr, daß sie ein ganz aus Goldstoff gewirktes Kleid trug, einen überaus weiten und reichen Rock ganz von lichtem Golddamast, mit Vögeln und Blumen von dunklerem Golde übersät.
«Sie bringen sich selbst um eine Überraschung: mein Kleid für die Taufe.» Die Schöne lächelte und fuhr sich verlegen, dabei aber doch ein wenig kokett über ihr Haar. Denn sie hatte die Perücke noch nicht auf gesteckt, und der Gatte sah ihre braunen Locken.
Friedrich Wilhelm wischte die Hände an seiner groben Schürze ab und streckte die Arme nach seiner jungen Frau aus. Er klagte tonlos und war, wie ein Unbeteiligter, fast verwundert, daß er nicht stöhnte: «Nun ist ein Unglück geschehen, das vielleicht nie mehr gutzumachen ist.»
Frau Sophie Dorothea wandte sich kühl ab. «Ich verstehe Sie nicht. Der Stein der Weisen ist gefunden. Kleiden Sie sich um. Begeben Sie sich mit mir zum König, ihn zu beglückwünschen. Lassen Sie mir Graf Gaëtano vorstellen.»
Die Feier des Goldes sollte nun zugleich zum Fest des königlichen Kindes werden. Die Stunde voller Gewalt und Tiefe war Ereignis geworden: dem ersten im Königspurpur geborenen Hohenzollern würde der Stein der Weisen als Gabe des Tauftages dargebracht werden.
Der Kronprinz hatte sich den väterlichen Wünschen gefügt. Die Kammerdiener stürzten mit Perücke, roten Schuhen, Scharlachmantel und Schmuckkasten herbei. Sie zogen ihm den Brokatüberwurf fast zu eilig über Kopf und Schultern. Der Kronprinz prüfte vor dem Spiegel kurz und aufmerksam, was man ihm anlegte. Der Schärpe gab er einige andere Falten. Die Perlenagraffe, die den Mantel an der Schulter hielt, steckte er um eine Kleinigkeit schräger. Die Locken der Perücke strich er weiter aus der Stirn zurück; die Hände erhielten einige Tropfen eines orientalischen Balsams. Er lächelte ein wenig über das Erstaunen der Diener. Und in all dem fremden Tun schlug sein Herz doch rascher und voller, weil all das Ungewohnte für seinen Sohn geschah.
Von der Mittagsstunde an wurden auf den Wällen die Kanonen gelöst. Der königliche Festzug begab sich auf dem im Winter blumenübersäten Wege zum Dom. Der Donner der Kanonen überklang die Glocken, der Wirbel der siebenhundert Trommeln übertönte die Orgel. Den langen Gang vom Tor zum Altar standen die Reihen der Schweizer gar de in goldverbrämten Mänteln und straußenfederüberladenen Hüten. Die Trommelstöcke flogen, kaum mehr sichtbar, in ihren Händen. Es war ein unfaßbarer Glanz über dem Dom. Von allen Emporen der Kirchenhalle wehten Fahnen. Der Altar baute sich zu einer Kerzenpyramide auf; der Zug der Gäste, zu ihm schreitend, war ein goldener Strom.
Am goldenen Taufbecken auf der obersten Stufe hielt die Ansbacher Brandenburgerin das hohe Knäblein über sie alle empor. Um seine schwachen Schultern lag der schwere Purpur, auf seinem kleinen Haupte strahlte die Krone, in seine Ärmchen hatte man Zepter und Reichsapfel gedrückt, und über seiner Brust spannte sich das Band des Schwarzen Adlerordens mit dem glänzenden Stern.
Der Wirbel der siebenhundert Trommeln steigerte sich zu immer ehernerem Dröhnen, um plötzlich in fast unheimliche Stille abzubrechen. Friedrich Wilhelm hörte einen Augenblick das leise Weinen seines Kindes. Aber da sangen die Chöre zu Flöte, Harfe und Orgel, und wenn er sich ein wenig vorneigte, um das blasse, welke Gesicht des Täuflings näher zu sehen, blendete ihn die Fülle der Kerzen.
Das Wasser, mit dem das Kreuz auf die Stirn des Kindes gezeichnet wurde, war aus dem Jordan geschöpft. Die Tropfen verrannen mit den Tränen des Täuflings. Die Ansbacherin mußte ihn fester an sich drücken, das zitternde Köpfchen unter der Last der Krone zu stützen. Die Feier sollte noch sehr lange dauern. Gerade war erst der Name gegeben: Fridericus Ludovicus.
Im Taufspruch ließ der sanfte König dem ungebärdigen Kronprinzen eine herbe Zurechtweisung erteilen:
«Denn alle Dinge sind möglich bei Gott —», ein Bibelwort, vom Hofbischof mit vieler Weisheit auszulegen, mit Sinnbildern, Mahnungen und schönen Allegorien.
Der Kronprinz sah das Haupt seines Kindes, auf dem die Krone fest gebunden war, immer wieder nach hinten sinken. Nun hielt eine der Prinzessinnen vom Geblüt den Täufling. Der Kronprinz suchte die Möglichkeit einer Verständigung mit seiner Frau. Die Kronprinzessin hatte ihre Augen fest auf den Prediger gerichtet, ihre Gedanken auf den anschließenden Kirchgang der Wöchnerin sammelnd.
Friedrich Wilhelm bemühte sich, die Aufmerksamkeit seines Vaters auf sich zu ziehen. Doch der König umfaßte immer wieder mit weitem und verzücktem Blick das Bild des Prunkes und der Weihe. Nun verhüllten ihn die Fahnen ganz.
In der ersten Reihe der Herren des Hofes stand Graf Gaëtano, hervorgehoben vor allen durch das ihm neu verliehene Band des Schwarzen Adlerordens mit dem strahlenden Stern. Der Kronprinz, von der Krönung des Vaters her der erste Ritter des Ordens, öffnete die Spange, die des eigenen Sternes Schärpe an der Seite zusammenhielt. Er wußte, wenn er sich zum Verlassen des Domes anschickte, würde sie sich lösen und der Orden unter seine Füße fallen.
Wie es dann in der Ordnung des Gratulationszeremoniells möglich war, begriff der Kronprinz nicht. Aber die Ansbacher Brandenburgerin stand plötzlich nahe neben ihm und sagte leise: «Ich sah, daß sich die Spange Ihres Ordensbandes löste.» Dann küßte sie schon der Kronprinzessin die Stirn und die Wangen.
Erst zwischen Tafel und Ball fand der junge Vater einen Augenblick Zeit, selbst nach dem Kinde zu sehen. Sehr blaß lag es in seiner Wiege und schreckte im Schlaf oft zusammen. Friedrich Wilhelm nahm besorgt die schwere Hermelindecke von der Wiege und sah, wie der ganze kleine Körper immer wieder zuckte. Dabei lag doch der Knabe in so tiefer Stille; fast war es zu still.
Die Kinderfrauen hielten sich in einem der Vorräume auf. Der Kronprinz wies sie an, nachts abwechselnd bei dem Prinzen zu wachen und sofort Nachricht zu geben, wenn sie etwas Auffallendes im Verhalten und Zustand des Kindes bemerkten. Auch befragte er sofort einen der erreichbaren Ärzte.
«Er kümmert sich um alles», rügten die Kinderfrauen streng, als der Kronprinz, den Leuchter in der Hand, sich entfernt hatte.
Auf dem Ball war seine Anwesenheit nicht mehr lange erforderlich. Die königliche Familie zog sich früh zurück. Friedrich Wilhelm konnte sich zeitig zur Ruhe begeben. Es tat ihm not nach einer Nacht, die er nahezu schlaflos über alchimistischen Werken zugebracht hatte. Auch gedachte er am kommenden Tage schon in den ersten Morgenstunden aufzustehen, um sich genauer über die nächsten Pläne des Grafen Gaëtano zu unterrichten und engere Fühlung mit dem königlichen Münzmeister zu suchen, der das Elaborat des Italieners einwandslos als Gold anerkannt hatte.
Auf dem Ritt zum Münzamt nahm der Kronprinz einen Umweg. Jenseits des Schlosses und Domes schloß sich an den Lustgarten bald wieder ein häßliches und ärmliches Stadtviertel an, das der König und sein Hof allerdings bei ihren Ausfahrten niemals zu berühren pflegten. Die Winkel und Gassen dort im alten Kölln waren auch nur noch wert, zu verfallen und vergessen zu werden.
Aber noch lebten Menschen in ihnen, für die keine bessere Wohnstatt bereit war. Der Kronprinz faßte jede Einzelheit ins Auge; jeden umgebrochenen Zaun; jede windschief hängende Tür; die vom Sturm zerrauften, von der Feuchtigkeit und Kälte modernden Strohdächer; die schmutzigen Kinder, die sich an dem frostigen Morgen draußen umhertrieben, zaghaft zu dem vornehmen Reiter aufsahen und ihn ängstlich, darum nicht minder beharrlich anbettelten.
Ein hochgewachsener junger Mann hämmerte trotz des eisigen Nordwindes an einem Fensterladen herum, der, locker und gesprungen, in den Angeln knarrte; er suchte den breiten Riß im Holz mit einer Latte zu übernageln. Aber bei jedem Hammerschlag splitterte der Sprung nur weiter. Als der Mann den Reiter anhalten sah, legte er sein Handwerkszeug auf den Fenstersims, ging ins Haus und schlug die Tür hinter sich zu.
Friedrich Wilhelm sprang vom Pferde und schritt dem jungen Menschen rasch nach. Der öffnete nur zögernd die Tür.
«Warum hat Er seine Arbeit abgebrochen?» fragte der Kronprinz unvermittelt.
«Weil das Holz keinen Nagel mehr hält.» Die Antwort schien jede weitere Frage abzuschneiden.
Der Kronprinz blieb hartnäckig und fuhr fort: «Warum müht Er sich heute überhaupt mit derlei Dingen? Weiß Er nicht, daß dieser Tag noch für die Tauffeierlichkeiten auf dem Schloß bestimmt ist?»
Der junge Mann machte kein Hehl daraus, daß er die Hoheit erkannt hatte. Ohne jede Befangenheit, doch mit viel Bitterkeit sprach er weiter.
«Warum sind der Herr Kronprinz um diese Stunde hier?»
Er beschrieb am Fenster einen weiten Bogen um die armen Hütten und verkommenen Wege. «Hier ist kein Fest. Die Feiern sind drüben hinter dem Lustgarten.»
Der Kronprinz knöpfte an seinen Reithandschuhen. «Hör Er, die Feste werden auch hier bald beginnen. Eine neue und herrliche Stadt wird auch hier bald entstehen. Es gibt ja nun Gold.»
Der junge Mann zeigte sich vollkommen unterrichtet.
«Ja, Herr Kronprinz, Preußens letztes Gold in des Generalmajors Graf Gaëtano Tasche.»
Jetzt prägte Friedrich Wilhelm sich das Gesicht des Mannes genau ein. Seine Züge waren klar und klug. Aber die junge Hoheit sagte: «Er ist sehr kühn. Warum traut Er elender Untertan nicht dem, was seines höchsten Herrn und Königs heißester Glaube ist?»
«Weil Graf Gaëtano sich gestern nach der Tafel von des Königs Majestät fünfzigtausend Taler zusichern ließ für die neue Goldbrauerei.» Der junge Mensch beschrieb wieder einen Halbkreis um die Elendshütten vor dem Fenster. «Fünfzigtausend Taler, Kronprinzliche Gnaden.»
«Was schließt Er daraus?» Friedrich Wilhelm ließ sich auf den Holzschemel nieder, den der andere ihm blank gewischt hatte. Er riß seinen Mantel auf.
«Daß es mit den Künsten des Goldmachers nicht stimmen kann, Euer Gnaden. Wie könnte er sonst in Geldverlegenheiten sein.»
Der Kronprinz bezwang seine Unruhe. Er gab sich sehr kühl. «Woher hat Er Botschaft, was an der königlichen Tafel gesprochen wird?»
Die Bitterkeit in der Antwort des Mannes war größer als der Stolz seines Ausdruckes. «Ich habe nur zum Freunde, wer mir und meinesgleichen helfen kann. Die königlichen Küchenjungen können unsereinem schon gute Freundschaftsdienste leisten, wenn sie nur den Herren Tafellakaien öfter ein wenig gefällig sind. Freilich, manchmal wollen sie mehr sagen, als sie wissen. Dann muß man sorgfältig sondern; denn die Küchenjungen tun nun auch noch ihr Teil dazu.»
Er lächelte flüchtig. Friedrich Wilhelm sah ihn von der Seite an, den Knopf der Reitpeitsche an den Mund gelegt. Der junge Mann wartete keinen Einwurf ab. Mit einer hastigen Wendung zu der Hoheit hin rief er hell, fast scharf: «Aber hier ist nichts übertrieben. Aber hier ist alles wahr, Euer Gnaden.»
«Trotz Küchenjungen und Tafellakaiengeschwätz», fiel der Kronprinz ein und hatte eine tiefe Falte zwischen den Brauen, «— das ist wahr.»
Er streifte die Handschuhe über. «Wie heißt Er?»
Es klang trotz der rauhen, abgerissenen Sprechweise der jungen Hoheit nicht unfreundlich.
«Creutz.» Der einfache Mann verneigte sich mit großer Höflichkeit.
«Creutz», wiederholte der Prinz. Schon trat er aus der engen Kammer; und Name, Mensch und Schicksal waren ihm eingeprägt. Im Takte seines Rittes dachte er nichts mehr als die eigenen Worte: «Aber das ist wahr — das ist wahr —»
Woher nahm der Vater noch fünfzigtausend Taler für den Goldmacher? Er zahlte seinen Beamten die Gehälter nicht mehr und war seinen Großen tief verschuldet, die ihn ausgesogen hatten. Bei denen, die sich schamlos an ihm bereichert hatten, mußte er borgen.
Aber dem Sohne schlug er es mit hochmütigem, mitleidsvollem Lächeln ab, als er ihn bat, seinen kronprinzlichen Etat von fünfunddreißigtausend Talern herabzusetzen. Das sei ein kleiner Etat. Der Kronprinz von Preußen müsse doch Tafel halten. Der erste Kronprinz von Preußen dürfe doch nicht derart bürgerliche Wäsche, Manschetten und Krawatten tragen. Von seiner Tafel, heiße es, stehe man manchmal hungrig auf.
Ach, über Tafel und Krawatten! Er brauchte sein Geld zu Wichtigerem; und dies war nun sehr seltsam: genau die fünfzigtausend Taler hatte der Kronprinz gespart, die der Goldmacher vom König verlangte. Er hatte sie gespart, obwohl der eigene Vater ihm, noch als er Knabe war, schon über dreißigtausend Taler schuldete. Er hatte sie gespart, obwohl er gewaltige Mengen seines Knabentaschengeldes immer wieder in seine Miliz gesteckt hatte. Die war so angewachsen, daß er seine Leute in den Scheunen verstecken mußte, kam der Vater König einmal nach Wusterhausen hinaus.
Er war bereit, seine Ersparnisse dem König zu leihen — zu solch harter Kur. Er wollte auch nur eine einzige Garantie von ihm: den Sturz der drei Minister, den Sturz vor allem Graf Wartenbergs. Denn der war Oberkämmerer, Erster Staatsminister, Generalpostmeister, Generalökonomiedirektor, Oberhauptmann der Schatullämter, Oberster Stallmeister aller Gestüte, Protektor der Akademien und Erbstatthalter der oranischen Erbschaft; er war es ohne jede Kontrolle und mit unumschränkter Verfügungsgewalt. Die Gräfin — einst die Frau des Kammerdieners Bidekap und im Packwagen aus Emmerich mitgebracht — schickte Geld nach England, denn sie traute Preußens Zukunft nicht recht; der Graf kaufte Güter in der Pfalz. Ihre Tafel kostete mehr als die königliche.
Der König dankte. Der König lehnte ab. Der Kronprinz investierte über zwanzigtausend Taler in «Bau Wusterhausen, Garten und Landmiliz». So hatte die Preußische Krone ein schuldenfreies Gut. Der König pochte vor den Gläubigem auf seine oranische Erbschaft, gab dem Goldmacher Versprechen und hoffte.
Friedrich Wilhelm ersuchte den König um seine Entfernung vom Hofe.
Friedrich I. fand seinem Sohn gegenüber nur noch müde Gesten. Dabei war es doch durchaus kein ungebräuchliches Mittel, sich eines etwas schwierigen jungen Herrn für eine Weile dadurch zu entledigen, daß man ihn auf Reisen schickte. Aber selbst an diese Erwägung knüpften sich unangenehme Erinnerungen. Denn war der Kronprinz vielleicht auf die Große Tour gegangen, wie sie für Fürstensöhne üblich war? Hatte er sich etwa durch das Leben an fremden Höfen verfeinern lassen? Über Holland war er überhaupt nicht hinausgekommen. Und in Amsterdam hatte er lediglich die Polizei, die Armenhäuser, die Gefängnisse, Schiffe und Magazine besichtigt, in Leiden nur die Anatomie auf gesucht!
Aber gut, gut; mochte er doch wieder reisen auf seine Art. Im Augenblick war seine Abwesenheit nur zu genehm. Was er nur wünschte an Urlaub, Ermächtigungen, Empfehlungen, sollte ihm zugebilligt sein.
Aber der Kronprinz wollte gar nicht reisen. Er wollte in den Krieg nach Flandern; und in der Verfechtung dieses Planes entwickelte er eine rhetorische Gewandtheit, die man bis dahin noch nicht an ihm wahrgenommen hatte. Daß er dem Vater seinen Willen klarzumachen suchte in dessen eigener Sprache und von der Fürstentragödie redete, die um die spanische Erbfolge auf geführt werde: das entschied den Erfolg seiner Bitte.
Die überraschenden Redewendungen gefielen dem Herrscher. Sie waren nicht bäurisch, wie so vieles an dem Sohn. Die Majestät raffte ihren Mantel zusammen und erhob sich. «Reisen Sie meinethalben auch nach Flandern — ich gewähre es Ihnen gern. Reisen Sie zu meinen Truppen — nur quälen Sie mich nicht mit Ihrer Engherzigkeit, Verzagtheit, Ihrer Kleingläubigkeit.» Er wollte den aussichtslosen Kampf gegen seinen Sohn nicht weiterführen.
Die Kronprinzessin fand es angebracht, daß der Kronprinz sich nach der Taufe des Stammhalters nun auch den Truppen zeigen wollte. Solche Besuche bei der Armee waren abwechslungsreich und ungefährlich. Das wußte die junge Fürstin von Vater und Bruder, dem Kurfürsten und Kurprinzen von Hannover.
König Friedrich aber wurde plötzlich wieder besorgt um den einzigen Sohn; nirgends und niemals war er des vollen Einsatzes fähig. Er ließ dem Kronprinzen schriftlich einen Befehl zugehen, nach welchem er ihn zum Besuch der verbündeten Heerführer ins flandrische Hauptquartier entsandte, keineswegs aber in seiner Eigenschaft als Chef des Kronprinzenregimentes. Schreibend blieb der schwache Vater fest; der Begegnung mit dem Sohne wich er aus.
Der gesamte Hof glaubte, sobald der Aufbruch des Kronprinzen zur Armee bekannt geworden war, die junge Hoheit von dem Goldmacher in die Flucht geschlagen. Wer konnte ahnen, daß der neue Regimentsschreiber in der Wusterhausener Truppe des Kronprinzen ein Spürhund gegen Gaëtano war. Wer konnte wissen, wer der Schreiber Creutz war, wie sein junger Herr ihn fand und was er von ihm hielt.
Friedrich Wilhelm fügte sich den Wünschen des Vaters und Königs. Er hatte ja auch wirklich eine Fürstlichkeit im flandrischen Lager zu besuchen, freilich gerade einen großen Herrn, der am Berliner Hofe verfemt war: Herrn Leopold von Anhalt-Dessau.
Er hatte begonnen, all die Verbitterung zu verstehen, durch die sich der Fürst in den Kreisen des Hofes gar so unbeliebt gemacht hatte. Er fing an zu ahnen, warum der große General sich als Freiwilliger bei den brandenburgischen Truppen herumtrieb, obwohl ein Rangjüngerer das Kommando führte. Was noch groß war an Brandenburg, schien unlösbar an den Fürsten Anhalt-Dessau gebunden; er wollte nicht von seinem Werke lassen, die Truppen, die er vierzehn Jahre, in vierzehn Feldzügen für Brandenburgs Reichsdienst geführt hatte, ruhmreich zu machen. Er wollte nicht Berührung haben mit dem neuen Königshofe.
Der «Kronprinz in Preußen» und Kurprinz von Brandenburg brach nicht zur Armee auf, nur weil es ihm verdrießlich war, lediglich dem Titel nach Regimentschef zu sein. Der Kronprinz in Preußen ging, den Dessauer zu suchen. Vielleicht sah der mit seinen Augen, hörte der mit seinen Ohren, redete der mit seiner Zunge. Einer mußte doch noch sein! Man hielt sie voneinander getrennt!
Der Fürst von Anhalt-Dessau fuhr Friedrich Wilhelm entgegen.
Je mehr sie sich dem Lager näherten, desto stärker spürten der ältere und der jüngere Mann ihre Übereinstimmung.
Den letzten Teil der Reise hatten sie gemeinsam zurückgelegt. Der Kronprinz hatte nur wenig Kasten und Truhen als Gepäck bei sich. Er hielt sich nicht an das Feldlagerzeremoniell.
Dem Dessauer war es recht, wie der Thronfolger kam: zerstreut, wortkarg, noch ganz gefangen im Berliner Ärger. So, genau so, pflegte auch er selbst jedesmal vom neuen Königshofe zu kommen!
Aber heute war des Prinzen schlechte Laune bald wie weggefegt.
Der Tag war da, an dem sie nun die ersten Truppen sahen. Sie waren noch nicht sechs Stunden gefahren. Es war gegen Mittag. Eine breite, blitzende Welle kam ihnen den Hang einer Erhebung entgegen, dichte Reihen von Soldaten. Fern hinter ihnen wehten schmale Wimpel von hohen Lanzen, Zeichen der Zelte, deren graue Spitzen vor dem Horizont der Ebene zum Gebirge wurden.
Man schien dem Frühling näher. Über den Stämmen der kahlen Bäume war ein feuchter, grüner Schimmer, Hauch des Frühlings über altem Holz. Der Schnee war getaut.
Die Mannschaften scharten sich zu schmalen Kolonnen, als sie am Reisewagen der Fürstlichkeiten vorbeimarschierten. Der Fürst und der Kronprinz lehnten sich aus dem Schlag. Den Dessauer erkannte jeder Soldat. Aber die Ordnung der Gruppen durfte durch die Begegnung nicht gestört werden. Darauf achtete der Fürst; das wußten sie und wollten keine schlimme Begrüßung.
Nur den Marsch des Dessauers stimmten sie an, den Marsch der Schlacht am Ritorto und des Sieges von Cassano:
«So leben wir, so leben wir —»
Der Zug war lang. Andere Lieder des Feldzugjahrzehntes folgten.
«Prinz Eugen, der edle Ritter —»
«Marlborough s’en va-t-en guerre, mironton, mirontaine —»
«Auf ein Lied, das Ihnen gilt, Hoheit.» Der Dessauer beugte sich in den Sitz zurück und kramte eine Reiseflasche mit Schnaps hervor. Sie tranken ohne Becher, der Kronprinz nach dem Fürsten; dann wechselten sie ab. Friedrich Wilhelm hob die Reiseflasche wie ein schönes Glas.
«Für ein solches Lied gäbe ich alle Titel, Fürst.»
Der Trinkspruch des Dessauers griff dem Prinzen ans Herz.
Aber niemals ist ein Lied auf Friedrich Wilhelm gesungen worden.
An der Tafel begrüßte Prinz Eugen von Savoyen den jungen Prinzen und den großen General mit höflicher Rede. Er stellte den Dessauer dem jungen Brandenburger hier draußen im Lager gleichsam von neuem vor: «Der Fürst von Anhalt-Dessau hat mit den brandenburgischen Truppen Wunder gewirkt. Kein Preis ist zu hoch, wodurch ich ihr Ausharren erkaufen kann.»
Der Kronprinz wandte keinen Blick von dem herrlichen Manne, der so begeistert von des Dessauers Heerschar redete — dem Manne, den der Sieg wie ein Schatten begleitete. Nun sah er ihn, der nur in Feldlagern Hof hielt: Prinz Eugen, den edlen Ritter — den heldischen Zwerg! Oh, es war etwas anderes, als unter Höflingen zu weilen!
Aber wenn Prinz Friedrich Wilhelm glaubte, auch den Fürsten von Anhalt-Dessau im Lager aufleben zu sehen, wie er selbst es tat, so täuschte er sich. Der Fürst wirkte plötzlich sogar ungemein ernüchternd auf ihn. Sein braunes Gesicht war faltiger, als seine Lebensjahre glauben ließen. Seine grauen Augen beobachteten mehr, als daß sie feurig strahlten, wie man immer pries. Mit seinem anliegenden, knapp zusammengebundenen frühen Grauhaar und dem — an den Rang- und Standesgenossen gänzlich ungewohnten — kurzgeschnittenen Schnauzbart erschien Fürst Leopold fast streng und unfreundlich. Da begann der Kronprinz nachzuspüren und von Stunde zu Stunde mehr zu begreifen, wie die Heerführer auch im Felde noch an ihren Höfen litten, wie sie von Spionen ihrer Kabinette umgeben waren und, selbst wenn sie einig waren im Kriegsrat, der Verräter wegen einander zum Scheine widersprechen mußten wie Prinz Eugen und der Dessauer. Der Kronprinz sah den erschlichenen Sieg der héros subalternes über die Tapferen und Großen.
Gewiß, es klang überwältigend: England, Holland, Portugal, Dänemark, das Reich — von zwei Verrätern abgesehen — sind vom Kaiser zu einem gewaltigen Bündnis zusammengeschlossen gegen den vermessensten König, der je auf Frankreichs Thron saß!
Aber als Truppenkörper war eine solche Fülle der Nationalitäten schwierig zu lenken. Nach erschöpfenden Feldzugsjahren waren die Söldner jedes Heeresteiles zudem nur noch Hergelaufene aus aller Herren Ländern — auch die Offiziere; und Deutsche kämpften gegen Deutsche um Spaniens Thron: die Kurfürsten von Bayern und Köln hielten es mit dem König von Frankreich! Der junge Brandenburger stand verwirrt im Treiben des Lagers. Er fühlte, daß er keinem etwas galt: den großen Heerführern, den Fürsten alter Häuser nicht — den Offizieren seines Vaters am wenigsten.
Die bitterste Stunde aber kam für ihn, als sich in seiner Gegenwart zwei Offiziere der Verbündeten unendlich beleidigend darüber streiten durften, ob der «König in Preußen» wohl fünfzehntausend Mann auf den Beinen halten könne.
«Mein Vater», rief der Kronprinz voller Zorn und Scham, «kann, wenn er nur will, dreißigtausend Mann halten!» Und er verschwieg: Wenn er nur dem Dessauer und mir seine Sache in die Hand gibt —. Ach, es genügt mir nicht, daß ich von fern ein wenig für die Verwundeten der letzten Schlachten sorge; daß ich Sonderentlohnungen vermittle; daß ich mir unentwegt berichten lasse; wahrhaftig, es ist nicht genug für einen Fürstensohn in dieser Zeit.
Er war verdammt, zu warten. Die Bäume wurden grün; und wo das Kriegsvolk nicht das Land zerstampfte, keimten Halme, ungleich und verstreut, aus Körnern, wie sie ohne Aussaat im Erdreiche lagen; aus Körnern, wie sie der Wind in den ängstlichen Ernten kriegerischer Vorjahre verwehte. Bauern hatten diese Felder nicht bestellt. Das Land gehörte den Söldnern.
Außer vom König empfing der Kronprinz auch sonst zahlreiche Post, wie jeder der großen Herren im Lager; nur daß die Schreiben, die ihm ausgehändigt wurden, nicht immer nur hochgestellte Absender hatten.
Gewiß, auch die Kronprinzessin teilte mit, sie habe sich seit Karnevalsbeginn an den Hof ihres Vaters nach Herrenhausen und Hannover begeben. Friedrich Wilhelm war von einer Last befreit, die ihn wochenlang bedrückt hatte. Der Kleine mußte also gedeihen! Wie wäre die junge Mutter sonst zum hannoverischen Karneval gereist!
Aber auch der einfache Mann Creutz schrieb, und der Kronprinz war erstaunt, wie der neue Sekretär seiner Wusterhausener Landmiliz diese Kunst beherrschte, die im Volke nur sehr selten anzutreffen war.
Der königliche Münzmeister, so stand in dem Brief, habe in letzter Zeit einen Aufwand getrieben, der ihm vor des Conte Gaëtano Zeiten nicht möglich gewesen sei.
Der Graf aber habe sich, bevor er nach Berlin kam, in München den Umstand zunutze gemacht, daß nach der Schlacht von Höchstädt ein Volksaufstand ausgebrochen war. Ohne alle Papiere hatte er die Stadt verlassen; eine Flucht war es, keine Abreise. Der Kurfürst von Bayern, um unermeßliche Summen von ihm betrogen, war gerade daran gewesen, ihn festsetzen zu lassen.
Creutz hatte auch sehr selbständig nachgeforscht, woher der Italiener nach München gekommen war: er hatte am pfälzischen Hofe und bei dem Herzog von Savoyen Goldmacherdienste getan, und der Herzog, als er sich in den Händen eines Gauners und Gauklers sah, war so tief beschämt, daß er ihn dem verdienten Gericht nicht übergab, sondern mit allen erforderlichen Ausweisen nur heimlich des Landes verwies. Er hatte keine Sühne verlangt; er hatte sich nur mit der Zusicherung begnügt, daß Gaëtano in fremden Landen an keinem anderen Fürsten ähnliche Verbrechen begehen würde.
Aus solcher Scham des Herzogs von Savoyen flössen das Unglück und die Schande des ersten Königs von Preußen. Und die Schande erschien dem Thronfolger um so größer, je tiefer er mit seinem neuen Schreiber in die Vorgeschichte des Italieners eindrang. Der Kronprinz ließ es sich viel Reisegeld kosten. Der arme Mann Creutz sah die Welt. Aber er kam immer weiter von den Städten fürstlicher Höfe ab, drang in immer abgeschiedenere Gefilde, bis er es endlich wußte, daß Domenico Manuel Gaëtano der Sohn eines armen Bauern aus Petrabianca, weit hinter Neapel, war; ein kluger Sohn, ohne Frage, denn er hatte das feine Goldschmiedehandwerk gelernt und zudem, um das Lehrgeld bezahlen zu können, von Taschenspielereien sein Leben gefristet. Da fiel er einem Alchimisten auf; der wollte von dem gar so geschickten Burschen kein Lehrgeld; der bot ihm Löhnung und Kost.
Nach einem Jahre mußte der Adept Gaëtano seine Heimat verlassen, und die Landreiter waren noch an der Grenze hinter ihm her. In Madrid war er schon kein Adept mehr. Dort begann er gleich mit eigener Alchimistenküche; dort wurde er auch gleich Betrüger genannt. Dafür trug die Frau, die mit ihm durch die Länder reiste, für eine halbe Million Taler Juwelen auf dem Leib und war doch nur eine Fleischerstochter aus einer so armen, dunklen Gasse, wie sie des hungrigen Mannes Creutz Jugend überschattet hatte.
Der dritte Kurier für den Kronprinzen kam mit Eilpost aus Hannover. Der Sohn war tot, die Kronprinzessin nach Berlin zurückgekehrt. Endlich versicherte noch ein Handschreiben König Friedrich I., die Trauerfeierlichkeiten würden bis zum Eintreffen des tiefbetrübten Vaters auf geschoben werden, ihm eine Tröstung und Erhebung zu geben.
«Ich habe hier nichts zu suchen.» Mit solchen Worten nahm der Kronprinz Abschied vom Dessauer. «Es war keine Schlacht. Es ist auch keine Schlacht in Vorbereitung. Man hält Reden, die Unfrieden stiften sollen im Reich. Ich werde dem König sagen, daß hier sein und aller Fürsten Geld vertan wird nur für Habsburgs Träume.»
Er ging vom flandrischen Lager weg, sein totes Kind zu sehen. Er hatte im Krieg nicht einen Toten erblickt.
Die Kinderfrauen beteuerten, was sich beteuern ließ. Die Ärzte wußten viele lateinische Gründe für den Tod seines Sohnes. Die Kronprinzessin hatte keinerlei Ahnung gehabt. Nun war sie leidend, sprach kaum mit dem Gatten.
Als man Friedrich Wilhelm zu der einbalsamierten Leiche des Kindes führte, wußte er, warum sein Sohn gestorben war.
Der Knabe Fridericus Ludovicus war. auf gebahrt im schweren Purpurmantel, die Krone auf dem schwachen Haupt, Zepter und Reichsapfel in seinen welken Händen, das Band des Schwarzen Adlerordens über der Brust, den Stern über dem schweigenden Herzen. Die Schweizergarde hielt die Totenwacht, mit siebenhundert silbernen Trommeln. Vor Schloß und Dom standen die Kanonen bereit, gelöst zu werden zum Trauersalut.
Der König hatte einen Sarg von Gold anfertigen lassen; am Fußende war ein mächtiger Adler ausgebreitet.
Vom Morgen bis zur Dämmerung durfte das Volk vorüberziehen und die Aufbahrung bewundern. Dem Kinde kam Ehre zu. Es war als der nächste Thronfolger begrüßt und ein Glück des Geschlechtes genannt worden. Der Kronprinz sprach nicht. Nur bat er die Ansbacher Brandenburgerin, sich seiner Frau anzunehmen.
Der Dessauer hatte ihn dringend zurückgerufen. Als er ihn am Wagenschlag empfing, stürzte sich der Prinz in seine Arme.
Der Dessauer legte die Arme um ihn, ohne allen schuldigen Respekt. Er war ja selbst ein söhnereicher Vater.
«Mein Sohn lag in einem goldenen Sarge», stöhnte Friedrich Wilhelm auf.
Da schauerte es den Dessauer. Und das geschah selten.